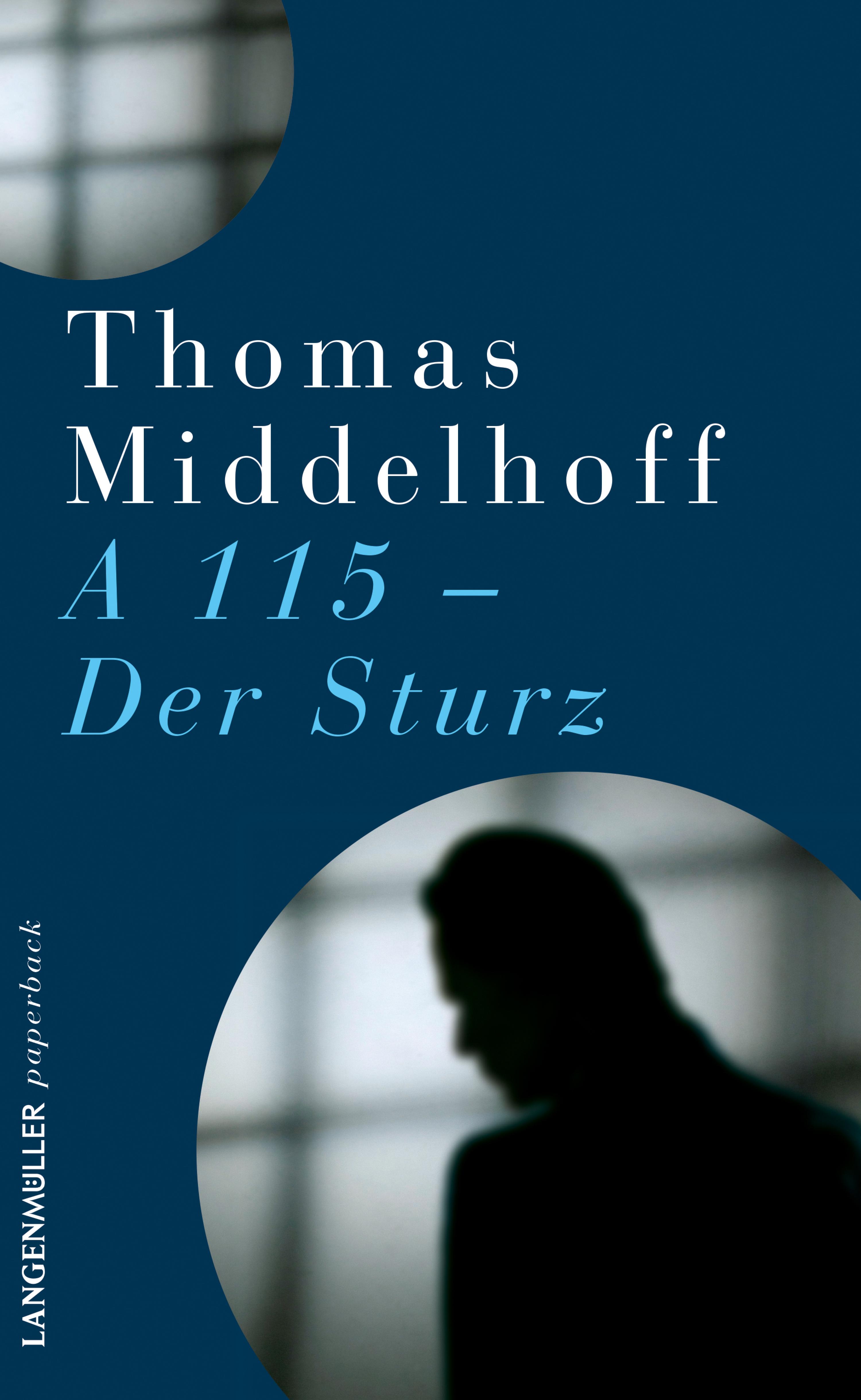
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Thomas Middelhoff war über viele Jahre einer der bedeutendsten Wirtschaftsmanager der Republik. In einem Aufsehen erregenden Prozess wurde er Ende 2014 zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Urteil sorgte angesichts seiner Härte selbst bei erfahrenen Juristen für Aufsehen. Mit großer Eindringlichkeit beschreibt Thomas Middelhoff die Vehemenz und Unverhältnismäßigkeit des deutschen Justizapparates. Mit seinen detaillierten Schilderungen gewährt er tiefen Einblick in die der Öffentlichkeit nicht zugängliche Schattenwelt des geschlossenen Vollzugs. "Dieser autobiografische Bericht kann als Paradigma für die deutsche Strafjustiz gesehen werden" Professor Bernd Schünemann in seinem Nachwort.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der Herr hat gegeben; der Herr hat genommen.
Gelobt sei der Name des Herrn.
Hiob 1,21
Thomas Middelhoff
A115
Der Sturz
Dieses Buch ist jenen gewidmet, die an der Gerechtigkeit in Gerichtssälen zweifeln, sowie jenen, die mit den Unzulänglichkeiten des geschlossenen Vollzugs konfrontiert sind.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© 1. ergänzte und aktualisierte Taschenbuchauflage 2020, Originalausgabe und das eBook 2020, LangenMüller in der
F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Umschlagmotiv: shutterstock
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering/München
ISBN 978-3-7844-8335-1
Inhalt
Prolog: Heile Welt?
Urteil und Saalverhaftung: Eine Welt bricht zusammen
Die erste Haftprüfung:
Die Entscheidung ist längst gefallen
Hoffnungslosigkeit und Menschlichkeit: Die Bedeutung von Werten in der Haft
Systemischer Lupus erythematodes: Therapie mit Müllbeuteln und Gummihandschuhen
Krankheit außer Kontrolle: Kampf gegen Windmühlen
Showdown in der Amtsstube: Wenn Richter plötzlich zu medizinischen Experten werden
Sicherheitskontrolle: Wie systematischer Schlafentzug einen Menschen krank macht
Die Kaution
Schlechte Nachrichten: Angst und kein Ende in Sicht
Im Namen des Volkes: Das Selbstverständnis der deutschen Justiz
Der geschlossene Vollzug
Die Rolle der Medien: Sieben Jahre am Pranger
Der Glaube in Unfreiheit
Epilog: Dankbarkeit, Verzeihen und ein großes Ziel
Nachwort
Prof. Bernd Schünemann: »A115 – Der Sturz« von Thomas Middelhoff: Ein exemplarischer Fall der deutschen Strafjustiz
Quellenverzeichnis
Bildnachweis
Danksagung
Vorwort
Knapp dreißig Monate sind seit dem Erscheinen der beiden Hardcover-Ausgaben von »A 115« vergangen. Dreißig Monate, in denen viel geschehen ist: meine Haftentlassung aus dem offenen Vollzug, der Beginn eines neuen Lebensabschnittes in Hamburg, der andauernde Kampf gegen die unheilbare Autoimmunerkrankung, die ich mir im Gefängnis zugezogen habe; die Veröffentlichung meines zweiten Buches »Schuldig« und der Beginn einer intensiven, nationalen und internationalen Vortragstätigkeit – vieles, was ich bei meiner Haftentlassung Ende November 2017 so genau nicht hatte vorhersehen können.
Damals hatte die Staatsanwaltschaft sofort nach dem Erscheinen von »A 115« Beschwerde gegen meine Entlassung eingelegt, die mir nach Verbüßung von zwei Dritteln meiner Haftzeit zustand, wie jedem, der nicht vorbestraft ist, keinen Totschlag begangen hat und kein Kinderschänder ist. Die Beschwerde überraschte mich nicht. Umso mehr aber der Umstand, dass sie von den Strafverfolgern nach gut einer Woche ohne weitere Angabe von Gründen zurückgezogen wurde. Davon erfuhr ich, wie schon einige Male vorher, völlig unvorbereitet, nur über die Radionachrichten.
Ende November 2017 wurde ich unter Auflagen mit einer vierjährigen Bewährungszeit entlassen – eine so lange Bewährung wird in der Regel nur bei schweren Delikten wie Kapitalverbrechen oder Kindesmissbrauch verhängt – und einem Bewährungshelfer unterstellt. Ich verließ die JVA-Bielefeld ohne irgendeinen konkreten Plan für meine Zukunft.
Wenige Tage später erhielt ich zu meiner Überraschung eine erste Einladung zu einem Vortrag von der Universität Innsbruck. Ich sollte vor deren Studenten sprechen, auch der Titel der Veranstaltung stand bereits fest: »Vom Himmel in die Hölle«.
Mein Absturz, den ich in »A 115« beschrieben habe, war aber nach meiner heutigen Ansicht das genaue Gegenteil: Konträr zur Themenstellung des Innsbrucker Vortrags, versetzte er mich erst in die Lage, den Weg »aus der Hölle in Richtung Himmel« zu finden. Es sind Erkenntnisse und Einsichten, die ich vor allem während meiner Zeit als Freigänger im offenen Vollzug und besonders während meiner Tätigkeit in Bethel sammeln konnte, wo ich mit behinderten Menschen zusammenarbeiten durfte.
Die Ursachen für mein Scheitern habe ich in meinem zweiten Buch »Schuldig – Vom Scheitern und Wiederaufstehen« aufgearbeitet. Vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen möchte ich damit anderen Menschen helfen, meine Fehler zu vermeiden und die Hoffnung nicht aufzugeben, wenn sie sich einmal in einer scheinbar hoffnungslosen Situation befinden.
Die Anliegen und Ziele von »A 115« bleiben von diesen persönlichen Einsichten unberührt. Und ich bin heute dankbar, dass »A 115« dazu beigetragen hat, die Öffentlichkeit für die schwierige Situation und die Notwendigkeit für Verbesserungen, aber auch für die Herausforderungen zu sensibilisieren, denen der geschlossene Vollzug in Deutschland gegenübersteht: zum Beispiel der hohe und weiter zunehmende Anteil von Ausländern in den Haftanstalten, die ineffizienten, veralteten Abläufe, die hohen Rückfallquoten, vor allem im Bereich der Jugendkriminalität, sowie eine weit verbreitete Drogenabhängigkeit und unzureichende Konzepte zur Resozialisierung.
Bei zahlreichen Vortragsveranstaltungen erhielt ich viel Zuspruch für diese Einsichten, vor allem auch von Justizvollzugsmitarbeitern. Meinen Schilderungen der Missstände im geschlossenen Vollzug wurde vonseiten der Justiz nicht widersprochen. Von Journalisten, die sich mit Fragen und Problemstellungen des geschlossenen Vollzugs befassen, wird »A 115« heute als Pflichtlektüre eingestuft.
Häufig stellte ich auf Vorträgen die Frage, warum wir uns hierzulande nicht engagierter mit den Problemen des Strafvollzugs befassen. Schließlich hat es doch Auswirkungen auf die Sicherheit von uns allen, wenn Straftäter eben nicht resozialisiert, sondern im Gegenteil noch schwerer kriminalisiert aus den Haftanstalten entlassen werden. Hierauf antwortete mir ein Politiker in Baden-Württemberg: »Sie haben meiner Meinung nach recht! Aber Sie glauben doch nicht etwa, dass man als Politiker mit dem Thema Verbesserung des Strafvollzugs eine Wahl gewinnen kann!«
Ein besonderes Anliegen von »A 115« war und ist die Abschaffung der sogenannten »15-minütigen Sicherheitskontrolle«. Während meiner Untersuchungshaft wurde ich über Wochen jede Nacht mindestens alle fünfzehn Minuten geweckt, um mit einem Lebenszeichen von mir sicherzustellen, dass ich mir nichts angetan hatte. Als Folge dieser Kontrolle und des damit verbundenen, systematischen Schlafentzugs erkrankte ich an einem systemischen Lupus Erythematodis (SLE), der meine Organe angreift, lebensbedrohlich und unheilbar ist – er wird mich mein Leben lang begleiten.
Wenn ich auf Vortragsveranstaltungen diese unmenschliche Form der Sicherheitskontrolle darstelle, sind die Reaktionen immer gleich. »So etwas gibt es doch nicht in Deutschland!« oder »Das ist doch Folter!« Niemand will sich vorstellen oder kann glauben, dass dies in hiesigen Gefängnissen wirklich praktiziert wurde und wird, ohne dass es der Öffentlichkeit bewusst ist. Umso mehr bin ich heute dankbar dafür, dass diese Form der Sicherheitskontrolle hierzulande Schritt für Schritt abgeschafft und durch zeitgemäße Kontrolltechniken ersetzt wird. Damit hat »A 115« sein Hauptanliegen erreicht.
Darüber hinaus ist dieses Buch auch ein Stück Trauma Verarbeitung, ein wichtiger Meilenstein in dem Prozess der Selbsterkenntnis: Ich lernte die Ursachen meines Scheiterns zu erfassen und meine eigene Verantwortung zu akzeptieren.
»A 115« zeigt aber auch, wie einfach es für die deutsche Justiz ist, einen Menschen und international bekannten Manager aus dem Verkehr zu ziehen und wegen Fluchtgefahr zu verhaften. Oft werde ich gefragt, warum die Justiz in anderen Fällen nicht ähnlich konsequent durchgreift. So naheliegend diese Frage sein mag, ich kann sie nicht beantworten.
Unabhängig von meiner persönlichen Schuld, halte ich, selbst mit einem größeren zeitlichen Abstand, die juristische Basis meines Urteils weiterhin für zweifelhaft. Mit dieser Einschätzung stehe ich nicht alleine. Und erstaunlicherweise vernehme ich derart kritische Stimmen – gerade auch aus dem Bereich der Justiz – heute immer häufiger. Stellvertretend für viele andere sei der OLG-Präsident einer niedersächsischen Stadt, in der ich einen Vortrag hielt, zitiert: »Bei mir hätten sie den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.«
Im Gegensatz hierzu hält sich in der Öffentlichkeit der Eindruck, ich sei ein Schwerverbrecher. Allerdings, heute ebenso wie früher, ohne jede Kenntnis darüber, wofür ich eigentlich verurteilt wurde. Wenn ich dies erläutere, ist zumeist ungläubiges Staunen die Reaktion. Und in der Regel folgt dann der Vergleich mit dem Fall eines bekannten Fußball-Managers und dessen öffentlichem Auftreten heute.
In den Monaten seit der Erstveröffentlichung von »A 115« erfuhr ich viel Zuspruch. Ich erkannte meine wirklichen Fehler, konnte ein neues Lebensmodell definieren und fand mein neues Glück. Dieses Buch und meine Geschichte sollen denjenigen Hoffnung geben, die im Bereich der Justiz und des Vollzugs arbeiten und die den Erfolg ihrer Tätigkeit an der Resozialisierungsquote messen lassen müssen. Nur wenn jeder einzelne sich engagiert, wird sich das System ändern lassen.
Hamburg, den 10. Februar 2020
Prolog: Heile Welt?
Du bist ewig für das verantwortlich,
was du dir vertraut gemacht hast.
Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz
Freitag, 14. November 2014, 5.50 Uhr. Es ist noch still im Haupthaus an diesem frühen Herbstmorgen, friedlich still, das Dunkel der Nacht liegt noch über dem Park, dem Bürohaus und dem Reiherbach, nur schemenhaft kann man in der Ferne die Stallungen erkennen. Heute Vormittag wird die XV. Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Essen nach fünfunddreißig Hauptverhandlungstagen das Urteil gegen mich verkünden. Eine Festschrift sowie einige Flüge soll ich Arcandor zu Unrecht in Rechnung gestellt haben, lautet die Anklage der Bochumer Staatsanwaltschaft, die am 6. Mai zum Prozessauftakt neunzig Minuten lang verlesen wurde.
Das Urteil meines Umfelds ist längst gefällt und eindeutig: Der Prozess wird heute mit einem Freispruch enden, da gibt es nicht den geringsten Zweifel. Die Kammer hatte schließlich in den vergangenen Wochen wiederholt verständige Signale ausgesendet. Familie, Freunde und Weggefährten sind seit Tagen fest von einem positiven Urteilsspruch überzeugt. Auch ich glaube das.
Leise dringen die Geräusche aus dem Erdgeschoss in den oberen Bereich des Hauses, unten wird bereits das Frühstück für die Familie zubereitet. Frische Brötchen, Obst, Müsli, der Duft des Kaffees erfüllt schon das Erdgeschoss. Es hat in der Nacht geregnet, die kühle Luft trägt durch das geöffnete Fenster den schweren, erdigen Herbstgeruch herein, der mir so vertraut ist. Alles scheint wie immer. Der dunkelblaue Anzug, das weiße Hemd, die blaue Krawatte. Ein letzter Blick in den Spiegel, im Nebenzimmer wird die Musik eines Regionalsenders von den Nachrichten unterbrochen. Meine anstehende Urteilsverkündung ist das Topthema des Tages. Als gäbe es keine dringenderen Probleme, geht es mir reflexhaft durch den Kopf.
Als ich die offene Küche betrete, ist die Familie schon an dem langen Holztisch vor der Fensterfront zum Park versammelt, jeder an seinem angestammten Platz: meine Frau Cornelie und zwei unserer fünf Kinder. Jan und Carolin wollen mich mit ihrer Mutter in den Gerichtssaal begleiten, Frederik will von seinem Wohnort direkt nach Essen fahren. Henriette und Maximilian werden heute Abend hier sein. Dann soll der Freispruch gefeiert werden, so haben wir es geplant.
Die frühe Uhrzeit fordert hier und da noch ihren Tribut, aber die Stimmung ist entspannt, fast heiter, als meine pflichtbewusste Tochter Carolin mit Blick auf ihren Bruder verkündet: »Es ist kurz vor sieben. Ich fahre jetzt los, um pünktlich in Essen zu sein. Wer mit mir fahren will, muss jetzt mitkommen.« Ein wenig widerstrebend erhebt sich Jan, und meine Frau sagt aufmunternd: »Es ist auch für uns Zeit zu fahren, Thomi, wir dürfen nicht zu spät kommen.«
Ich leere die Tasse Kaffee mit einem großen Schluck, verabschiede mich von Amy, dem Hund meines jüngsten Sohnes Max, und nicke lächelnd unserem Mitarbeiter Herrn Lachmann zu, der mir »good luck« zuruft. Der Wagen wartet schon vor der Tür, die Zeitungen liegen bereit. Stefan Bark kennt meine Arbeitsroutine, seit fast zehn Jahren ist er so viel mehr als nur mein Fahrer und kümmert sich loyal auch um vieles jenseits der Fahrten. »Die Nachrichten berichten über uns«, sagt er und steuert den Wagen über die noch dunkle Allee. Das gedämpfte Licht im Fond wirkt beruhigend; gelöst und zuversichtlich sitze ich neben meiner Frau, als sich das große schmiedeeiserne Tor lautlos hinter uns schließt. Dieser Tag wird der Beginn meiner Rehabilitation. Es kann gar nicht anders sein.
Im Wagen liegt mein morgendliches Arbeitspensum bereit, perfekt vorstrukturiert von meiner langjährigen Sekretärin, die Akten gestapelt, ganz oben die Liste mit den auf der Fahrt nach Essen zu erledigenden Dingen. Eine schwere Registermappe, gefüllt mit diversen Vorgängen, Projekten und Aufgaben für die kommenden Tage und Wochen. Es ist viel zu tun.
Der Wagen rollt gleichmäßig über die A2 Richtung Essen, und ich ahne nicht, dass alles ganz anders kommen wird. Dass der heutige Tag eine Zäsur sein wird, die mein Leben auf den Kopf stellt. Ich ahne nicht, dass ich meinen Fahrer Stefan Bark nicht mehr wiedersehen werde, dass ich für lange Zeit gar kein eigenes Auto besitzen werde; dass ich bei meiner Rückkehr rund sechs Monate später nicht nur sechzehn Kilo Körpergewicht verloren haben werde, sondern auch den letzten Rest meiner Reputation. Ich ahne auch nicht, dass ich keine berufliche und wirtschaftliche Basis mehr haben werde, aber dafür eine schwere, unheilbare Autoimmunerkrankung, die künftig meinen Alltag bestimmen wird und deren Folgen lebensbedrohlich sein können. Ich ahne nicht, dass ich meine Familie, die ich immer vor Unannehmlichkeiten schützen wollte, an die Grenzen des Zumutbaren und darüber hinaus führen werde; dass diese Familie schwer traumatisiert sein wird, aus einer scheinbar heilen Welt von einem Tag auf den anderen unwiederbringlich in ein allumfassendes Chaos gestürzt. Ihr Glück, ihr unbeschwertes Leben, all das, wofür ich in den vergangenen vierzig Jahren gearbeitet habe – zerstört. Von einem Moment auf den anderen. Von all dem und von so vielem anderen ahne ich nicht das Geringste, als der Wagen Fahrt aufnimmt und wir uns dem Ort der Urteilsverkündung nähern, wo sich an diesem Vormittag des 14. November 2014 für mich ein Abgrund auftun wird.
Urteil und Saalverhaftung: Eine Welt bricht zusammen
Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hatte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Franz Kafka, Der Prozess
»Heute wird alles jut!«
Die Verkehrsverhältnisse zwischen Bielefeld und Essen sind an diesem Freitagmorgen ausgesprochen entspannt. Ohne nennenswerte Behinderungen erreichen wir nach siebzig Minuten Fahrzeit die Zweigertstraße 52, den Sitz des Landgerichts Essen. Stefan Bark deutet das als gutes Zeichen: »Heute wird alles jut!«, konstatiert er optimistisch in seinem kölschen Dialekt.
Fünfzig Minuten vor Beginn der Hauptverhandlung, in der heute die Urteilsverkündung erfolgen soll, hält der Wagen vor dem Haupteingang des Landgerichts – und vor einer Vielzahl von Journalisten, die sich im Dämmerlicht des frühen Morgens bereits in Stellung gebracht haben. Ich verlasse den Wagen mit einem kleinen Sprung, einen braunen Aktenkoffer in meiner linken Hand; ein Geschenk meines geliebten Vaters, das ich vor vielen Jahren von ihm erhalten hatte. Stefan Bark will meine Frau zu einem Hintereingang bringen, damit sie unbehelligt von den Medienvertretern in das Gerichtsgebäude gelangen kann.
Ich bahne mir den Weg an Kameras, Mikrofonen und Reportern vorbei und eile in das Gebäude. Wie an jedem der fünfunddreißig Verhandlungstage zuvor begrüße ich die meist freundlichen Beamten an der Sicherheitsschleuse, die auch heute wieder meinen Aktenkoffer durchleuchten. Auf der anderen Seite der Sicherheitskontrolle warten weitere Kamerateams, um jede mögliche Gemütsregung festzuhalten.
»Wie haben Sie geschlafen?«, fragt eine kleine blonde Radioreporterin. »Tief und fest«, antworte ich ruhig und selbstsicher und schicke noch ein betont erstauntes »Warum?« hinterher. Nur wenige Meter weiter stellt sich eine TV-Journalistin in den Weg: »Ich arbeite für RTL. Wir haben gestern vom Pressesprecher des Landgerichts, Herrn Richter Hidding, erfahren, dass die Urteilsverkündung heute lange dauern wird. Können Sie sich das erklären?«
Eine Sekunde stutze ich überrascht und habe ad hoc keine plausible Antwort auf diese unerwartete Frage parat. »Bei dem zu erwartenden Freispruch gibt es der Öffentlichkeit gegenüber viel zu erklären, nach dem Medienrummel der vergangenen Monate und Jahre«, antworte ich schließlich und drücke mich hastig und mit entschuldigenden Bemerkungen ohne weiteren Kommentar an den Kamerateams vorbei in die Gerichtskantine, wo meine Anwälte Winfried Holtermüller und Udo Wackernagel schon warten.
Es gibt durchaus angenehmere Orte für Besprechungen als diese lieblose Kantine, die deutliche Abnutzungsspuren offenbart. Zu dritt nehmen wir an einem weißen Plastiktisch Platz, auf weißen Plastikstühlen mit bunten Sitzpolstern im Floridastil. Diesen Tisch hatten wir in den zurückliegenden Monaten seit dem Beginn der Hauptverhandlung Anfang Mai 2014 immer genutzt. Heute soll er endgültig zu meinem »Glückstisch« avancieren. Wir besprechen den zu erwartenden Tagesablauf und erörtern nochmals den Text der Pressemitteilung, die für meinen Freispruch vorbereitet worden ist. Parallel erledige ich wie immer noch einige dringende geschäftliche Telefonate.
Es ist 8.50 Uhr, als wir die Kantine verlassen und zurück zum Treppenhaus in der Eingangshalle gehen. Zügig, aber ohne Eile und in das Gespräch vertieft steigen wir die Stufen des breiten Aufgangs zum Saal 101 des Landgerichts hinauf. Wir kommen nicht weit. Schon auf dem ersten Treppenabsatz erwartet uns eine Armada von Fotografen, dahinter die Mikrofone der Radio- und TV-Reporter, Kameras. Es herrscht dichtes Gedränge auf der Treppe, laute Rufe schallen aus allen Richtungen: »Dr. Middelhoff, schauen Sie in meine Kamera!«; »Herr Middelhoff, was sagen Sie zum heutigen Tag, was erwarten Sie?«
Sie bekommen keine Antworten, es gibt nichts, was nicht schon gesagt worden wäre – was also noch? Wortlos, den Blick geradeaus gerichtet, meine beiden Anwälte hinter mir, dränge ich mich durch diese Phalanx, die sofort kehrtmacht und schimpfend und mit lautem Getöse in den Saal 101 stürmt, wo bereits weitere Kamerateams ihr grelles Licht auf mich richten.
Der Saal 101 ist der größte Verhandlungssaal des Landgerichts Essen. Zwar deutlich in die Jahre gekommen und ebenso abgenutzt wie die Kantine, aber dennoch in seiner Wirkung auch ein Symbol für Größe, Würde und die Macht der Justiz. Ein für diesen Andrang deutlich besser geeigneter Ort als die kleinen, beengten und wenig ansehnlichen Räume, in denen die zurückliegenden Verhandlungstage wegen des geringer gewordenen Medieninteresses abgehalten worden sind. Dies ist heute eindeutig anders.
Die Stirnseite des Saals ist für die XV. Große Wirtschaftsstrafkammer reserviert, links vom Richtertisch nehme ich mit meinen beiden Anwälten Platz, gegenüber und rechts von den Richtern sitzen bereits die Oberstaatsanwälte Daniela Friese und Dr. Fuhrmann von der Staatsanwaltschaft Bochum.
Zu meiner Linken Winfried Holtermüller, zu meiner Rechten Udo Wackernagel, sehe ich mich einem Pulk von Journalisten gegenüber, zwischen uns nur der graue Tisch mit den Mikrofonen. Das unablässige Klicken der Kameras aus allen Richtungen scheint zu einem Gewitter anzuschwellen, aufgeregte Rufe und die sich wiederholenden Fragen, die nicht verstummen wollen, Mikrofone dicht vor meinem Gesicht. Der eine oder andere bekannte Journalist im Hintergrund nickt mir zu und zieht entschuldigend die Schultern hoch. Doch niemand gebietet Einhalt, niemand nimmt Rücksicht auf die Anspannung in diesem Moment, in dem man sich noch einmal sammeln wollte, bevor die Urteilsverkündung in wenigen Minuten über mein Schicksal entscheidet. Hinter den Journalisten steht der Pressesprecher des Landgerichts Essen, Dr. Johannes Hidding, im vertraulichen Gespräch mit einem Medienvertreter. Auch er greift nicht ein.
Wie an allen Verhandlungstagen habe ich um mich herum eine imaginäre Mauer errichtet, um zu verhindern, dass die Reporter meine Emotionen wahrnehmen können. Wie immer wird man mir diesen Selbstschutz später wahlweise als »Arroganz«, »Überheblichkeit« oder als »Gefühlskälte« auslegen. Das Gegenteil ist der Fall. In diesen unendlich langen Minuten fühle ich mich wie an einem öffentlichen Pranger: schutzlos, einsam, zutiefst verunsichert. Aber geht das die Öffentlichkeit etwas an? Wer kann für sich das Recht in Anspruch nehmen, mein innerstes Befinden direkt in alle deutschen Wohnzimmer zu übertragen? Wer an einem Tag wie heute Selbstbewusstsein demonstriert, dem wird allzu häufig mangelnde Demut vorgeworfen, am lautesten von jenen, die ihr eigenes Heil im Opportunismus suchen.
Verstohlen schaue ich nach rechts und versuche, im Zuschauerraum die vertrauten Gesichter meiner Familie zu entdecken. Ich finde sie außen in der fünften Reihe sitzend. Wie durch einen Schleier nehme ich die erschrockenen Blicke von Nele, Caro, Freddy und Jan wahr – und werde sie nie mehr aus meiner Erinnerung löschen können.
Endlich werden die Medienvertreter von Richter Hidding gebeten, den Saal zu räumen, was sie nur widerwillig und quälend langsam tun. Es ist jener Richter Hidding, von dem die RTL-Journalistin schon am Tag zuvor erfahren hat, es würde heute eine lange Sitzung werden. Woher auch immer er dieses Wissen nahm und warum auch immer er die Notwendigkeit sah, diesen Hinweis zu geben.
Es ist 9.15 Uhr, als die schweren Holztüren von den Justizbediensteten geschlossen werden. Es wird leise im Saal, so leise, dass ich meine, man müsste hören, wie mir das Herz im Brustkorb hämmert. Ich atme tief durch und versuche, mich innerlich zur Ruhe zu bringen.
»Die Kammer ist mal wieder verspätet«, flüstere ich Udo Wackernagel ins Ohr, als sich die Tür hinter dem Richtertisch öffnet. Angeführt vom Vorsitzenden Richter Jörg Schmitt hält die XV. Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Essen Einzug in den Saal 101: die Berichterstatterin, die Beisitzerin, die Schöffen sowie die Ersatzschöffen und der Ersatzrichter. Eine Reihe sehr ernster Gesichter über feierlich wirkenden schwarzen Richterroben, und für Sekundenbruchteile drängt sich die Assoziation eines Staatsbegräbnisses in mein Gehirn; zu kurz, um die fatale Symbolhaftigkeit dieses Bildes erahnen zu können.
Kaum haben die Kammermitglieder hinter dem Richtertisch stehend ihre Positionen eingenommen, beugt sich Richter Schmitt nach vorne und hebt unter lautem Gemurmel im Saal das Tischmikrofon vor ihm an – soweit das Kabel reicht. Er muss wiederholt um Ruhe bitten. Dann nehme ich nur noch Wortfetzen wahr: »Im Namen des Volkes … verurteile ich zu drei Jahren Haft … nehmen Sie Platz.«
»What the fuck …«, entfährt es Udo Wackernagel leise. Es rauscht in meinem Kopf, ich bin unfähig, mich zu bewegen, unfähig, etwas zu sagen, unfähig, irgendeine Regung zu zeigen. Einen Moment lang nehme ich nichts mehr um mich herum wahr. Mit erstarrter Miene hätte ich auf meinem Stuhl gesessen, kalkweiß, wird man später sagen. Einzelne Reporter hätten hastig den Saal verlassen, um Eilmeldungen abzusetzen; und überall im Raum seien erregte Stimmen zu hören gewesen.
An diesem 14. November 2014 werde ich um 9.30 Uhr von der XV. Großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Essen nach fünfunddreißig Verhandlungstagen wegen schwerer Untreue in siebenundzwanzig Fällen und einem Schaden in Höhe von insgesamt 487.500 Euro, darin enthalten drei Fälle von Steuerhinterziehung in Höhe von 26.500 Euro, zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt.
Die Staatsanwaltschaft hatte zu Beginn des Prozesses über fünfzig Fälle zur Anklage gebracht und hierfür eine Haftstrafe von drei Jahren gefordert. Von diesen Fällen wurden einige nach Paragraph 154 Strafprozessordnung, andere förmlich eingestellt. Die Anzahl der Fälle, die das Urteil begründen, hat sich im Verhältnis zu den ursprünglich zur Anklage gebrachten etwa halbiert. Auf das Strafmaß hat das keinen Einfluss: Die Kammer folgt mit der dreijährigen Haftstrafe der Forderung der Staatsanwaltschaft in vollem Umfang.
Richter Schmitt verliest die Urteilsbegründung mit kräftiger Stimme, hin und wieder erscheint mir sein Vortrag deutlich emotional. Auch die eingestellten Fälle werden noch einmal kommentiert, was die Medien zumindest als moralischen Schuldspruch werten. Bei einem zur Anklage gebrachten Vorstandswochenende habe man bei einem Glas Wein den Abbau von viertausend Arbeitsplätzen bei KarstadtQuelle beschlossen, heißt es da etwa. Dergleichen entspricht allerdings weder der Wahrheit noch den Fakten der Beweisaufnahme aus den zurückliegenden fünfunddreißig Verhandlungstagen.
Fragen schießen ungeordnet durch meinen Kopf: Wie konnten meine Anwälte und ich uns so sehr irren? Warum haben wir das Verhalten des Gerichts und seine Stellungnahmen zu unseren zahlreichen Beweisanträgen so falsch bewertet? Warum konnte das Gericht zu diesen wertenden Feststellungen in seiner Urteilsbegründung finden, wie es Tage später bei einem Befangenheitsantrag meiner Anwälte eingestehen musste? Welche Chancen hat ein Revisionsverfahren? Welche taktischen und strategischen Fehler haben meine Anwälte, welche persönlichen Fehler habe ich während der Verhandlung gemacht?
Nachdem die Urteilsbegründung verlesen ist, hält Richter Schmitt kurz inne, und die versteinerten Mienen lassen mich nichts Gutes ahnen: Es warten an diesem Tag noch weitere schlechte Nachrichten auf mich.
Hatte ich bisher geglaubt, es könne nicht schlimmer kommen, werde ich jetzt eines Besseren belehrt: Richter Schmitt verweist übergangslos auf einen Haftbefehl gegen mich wegen dringender Fluchtgefahr. Diesen werde er unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen und allein mit mir und meinen Anwälten erörtern. Aus diesem Grunde, so ordnet er an, sei der Saal nun unverzüglich zu räumen.
Es entwickeln sich tumultartige Szenen, während Zuschauer und Medienvertreter den Saal verlassen. Verzweifelt versuche ich, in diesem Chaos meine Familie zu entdecken. Ich entdecke Carolin, fassungslos, ich sehe, wie meine Frau erschrocken ihre rechte Hand auf den Mund presst, ich nehme die erstarrten Gesichtsausdrücke meiner Söhne Freddy und Jan wahr. Was tue ich ihnen hier nur an?
Obwohl das Gericht es untersagt hat, versuchen einzelne renitente Reporter weiterhin, Fotos zu machen, bevor sie endgültig des Saals verwiesen werden. Als gäbe es nicht schon genug Motive, die meine Verzweiflung in diesem Moment dokumentieren; als sei nur das ultimativ letzte Bild das wahre Bild und ich kein Mensch, der trotz allem ein Recht auf Würde und Achtung hat.
Thomas Fischer, der Vorsitzende Richter des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe, kommentiert eine Woche später ein Bild von mir mit den Worten: »Ein Foto vom zunehmend derangierten Angeklagten.« Glaubt dieser Vorsitzende Richter oder irgendjemand sonst wirklich, dass ich diesen Urteilsspruch und die Ankündigung eines Haftbefehls ohne jede Regung zur Kenntnis nehme?
Das Gericht verlässt für kurze Zeit den Saal und kehrt sogleich wieder ohne Roben zurück. In dunklem Anzug und mit weißer Krawatte verliest der Vorsitzende Richter umgehend den Haftbefehl wegen »dringender Fluchtgefahr«. Ich fühle mich wie der Protagonist eines Dramas in der falschen Rolle: Was hier angenommen wird, würde ich niemals tun – und kann es doch nicht beweisen. Niemals würde ich meine Familie alleine ihrem Schicksal überlassen, jetzt nicht und künftig nicht, ganz gleich, unter welchen Umständen. Und niemals würde ich mich meiner Verantwortung entziehen, wenn ich sie zu tragen habe.
Nach Verlesung des Haftbefehls ordnet die Kammer an, dass geprüft werden müsse, ob Voraussetzungen für dessen Aussetzung gegeben seien. Das alles fühlt sich an, als ginge es hier gar nicht um mich, so fern scheinen mir die Stimmen, die da sprechen, so irreal kommt mir die Szenerie vor, in der doch nicht mein Platz sein kann. Vielleicht ist es ein Reflex, vielleicht ein ausgeprägter Überlebensinstinkt, aber in diesem Moment bin ich plötzlich wild entschlossen, um meine Freiheit zu kämpfen. Ich will nicht in einem Gefängnis enden – heute nicht und nicht in der Zukunft. Ich fühle mich unschuldig und zu Unrecht verurteilt.
Ich kämpfe um meine Freiheit
Es bleibt keine Zeit für theoretische Gedankenspiele. Als Erstes soll die Frage meines Wohnortes erörtert werden. »Wo leben Sie und Ihre Familie eigentlich?«, fragt der Vorsitzende Richter. Als sei diese Frage während der fünfunddreißig Verhandlungstage noch nicht ausreichend zur Sprache gekommen. Die Anwälte erklären zum wiederholten Mal, dass mein erster Wohnsitz derzeit zwar in Saint-Tropez sei, ich mich aber seit Beginn der Hauptverhandlung überwiegend in Bielefeld aufhalte. Wir machen deutlich, dass ich, ebenso wie meine Frau, sofort bereit sei, den ersten Wohnsitz nach Bielefeld zu verlegen, um die Annahme einer Fluchtgefahr zu entkräften.
Anschließend geht es um die »Einkommens- und Vermögensfrage«. Ob ich eine Kaution stellen könne, soll dabei festgestellt werden, beziehungsweise ob es vielleicht doch Vermögen im Ausland gebe. Mit Unterstützung meiner Anwälte lege ich zunehmend verzweifelt nochmals dar, was ich der Kammer bereits am 26. September 2014 während der Hauptverhandlung detailliert mündlich und schriftlich erläutert hatte: »Kurz gefasst bin ich zurzeit nicht in der Lage, eine Kaution in signifikanter Höhe zu stellen, weil mein gesamtes liquides Vermögen, das sich bei dem Bankhaus Sal. Oppenheim in Form von Festgeldern befindet, von dieser Bank widerrechtlich blockiert wird«, erkläre ich, darum bemüht, die Fassung zu wahren. Diese Auseinandersetzung zwischen mir und meiner Frau einerseits und meinem ehemaligen Gesamtvermögensverwalter Josef Esch und der Bank Sal. Oppenheim andererseits wird seit dem Jahr 2010 – leider öffentlich – ausgetragen. All das hatte ich dem Gericht im Rahmen meiner Einlassung zu meinen wirtschaftlichen Verhältnissen geschildert.
Die Stimmung ist mittlerweile erhitzt und angespannt. Und ich habe Angst; große, unheilvolle, übermächtige Angst; Angst, dass das hier auf eine Weise enden könnte, die mir den Boden unter den Füßen wegzieht.
Nachdem ich meine wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse noch einmal erläutert habe, mache ich erneut einen Vorschlag: Ich werde meinen Pass und meinen Personalausweis abgeben, mich per sofort mit erstem Wohnsitz in Bielefeld anmelden und einer täglichen Meldepflicht auf der Polizeiwache nachkommen. Ich bete insgeheim, dass dieser Vorschlag das Gericht überzeugt. Die beiden Vertreter der Staatsanwaltschaft Bochum haben keine grundsätzlichen Einwände. Aber sie haben den Antrag auf einen Haftbefehl ja auch nicht gestellt. In die kurze Stille hinein fragt die beisitzende Richterin: »Wo befindet sich denn der Reisepass?«
»Wahrscheinlich in einem Koffer in meinem Auto«, entgegne ich und biete an, dass ich meinen Fahrer Stefan Bark sofort anrufen kann, damit er den besagten Koffer bringt.
Nach einer zustimmenden Geste des Vorsitzenden Richters greife ich zu meinem Blackberry und wähle die Nummer meines Fahrers. »Bark hier. Was kann ich für Sie tun?«, fragt er, hörbar unruhig. Als mein langjähriger Fahrer ist er den Journalisten bestens bekannt. Vermutlich ist er in diesem Moment draußen vor dem Gerichtsgebäude längst von ihnen dicht umzingelt, weil sie hoffen, über ihn vielleicht doch an irgendeine Information zu kommen. »Bringen Sie mir meinen schwarzen Aktenkoffer«, bitte ich Herrn Bark nervös und knapp. Die Luft ist dünn in diesem Raum und der Abgrund nah, das ist mir in diesen Minuten nur allzu klar.
Kaum habe ich die Bitte an Stefan Bark ausgesprochen, korrigiere ich mich noch einmal, Gott weiß, was für einer fatalen Eingebung folgend: »Nein, besser Sie nehmen den Pass und den Personalausweis aus dem Koffer und händigen die Dokumente Herrn Holtermüller aus.« Draußen vor der Tür des Gerichtssaals lärmen die Journalisten, und es dürfte für Bark kaum möglich sein, sich durch dieses dichte Treiben mit einem schweren Aktenkoffer in der Hand seinen Weg zu bahnen. Er antwortet mit einem knappen »Okay«.
Hoffentlich werden die Dokumente schnell hier sein, damit das alles hier endlich ein Ende hat. Doch eilig hat es die Kammer offensichtlich nicht: Der Vorsitzende Richter schlägt eine Mittagspause vor. Es ist kurz vor 13 Uhr, und er ordnet an, dass wir uns um 14.30 Uhr wieder treffen, um anschließend weiter zu beraten. Ich fühle mich mental schrecklich erschöpft, an Essen ist ohnehin nicht zu denken, und frage ihn, ob ich solange hier im Verhandlungssaal warten könne. Erst jetzt fällt mir plötzlich auf, dass sich zu dem einen Justizwachmann, der sonst üblicherweise bei den Verhandlungen zugegen war, ein zweiter Kollege hinzugesellt hat. Der Haftbefehl hat offensichtlich schon vor seiner finalen Bestätigung unmittelbare Konsequenzen für mich!
Der Vorsitzende Richter erklärt, dass ich angesichts der neuen Situation, also des Haftbefehls, auf keinen Fall die Mittagspause im Gerichtssaal verbringen könne, sondern »nach unten verbracht werden müsse«. Meine Anwälte, wirft einer der Justizwachmänner ein, sollten besser durch den Besuchereingang den Saal verlassen. Vor dem Haupteingang würden über hundert Reporter mit Kameras und Mikrofonen warten. Da sei wirklich kein Durchkommen. Draußen hört man lauten Tumult.
Das wirklich Letzte, was ich will, ist, mich »nach unten zu begeben«, alles in mir sträubt sich gegen diesen Gedanken. Dennoch, das ist mir trotz meiner Aufregung klar, muss ich jetzt den Anordnungen der Kammer folgen. Ich mobilisiere, was mir die vergangenen Stunden an Energie gelassen haben, und verlasse den Saal ohne zu zögern durch eine in die Wandvertäfelung eingelassene Tür; gefolgt von einem Wachmann und begleitet von dem unguten Gefühl, dass ich mit diesem Gang eine Reise in die Ungewissheit antrete, in den Schlund eines Ungeheuers, das mich Stück für Stück verschlingen wird.
Vor dem Justizbeamten hergehend, betrete ich unmittelbar hinter der »Geheimtür« eine Wendeltreppe, die mich in die Tiefe führt. Das trostlose Treppenhaus ist von fahlem Neonlicht beleuchtet: roher Putz, lose Drähte und offensichtlich jahrzehntealter Schmutz. Wie viele Menschen mögen diese Wendeltreppe wohl schon vor mir beschritten haben bei dem, was im wahrsten Sinne des Wortes ein Abstieg ist. Unten wartet bereits ein stämmiger, kahlköpfiger Wachmann, der angesichts seines äußeren Erscheinungsbildes als Idealbesetzung in einer US-Justizserie hätte durchgehen können.
Er grüßt höflich und respektvoll und weist mich an, an einem kleinen Tisch mit vier Stühlen Platz zu nehmen. Meinen Blackberry dürfe ich hier unten nicht mehr benutzen.
Am 14. November 2014 um 13.15 Uhr sitze ich im Keller des Essener Justizgebäudes. Niedrige Decken, kahle Wände, fahles Neonlicht, abgewetztes Linoleum und zu meiner Linken eine Reihe grauer Zellentüren, die in diesem Moment über die Maßen bedrohlich wirken; als winkten sie mit dem, was mir das Schicksal noch alles zuteilwerden lassen könnte. Aus einzelnen Zellen dringt immer wieder Lärm, von den Wärtern umgehend mit deutlichen Kommandos übertönt.
Wie wird es jetzt weitergehen? Wann komme ich hier wieder raus? Fragen wie diese kreisen unablässig in meinem Kopf. Um nichts in der Welt will ich mich von diesem Ungeheuer »hier unten« verschlingen lassen.
Kurze Zeit später kommen Holtermüller und Wackernagel, Ersterer mit meinem Pass und dem Personalausweis in der Hand. Beide Dokumente sind ihm an der Pforte zum Keller von meinem Fahrer übergeben worden. Die beiden berichten von chaotischen Zuständen draußen: Ein Heer von Journalisten wartet zunehmend ungeduldig auf Informationen. Die Nachricht vom Haftbefehl gegen mich und von meiner Saalverhaftung sei auf »allen Kanälen« und über das Internet bereits weltweit verbreitet worden.
Die Anstrengung der vergangenen Stunden fordert ihren Zoll, erschöpft versuchen wir, den bisherigen dramatischen Verlauf des Tages zu analysieren, das Verhalten der Kammer, das sich für uns alle so überraschend verändert hatte, die Möglichkeiten, wie es jetzt weitergehen könnte. Holtermüller, noch blasser als sonst, nimmt meine linke Hand: »Du bist hier bald wieder draußen«, versucht er, mir Mut zuzusprechen. Vielleicht ist es die Erschöpfung, aber er klingt nicht wirklich überzeugend.
Der kahlköpfige Wachmann kommt herein und erinnert noch einmal daran, dass ich meinen Blackberry nicht benutzen darf. »Aber Sie können vom Festnetz aus telefonieren.« Immerhin. Ich werde noch lernen, was es heißt, nach jedem Strohhalm greifen zu müssen. Wir gehen in ein größeres Besprechungszimmer mit Neonlicht und einem quadratischen Fenster zum unterirdischen Flur – und einem Telefon. Ich rufe Hartmut Fromm an, ebenfalls mein Anwalt, an Anwälten mangelt es mir in diesen Zeiten nicht, aber vor allem auch ein Freund. Wir wollen eine mögliche Kaution mit ihm besprechen. Doch schnell wird klar, dass das kein realistisches Szenario ist – Sal. Oppenheim und der Deutschen Bank sei Dank. Zudem ist die Gefahr, dass eine solche Kaution von meinen prominenten Gläubigern gepfändet wird, zu groß. Sie haben unter anderem mit einer Taschenpfändung im Gericht bereits bewiesen, dass sie vor nichts zurückschrecken.
Den Rest der Zeit verbringen wir mit einem unkonzentrierten Gedankenaustausch. Es ist der instinktive Versuch, in diesen Minuten keine Stille aufkommen zu lassen, die der Angst das Feld überlassen könnte. Solange ich rede, habe ich die Illusion, dass ich noch Herr der Lage bin, irgendwie. Vor mir auf dem Tisch liegen mein Personalausweis und mein Pass. Keiner von uns beachtet sie.
Um 14.40 Uhr hören wir, dass die Kammer auf dem Weg in den Keller sei. Zehn Minuten später als verabredet; eine Lappalie eigentlich, für mich in dieser Situation eine quälende Ewigkeit.
Holtermüller hört noch schnell seine Voicemail ab: Der Absender der ersten Nachricht ist die New York Times; Reuters und Bloomberg folgen. Alle mit der gleichen Frage: »What the hell is going on? Is this really true?« Zum Antworten kommt er nicht mehr, die Richter betreten den Raum, der mir mittlerweile ungeheuer stickig vorkommt. Ihre Stimmung scheint gut, immerhin, das kann vielleicht hilfreich sein. Die Vertreter der Staatsanwaltschaft treffen fast zeitgleich ein.
In knappen Worten fasst Winfried Holtermüller die Situation zusammen: Eine Kaution, von mir gestellt, sei nicht möglich. Mein Pass und mein Personalausweis seien von Herrn Bark übergeben worden, sie befänden sich hier auf dem Tisch. Die Anspannung scheint sich ein wenig gelöst zu haben, die Stimmung in dem unterirdischen Raum scheint konstruktiv, deshalb entschließe ich mich kurzerhand, noch einen Vorstoß zu wagen. Ich werde Pass und Personalausweis mit sofortiger Wirkung abgeben, meinen Wohnsitz unmittelbar nach Bielefeld verlegen, mich täglich bei der Polizeistation melden, Tagesreisen nur innerhalb des Landes vornehmen und eine Erklärung abgeben, dass ich mein Haus in Südfrankreich bis auf Weiteres nicht mehr nutzen werde.
Das scheint auf fruchtbaren Boden zu fallen. Die beisitzende Richterin fragt, ob sie sich Pass und Personalausweis ansehen dürfe. Ich händige ihr die Dokumente aus, die bislang unbeachtet vor mir auf dem Tisch gelegen haben.
Mit den Ausweisen zieht sich die Kammer zur Beratung zurück, wir bleiben mit den Vertretern der Staatsanwaltschaft zurück. Schweigen erfüllt den Raum, doch dann keimt wieder Hoffnung auf – offenbar auch bei meinen Anwälten: »Gleich kommst du hier raus«, raunt mir Holtermüller mit nun überzeugt klingender Stimme zu. »Das ist gleich geschafft.« Leider liegt er auch mit dieser Einschätzung wieder falsch.
Die Tür öffnet sich, die Richter betreten den Raum. Meine Uhr zeigt 15.10 Uhr, mein Herz klopft wild. Da ergreift die beisitzende Richterin das Wort, es scheint fast aus ihr herauszuplatzen: »Es ist ja schon unglaublich«, sagt sie mit erregter Stimme, »uns hier einen abgelaufenen Pass vorzulegen!« Und während sie das sagt, wirft sie meinen Pass an den Vertretern der Staatsanwaltschaft vorbei in meine Richtung. »Dieser Pass ist im Oktober 2014 abgelaufen!«
Völlig perplex greife ich nach dem Pass, der auf dem Holztisch vor mir gelandet ist, und erkenne sofort, dass es stimmt: Offensichtlich hat Stefan Bark in der Aufregung den falschen der beiden, den abgelaufenen Pass aus meinem Koffer gezogen. Der befand sich nur deshalb überhaupt noch dort, weil in ihm mein erster Wohnsitz Saint-Tropez eingetragen ist.
Ich ringe nach Luft, fühle Panik aufsteigen. »Der richtige Pass muss noch in dem Aktenkoffer sein«, sage ich, und dass ich meinen Fahrer bitten könne, ihn sofort zu bringen. Meine Worte erreichen ihre Adressaten nicht mehr.
In meiner Verzweiflung wähle ich – das entsprechende Verbot des Richters missachtend – die Nummer von Stefan Bark auf meinem Blackberry. »Da muss doch der gültige Pass in meinem Aktenkoffer sein«, rufe ich erregt in das Mikrofon des Geräts. »Warum haben Sie den nicht gebracht oder beide Pässe zusammen?« – »Ja«, antwortet er, »da ist noch der gültige Pass in Ihrem Koffer. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn eben nicht mitgebracht habe.« Das sei eine gute Frage, fügt er noch hinzu, als würde das jetzt wirklich noch eine Rolle spielen. »Ich bringe sofort den richtigen Pass.« Meine resignierende Antwort, »das scheint mir nicht mehr nötig zu sein«, hört er nicht mehr – er hat aufgelegt.
Ich mache einen letzten verzweifelten Versuch. Erfolglos. »Sie bleiben über das Wochenende ›drüben‹ wegen Fluchtgefahr. Wir sollten aber im Gespräch bleiben und uns kurzfristig wieder zusammensetzen«, ordnet der Vorsitzende Richter an. Die Anwälte sind stumm. Kapitulation auf ganzer Linie. »Ich bitte Sie«, insistiere ich noch einmal. »Ich bitte Sie von ganzem Herzen, meine Familie wartet dort oben, ich kann sie doch nicht alleine lassen in dieser Situation, bitte lassen Sie mich gehen.« Ich spüre Tränen aufsteigen und bemühe mich, sie zurückzuhalten; Tränen der Wut, dass ich in dieser Situation so hilflos bin, Tränen der Scham vor meiner Familie, Tränen des Ärgers über mich selbst: Wie konnte ich nur in eine solch hoffnungslose Situation geraten?
Die Kammer scheint ungerührt, und mir wird klar, was mir dennoch so unvorstellbar erscheint: Ich werde das Wochenende hinter Gittern verbringen. Aber am Dienstag, schießt es mir durch den Kopf, am Dienstag muss ich an der mündlichen Verhandlung am Landgericht Köln teilnehmen, wo die Zivilklage von meiner Frau und mir gegen das Bankhaus Sal. Oppenheim und die Deutsche Bank über Rückabwicklung und Schadenersatz im Rahmen unserer Beteiligung an den »Oppenheim-Esch-Fonds« verhandelt wird. »Bitte«, richte ich das Wort an die Kammer, »ich bitte Sie, können wir uns nicht zur Haftprüfung am Montag treffen, dann hätte ich am Dienstag noch die Chance, als Zeuge an dem Klageverfahren gegen Sal. Oppenheim teilzunehmen?«
Zögern, Richter Schmitt schaut auf seinen Kalender, sieht seine Kolleginnen an. »Wir könnten uns auch am Montag treffen«, antwortet er. »Dreizehn Uhr sollte für mich möglich sein.« Sie könne erst um vierzehn Uhr, wirft die beisitzende Richterin ein, die Staatsanwaltschaft stimmt zu. »Wir werden am Montag um vierzehn Uhr hier sein«, höre ich Udo Wackernagel sagen. Er ist zwar noch ein junger Anwalt, zu diesem Zeitpunkt ohne ausgiebige Prozesserfahrung, aber hoch talentiert, untadelig im Charakter, intelligent, schlagfertig und mit einer ordentlichen Portion Humor ausgestattet.
Da mein eigentlicher Strafverteidiger, Dr. Sven Thomas, den ich seit den Achtzigerjahren kenne, mit der Vertretung von Bernie Ecclestone betraut war und deswegen in meiner Hauptverhandlung nicht zugegen sein konnte, hatte er sich damit einverstanden erklärt, dass Winfried Holtermüller zusätzlich meine Strafverteidigung übernahm. Dieser hatte sich uns als der einzige Anwalt in Deutschland angedient, der nicht nur ein erstklassiger Zivilrechtler sei, sondern auch ein herausragender Strafverteidiger. Dabei hatte er lediglich zur Bedingung gemacht, dass ihm ein junger Kollege aus der Sozietät von Dr. Thomas zuarbeiten solle. Diese Entscheidung, die ich zusammen mit Dr. Thomas, Holtermüller und Udo Wackernagel in einem Konferenzzimmer der Sozietät TDWE vor Beginn der Hauptverhandlung getroffen hatte und die ich letztlich zu verantworten habe, war eine Fehlentscheidung. Sie hat mich nicht nur über zwei Jahre meines Lebens gekostet, sondern ganz wesentlich mit zu dem Chaos beigetragen, in das ich in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten geraten sollte. Heute bin ich der festen Überzeugung, dass es mit Sven Thomas und Udo Wackernagel als verantwortlichen Vertretern in der zurückliegenden Hauptverhandlung nicht zu dieser überraschenden Art der Verurteilung gekommen wäre. Leider erweisen sich oft die fatalsten Fehler erst im Nachhinein als solche.
Die Kammer bestätigt den Termin am Montag, den 17. November 2014, um vierzehn Uhr in denselben Räumlichkeiten. Wir wollen uns gerade von den Stühlen erheben, da äußert der Vorsitzende Richter scheinbar unvermittelt noch den Gedanken, ob man nicht über eine potenzielle Suizidgefahr bei mir nachdenken müsse. Er beantwortet sich diese Frage sogleich selbst: Er werde einen entsprechenden Hinweis an die Leitung der JVA geben. Ich protestiere vehement: »Nie im Leben würde ich mir selbst etwas antun!«
Es ist jetzt 15.35 Uhr, Udo Wackernagel zieht mich in einen kleinen Nebenraum, die Kammer will noch Beschlüsse verfassen. Wir verlassen den Raum gemeinsam mit den Vertretern der Staatsanwaltschaft und lassen die Richter mit der Justizsekretärin zurück. Richter Schmitt diktiert jetzt, wie ich später lernen werde, die Haftbedingungen für mich, die unter anderem »Telefon- und Briefkontrollen« vorsehen, »optisch/akustische Kontrollen bei Besuchen« sowie »den ausdrücklichen Hinweis auf eine Suizidgefahr«.
Das war’s dann. Innerhalb weniger Stunden bin ich von einem international tätigen Manager zu einem vermeintlichen Schwerverbrecher geworden. Die erschreckende Erkenntnis dabei ist, dass die deutsche Justiz diesen Absturz am Tag der Urteilsverkündung gegen mich herbeiführen kann, ohne dass sie sich dafür sonderlich anstrengen müsste.
Nach drüben
Wir sitzen im Nebenraum, schweigend, die Anwälte bemüht, mich ihre Betroffenheit so wenig wie möglich spüren zu lassen. Ich greife nach dem Blackberry; was auch immer jetzt folgen würde, ich will den wichtigsten Menschen in meinem Leben wenigstens noch Nachrichten zukommen lassen. Eine SMS schicke ich meinem ältesten Sohn Jan. »Stefan Bark wartet mit dem Pass an der Pforte«, schreibt er sofort zurück. »Zu spät«, antworte ich. »Bitte nicht«, lese ich auf dem Display. »Pass gut auf die Familie auf«, tippe ich und spüre, wie sich das Zittern meiner Hände nur schwer kontrollieren lässt. »Können wir nicht wenigstens noch kurz persönlich von dir Abschied nehmen?« Jans Verzweiflung ist noch schwerer zu ertragen als die Situation an sich. Fast flehentlich bitte ich Udo Wackernagel, ob er die Bitte dem Vorsitzenden Richter vortragen könne. Er verlässt den Raum und kehrt zu schnell wieder zurück, kopfschüttelnd: »Schmitt will das definitiv nicht zulassen«, sagt er, flüsternd, als schäme er sich seiner Worte. »Sie dürfen Ihren Blackberry jetzt wirklich nicht mehr benutzen. Am besten, Sie geben ihn mir, ich werde ihn Ihrer Familie aushändigen.« Unschlüssig schaue ich auf das kleine schwarze Gerät in meinen Händen, das bis eben noch meine Verbindung zur Außenwelt war. Es bleibt noch so viel zu sagen, so viel zu schreiben an meine Familie, so vieles, das ich in den zurückliegenden Jahren schon längst hätte sagen oder schreiben sollen.
Im Sekundentakt gehen Nachrichten ein, ich sehe das Lämpchen wie durch einen Schleier blinken, unfähig zu reagieren. Da ruft meine Frau an, ich höre ihre Stimme, ihr Weinen, ihre Verzweiflung. Es ist die Ohnmacht, die jetzt Tränen über mein Gesicht rinnen lässt: Ich sehe meine Familie all dem ausgesetzt und kann nichts für sie tun. Udo Wackernagel drängt erneut, die Kommunikation jetzt einzustellen. Ich solle Richter Schmitt nicht verärgern. Ich schalte den Blackberry aus und reiche ihn ihm wie betäubt.
In diesen Minuten verschiebt sich das Gefüge, das meinem Leben über Jahrzehnte die Balance gegeben hatte: Mein ältester Sohn übernimmt ohne Zögern meine Rolle – und die Verantwortung für die Familie. Er stellt seine eigenen Bedürfnisse, seine beginnende Karriere selbstlos zurück. Hätte ich das je getan? Ich werde ihm dafür immer dankbar sein.
Mit dem Blackberry verschwinden jetzt auch alle wichtigen Kontaktdaten. Telefonnummern, Adressen – wie ausgelöscht. Wer merkt sich noch lange Ziffernfolgen, wo Smartphones unser Gedächtnis ersetzen? Udo Wackernagel zieht mich in den Vorraum, ich soll an jenem Tisch Platz nehmen, an dem ich kurz zuvor bei meiner Ankunft hier unten bereits gesessen hatte. Da noch mit der Hoffnung, das Zimmer als freier Mann wieder verlassen zu können. Die Tür des größeren Besprechungsraumes, in dem wir vorhin noch verhandelt hatten, öffnet sich, die Richter verlassen wortlos den Raum, keiner von ihnen sieht mich an. 15.45 Uhr: Feierabend im Landgericht. Die Herrschaften werden zweifellos pünktlich bei ihren Familien sein.
Wackernagel beugt sich zu mir hinunter: »Sie müssen jetzt ganz stark sein!« Seine Worte hallen in meinem Kopf und dringen doch nicht zu mir durch. Er schiebt sein Gesicht dicht vor meines: »Sie müssen jetzt ganz stark sein – für Ihre Familie«, wiederholt er. Ich ringe um Fassung: »Das werde ich.«
Die Anwälte nehmen ihre Jacken und die Aktenkoffer und verlassen den Raum durch die vergitterte Sicherheitspforte. Es ist nur ein Traum, wenn auch ein Albtraum, ich bete innerlich, dass es einer ist. Bis eine deutlich vernehmbare Stimme das Gegenteil beweist: »Stehen Sie auf und stellen Sie sich dort an die Wand«, ordnet ein stämmiger Wachmann in einem Ton an, der keinen Widerspruch duldet. »Leeren Sie Ihre Taschen und legen Sie den Inhalt auf den Tisch«, sagt ein zweiter. »Danach ziehen Sie Ihre Schuhe aus.« Mechanisch folge ich den Anweisungen, wie in einen dichten Nebel gehüllt: Einen silbernen Stift mit zarter Gravur, achtzig Cent und meinen Personalausweis lege ich vor mich hin.
Der zweite Justizmitarbeiter überprüft mich mit einem Metalldetektor. Die Schuhe soll ich wieder anziehen, die Schnürsenkel bereiten mir Mühe, die Hände gehorchen nicht wie gewohnt. Den Stift, die achtzig Cent und den Ausweis darf ich wieder einstecken. »Folgen Sie mir«, befiehlt der erste Beamte und führt mich in einen Gang, der endlos scheint. Nach etwa einhundertfünfzig Metern öffnet sich rechter Hand ein Durchgang, der mit Gitterstäben gesichert ist. Ein freundlicher weißhaariger Mitarbeiter wartet schon: »Guten Tag, Herr Dr. Middelhoff. Ich werde Sie jetzt nach drüben bringen. Gehen Sie voraus und folgen Sie immer diesem Gang.«
Es ist 16.15 Uhr. Ich hole tief Luft, wie man es sonst vielleicht tut, bevor man im Wasser abtauchen will, gehe durch die Tür und steige eine Treppe hinab. Das Licht ist kalt, die Wände sind sauber und cremefarben gestrichen, weiße Rohre führen an ihnen entlang in die Höhe. An die Treppe schließt sich ein weiterer langer Gang an, der in Windungen verläuft. Weiter vorne erblicke ich eine blau gekleidete Person, die mit schlurfenden Schritten vorwärts geht, langsamer als ich. Am Rande des Abgrunds kann auch Harmloses bedrohlich wirken. Instinktiv halte ich Abstand. Am Ende wieder eine Treppe, sie führt hinauf und endet an einer massiven Stahltür.
Zum Nachdenken bleibt keine Zeit. »Dort schräg über den Hof rechts hinüber und drüben die kleine Treppe hoch, zweite Tür«, höre ich den Wachmann sagen. Wir treten auf den Innenhof, umsäumt von mächtigen, bedrohlich wirkenden Blöcken, alle Fenster vergittert, Stacheldraht. Reflexartig ziehe ich den Kopf ein und blicke mich um: Bitte keine Presse, nicht jetzt, nicht hier – das soll meine Familie nicht auch noch ertragen müssen. Es sind keine Fotografen da, natürlich nicht. Erleichterung fühlt sich anders an.
Wieder eine Treppe, eine weitere Stahltür, mein blau gekleideter neuer Genosse wird durch eine Seitentür weggeführt. Ich solle hier warten, bedeutet man mir. Ich beginne zu ahnen, wie viele Facetten das Warten in dieser Welt haben kann, wie sehr es einen Menschen zermürben kann. Mein Kopf scheint leer, meine Gedanken rasen dennoch unaufhaltsam. Nie zuvor habe ich mich so einsam gefühlt.
Der Wachmann kehrt zurück. Ich folge ihm durch einen weiteren Gang, an zwei Holzbänken halten wir, aus den Augenwinkeln nehme ich rötlich gestrichene Wände und Grünpflanzen wahr. Er verabschiedet sich freundlich und verschwindet durch eine Holztür. Warten. Wieder warten. Nach zehn Minuten öffnet sich die Tür, und ich werde in den Raum gebeten. Zwei Männer sitzen an Schreibtischen, die Blicke offen. »Dr. Middelhoff, das hier ist jetzt Ihre Aufnahme bei uns«, erklärt der erste. Ich muss mein Alter angeben, Konfession, Adresse. »Wie sind Sie versichert?«, fragt der andere in jovialem Tonfall dazwischen. Ich beantworte die Fragen knapp und höflich. Bis der erste schließlich versöhnlich und erstaunt bemerkt: »Sie sind ja gar nicht so arrogant, wie ich in der Presse gelesen habe.«
Wie dankbar bin ich in diesem Moment für dieses knappe Bekenntnis. Wie gedankenlos Urteile gefällt werden, wie unreflektiert und getrieben von Populismus, Neid und Schadenfreude Menschen verurteilt werden, habe ich in den vergangenen Jahren zur Genüge erlebt; zuletzt gipfelnd in einer emotional vorgetragenen Urteilsbegründung durch eine Instanz, die eigentlich der Objektivität, Wahrheit und Gerechtigkeit dienen soll. Wie viel näher an der Wahrheit war für mich dieser Satz des unbekannten Vollzugsmitarbeiters.
Nackt in der Kleiderkammer





























