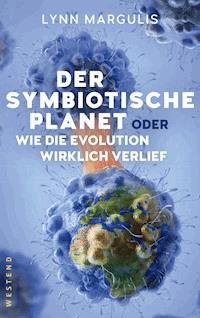
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der symbiotische Planet oder Wie die Evolution wirklich verlief
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Ebook Edition
Lynn Margulis
Der symbiotische Planet
ODER
Wie die Evolution wirklich verlief
Aus dem Englischen übersetzt von Sebastian Vogel
Originaltitel: Symbiotic Planet Aus dem Englischen übersetzt von Sebastian Vogel Englische Originalausgabe erschienen bei Weidenfeld & Nicolson/ Orion Publishing Group Ltd., London; amerikanische Originalausgabe erschienen bei Basic Books., New York © 1998 Lynn Margulis
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-704-7
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2017
Umschlaggestaltung: pleasant_net, Büro für strategische Beeinflussung
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Prolog
Time does go on –I tell it gay to those who suffer now –They shall survive –There is a sun –They don’t believe it now –
(Die Zeit geht weiter –Künde ich fröhlich jenen, welche heute leiden –Sie werden überleben –Und die Sonne sehen –Mögen sie es auch jetzt nicht glauben –)1
»Mama, was hat das Gaia-Konzept mit deiner Symbiontentheorie zu tun?«, fragte mein 17jähriger Sohn Zach eines Tages nach der Arbeit. Er hatte ursprünglich Ambitionen als Politiker gehabt, arbeitete aber inzwischen ziemlich desillusioniert als Assistent für einen Abgeordneten im Parlament des US-Bundesstaates Massachusetts in Boston und war gerade von dem ermüdenden Versuch, für einen seiner beiden abwesenden Chefs eine Altersheimgesetzgebung zu entwerfen, nach Hause gekommen.
»Nichts«, erwiderte ich sofort, »jedenfalls nicht, dass ich wüsste.« Seither habe ich immer wieder über diese Frage nachgedacht. Das Buch, das Sie in Händen halten, ist der Versuch einer Antwort. Es befasst sich hauptsächlich mit den beiden großen wissenschaftlichen Themen, die mich mein gesamtes Berufsleben begleitet haben –, der seriellen Endosymbiontentheorie (SET) und Gaia sowie ihrer Beziehung zueinander.
Zachs Frage, wie Symbiose und Gaia zusammengehören, lässt sich sehr treffend mit einer witzigen Bemerkung meines ausgezeichneten früheren Studenten Greg Hinkle beantworten, der heute Professor an der University of Massachusetts in South Dartmouth ist. Bevor Greg seinen Doktor machte, war er der Überzeugung und lehrte, dass Symbiose einfach das Zusammenleben von Lebewesen unterschiedlicher Arten in körperlichem Kontakt sei. Die Partner der Symbiose, die Symbionten, sind einander in Treue verbunden: Sie befinden sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort, berühren sich unmittelbar oder leben sogar ineinander. Die Vorstellung von »Gaia« – der alte griechische Name für die Mutter Erde – geht davon aus, dass die Erde lebendig ist. Nach der Gaia-Hypothese, die von dem englischen Chemiker James E. Lovelock formuliert wurde, werden verschiedene Eigenschaften der atmosphärischen Gase, der Oberflächengesteine und des Wassers durch Wachstum, Tod, Stoffwechsel und andere Aktivitäten aller Lebewesen reguliert. Greg witzelte: »Gaia ist einfach Symbiose vom Weltraum aus gesehen« – alle Lebewesen stehen miteinander in Berührung, weil sie alle von der gleichen Luft und dem gleichen Wasser umspült werden. Die Gründe, warum Greg meiner Überzeugung nach recht hat, werden auf den folgenden Seiten ausführlich erläutert.
Wenn Sie aus diesem Buch etwas über Symbiose und die Gaia-Theorie im Zusammenhang mit radikalen neuen Ansichten über das Leben erfahren, ist das vier glücklichen Umständen zu verdanken: erstens Zachs Frage; zweitens den Beiträgen von Dorion Sagan zur Qualität meines Denkens und Schreibens2; drittens Lois Brynes, die dieses Manuskript mit vorausschauender Redlichkeit und peinlich genauem künstlerischem Geschmack hinterfragte, neu gliederte und umstrukturierte3; und schließlich der notwendigen Beharrlichkeit von William Frucht von Basic Books, der auf eine konzentrierte Organisation und weniger hemmungsloses Erzählen drängte. Mit einem so intelligenten, neugierigen und zu Recht kritischen Lektor zu arbeiten ist immer wieder eine Freude.
Dieses Buch handelt vom Leben auf unserem Planeten, seiner Evolution und davon, wie sich unsere Ansichten dazu gewandelt haben. Wenn ich ihm einen Untertitel geben sollte, dann wäre es die Forschung, und zwar insbesondere die naturwissenschaftliche Forschung, mit ihren zahlreichen Wendemanövern und festen Regeln, die sie voranbringen oder hemmen können. Viele Umstände tragen insgeheim dazu bei, dass manche wissenschaftlichen Entdeckungen wieder verloren gehen, insbesondere solche, die an geheiligten Normen unserer Kultur kratzen. Unsere Spezies hängt an der vertrauten, tröstlichen Gleichförmigkeit der gewohnten Denkweisen. Und die »Konventionen« sind tiefer verwurzelt, als wir gemeinhin zugeben. Selbst wenn wir für eine bestimmte Philosophie oder Denkrichtung nicht einmal den richtigen Namen kennen und kaum etwas über ihre Geschichte wissen, ist doch jeder von uns in seiner eigenen, sicheren »Wirklichkeit« verwurzelt. Unser Weltbild prägt das, was wir sehen, und die Art und Weise, wie wir etwas lernen. Jede Idee, die wir als Tatsache oder Wahrheit akzeptieren, ist in ein umfassendes Denkgebäude eingebettet, dessen wir uns in der Regel nicht bewusst sind. Solche kulturell bedingten Beschränkungen kann man »erlernte Unfähigkeiten«, »kollektives Denken« oder »soziale Konstruktionen der Wirklichkeit« nennen. Wie auch immer man die beherrschenden Eingrenzungen, die über unsere Sichtweisen bestimmen, bezeichnen mag – sie betreffen jeden von uns, auch Naturwissenschaftler. Alle sind in ihrer Wahrnehmung mit ausgeprägten sprachlichen, nationalen, regionalen und generationsbedingten Schranken belastet. Wie jeder andere Mensch, so wird auch der Naturwissenschaftler in seinem Verhalten von unbewussten Vorurteilen beeinflusst, die unmerklich das Denken lenken.
Eine solche weitverbreitete, unausgesprochene Annahme betrifft die »Große Seinskette«: Sie definiert die altehrwürdige Stellung des Menschen als Mittelpunkt des Universums – unter Gott und über den Gesteinen. Diese anthropozentrische Vorstellung beherrscht das religiöse Denken, selbst das Denken derjenigen, die nach eigener Auskunft Religion ablehnen und eine naturwissenschaftliche Weltanschauung an ihre Stelle gesetzt haben. Für die alten Griechen verband die Seinskette eine Fülle von Göttern am oberen Ende zunächst mit Männern, dann Frauen, Sklaven, Tieren und Pflanzen. Das letzte Glied bildete ein Nährboden aus Gestein und Mineralien. Die jüdisch-christliche Version erlaubte eine leichte Abwandlung: Die Menschen standen über den Tieren, aber ein wenig unter den Engeln. Und die unumstrittene, offenkundige Spitze bildete natürlich der Allmächtige4.
Diese Vorstellungen werden von der naturwissenschaftlich geprägten Weltanschauung als veralteter Unsinn abgetan. Alle heutigen Lebewesen sind gleichermaßen aus der Evolution hervorgegangen. Alle haben eine mehr als drei Milliarden Jahre lange Entwicklung aus bakterienartigen gemeinsamen Vorfahren hinter sich. Es gibt keine »höheren« Wesen, keine »niederen Tiere«, keine Engel und keine Götter. Der Teufel ist wie der Weihnachtsmann ein nützlicher Mythos. Selbst die »höheren« Primaten, die Klein- und Menschenaffen, sind trotz ihres Namens (vom lateinischen primus, »der Erste«) nichts Höheres. Wir von der Spezies Homo sapiens und unsere Verwandten unter den Primaten sind nichts Besonderes, sondern nur Neuankömmlinge auf der Bühne der Evolution. Die Ähnlichkeiten zwischen dem Menschen und anderen Lebensformen sind viel auffälliger als die Unterschiede. Unsere engen Verbindungen aus gewaltigen erdgeschichtlichen Zeiträumen sollten in uns nicht Widerwillen, sondern Ehrfurcht wecken.
Als Spezies fürchten wir immer noch das Exzentrische, das außerhalb der »Norm« Gelegene, in unserem Bild von uns selbst. Trotz oder vielleicht auch wegen Darwin verstehen wir in unserem Kulturkreis die Wissenschaft der Evolution eigentlich immer noch nicht. Wenn Naturwissenschaft und Kultur aufeinanderprallen, trägt die Kultur stets den Sieg davon. Die Evolutionsforschung sollte viel besser verstanden werden. Ja, wir Menschen sind tatsächlich aus der Evolution hervorgegangen, aber sie begann nicht erst beim Affen oder auch bei den Säugetieren. Wir haben uns aus einer langen Reihe von Vorläufern und letztlich aus den allerersten Bakterien entwickelt.
Der größte Teil der Evolution hat sich in jenen Lebewesen abgespielt, die wir als »Mikroben« abtun. Wie wir heute wissen, hat sich alles Leben aus den kleinsten Lebensformen, den Bakterien, entwickelt. Diese Tatsache muss uns nicht unbedingt angenehm sein. Mikroben und insbesondere Bakterien werden gewöhnlich als Feinde betrachtet und als Keime verunglimpft. Doch zu den Mikroben gehören all jene Lebewesen – Algen, Bakterien, Hefen und so weiter –, die man unter einem Mikroskop genauer erkennen kann als mit dem bloßen Auge, dem sie sich lediglich als Schmiere oder Schleim präsentieren. Ich behaupte: Wir Menschen sind, wie alle anderen Affen, nicht das Werk Gottes, sondern das Ergebnis der Milliarden Jahre währenden Wechselwirkungen zwischen höchst reaktionsfähigen Mikroben. Dies klingt für manche Menschen beunruhigend. Dem einen oder anderen erscheint das gar als beängstigende Nachricht aus der Welt der Wissenschaft, einer Informationsquelle, die es abzulehnen gilt. Ich finde sie faszinierend: Sie spornt mich an, mehr in Erfahrung zu bringen.
1 Symbiose überall
A Bee his burnished Carriage Drove boldly to a Rose – Combinedly alighting – Himself –
(Die leuchtend Last trug eine Biene kühn zur Rose hin – Wo sie gemeinsam dann mit ihr – Sich niederließ –)
Symbiose – ein System aus Lebewesen verschiedener Arten, die in engem körperlichen Kontakt leben – erscheint uns als ein spezielles wissenschaftliches Konzept und als ein spezifischer biologischer Fachausdruck. Das liegt daran, dass wir uns ihrer großen Verbreitung nicht bewusst sind. Nicht nur unser Darm und unsere Augenwimpern sind dicht mit bakteriellen und tierischen Symbionten besetzt; auch wenn man sich im eigenen Garten oder im Stadtpark umsieht, sind sie allgegenwärtig, fallen aber nicht sofort ins Auge. Klee und Wicken, zwei verbreitete Pflanzen, haben an ihren Wurzeln kleine Knöllchen. Dort befinden sich die stickstofffixierenden Bakterien, die für ein gesundes Wachstum in stickstoffarmen Böden unentbehrlich sind. Schauen wir uns die Bäume an – den Ahorn oder die Eiche beispielsweise. Bis zu dreihundert verschiedene symbiontische Pilze, darunter auch solche, die wir als große Pilze kennen, sind als sogenannte Mycorrhiza mit den Baumwurzeln eng verwoben. Oder nehmen wir den Hund, der die in seinem Darm lebenden symbiontischen Würmer in der Regel nicht bemerkt. Wir sind Symbionten auf einem symbiontischen Planeten, und wenn wir genau hinschauen, finden wir überall Symbiose. Für viele verschiedene Arten von Leben ist dieser körperliche Kontakt unentbehrliche Lebensbedingung.
Praktisch alles, womit ich mich heute befasse, wurde bereits von unbekannten Gelehrten oder Naturforschern vorweggenommen. Einer meiner wichtigsten wissenschaftlichen Vorgänger verstand und erklärte die Rolle der Symbiose in der Evolution eingehend. Der Anatom Ivan E. Wallin (1883–1969) von der University of Colorado legte in einem ausgezeichneten Buch dar, dass neue Arten durch Symbiose entstehen. Der evolutionstheoretische Begriff Symbiogenese bezeichnet den Ursprung neuer Gewebe, Organe, Organismen – ja sogar Arten – durch das Eingehen langfristiger oder ständiger Symbiosen. Wallin benutzte das Wort Symbiogenese nicht, aber die Idee war ihm vollkommen geläufig. Besonderes Augenmerk richtete er auf die Symbiose von Tieren mit Bakterien, einen Vorgang, den er als »Entstehung mikro-symbiontischer Komplexe« oder »Symbiontizismus« bezeichnete. Das ist sehr wichtig. Darwin gab seinem Hauptwerk zwar den Titel Über die Entstehung der Arten, aber mit dem Auftauchen neuer Arten befasst sich sein Buch in Wirklichkeit kaum1.
Symbiose – hier stimme ich völlig mit Wallin überein – ist von entscheidender Bedeutung, wenn man Neuentwicklungen in der Evolution und die Entstehung der Arten verstehen will. Ich bin sogar überzeugt, dass der Begriff der Art als solcher Symbiose erfordert. Bei Bakterien gibt es keine Arten2. Arten existierten nicht, bevor Bakterien sich zu größeren Zellen zusammentaten, unter anderen zu den Vorläufern aller heutigen Pflanzen und Tiere. In diesem Buch werde ich zeigen, wie langfristige Symbiose zunächst zur Evolution komplexer Zellen mit einem Zellkern und von dort zur Entstehung anderer Lebewesen wie Pilzen, Pflanzen und Tieren führte.
Dass Tier- und Pflanzenzellen ursprünglich durch Symbiose entstanden sind, ist heute nicht mehr umstritten. Dieser Aspekt meiner Theorie der Zellsymbiose wurde durch die Molekularbiologie und insbesondere durch die Sequenzierung von Genen bestätigt. Dass Bakterien als Plastiden und Mitochondrien dauerhaft in Pflanzen- und Tierzellen aufgenommen wurden, ist der Teil meiner seriellen Endosymbiontentheorie, die sich heute sogar in Schulbüchern wiederfindet. Aber in vollem Umfang wird die Bedeutung der symbiontischen Sichtweise für die Evolution noch nicht gewürdigt. Und die Vorstellung, neue Arten könnten durch symbiontische Verschmelzung aus den Angehörigen alter Arten entstehen, wird in Gesellschaft »anständiger« Wissenschaftler noch nicht einmal diskutiert.
Ein Beispiel: Einmal fragte ich den beredten, sympathischen Paläontologen Niles Eldredge, ob ihm ein Fall bekannt sei, in dem die Bildung einer neuen Art dokumentiert ist. Ich sagte ihm, sein Beispiel dürfte aus Labor, Freiland oder der Beobachtung von Fossilfunden abgeleitet sein. Er konnte nur ein gutes Beispiel anführen: die Experimente von Theodosius Dobzhansky mit der Taufliege Drosophila. In jenen faszinierenden Versuchen kam es bei Taufliegenpopulationen, die man bei stetig steigenden Temperaturen ausgebrütet hatte, zu einer genetischen Trennung: Nach etwa zwei Jahren konnten die Fliegen, die in wärmerer Umgebung herangewachsen waren, mit ihren Vettern aus dem kälteren Umfeld keine fruchtbaren Nachkommen mehr zeugen. »Aber«, so fügte Eldredge schnell hinzu, »es stellte sich heraus, dass das etwas mit einem Parasiten zu tun hatte!« Tatsächlich entdeckte man später, dass den in warmer Umgebung geschlüpften Fliegen ein in den Zellen lebendes, symbiontisches Bakterium fehlte, das bei denen in niedrigeren Temperaturen aufgewachsenen Tieren vorhanden war. Eldredge tat diese Beobachtung der Artbildung verächtlich ab, weil dabei die Symbiose mit Mikroorganismen im Spiel war! Er hatte wie wir alle gelernt, dass Mikroben Keime sind, und wenn Keime auftreten, hat man keine neue Art, sondern eine Krankheit. Und er hatte auch gelernt, dass die Evolution durch natürliche Selektion in der Anhäufung von Mutationen einzelner Gene über die Erdzeitalter hinweg besteht.
Eine Prokaryotenzelle und eine Eukaryotenzelle im Vergleich; Zeichnung von Christie Lyons.
Ironie des Schicksals: Niles Eldredge ist zusammen mit Stephen Jay Gould Urheber der Theorie des »unterbrochenen Gleichgewichts« (punctuated equilibrium). Nach Ansicht beider zeigen Fossilfunde, dass die Evolution während der meisten Zeit stillsteht und sich dann plötzlich beschleunigt: In den Fossilpopulationen spiegeln sich schnelle Veränderungen während relativ kurzer Zeiträume wider, und danach tritt für längere Perioden eine »Stasis« ein. Aus der langfristigen Sicht der erdgeschichtlichen Zeiträume sind Symbiosen wie Lichtblitze der Evolution. Nach meiner Überzeugung trägt die Symbiose als Quelle entwicklungsgeschichtlicher Neuentwicklungen dazu bei, die Beobachtung des »unterbrochenen Gleichgewichts«, das heißt der plötzlichen Sprünge in den Fossilfunden, zu erklären.
Die einzigen anderen Lebewesen neben den Taufliegen, bei denen man die Entstehung von Arten im Labor beobachten konnte, gehörten zur Gattung Amoeba, und auch hier war Symbiose im Spiel. Symbiose ist eine Art von Lamarckismus. Dieser Begriff erinnert an Jean Baptiste de Lamarck – er galt in Frankreich als der erste Evolutionstheoretiker, seine Theorie wird aber heute meist wegen der »Vererbung erworbener Merkmale« verächtlich abgelehnt. Der einfache Lamarckismus besagt: Lebewesen erben Merkmale, die ihre Eltern durch Umweltbedingungen erworben haben. Durch Symbiogenese dagegen erwerben die Lebewesen keine Eigenschaften, sondern ganze Organismen und natürlich auch deren gesamte Genausstattung! Ich könnte behaupten, was ich oft von meinen französischen Kollegen gehört habe: dass Symbiogenese eine Form von Neo-Lamarckismus ist. Symbiogenese ist entwicklungsgeschichtlicher Wandel durch die Vererbung erworbener Genausstattungen3.
Lebewesen entziehen sich einer genauen Definition. Sie kämpfen, sie fressen, sie tanzen, sie paaren sich, sie sterben. Am Anfang der mannigfaltigen Fähigkeiten aller großen, vertrauten Lebensformen steht die Symbiose, die Neues schafft. Sie führt unterschiedliche Lebensformen zusammen, und immer aus gutem Grund. Oft vereinigt der Hunger den Räuber mit der Beute oder den Mund mit seinem Opfer, dem photosynthetischen Bakterium oder der Alge. Die Symbiogenese vereint verschiedenartige Individuen zu großen, komplexeren Gebilden. So entstandene Lebensformen sind sogar noch andersartiger als ihre ungleichen »Eltern«. Ständig verschmelzen »Individuen« und passen ihre Fortpflanzung an. Sie bringen neue Populationen hervor, die zu symbiontischen neuen Wesen aus vielen Einzelelementen werden. Diese wiederum organisieren sich auf einer höheren, umfassenderen Integrationsebene zu »neuen Individuen«. Symbiose ist kein nebensächliches oder seltenes Phänomen. Sie ist natürlich und weit verbreitet. Wir leben in einer symbiontischen Welt.
An der Küste der Bretagne im Nordwesten Frankreichs und an den Stränden beiderseits des Ärmelkanals findet sich eine seltsame Art von »Seetang«, die eigentlich gar kein Seetang ist. Aus der Entfernung wirkt er wie hellgrüne Flecken auf dem Sand. Vollgesogen mit Wasser, liegen solche glitzernden Flecken in seichten Pfützen. Nimmt man ein wenig grünes Wasser mit der Hand auf und lässt es durch die Finger fließen, so bemerkt man klebrige Streifen, die wie Tang aussehen. Aber unter einer kleinen Taschenlupe oder einem schwach vergrößernden Mikroskop zeigt sich, dass es sich in Wirklichkeit um grüne Würmer handelt. Diese Massen von sonnenbadenden grünen Würmern können sich – anders als jeder Seetang – im Sand eingraben und verschwinden. Zum ersten Mal wurden sie in den zwanziger Jahren von dem Engländer J. Keeble beschrieben, der den Sommer immer in Roscoff verbrachte. Keeble nannte sie »Pflanzentiere« und illustrierte sie eindrucksvoll auf dem farbigen Titelbild seines Buches Plant-Animals. Die Plattwürmer der Art Convoluta roscoffiensis sind ganz und gar grün, weil ihr Gewebe dicht mit Zellen von Platymonas angefüllt ist; und da die Würmer selbst durchsichtig sind, scheint die grüne Farbe der photosynthetischen Alge Platymonas hindurch. Die grünen Algen sind zwar auffällig, dienen aber nicht nur der Verzierung: Sie leben und wachsen, vermehren sich und sterben im Körper der Würmer. Und sie produzieren sogar die Nahrung, die die Würmer »fressen«. Der Mund wird bei den Würmern überflüssig und hat nach dem Schlüpfen der Larve keine Funktion mehr. Das Sonnenlicht fällt auf die Algen in ihrem mobilen Gewächshaus, sodass sie wachsen und sich ernähren können; gleichzeitig scheiden sie Photosyntheseprodukte aus und füttern damit ihren Wirt von innen. Sogar bei der Abfallentsorgung tun die symbiontischen Algen ihrem lebenden Gehäuse einen Gefallen: Sie verwerten die Harnsäure des Wurms und gewinnen daraus Nährstoffe für sich selbst. Algen und Wurm sind ein winziges Ökosystem, das in der Sonne dahinschwimmt. Die beiden Lebewesen sind sogar so innig verbunden, dass sich ohne hochauflösende Mikroskope kaum sagen lässt, wo das Tier aufhört und die Alge anfängt.
Solche Partnerschaften gibt es überall. Die Schnecke Plachobranchus beherbergt in ihrem Körper grüne Symbionten, die in so gleichmäßigen Reihen wachsen, als hätte sie jemand gepflanzt. Riesenmuscheln dienen als lebende Gärten und halten die Algen mit ihrem Körper ins Licht. Die im Pazifik heimische Mastigias ist eine Qualle ähnlich der Portugiesischen Galeere; ihre Medusoiden treiben zu Tausenden wie kleine grüne Regenschirme dicht unter der Wasseroberfläche durch die Lichtstrahlen4.
Auch tentakeltragende Süßwasserpolypen (Hydra) können weiß oder grün sein, je nachdem, ob ihr Körper mit grünen, photosynthetisch aktiven Partnern angefüllt ist. Sind Hydren Tiere oder Pflanzen? Bei einem grünen Polypen, der von seinen nahrungsproduzierenden Partnern (Chlorella genannt) ständig bewohnt wird, ist das schwer zu sagen. Sind Polypen grün, so sind sie symbiontisch. Sie sind zur Photosynthese fähig und können schwimmen, sich bewegen oder an einer Stelle verharren. Sie nehmen am Spiel des Lebens weiterhin teil, weil sie durch Integration Individualität erwerben.
Wir Tiere sind mit allen unseren 30 Millionen Arten aus dem Mikrokosmos hervorgegangen. Die Welt der Mikroben, Quelle von Boden und Luft, gibt auch über unser eigenes Überleben Auskunft. Ein wichtiges Thema im mikrobiellen Drama des mikroskopisch Kleinen ist die Entstehung der Individualität aus den Wechselwirkungen einstmals unabhängiger Akteure.
Ich betrachte den täglichen Lebenskampf unserer nichtmenschlichen Mitbewohner der Erde mit Interesse. Viele Jahre lang machte ich zusammen mit meiner früheren Studentin Lorraine Olendzenski, die heute an der University of Connecticut arbeitet, Videoaufnahmen vom Leben im Mikrokosmos. In jüngerer Zeit arbeiteten wir mit Lois Brynes zusammen, der tatkräftigen früheren Mitdirektorin des New England Science Center in Worcester (Massachusetts). Zusammen mit einer Gruppe sehr begabter Studenten von der University of Massachusetts drehen wir Filme und Videos, mit denen wir anderen Menschen unsere mikroskopisch kleinen Bekannten vorstellen.
Ein Beispiel für entstehende Individualität, das wir kürzlich in Massachusetts entdeckt und neu beschrieben haben, ist Ophrydium, ein Schaumbewohner in Teichgewässern, der aus »Geleekugeln« zusammengesetzt zu sein scheint. Unsere Filme zeigen diese »Wasserbälle« in eindrucksvoller Deutlichkeit. Das größere »Individuum«, die grüne Geleekugel, ist aus kleineren, kegelförmigen »Individuen« zusammengesetzt, die sich aktiv kontrahieren. Die Kegel sind wiederum zusammengesetzt: Grüne Chlorella-Algen leben, in dichten Reihen angeordnet, im Inneren von Ciliaten. Jeder der mit der Spitze nach unten orientierten Kegel enthält Hunderte von kugelförmigen Symbionten, den Zellen von Chlorella. Diese grüne Alge ist weit verbreitet; in Ophrydium sind die Algenzellen gefangen und für die Lebensgemeinschaft der Geleekugel nutzbar gemacht. Jedes »Einzellebewesen« dieser »Art« ist in Wirklichkeit eine Gruppe, ein membranumhülltes Mikrobenpaket, das wie ein Individuum aussieht und sich auch so verhält.
Auch das nahrhafte Getränk Kefir, das aus dem Kaukasus stammt, ist ein symbiontischer Komplex. Kefir enthält körnig geronnene Milch, die in Georgien »Mohammeds Kügelchen« genannt wird. Die Klümpchen sind dichte Pakete aus über 25 verschiedenen Hefe- und Bakterienarten. Jedes besteht aus Millionen Individuen. Aus solchen verschmolzenen Organismen gehen manchmal neue Lebewesen hervor. »Selbständige« Lebensformen haben die Neigung, sich zu verbinden und auf einer höheren Organisationsebene in neuer, größerer Gesamtheit wiederzuerstehen. Nach meiner Vermutung wird es für die Zukunft der Spezies Homo sapiens schon sehr bald notwendig sein, sich der Verschmelzung und Vermischung unserer Mitbewohner auf der Erde, die uns im Mikrokosmos vorausgegangen sind, bewusster zu werden. Eines meiner ehrgeizigen Ziele besteht darin, irgendeinen großen Regisseur zu beschwatzen, die Evolutionsgeschichte als Abbild des Mikrokosmos im 42-Millimeter-Format (IMAX oder OMNIMAX) zu filmen und so die Bildung und Lösung spektakulärer Beziehungen im Reich des Lebens zu zeigen.
So wie während der gesamten Erdgeschichte entstehen und vergehen lebende Zusammenschlüsse auch heute noch unverändert. Symbiosen – stabile und flüchtige – sind und bleiben ein beherrschendes Element. Solche Evolutionsgeschichten haben Fernsehsendungen verdient.
2 Entgegen der Lehrmeinung
The hills erect their Purple Heads The Rivers lean to see Yet Man has not of all the Throng A Curiosity
(Der Berg erhebt sein purpurn Haupt Der Fluss lässt gern sich sehen Dem Menschen mag bei alledem Die Neugier wohl vergehen)
Die schmerzhaftesten Gefühle, an die ich mich erinnern kann, hatte ich mit 13 Jahren. Keine berufliche Enttäuschung, keine Zurückweisung in der Liebe hat mich in größere Trübsal und Teilnahmslosigkeit gestürzt. In Ausübung meiner vermeintlichen Rechte als freie Bürgerin verließ ich heimlich die achte Klasse der Laborschule der University of Chicago mit ihrem höchst mäßigen Angebot an potentiellen Verehrern und kehrte an die große staatliche Highschool zurück, an die ich nach meiner eigenen Überzeugung gehörte. Ich weigerte mich, auch nur einen Tag länger in jener Laborschule zu bleiben, wo alles so vertraut und die Algebra so schwierig war.
Ich wohnte damals in der wunderschönen Wohnung meiner Eltern am South Shore Drive und entschied, dass Weglaufen die einzige Lösung sei. Natürlich hatte ich kein Geld, keinen Ort, wohin ich gehen konnte, und einen strengen Stundenplan mit Unterricht und Verpflichtungen. Als mir klar wurde, dass Weglaufen nicht machbar war, die Tage sich in die Länge zogen und es draußen eisig kalt wurde, brütete ich einen Plan aus. Ich war seinerzeit im September, als nur eine einzige Klasse begann, in die vierte Klasse der Laborschule der University of Chicago gekommen, und natürlich wusste ich, dass mich der Wechsel ein Halbjahr zurückgeworfen hatte. Meine Freunde an der staatlichen Schule waren mir ein halbes Jahr voraus. Als meine Trübsal im November oder Dezember ihren Höhepunkt erreichte, gerade als das erste Halbjahr der achten Klasse zu Ende ging, nahm mein Plan Gestalt an. Ich würde die Verwicklungen der Algebra für immer hinter mir lassen und mich zusammen mit meinen alten Highschool-Freunden für die neunte Klasse der Hyde Park High School eintragen, die fünftausend Schüler hatte. Nachdem mein Vater mir in einem hochnotpeinlichen Gespräch nur allzu deutlich klargemacht hatte, dass ich nichts Derartiges tun würde, erkannte ich, dass ich meinen Plan im Untergrund weiter verfolgen musste. Eines schönen Tages Anfang Februar – die Sonne stand tief am Himmel – schwänzte ich die Schule mit dem großartigen Gefühl, mich aus dem harten Griff der Verantwortung befreit zu haben. Ich setzte mich in den Bus und fand das riesige anonyme Büro der chaotischen Stadtschule an der 63. Straße, die sogar von der Polizei überwacht wurde. Ich trug mich für die neunte Klasse ein, für die ich nach meiner eigenen Einschätzung mehr als ausreichend qualifiziert war, und auf die Frage der Schulbeamten erklärte ich, ich hätte die Schule der University of Chicago bis zur achten Klasse besucht, aber dann das Herbsthalbjahr verpasst, und jetzt sei ich gerade mit meinen Eltern von außerhalb der Stadt hierher gezogen.
Etwa zwölf Wochen lang besuchte ich einfach alle Unterrichtsstunden, die für mich vorgesehen waren. Am meisten Spaß hatte ich bei Mrs. Kniazza, einer ausgezeichneten Spanischlehrerin. Meine Leistungen waren die einer Musterschülerin. Meine Eltern hatten natürlich keinen Grund zu der Annahme, ich sei nicht jeden Tag an der Laborschule der University of Chicago, und ich hatte keine Veranlassung, sie aufzuklären. Irgendwann gegen Ende des Frühjahrs erhielt ich eine Mitteilung. Die Hyde Park High School hatte eine Kopie meiner bisherigen Zeugnisse angefordert und erfahren, dass ich die achte Klasse an der University of Chicago gar nicht abgeschlossen hatte. Demnach hätte ich keinerlei Berechtigung, die Hyde Park High School zu besuchen. Man bestellte mich zum Verhör in das Büro des Schuldirektors. Nein, ich hatte die Klasse an der University of Chicago nicht abgeschlossen, aber warum, so meinte ich, hätte ich mir die Mühe machen sollen? Seit der Vorschule an der O’Keefe-Grundschule hatte ich immer im Februar angefangen, und jetzt war ich zu meinen Freunden von der O’Keefe-Schule zurückgekehrt, die mittlerweile die Hyde Park High School besuchten. Da ich wieder bei meinen alten Klassenkameraden war, hatte ich einfach den alten Zustand wiederhergestellt. Die Entrüstung wuchs, als die Verwaltung der Highschool erfuhr, dass meine Eltern keine Ahnung hatten und glaubten, ich sei auf der Laborschule; bei meiner Abmeldung dort hatte ich nicht eingestanden, dass meine Eltern nichts davon wussten. Und dass die Rechnung für das Schulgeld nicht mehr kam, hatten meine Eltern natürlich nicht bemerkt.
Nun folgten viele tränenreiche Gespräche innerhalb und außerhalb der Schule. Ob meinem Vater oder mir die Lösung einfiel, weiß ich nicht mehr. Letztlich kamen wir darauf, als wir uns fragten, wie junge Leute aus Schulen im Ausland, deren Stufensystem nicht mit unserem übereinstimmt, an den höheren Schulen der USA richtig untergebracht werden. Wir beantragten, dass ich in Mathematik, Englisch, Geschichte und Geisteswissenschaften die Aufnahmeprüfungen für ausländische Schüler machen sollte. Dabei bestand ich den Test für die neunte Klasse ohne Weiteres. Ich hatte die Schlacht gewonnen. Man gestattete mir, die neunte Klasse an der Hyde Park High School abzuschließen, wo ich mich einer viel größeren Auswahl an Verehrern erfreute.
Aber den Krieg hatte ich verloren. Als ich nach zwei Jahren an der staatlichen Schule vorzeitig zum College ging und so wieder an die University of Chicago zurückkehrte, erklärten mir meine akademischen Berater, meine mathematischen Leistungen seien gesunken, mein Wortschatz habe sich vermindert, und ich sei am Ende der zehnten Klasse ganz allgemein eine schlechtere Studentin, als ich es nach der Hälfte der achten gewesen war. Als ich im Frühjahr 1954 endgültig das städtische Rassenelend der Hyde Park High School verließ und »The College« besuchte (so nannte man die University of Chicago, obwohl sie schon sehr junge Studenten annahm), hatte ich vor, nach einem Rückfall von zwei Jahren wieder eine gute Studentin zu werden. Als ich wieder da war, wo ich nach Ansicht meiner ängstlichen Eltern hingehörte, war ich entschlossen, den allerbesten aller gutaussehenden, klugen, begehrenswerten jungen Männer kennenzulernen. Es folgten die Sagan-Jahre.





























