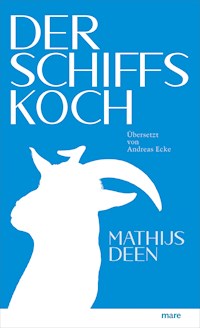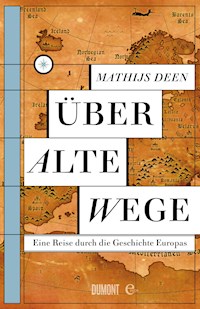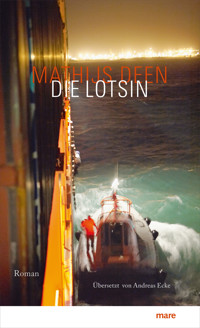
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kaum hat vor Helgoland eine Übung des niederländischen, deutschen und dänischen Grenzschutzes begonnen, geht bei der Küstenwache ein Notruf ein. Eine Klimaforscherin, die mit einem US-Forschungsschiff auf dem Weg von Grönland nach Kiel war, wird vermisst. Nach vergeblicher Suche der Küstenwache und der Helgoländer Seenotretter führt Xander Rimbach, Ermittler der Bundespolizei See, Verhöre an Bord der RV Anthropocene. Alles deutet darauf hin, dass die Wissenschaftlerin, die seit Jahren an Depressionen litt, willentlich über Bord gegangen ist. Doch als Kommissar Liewe Cupido eine Nachricht der Lotsin erhält, die die Anthropocene auf die Elbe gesteuert hat, kommen Zweifel auf. Und als der Fund eines niederländischen Nordseekutters offenbart, dass die vermisste Frau ein grausames Ende gefunden hat, ist die Dringlichkeit der Ermittlungen nicht mehr zu bestreiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mathijs Deen
DIE LOTSIN
Roman
Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke
Für Kim
Die Einsamkeit ist wie ein Regen. Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen …
Rilke
Man findet nicht nur das, was da ist, sondern auch, was fehlt.
Liewe Cupido
13. NOVEMBER 2012 DIENSTAG
DEN BURG, TEXEL
Als Notarin Marjon Hoogeberg ihr Büro verließ, sah sie durch die Glasscheibe des Wartezimmers eine Frau, die ihr nicht bekannt vorkam. Eine zierliche Frau in einem grünen Wachsmantel und mit halblangem, grau meliertem Haar. Marjon schätzte sie auf Anfang siebzig.
Testament, dachte sie.
»Die Letzte für heute?«, fragte sie Clara, ihre Sekretärin.
»Ja, das ist die Letzte.«
»Müsste ich sie kennen?«
»Es ist die Witwe Cupido. Von diesem Fischer, der vor Jahrzehnten ertrunken ist. Sie möchte ein Testament.«
»Kannst du herausfinden, ob es Kinder gibt?«
»Sie hat zwei. Der Sohn ist deutscher Staatsbürger, aber die Tochter Niederländerin. Sie selbst ist übrigens auch Deutsche. Sie hat hier am Ozeanografischen Institut gearbeitet, sie war Professorin.«
»Bring sie schon mal ins Büro, ich komme sofort.«
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen«, sagte Marjon, als sie kurz darauf das Zimmer betrat. Frau Cupido saß kerzengerade an dem schweren, dunklen Tisch, der zusammen mit einem massiven Mahagoniregal dem Raum so etwas wie notarielle Würde verlieh. »Marjon Hoogeberg.« Sie streckte ihrer Besucherin die Hand entgegen.
»Anna Uelsen«, sagte die Frau, die aufstand und ihr die Hand drückte.
»Möchten Sie nicht ablegen?«
»Nein.«
»Sie haben mir einen anderen Namen genannt, als ich erwartet hatte.«
»Sie hatten Cupido erwartet.«
Marjon lächelte. »So ist es. Sie haben mir wohl Ihren Geburtsnamen genannt.«
»Uelsen«, bestätigte Anna.
»Sie möchten sich wegen eines Testaments erkundigen?«
»Ja.«
»Das ist ein bedeutender Schritt.« Sie schaute Anna mit einem Blick an, der sowohl Ermutigung als auch Mitgefühl ausdrückte. »Haben Sie einen konkreten Anlass, über ein Testament nachzudenken?«
»Ja.«
Marjon unterdrückte ein Lächeln, während sie die beiden DIN-A4-Seiten studierte, die Clara für sie ausgedruckt hatte. »Dann lassen Sie uns besprechen, wie ich Ihnen helfen kann. Ein Testament ist ein vertrauliches Dokument, und ich nehme an, Sie wissen, Frau … Wie möchten Sie angeredet werden?«
»Uelsen.«
»Möchten Sie etwas trinken? Meine Mitarbeiterin bringt Ihnen gern einen Tee.«
»Nein, danke.«
»Frau Uelsen, ich möchte, wahrscheinlich überflüssigerweise, erwähnen, dass ich gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet bin, dass also alles, was Sie mir anvertrauen, unter uns bleibt. Das mag Ihnen ein wenig formell vorkommen, ist aber wichtig.«
»Ich habe nichts gegen Formelles.«
Marjon überflog noch einmal die ausgedruckten Seiten. »Meine Mitarbeiterin hat bereits einige Informationen zusammengestellt. Ich sehe, dass Sie zwei Kinder haben, Liewe und Paula, stimmt Liewe ohne u?« Sie griff nach ihrem Kugelschreiber, um den vermeintlichen Tippfehler zu korrigieren.
»Ja.«
»Oh. Ich dachte, es wäre ein Schreibfehler.«
»Es ist kein Schreibfehler, jedenfalls nicht Ihrer.«
»Wie ich sehe, hatte Ihr verstorbener Mann, Jan Cupido, ein Testament gemacht, und Ihre Kinder waren minderjährig, als er verunglückte.« Sie schaute Anna kurz in die Augen, bevor sie fortfuhr. »Außerdem sehe ich, dass Paula, als sie achtzehn wurde, Anspruch auf ihren gesetzlichen Pflichtteil erhoben hat, Ihr Sohn dagegen bis heute nicht.«
Anna nickte.
»Sie besitzen ein Haus an De Rede … Ist das eins der Häuser am Deich beim Pumpwerk?«
»Ja.«
»Das Haus mit dem Obstgarten? Den Bäumen, die im Frühjahr so schön blühen?«
»Das sind Kirschen.«
»Ein herrlicher Anblick. Ich fahre manchmal extra mit dem Rad vorbei, wenn sie blühen.«
Anna wischte etwas von ihrem Ärmel und nickte.
»Und das Haus ist vollständig Ihr Eigentum? Keine Hypothek?«
»Es gibt noch eine Resthypothek. Das liegt an der Auszahlung des erwähnten Pflichtteils.«
Marjon zögerte. »Darf ich fragen, ob das damals harmonisch geregelt wurde? Oder gab es Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Tochter?«
»Es war nicht harmonisch.«
»Liege ich ganz falsch mit meiner Vermutung, dass Sie eben deshalb ein Testament aufsetzen lassen möchten?«
»Nein, das stimmt.«
Marjon wartete ab, aber mehr kam nicht. »Könnten Sie vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen?«, fragte sie schließlich. »Die Rechtslage ist im Prinzip klar. Ihre Kinder erben. Wenn Sie nichts unternehmen, wird alles nach den Bestimmungen des Erbrechts abgewickelt.«
»Liewe hat die deutsche Staatsbürgerschaft, ich ebenfalls. Mein Mann war Niederländer, Paula ist auch Niederländerin.«
»All das spielt keine Rolle.«
»Ah«, sagte Anna. Sie wartete. Als das Schweigen unbehaglich wurde, fragte sie: »Ist dies jetzt der richtige Moment, zu erklären, warum ich ein Testament möchte?«
Marjon konnte ein Lachen nicht unterdrücken. »Es ist in der Tat der richtige Moment, Frau Uelsen.«
»Meine Kinder haben sich überworfen. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass meine Tochter ihren Pflichtteil eingefordert hat, die Gründe liegen weiter zurück, aber die Streitigkeiten wegen des Pflichtteils waren auch Ausdruck der Entfremdung zwischen ihnen. Ich bin jetzt dreiundsiebzig geworden und möchte mir den Gedanken ersparen, dass es nach meinem Tod wieder zu Streit kommt.«
»Was genau befürchten Sie?«
»Sie wissen, dass mein Mann auf See verunglückt ist. Liewe war sechzehn, Paula zwölf. Nach dem Unglück ist Liewe ein bisschen auf Abwege geraten, hat sich dann aber wieder gefangen. Dass er nach seinem Schulabschluss die Insel verlassen konnte, hat ihm gutgetan. Er ist nach Deutschland gegangen und da Kriminalbeamter geworden. Paula war jünger, für sie war ihr Vater alles. Sie ist schließlich auch weggegangen, aber bis dahin musste sie sich noch einige Zeit gedulden. Natürlich haben beide auf ihre Weise unter dem Verlust ihres Vaters gelitten, aber Paula war besonders schwer getroffen. Der Unfall geschah auf hoher See, die Augenzeugen haben nie erklären können oder wollen, was genau passiert ist. Und ich konnte meinen Kindern all die Ungewissheit nicht nehmen und den Verlust des Vaters nicht ausgleichen. Ich konnte auch nicht verhindern, dass sie sich dauernd in die Haare gerieten. Ich dachte, meine Tochter lehnt sich stellvertretend gegen ihren Bruder auf, weil ihr Vater nicht mehr da ist. Aber vermutlich steckte mehr dahinter. Liewe ist ziemlich introvertiert.«
»Introvertiert«, wiederholte Marjon unwillkürlich.
»Sie denken: wie seine Mutter.«
»Ja, das dachte ich«, antwortete Marjon. »Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel.«
»Warum sollte ich, Sie haben ja recht.«
»Ihre Kinder streiten sich immer noch?«
»Sie haben keinen Kontakt miteinander.«
»Und Sie befürchten, dass es nach Ihrem Ableben nicht zu einer Verständigung kommt.«
»Richtig, das befürchte ich.«
»Was die Aufteilung des Erbes angeht?«
»Unter anderem.«
Marjon nahm ihre Brille ab. »Das ist bedauerlich.«
»Ja.«
»Kommen Sie selbst gut mit Ihren Kindern aus?«
»Mit Liewe spreche ich regelmäßig. Mit meiner Tochter viel seltener. Ich habe einige Zeit gebraucht, um all den Ärger von damals zu verdauen, als sie achtzehn wurde und nur noch Forderungen stellte.«
»Und wie gehen Sie damit um, dass die beiden sich nicht sehen wollen?«
»Das Wochenende ist für meinen Sohn. Wenn meine Tochter kommen möchte, dann geht das nur unter der Woche.«
Einen Moment herrschte Schweigen. Marjon beobachtete Anna, die den Blick gesenkt hatte, die Hände auf dem Tisch faltete und sich schließlich zu der Frage durchrang: »Was raten Sie mir?«
»Wenn Sie vermeiden möchten, dass sich Ihre Kinder nach Ihrem Ableben gemeinsam um Ihren Nachlass kümmern müssen, können Sie einen Nachlassverwalter bestimmen, der sich der Sache annimmt. Das kann so weit gehen, dass diese Person alles regelt, sogar den Verkauf des Hauses und die Aufteilung des Erlöses. In diesem Fall hätten Ihre Kinder darauf gar keinen Einfluss.«
»Und wer könnte das übernehmen?«, fragte Anna.
»Das liegt in Ihrem Ermessen.«
Anna rieb mit der rechten Hand über den Rücken der linken.
»Es besteht auch die Möglichkeit«, ergänzte Marjon, »einen Notar damit zu betrauen.«
Anna blickte auf. »Es gibt nur einen auf der Insel.«
»Das stimmt«, sagte Marjon. »Wenn Sie es wünschen, kann ich die Nachlassverwaltung übernehmen. Der Vorteil wäre, dass ich über alle Informationen verfüge.«
Anna dachte nach. Marjon wartete ab und sagte dann: »Möchten Sie nicht doch etwas trinken? Geben Sie mir doch Ihren Mantel. Ich habe heute keine weiteren Termine. Wir haben Zeit.«
»Na gut«, sagte Anna. »Vielen Dank.«
6. AUGUST 2017 SONNTAG
EAST GREENLAND ICE-CORE PROJECT FIELD STATION
Die Forschungsstation, die im Nordosten Grönlands auf der Eisfläche steht, erinnert aus der Ferne an eine riesige Handgranate. Es ist eine pechschwarze, sich nach unten verjüngende Kuppel, vierzehn Meter hoch, und der mehreckige Aufbau ganz oben, die Auslösemechanik der Granate ohne Sicherungsstift und -hebel, erweist sich bei näherem Hinsehen als Aussichtsplattform, zu der die Forscher hinaufsteigen können, um durch mannshohe Fenster in alle Himmelsrichtungen zu spähen.
Fast nie steigt jemand dort hinauf, vor allem, weil nichts zu sehen ist als Schnee bis zum Horizont, ohne Orientierungspunkte, ohne Farbabstufungen. Rings um das Bauwerk stehen eine Eisbohranlage, ein paar Schneemobile, Schlafbaracken, Fahnenstangen und WC-Container.
Die kilometerdicke Eisschicht, auf der die Station steht, ist auf dem Weg in Richtung Meer. Folglich driftet die gesamte Niederlassung, auch wenn das wegen der Langsamkeit des Geschehens nicht zu hören oder zu spüren ist. Nicht einmal für die Schlaflosen, die nachts, den Schlafsack bis zum Kinn geschlossen, in die leblose Stille horchen. Sie liegen wach, kämpfen mit dem Tageslicht, das nicht weichen will, oder mit Zwangsvorstellungen, die sie heimsuchen wie Gespenster. Wer schlafen kann, träumt von warmen Abenden und Sternenhimmeln.
Währenddessen kriecht die Station mit allen Fahnenstangen, Baracken und Schneemobilen, mit allen Forschern, Ingenieuren, Technikern und dem Versorgungspersonal in jeder Stunde ein paar Millimeter nach Nordosten. Auch die Bohranlage, mit der die Bohrtechniker im Schichtdienst Meter für Meter in die Tiefe vordringen und Eisbohrkerne für die Forscher heraufholen, reist mit.
Mit immer tieferen Bohrungen in immer älteren Eisschichten unternehmen die Bohrtechniker eine Zeitreise rückwärts. Die heraufgeholten Bohrkerne sind in den Laborräumen in der richtigen Reihenfolge ausgelegt. Es ist ein tiefgefrorener Zeitstrahl, dick wie ein Oberarm, und erzählt denen, die seine Sprache verstehen, eine Geschichte von zig Jahrtausenden Wintern. Die Forscher und Forscherinnen sind aus allen Weltgegenden gekommen, um ein paar Monate lang die Proben zu datieren. Sie zählen die Eisschichten wie die Jahresringe eines Baumes. Oder sie analysieren die Gasbläschen und Staubschichten, die wie Sedimente im Eis gefangen sind, Körnchen, die, wenn man Glück hat, bei einem bekannten, datierten Vulkanausbruch oder Meteoriteneinschlag in ferner Vergangenheit in die Atmosphäre geschleudert wurden und auf den Eisschild niedergegangen sind. In den Laboren, die als geräumige Keller ins Eis gegraben wurden, herrscht klirrende Kälte, und die Forscher haben sich in viele Schichten Kleidung eingepackt: Thermowäsche, dicke Socken, Pullover, Daunenjacken, in denen man aussieht wie ein Michelin-Männchen. Sie sind kaum voneinander zu unterscheiden.
Außer sonntags. Dann sind die Laborkeller verlassen, und das Leben spielt sich im Bauch der Kuppel ab. Dort ist der Gemeinschaftsraum, von dem endlosen Tag durch eine fensterlose schwarze Haut getrennt, die das kalte Sonnenlicht in Wärme umwandelt. Die Michelin-Jacken werden gegen das eleganteste oder extravaganteste Outfit eingetauscht, das die Männer und Frauen zur Station mitgebracht haben. Die beiden Köche bekommen frei, und eine zum Küchendienst eingeteilte Gruppe von Forscherinnen und Forschern bereitet ein festliches Mittagessen zu.
Es ist halb zwölf am 6. August, und Ole Dansgaard, der wissenschaftliche Leiter der Station, steigt auf einen Stuhl und bittet um Aufmerksamkeit. Mit beiden Händen hält er eine Flasche Sekt vor seinen Bauch, der sich ein wenig über den eng geschnallten Gürtel wölbt. Ein Pflaster auf einer Wange verdeckt eine Schnittwunde vom Rasieren.
»Gestern am späten Abend haben die Bohrtechniker einen anderthalb Meter langen Bohrkern heraufgeholt, und ich kann euch jetzt sagen: Wir haben die Kilometergrenze überschritten.«
Es wird gejohlt.
»Um genau zu sein, mit dem neuesten Bohrkern sind wir bis zu einer Tiefe von 1007 Metern ins Eis vorgedrungen. Wir sind auf halbem Wege. Applaus für die Bohrtechniker!«
Die Bohrtechniker, die im kleinen Kreis beieinanderstehen, nicken den Applaudierenden zu.
»Sie haben es nicht immer leicht gehabt, wir hatten schlechtes Wetter, immer wieder einmal ging etwas kaputt, aber sie haben für alle Probleme eine Lösung gefunden. Sie lassen sich durch nichts entmutigen, durch nichts abschrecken, sie bohren immer weiterrrr.«
Neuer Applaus. Der wissenschaftliche Leiter hebt die rechte Hand, damit man ihm wieder zuhört. »Und … und … und … Sie sind eigensinnig, diese Bohrtechniker, niemand braucht ihnen zu sagen, was sie zu tun haben, man versucht es auch besser nicht, wie ich lernen musste …« Er betastet das Pflaster.
Gelächter.
»… aber das ist nicht das Einzige, was ich sagen wollte, wir haben noch mehr zu feiern, noch eine Grenze wurde überschritten. Wo ist Iona?«
Er blickt suchend in die Runde. »Die Analyse der vulkanischen Partikel im vorletzten Kern ermöglicht uns eine genaue Datierung der Schicht, bei der wir angekommen sind … Iona Grimstedt … Wo steckst du? Iona? Ist Iona nicht hier?«
Iona, bisher verborgen hinter zwei bärigen Glaziologen aus Kanada, tritt einen Schritt vor und knickst mit ausgebreiteten Armen.
»Ach, da bist du ja … Iona konnte die Tephra im Eis des vorletzten Kerns einem Ausbruch des Torfajökull zuordnen, und das bedeutet, dass wir vorgedrungen sind bis zur Zeit vor … wann genau war dieser Ausbruch noch, Iona?«
»55,4«, antwortet Iona.
»… fast fünfundfünfzigeinhalbtausend Jahren. Wir haben also auch die Fünfzigtausend-Jahre-Grenze längst überschritten, und der Bohrkern der vergangenen Nacht hat uns noch ein Stück weitergebracht.«
Auch diese Nachricht, eigentlich allen schon bekannt, wird mit wohlwollendem Johlen begrüßt. Dansgaard hebt die Sektflasche, er ruft die Bohrtechniker und Iona nach vorn, alle nehmen sich ein Glas, der Korken fliegt durch den Raum, und kurz danach posiert Iona in einem Halbkreis mit den Bohrtechnikern für den Fotografen, der im Auftrag von National Geographic für eine Fotoreportage über das Leben und Leiden auf der Station eingeflogen wurde. Weil die Bohrtechniker mit ihren Jeans, T-Shirts und Holzfällerhemden gegen den sonntäglichen Dresscode verstoßen, sticht Iona in ihrem schwarzen Galakleid mit dem perlweißen Schal auf den nackten Schultern besonders heraus.
Dann sind plötzlich weitere Sektflaschen da, Korken knallen. Ein Schweizer Klimatologe hilft dem wissenschaftlichen Leiter vom Stuhl herunter.
Eine knappe halbe Stunde später – die meisten sitzen am Tisch und essen – steht Iona nach einem Blick auf die Uhr über der Küchentür auf und geht zum Hausmeister der Station.
»Ich kann doch um zwölf telefonieren, oder? Meine Tochter hat Geburtstag, und ich habe versprochen, um vier Uhr anzurufen. Vier Uhr bei ihr, meine ich.«
»Natürlich«, antwortet der Hausmeister. »Das Telefon liegt im Büro bereit.«
Doch als Iona das Büro betreten will, hört sie, dass schon jemand anders das einzige Telefon der Station benutzt. Auf dieser Eisfläche hat man keinen Mobilfunkempfang. Wer dringend telefonieren muss, kann das nur mit dem Satellitentelefon. Und mit dem telefoniert gerade der Fotograf. Iona zögert, schaut auf die Uhr, öffnet dann doch die Tür.
Der Fotograf dreht sich von ihr weg, dämpft die Stimme. Dann bittet er Iona, draußen zu warten.
Sie schließt die Tür, schaut noch einmal auf die Uhr, öffnet die Tür wieder. »Two minutes«, sagt sie leise zum Fotografen und zieht die Tür erneut zu, aber nicht ganz. Sie horcht, blickt dabei zunächst auf die Uhr, doch dann schweifen ihre Gedanken ab. Sie zieht die Schultern ein wenig hoch, sieht auf den Boden und wartet. Als sich nach fünf Minuten die Tür öffnet und der Fotograf ihr das Telefon hinhält, lächelt sie, nimmt den Apparat, betritt das Büro und schließt die Tür hinter sich.
Um halb eins sind alle mit Essen fertig. Der Hausmeister kehrt von einem Gang nach draußen zurück und bittet laut um Aufmerksamkeit. »Hören Sie bitte einen Moment zu. Alle! Wir erwarten einen Whiteout. Niemand darf allein ins Freie.«
Alle Anwesenden kennen die Regeln, man hat sie ihnen bei der Ankunft auf der Station eingeschärft. Bei einem Whiteout, wenn das Sonnenlicht zum Beispiel durch Nebel gedämpft ist, verschwindet von einem Moment zum anderen der Horizont, der weiße Boden und der Himmel sind nicht mehr zu unterscheiden, man verliert völlig die Orientierung. Am besten geht man gar nicht nach draußen und wartet das Ende des Whiteouts ab; notfalls geht man mindestens zu zweit auf den markierten Wegen von der Kuppel zur Bohranlage, den Toiletten oder den Schlafbaracken.
»Sind alle drin?« Der Hausmeister blickt sich um, geht dann zum Büro, klopft an und öffnet die Tür. »Iona?«
Aber Iona ist nicht im Büro. Das Telefon liegt auf der Ladestation. Er schließt die Tür, geht zurück, blickt sich wieder suchend um. »Hat jemand Iona gesehen?« Und dann lauter: »Hat irgendjemand Iona Grimstedt gesehen?«
Es wird still. Niemand hat Iona gesehen.
»Hat jemand mitbekommen, dass sie nach draußen gegangen ist? Hat sie jemandem gesagt, wo sie hinwollte?« Niemand hat sie weggehen sehen, sie hat niemandem etwas gesagt.
Nun geht alles schnell. Der Hausmeister erteilt ein paar knappe Anweisungen, eine kleine Gruppe Stammpersonal schlüpft in die Jacken, auch der Arzt. Die Wissenschaftler müssen in der Kuppel bleiben. Es kommt zu einem Wortwechsel zwischen dem Hausmeister und dem Fotografen, der auch seine Jacke angezogen hat. »Sie bleiben hier«, sagt der Hausmeister.
Nach ein paar Minuten, in denen klar wird, dass Iona weder in ihrer Baracke noch in den Toilettencontainern noch in einem der Laborkeller zu finden ist, werden Schneemobile gestartet. Der Fotograf kann gerade noch festhalten, wie sie sich im gleichförmigen Grauweiß auflösen.
8. August, 17:19
Von: O. P. Dansgaard
An: Kapitän der RV Anthropocene
Betreff: Dringende Bitte um Aufnahme eines Passagiers
Sehr geehrter Herr Gardiner,
als wissenschaftlicher Leiter der EGRIP Field Station habe ich eine dringende Bitte an Sie als Kapitän der RV Anthropocene.
Wenn ich recht informiert bin, haben Sie einige meiner Forscherkollegen an Bord, werden in der kommenden Woche zwischen Grönland und Island Messbojen auslegen und anschließend nach Kiel zum GEOMAR zurückkehren.
Ich habe diese Informationen von dem kanadischen Fotografen Emile Rancourt, der seit vergangener Woche als Gast auf unserer Station ist und im Rahmen seiner Reportage über Klimaforschung für National Geographic am kommenden Samstag (12. August) in Akureyri an Bord Ihres Schiffes gehen wird.
Meine Bitte ist, dass er mit einer Wissenschaftlerin von unserer Station an Bord gehen darf. Diese Wissenschaftlerin, Dr. Iona Grimstedt-Tauber, ist am vergangenen Sonntag aus nicht geklärten Gründen ohne ausreichenden Schutz vor der Kälte aufs Eis hinausgegangen. Einige Hundert Meter von der Station entfernt wurde sie von unseren Leuten unterkühlt und mit Atemnot gefunden. Es geht ihr jetzt den Umständen entsprechend gut, sie ist ansprechbar und macht keinen übernervösen oder deprimierten Eindruck. Trotzdem hat unser Arzt ihr dringend geraten, nach Hause zu fahren und sich dort genauer untersuchen zu lassen. Als wir über das GEOMAR in Kiel mit ihrem Ehemann Torsten Grimstedt Kontakt aufnehmen wollten und erfuhren, dass er nicht zu Hause, sondern zurzeit als Erster Offizier auf der Anthropocene unterwegs ist, schlug unser Arzt vor, dass Iona Grimstedt-Tauber in seiner Begleitung nach Kiel reisen soll, weil er vermutlich einen beruhigenden Einfluss auf sie haben wird. Dass bis zum Eintreffen Ihres Schiffs in Kiel noch über eine Woche vergehen kann, hält der Arzt in diesem Fall eher für positiv. Wir wären Ihnen ausgesprochen dankbar, wenn Sie Herrn Grimstedt über die Situation in Kenntnis setzen würden.
In der Hoffnung, dass Sie angesichts des Ernstes der Lage bereit sind, diese naheliegende Lösung zu ermöglichen, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Dr. Ole P. Dansgaard
9. AUGUST 2017 MITTWOCH
RV ANTHROPOCENE, 67°15'18.3''N 16°47'13.6''W
Der Erste Offizier Torsten Grimstedt hat sich einen Becher Kaffee geholt und geht bedächtig, das Rollen und Stampfen vorausberechnend, zu dem Tisch, auf dem die Köchin einen Teller mit Omelett für ihn bereitgestellt hat. Es ist Viertel nach sieben, noch eine Dreiviertelstunde bis zu seiner Wache, er hat Zeit. Als er gerade Platz genommen hat, betritt Kapitän Gardiner die Messe. An Torstens Tisch bleibt er stehen.
»Ich muss mit dir sprechen, aber nicht hier.«
Grimstedt deutet auf sein Omelett.
»Es dauert nicht lange. In meiner Kammer.«
Als sie kurz darauf in der Kammer des Kapitäns stehen, Gardiner die Tür geschlossen hat, beide in das angrenzende kleine Büro gegangen sind und Gardiner eine schwere Jacke von einem Stuhl nimmt, um Platz zu schaffen, sagt er: »Setz dich, Torsten, deine Frau kommt Samstag an Bord.«
Torsten setzt sich nicht. Er starrt Gardiner an. Als hätte er das Gesagte nicht verstanden.
»Iona«, sagt Gardiner. »Deine Frau Iona. Sie kommt in Akureyri an Bord. Setz dich.«
»Iona«, sagt Torsten.
»Ja, deine Frau. Es geht ihr gut, kein Grund zur Sorge. Nicht mehr jedenfalls. Jetzt setz dich doch.«
Gardiner, der selbst noch steht, sucht etwas auf seinem Schreibtisch. »Ich habe eine Mail bekommen. Hab sie ausgedruckt.«
Die Anthropocene rollt stark, beide Männer machen einen Schritt gegen die Neigung, ein kleiner Stapel Papier rutscht vom Schreibtisch. Gardiner geht in die Knie, stützt sich mit einer Hand an dem verankerten Tischbein ab und hebt eins der Blätter auf. »Hier«, sagt er, während er vorsichtig aufsteht. »Lies selbst.«
Torsten nimmt das Blatt, liest stehend, die Beine gespreizt. Gardiner blickt an Torsten vorbei durch ein Bullauge auf die Wellen. Das Büro ist kaum groß genug für zwei stehende Männer bei Windstärke sieben.
»Aufs Eis hinausgegangen«, sagt Torsten.
»Der Arzt sagt, sie ist wieder auf dem Damm.«
»Aber auch, dass sie da wegmuss.«
Gardiner zeigt auf den Stuhl. »Willst du dich nicht doch kurz hinsetzen?«, fragt er.
Torsten schüttelt den Kopf. Er liest noch einmal. »Unterkühlt und mit Atemnot«, zitiert er.
»Die meisten gehen in Akureyri von Bord«, sagt Gardiner. »Wir haben mehr als genug Platz.«
Torsten lässt das Blatt sinken. »Keine gute Idee«, murmelt er.
Gardiner hat es gehört. »Wie meinst du das?«, fragt er. »Willst du denn nicht sehen, wie es ihr geht?«
»Kann ich nicht von Bord und mit ihr nach Hamburg fliegen?«
»Das wird nicht gehen, Torsten«, antwortet Gardiner. »Ich habe keinen Ersatz für dich. Wir müssen noch zu den Bojen bei Grönland und dann bis nach Kiel.«
»Wie ist das bloß möglich«, sagt Torsten.
»Wie ist was möglich?«
Torsten ignoriert die Frage, schaut auf die Armbanduhr. »Mein Omelett«, sagt er. »Und gleich muss ich auf die Brücke.«
»Willst du die Mail haben?«
»Nein.« Torsten gibt ihm das Blatt zurück, schüttelt den Kopf und verlässt die Kammer.
11. AUGUST 2017 FREITAG
OSTENDE
Kaum ist Dolores Benavides am Visserskaai an Bord der kleinen Fähre gegangen, da beginnt ihr Telefon zu vibrieren. Es hört gar nicht mehr auf. Sie holt das Telefon aus der Tasche und sieht, dass sie eine ganze Serie von Mails bekommt. Einen Moment befürchtet sie, dass ihr Account gehackt wurde, doch dann sieht sie, dass sämtliche Mails von Iona stammen. Sie scrollt durch die Liste, schaut nach den Betreffs: Eis, Pferdekopfpumpe, Still, Warten, Cécile, Wütend, Arpoi, IPCC, Was machen wir hier, Rauschen.
Es ist seltsam, plötzlich wieder Mails von Iona zu bekommen, und gleich so viele auf einmal. Sie kennt Iona aus der Zeit, als sie beide in Edmonton im Eislabor für ihre Dissertationen geforscht haben. Aber das liegt viele Jahre zurück. Sie haben beide über die Datierung und Analyse von Eisbohrkernen promoviert, Iona in New York, sie in Gent, doch dann ging Iona nach Deutschland, und sie selbst bekam die Stelle in Ostende am Flämischen Ozeanografischen Institut. Der Kontakt, schon seit Längerem von Empfindlichkeiten geprägt und manchmal schwierig, schlief ein. Mails oder WhatsApp-Nachrichten kamen nur noch an Geburtstagen und natürlich, als Ionas Tochter Cécile geboren wurde. Aber auch das liegt schon wieder fünf Jahre zurück. Das Letzte, was sie über Iona gehört hat – nicht mehr von ihr selbst –, war, dass sie nach Grönland gehen würde, um wieder Eisbohrkerne zu datieren, wie früher. Die ruhige, reservierte, introvertierte Iona. Und nun plötzlich vierundzwanzig Mails.
Dolores öffnet die erste. Sie ist schon Wochen alt.
Von: Iona
An: Dolores
Betreff: Eis
15. Juli 2017, 01:10
Hallo, Dolores,
es hat gar keinen Sinn, dir zu schreiben, denn hier auf dem Eisschild hat man keinen Empfang, sodass ich alles, was ich schreibe, erst abschicken kann, wenn ich wieder in Kangerlussuaq gelandet bin, und das wird erst am 25. August sein, in über einem Monat, das heißt, wenn das Flugzeug dann starten kann, was längst nicht jeden Tag möglich ist. Das Wetter kann hier jederzeit umschlagen, und dann sitzt man fest und kann nur warten. Es ist eine amerikanische Militärmaschine, eins von diesen grauen Ungetümen, die man aus Filmen kennt, wir sitzen an beiden Seiten des Laderaums quer zur Flugrichtung, als ob wir Marines wären, die in einem Kriegsgebiet abgesetzt werden. Es landet einfach auf dem Eis, auf einer mit Fähnchen markierten Bahn. Das ist verdammt holprig.
Hier ist es die ganze Nacht hell, wir schlafen zu viert in einer kleinen Baracke, ich liege lange wach, dann rauscht es in meinen Ohren, und ich möchte ein bisschen erzählen, auch um festzuhalten, was ich so alles denke und erlebe, obwohl ich es gar nicht abschicken kann. Ich weiß, dass ich gegen eine weiße Wand rede, aber ich tue es trotzdem, weil es mich beruhigt. Ich dachte: Wem könnte ich das alles erzählen, wenn nicht Dolores. Und vielleicht ist dies ja schon die einzige Mail, die ich dir schreibe, vielleicht lerne ich morgen, hier zu schlafen, und auch, die Stille nicht mehr zu hören. Vielleicht schreibe ich dir aber sogar jeden Tag etwas, oder alle paar Tage, und dann tippe ich auf Senden, und das Telefon denkt: Ich merke mir das schon, und die Nachrichten sammeln sich an, und irgendwann, wenn ich wieder Empfang habe, kriegst du einen ganzen Schwung davon.
Seit ich hier bin, denke ich wieder ziemlich oft, ich weiß nicht, warum, an unsere Zeit vor zehn Jahren in dem Eislabor. Dass ich jetzt auf diesem Eis liege, stehe, gehe, esse, schlafe oder eben nicht, das beschäftigt mich, aber mir ist nicht klar, was genau mich so beschäftigt. Ich denke darüber nach, dass wir hier auf so viel Vergangenheit stehen, kleine, geschäftige Menschlein auf all dem langsamen Eis. Ich habe nicht den Eindruck, dass es den anderen (ich schlafe in der Baracke zusammen mit zwei chilenischen Doktorandinnen und einer neuseeländischen Postdoktorandin) auch so geht, und ich halte lieber den Mund.
Jetzt muss ich wirklich versuchen zu schlafen.
Bis dann, Dolores. Sei bitte nicht wieder böse, weil du so lange nichts von mir gehört hast.
Iona
Dolores steckt das Telefon ein und blickt sich um. Erst jetzt merkt sie, dass eine Empfangsmitarbeiterin des Instituts neben ihr steht. Am Empfang arbeiten drei Frauen, und sie verwechselt immer die Namen. Um zu verbergen, dass sie nicht weiß, ob diese Frau Angelique, Pauline oder Maria heißt, sagt sie nur: »Ach, guten Morgen.«
»Schlechte Nachrichten?«
»Nein, wieso?« Die Frau hat einen holländischen Akzent. Also nicht Maria, denkt Dolores.
»Du hast so wütend geguckt.«
»Ach nein, ich hab nur hundert Mails von einer Kollegin bekommen, alle mit … wie soll ich sagen … Anekdötchen.«
»Einer Kollegin von hier?«
»Nein, von früher. Wir haben in Kanada zusammengearbeitet. Sie ist jetzt auf Grönland. Jede Menge Anekdötchen mit Schnee.«
Die Empfangsmitarbeiterin nickt. »Einfach löschen«, sagt sie. »Oder blockieren. Mache ich bei Stalkern sofort.«
Die Fähre hat den Binnenhafen durchquert und legt am Westufer an. Dolores nickt der anderen Frau kurz zu, lässt sie stehen und geht vor ihr an Land. Bis zum Institut sind es nur fünf Minuten. Sie hat heute viel zu tun, und es ist ein herrlicher Tag.
12. AUGUST 2017 SAMSTAG
AKUREYRI
Torsten steht an Deck und blickt auf den Kai hinunter, als das Taxi vor der Anthropocene anhält. Niemand steigt aus, Torsten macht auch keinen Schritt auf die Gangway zu. Dann scheint das Bezahlen erledigt zu sein, die beiden vorderen Türen werden gleichzeitig geöffnet. Der Fahrer geht zum Kofferraum. Fotograf Emile Rancourt reckt sich, blickt am Schiff hinauf, beugt sich zum Beifahrersitz, holt eine dicke rote Jacke und eine Fototasche aus dem Wagen, zieht die Jacke an, hängt sich die Tasche an die Schulter und geht ebenfalls zur Rückseite des Autos.
Am Fenster der Rückbank sieht Torsten undeutlich ein Gesicht. Weil sich das Licht der tief stehenden Sonne im Glas spiegelt, kann er es nicht erkennen, aber er weiß, dass es Iona ist, er weiß, dass sie zu ihm hinaufschaut, er weiß, dass sie sieht, dass er sie sieht, er weiß, dass sie weiß, dass er wartet.
Endlich öffnet sich auch ihre Tür, und sie steigt aus. Sie hebt kurz die Hand und schiebt aus der Bewegung heraus eine losgewehte Locke hinters Ohr.
Torsten geht die Gangway hinunter, legt Iona kurz die Hand auf den Rücken, nimmt vom Taxifahrer ihr Gepäck entgegen und betritt vor ihr und dem Fotografen die Gangway. An Deck steht jetzt Kapitän Gardiner. Er nickt Iona zu, lächelt.
»Willkommen an Bord«, sagt er. »Betrachten Sie die Anthropocene als Ihr Zuhause. Torsten bringt Sie in eure Kajüte. Wir sehen uns später.« Dann begrüßt er den Fotografen und führt ihn zur Messe.
Iona und Torsten bleiben an Deck zurück. Ein Windstoß weht Iona die Locke wieder vors Gesicht. »Es tut mir leid«, sagt sie.
»Alles in Ordnung?«, fragt Torsten.
Iona nickt zögernd. »Ja«, sagt sie. »Der Arzt hat mich weggeschickt, aber eigentlich hätte ich gut dableiben können.«
Torsten schaut sie an, sie erwidert zunächst den Blick, wendet sich dann ab. »Ich glaube, ich schäme mich.«
»Dazu hast du keinen Grund«, sagt Torsten. »Gleich kommt ein Schauer, gehen wir rein.«
Kurz danach hat sich Iona in der Kammer ihres Mannes auf die untere Koje gesetzt, die Schultern hochgezogen, die Hände zwischen den Knien gefaltet.
»Was ist passiert?«, fragt Torsten.
Iona schüttelt den Kopf. »Ich habe Musik gehört«, sagt sie. Torsten setzt sich an den Schreibtisch, streicht mit der Hand über die Platte. Er wartet, doch es kommt nichts mehr. »Wir haben Zeit«, sagt er. »Heute Abend, gleich, laufen wir aus, wir müssen zwischen Island und Grönland noch Messbojen auslegen, dann erst geht es nach Hause.«
»Sind viele Wissenschaftler an Bord?«, fragt Iona.
»Drei, eine von Texel, eine aus Kiel, einer von Helgoland.«
»Kenne ich jemanden davon?«
»Ich weiß nicht, wen du alles kennst, Iona.«
»Wird es heute Nacht dunkel?«
»Ein paar Stunden vielleicht, nicht lange«, sagt er. »Wieso?«
Iona antwortet nicht. Beide schweigen einen Moment. Dann beginnt das Schiff zu vibrieren. Die Motoren sind angelassen worden. Iona schließt die Augen. »Schön«, sagt sie. »Geräusche.« Sie öffnet die Augen wieder. »Dort ist es still.«
An Deck sind Leute unterwegs. Jemand ruft etwas. Das Bugstrahlruder lärmt.
»Hast du Cécile angerufen?«, fragt Iona.
»Ich habe ihr eine Mail geschickt«, sagt Torsten. »Anrufen ging nicht. Wir waren auf See. Und du?«
»Ja … ja …«, sagt Iona. »Ich war etwas zu spät dran. Cécile war schon wieder zum Spielen rausgegangen. Ich hatte Mutter am Apparat.«
»Und?«
»Wie immer, das Übliche.«
»Tja, Kinder spielen eben«, sagt Torsten. Er steht auf.
Auch Iona erhebt sich. »Halt mich einen Moment fest«, sagt sie.
Torsten schließt sie in die Arme. Eine Weile stehen sie still aneinandergeschmiegt. Dann verschränkt Iona die Arme zwischen sich und Torsten, doch er lässt sie nicht los. »Da auf dem Eis hängt man so eng aufeinander«, sagt sie. »Es ist so seltsam still, schlafen geht nicht, aber am Tag ist alles gut, na ja, was heißt am Tag … es ist immer Tag.« Sie blickt zur Seite, schließt die Augen, öffnet sie wieder. »Man freut sich aufs Anrufen, und wenn man dann anruft … dann ist alles plötzlich so weit weg …«
Sie schiebt Torsten von sich und setzt sich wieder auf die Koje. Torsten späht durchs Bullauge. Die Anthropocene löst sich vom Kai. »Wir haben abgelegt«, sagt er.
Iona schaut ihn an. »Kannst du nachfragen, ob ich eine Kajüte für mich allein haben kann?«
Torsten nickt. »Mach ich«, sagt er.
OSTENDE
Dolores sitzt mit einem Becher Tee am Fenster. Es ist noch früh, unten auf der Promenade kommen ein paar Jogger vorbei, am Strand ist jemand mit seinem Hund unterwegs, über dem Meer ist es diesig.
Von: Iona
An: Dolores
Betreff: Pferdekopfpumpe
19. Juli 2017, 00:45
Hallo, Dolores,
es ist nach Mitternacht, die anderen drei schlafen. Zum Glück schnarcht eine der Chileninnen leise. Ein Geräusch, Leben.
Torsten ist noch zu Hause, aber morgen fliegt er nach Tromsø und geht an Bord der Anthropocene. Meine Mutter ist jetzt in Kiel, ich weiß, dass sie sich da nicht wohlfühlt. Aber wo fühlt sie sich schon wohl? Sie bleibt bei Cécile, bis ich zurückkomme. Sie schlafen jetzt. Torsten auch. Wenn ich wirklich schlafen will, denke ich an die vielen Pferdekopfpumpen bei Edmonton, weißt du noch? Dann versuche ich, wie diese Pumpen zu atmen, aber wie eine, die es nicht mehr lange macht, ein … aus … ein … aus … immer langsamer, bis es nichts mehr zu pumpen gibt.
Ich würde gern wieder einmal einen Vogel hören. Ansonsten vermisse ich nicht viel. Cécile vielleicht, hin und wieder, aber wenn ich arbeite, gibt es für mich nur Eis, und Staub.
Die Chilenin hat sich umgedreht und schnarcht nicht mehr. Jetzt ist es nur noch still, und wenn ich etwas höre, kommt es aus meinem Kopf. Ich versuche manchmal, die Kälte zu spüren, unter mir, unter uns allen. Oder ich versuche zu hören, dass wir driften. Früher bin ich jeden Tag vom Haus zum Schulbus gegangen, anderthalb Meilen von uns bis zur Straße. Das ist ungefähr so weit, wie das Eis hier dick ist. Natürlich kann man nicht hören, dass sich das Eis bewegt, trotzdem horche ich. Wir bohren bis zur untersten Schicht, die ist an dieser Stelle in mehr als zwei Kilometern Tiefe. Früher habe ich für diese Strecke manchmal eine Stunde gebraucht, und
Dolores wischt die Mail weg, markiert die ganze Serie Mails von Grönland und löscht sie. »Sorry, Iona«, sagt sie.
2. SEPTEMBER 2017 SAMSTAG
CUXHAVEN
Die Bundespolizei See hat die Kiellegung des neuen Patrouillenschiffs Potsdam Mitte August zum Anlass genommen, niederländische und dänische Kollegen zu einem festlichen Empfang in Cuxhaven einzuladen; anschließend findet eine gemeinsame Übung statt, geleitet vom Patrouillenschiff Bad Bramstedt aus, das vor Helgoland ankern wird.
Henk van de Wal, ehemaliger Brigadekommandeur der Marechaussee, hat diese Gelegenheit, wieder einmal auf See zu sein, beim Schopfe gepackt. Nach der Auflösung der Brigade in Delfzijl hat es ihn nach Havelte verschlagen, wo das Hauptquartier der Brigade Waddengebied in einer von Wäldchen umgebenen Kaserne untergebracht ist. Die tägliche Autofahrt von der Küste und der offenen Landschaft bei Termunterzijl zum Halbdunkel des Waldrands kostet ihn Überwindung.
Doch heute Morgen musste er nicht nach Havelte. Nachdem er in Delfzijl Wachtmeester Rob Bonte und zwei Zollbeamte abgeholt hatte, fuhr er gut gelaunt über die Grenze, hinter der das weite Panorama seiner Jugend noch mehrere Hundert Kilometer nach Osten reicht.
Der Nachmittag neigt sich dem Ende zu, als sie in der Kasernenstraße in Cuxhaven ankommen. Unterwegs war van de Wal für seine Verhältnisse sehr gesprächig gewesen. Er erzählte von einer Übung mit deutschen und dänischen Kollegen vor ein paar Jahren, ebenfalls in Cuxhaven, zu der er mit Opperwachtmeester Dobbenga gefahren war. Entspannt berichtete er von der guten Atmosphäre, von lustigen Missverständnissen, von korrekten Deutschen und launischen Dänen, von Lothar Henry, dem stellvertretenden Leiter in Cuxhaven, und wie Henry in geradezu lyrischem Ton die Achterbahn des Freizeitparks Duinrell lobte, wo er als Kind einmal die Sommerferien verbracht hatte; außerdem von einer Kneipe in Cuxhaven, in der sie mit den Dänen bis in die Nacht Bier getrunken hatten, und, ein bisschen wirr, von der nächtlichen Suche nach dem Hotel.
Doch jetzt, als sie auf das abweisende Gebäude der Bundespolizeiinspektion zufahren, scheint sich van de Wals Stimmung leicht einzutrüben. Er hat keine allzu guten Erinnerungen an den Leiter der Bundespolizei See, Hermann Rademacher, dem er gleich begegnen wird. Er hält vor dem Schlagbaum an, nennt an der Gegensprechanlage seinen Namen, und als eine knarrende Stimme sie willkommen heißt, fasst er wieder Mut. Im Kofferraum hat er als Geschenk für die deutschen Kollegen einen ganzen Laib mittelalten Gouda, und er hat sogar extra ein großes Käsemesser gekauft, damit er den Käse vor den Kollegen anschneiden und jedem ein frisches Stück mitgeben kann.
Der Empfang ist herzlich. Pfeiffer, ein älterer Beamter, führt sie zur Kantine, in der es schon ziemlich voll ist. Außer Beamten der Bundespolizei sieht van de Wal die vier Mann von der dänischen Delegation, die vor einer halben Stunde eingetroffen sind. Auf den über den Raum verteilten Stehtischen warten Schalen mit Wurstscheiben und Salzkeksen; eine Bildwand neben einem Rednerpult zeigt eine fotorealistische Abbildung der Potsdam, von der van de Wal, den schweren Käselaib mit beiden Armen an die Brust gepresst, den Blick erst einmal nicht abwenden kann. Bis Lothar Henry mit ausgestreckter Hand auf ihn zukommt. Weil van de Wal sich so unbeholfen wie vergeblich bemüht, eine Hand zur Begrüßung frei zu machen, führt Lothar ihn schließlich zu einem Tisch am Rand und räumt ein paar Gläser weg, damit van de Wal den Käse ablegen kann.
Das Geschenk weckt Neugier, schnell bildet sich ein Halbkreis von Männern und Frauen vor dem im Licht der Deckenlampen schimmernden Laib. Rob Bonte bringt einen in Papier eingeschlagenen, länglichen Gegenstand von der Größe eines Karabiners und reicht ihn van de Wal, der das glänzende, gebogene Käsemesser auspackt und auf den Käse legt.
»Das Beste aus Holland für unsere deutschen Freunde«, sagt er.
»Und die dänischen?«, fragt ein Mann von der dänischen Küstenwache.
»Hier sind alle Menschen Brüder«, erklärt van de Wal. »Alles, was man teilt, vermehrt sich, hat mein Opa immer gesagt, und …«
Er kann den Satz nicht vollenden, denn in diesem Moment öffnet sich der Halbkreis, und Hermann Rademacher kommt auf ihn zu. Er ist grauer geworden, seit van de Wal ihn zuletzt gesehen hat. Sein Haar ist etwas länger, und er hat sich einen kurzen Bart stehen lassen. Unter seiner Uniformjacke zeichnet sich ein Bäuchlein ab. Er wirft einen kurzen Blick auf den Käse, deutet wahrhaftig vor van de Wal ein Strammstehen an und streckt ihm die Hand entgegen. »Brigadekommandeur van de Wal«, sagt er, »willkommen zurück in Cuxhaven.«
Dann tritt er zur Seite, damit van de Wal die Gelegenheit hat, ihm Rob Bonte und die beiden Zollbeamten vorzustellen. Auch sie werden formell, aber gastfreundlich begrüßt.
»Darf ich nun, da wir vollzählig sind, für einen Moment um Aufmerksamkeit bitten?« Es ist Lothar Henry, der zum Rednerpult gegangen ist. »Im Namen der Bundespolizei See heiße ich Sie alle herzlich willkommen, und ich bitte unseren Leiter, Herrn Rademacher, nach vorn zu kommen und das Wort an Sie zu richten.« Rademacher, der Pfeiffer etwas zugeflüstert hat, geht ans Rednerpult, klopft aufs Mikrofon und beginnt zu sprechen. Auch er heißt die Kollegen aus den Niederlanden und Dänemark willkommen, erinnert an frühere gemeinsame Übungen, die erfolgreich verlaufen seien, und kommt auf bestimmte gesellschaftliche und politische Entwicklungen sowohl in einzelnen Ländern als auch international zu sprechen; Veränderungen, die letztlich alle zur Folge haben, dass die Arbeit an den Außengrenzen Europas nicht nur wichtiger, sondern auch schwieriger geworden sei. »Dass Sie, Niederländer und Dänen, flexibel und effizient mit uns zusammenarbeiten, liegt in diesen Zeiten wachsender Unruhe im Inland und zunehmenden Drucks auf die Außengrenzen in unser aller Interesse«, erklärt er. »Jedes Land stellt sich den Herausforderungen auf seine Weise, das ist nun einmal so, aber gerade deshalb ist es wichtig, dass wir uns kennen und verstehen. Denn, liebe Kollegen, die Bürger sehen uns auf die Finger, die Politik sieht uns auf die Finger. Und wir müssen dafür sorgen, dass ihnen gefällt, was sie sehen. Nicht von ungefähr hat der Bundestag 2015 Geld für die Erneuerung unserer Flotte durch drei neue Schiffe bewilligt, mit denen wir den Herausforderungen von morgen gewachsen sein werden. Vor zwei Wochen wurde auf der Fassmer-Werft in Berne das erste der drei, die Potsdam, auf Kiel gelegt.«
In diesem Moment kommt auf der Bildwand die Abbildung des Schiffs in Bewegung. Es beginnt eine Computeranimation, in der man es von allen Seiten sieht und sich virtuell über die Decks und ins Innere bewegt. Rademacher sagt dazu, was alle sehen können: Mit fast neunzig Metern Länge und einer Bruttoraumzahl von über zweitausend ist die Potsdam für ein Patrouillenschiff ziemlich groß, sie hat achtern ein Hubschrauberlandedeck, an Steuerbord und Backbord mittschiffs jeweils ein mit speziellen Davits auszubringendes schnelles Kontrollboot, zwei Heckwannen für Tochterboote, eine geräumige Brücke, auf der man sich vorkommt wie auf einer Fregatte. Dann sieht man die Mannschaftsunterkünfte, den Sanitätsbereich, der an einen Operationssaal erinnert, eine Arrestzelle für renitente Personen, eine Kombüse, eine Wäscherei, einen Fitnessraum, natürlich die Messe und einen Aufenthaltsraum für die Besatzung, darunter den endlosen Maschinenraum.
Van de Wal, der die Animation reglos mit verschränkten Armen verfolgt, reagiert nicht, als Bonte ihm auf die Schulter tippt. Erst als Bonte es ein zweites Mal tut, schrickt er auf wie aus einem Traum.
»Musst du nicht auch noch was sagen?«, fragt Bonte leise.
Van de Wal zuckt mit den Schultern.
»Vielleicht warten wir mit dem Käse einen günstigeren Moment ab«, flüstert Bonte.
Van de Wal schüttelt den Kopf und starrt auf die Bildwand, auf der die Potsdam jetzt auf hoher See zu sehen ist, mit schäumender Bugwelle, während ein Hubschrauber vom Landedeck aufsteigt.
Schon wieder tippt ihm Bonte auf die Schulter.
»Was ist denn?«, zischt van de Wal.
»Der Käse«, sagt Bonte.
Van de Wal zuckt erneut mit den Schultern, aber jetzt ruckartig, als wollte er etwas abschütteln.
»Kuck doch mal«, sagt Bonte leise. »Er ist weg.«
3. SEPTEMBER 2017 SONNTAG
DEUTSCHE BUCHT
Es herrscht kühles, aber fast windstilles Herbstwetter, als die Bad Bramstedt am nächsten Morgen um halb sieben in der Elbmündung an der Kugelbake vorbeifährt und Kurs auf Helgoland nimmt. Auf dem Patrouillenschiff ist es ziemlich voll, die Stimmung ist ausgelassen. Van de Wal und Rob Bonte teilen sich eine Kajüte, die Zollbeamten sind bei den dänischen Kollegen untergebracht. Die Deutschen mussten zusammenrücken. Wegen der Übung sind auch Beamte an Bord, die normalerweise nur an Land arbeiten und für die dieser Ausflug eine angenehme Abwechslung bedeutet. Sogar ein junger Ermittler ist darunter. Dieser Kollege namens Xander Rimbach hat noch nicht viel Zeit auf See verbracht. Er steht an Deck, die Hände an der Reling, den Blick auf den Horizont gerichtet, der im ersten Tageslicht langsam sichtbar wird. Auch bei schwachem Wind ist die See in der Deutschen Bucht immer etwas unruhig, und Rimbach hat einen empfindlichen Magen. Rob Bonte bleibt neben ihm stehen. Backbord voraus liegen zwei Inseln. Rob fragt nach ihren Namen. Xander antwortet, er habe keine Ahnung.
»Du warst wohl noch nicht oft auf See?«, sagt Rob.
Xander schüttelt den Kopf. Eine Weile blicken sie zu den Inseln hinüber, die langsam vorbeigleiten.
»Eigentlich hatte ich gestern auch Cupido erwartet, aber ich habe ihn nicht gesehen.«
Xander atmet die frische Morgenluft tief ein, schluckt dann langsam etwas hinunter. »Liewe ist mit einem Fall beschäftigt, und außerdem …« Er vollendet den Satz nicht.
»Solche Veranstaltungen meidet er wohl lieber, was?«
»Er feiert nicht gerne«, sagt Xander. Dann deutet er in Richtung Brücke. »Aber ich habe auch den Eindruck, dass die beiden sich aus dem Weg gehen.«
»Cupido und Rademacher?«
Xander nickt und atmet wieder tief ein.
Natürlich ist Rademacher an Bord. Bei der anstehenden Übung wird er zwischen Lauwersoog in Groningen und Esbjerg in Jütland Einsätze von Bundespolizei See, Zoll und den entsprechenden niederländischen und dänischen Organisationen koordinieren.
Es ist nach neun, als die Bad Bramstedt bei Düne, der flachen Nebeninsel Helgolands, den Anker fallen lässt. An dieser Stelle liegt das Schiff wie in einem Hinterhalt, durch Dünen und die Felsen der Hauptinsel verdeckt und für Schiffe mit Kurs auf Hamburg oder Bremen nicht sichtbar.
Die Messe der Bad Bramstedt ist als Einsatzzentrale eingerichtet. An drei zu einem Dreieck zusammengeschobenen Tischen sitzen jeweils ein Zollbeamter und ein Grenzschützer aus einem der beteiligten Länder vor Computerbildschirmen. Jeder ist direkt mit Kollegen im eigenen Land verbunden und hat Zugriff auf deren Datenbanken. Über zwei Lautsprecher auf Rademachers Tisch kann man Funksprüche auf dem allgemeinen Kanal 80 und dem für Notfälle bestimmten Kanal 16 mithören. Auf den Monitoren lässt sich der Schiffsverkehr im gesamten Gebiet noch bis weit nördlich der Deutschen Bucht verfolgen. Zu sehen ist ein buntes Durcheinander von kriechenden Pünktchen, die sich, je näher sie den Mündungen von Ems, Weser und Elbe oder dem Hafen von Esbjerg kommen, mehr und mehr ordentlich hintereinander einreihen, wie sehr langsame Ameisen auf dem Weg zum Nest. An Ankerplätzen warten Schiffe auf Lotsen.
Rademacher hat am deutschen Tisch Platz genommen und schaut auf die Uhr. Es ist fünf vor zehn, in fünf Minuten übernimmt er die Koordination. Er tippt auf seinem Telefon etwas ein, blickt dann auf den Monitor mit dem Schiffsverkehr. Er nickt langsam, seine Lippen bewegen sich, als würde er einem nur für ihn sichtbaren Gegenüber etwas zuflüstern.
An den Tischen wird es still, alle konzentrieren sich auf ihre Monitore, suchen in ihren Datenbanken nach Angaben zu den Schiffen in Reichweite der Patrouillenboote. Dann, um Punkt zehn, als Rademacher gerade in Aktion treten will, kommt ein Funkspruch auf Kanal 16: »Mayday, mayday, mayday. Man overboard, requesting assistance. This isRV Anthropocene, at 54°32'24'' North 7°10'47'' West, requesting assistance.«
Rademacher zögert, schaut von einem zum anderen. Nach wenigen Sekunden antwortet der Seenotrettungskreuzer von Helgoland.
»Anthropocene, hier ist die Hermann Marwede, Helgoland, wir sind unterwegs.«
»Die sind noch achtzehn Seemeilen von uns entfernt«, sagt Rob Bonte.
»Zu weit für uns«, urteilt Rademacher. »Vielleicht der Heli.« Er steht auf. Hier kann er die Funksprüche nur hören, zum Antworten muss er auf die Brücke.
»Herr Rademacher«, sagt Rob, doch Rademacher reagiert nicht und verlässt mit großen Schritten die Messe. Rob schaut erneut auf seinen Monitor, steht dann ebenfalls auf und folgt Rademacher. Der geht aber so schnell, dass Rob ihn erst auf der Brücke einholt. Rademacher greift zum Hörer des Funkgeräts.
»Anthropocene, hier ist die Bad Bramstedt, Bundespolizei See. Wird der Einsatz eines Helikopters gewünscht?«
Es bleibt still. Rademacher runzelt die Stirn, wiederholt dann die Anfrage.
Nun meldet sich wieder die Hermann Marwede. »Anthropocene, hier die Hermann Marwede. ETA in vierzig Minuten. Ist die Position des Unfalls bekannt?«