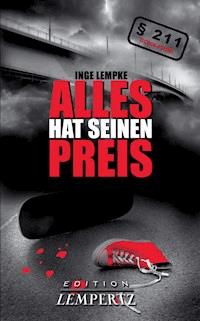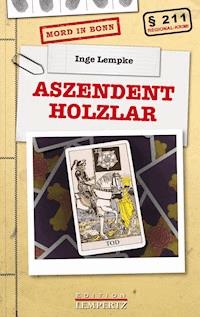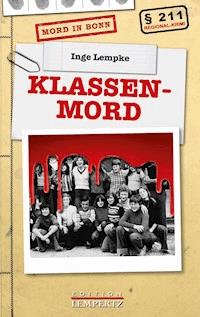Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lempertz Edition und Verlagsbuchhandlung
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als er wieder zu sich kam, hatte er Kopfschmerzen. Manfred hielt den Atem an und lauschte. Er lag eindeutig im Freien: In der Ferne bellte ein Hund, in nicht so weiter Ferne fuhr ein Auto vorbei. Ganz in der Nähe waren auf einmal leise Schritte zu hören. Und dann eine Stimme an seinem Ohr, die monoton flüsterte: "Manfred Baum, heute wird Gott dich durch mich bestrafen. Du bist ein schlechter Mensch, selbstgerecht und unbarmherzig. Du hast Menschen wie Abschaum behandelt, du hast ihre Selbstachtung zerstört und manchmal sogar ihr Leben. Weil Satan in dir ist. Ich werde ihn dir austreiben, und dann kann deine Seele in den Himmel auffahren. Zwei Mordserien, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, erschüttern die Stadt. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare Andreas Montenar und Sascha Piel auf die neu gegründete Glaubensgemeinschaft des Predigers Jonas Kirch, der verkündet, er sei von Gott nach Bonn gesandt worden, um die Menschen aus den Fängen des Teufels zu retten. Ist Kirch in die Mordfälle verwickelt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inge Lempke
Der Teufel in uns
Mord in Bonn
Edition Lempertz
Impressum
Math. Lempertz GmbH Hauptstr. 354 53639 Königswinter Tel.: 02223 / 90 00 36 Fax: 02223 / 90 00 38 [email protected] www.edition-lempertz.de
© 2012 Mathias Lempertz GmbH
Text: Ingrid Lempke
Umschlaggestaltung, Satz und Layout: Ralph Handmann
Kapitel 1
Bonn-Buschdorf - Samstag, 9.Februar, 15.15 Uhr
Während Tina den letzten Küchenstuhl ins Wohnzimmer trug, überfiel sie für einen Moment das Gefühl, dass heute in diesem Haus etwas Neues, etwas Großartiges, etwas Großes beginnen könnte.
Dieses Gefühl hing mit Jonas zusammen, und es ließ ihr eine Gänsehaut über die Arme laufen. Wärme durchflutete ihre Seele, einen Moment lang fühlte sie sich so glücklich, dass sie hätte weinen mögen…aber eine Tina Bruschinsky weinte nicht so leicht. Und schon gar nicht wegen eines Mannes.
Im Wohnzimmer zählte sie die Sitzplätze nach – es fehlten immer noch fünf. Benny wollte zwei Klappstühle mitbringen. Gut, mussten die Übrigen eben mit Kissen auf dem Boden Vorlieb nehmen.
Rasch eilte Tina zurück in die Küche und goss noch eine Kanne schwarzen Tee auf. Als sie zwei Kannen Kaffee ins Wohnzimmer brachte, klingelte es. Tina stellte die Kannen zu den vielen Tassen auf dem Tischchen in der Ecke, flitzte in den Flur und merkte, wie sie sich anspannte, als sie die Tür öffnete.
Da stand er, der Mann, den sie heute erst zum dritten Mal sah: etwas größer als sie, schlank, weißer Anzug, weißes Hemd, weiße Schuhe. Ein nicht zu übersehendes, silbernes Kreuz auf der Brust. Grauweißes, schulterlanges Haar, silberne Brille. Und dahinter diese Augen, diese graugrünen, gütigen, mitfühlenden, manchmal vor Begeisterung sprühenden Augen!
Tina wurde den Verdacht nicht los, dass sie auf dem besten Weg war, sich in den Mann zu verlieben. Auch wenn er fast 20 Jahre älter war als sie.
„Hallo, Tina, ich wollte eigentlich längst da sein, um dir ein bisschen zu helfen, aber ich hab mich total verfahren.“ Jonas trat in den Flur, breitete die Arme aus und legte sie um die vor Überraschung erstarrte Tina. Das hatte er ja noch nie gemacht! Sie umarmte ihn vorsichtig zurück, während er kundtat: „Ich wünsche dir Glück und Zufriedenheit!“
Dann ließ er sie los, und Tina stotterte: „Äh ja...wünsche ich dir...natürlich auch.“
Jonas strahlte sie an, als sei sie die Offenbarung. Tina schaute weg und zeigte nach rechts. „Ich hab da im Wohnzimmer was vorbereitet.“
Kurz darauf sah er sich im Raum um und meinte anerkennend: „Das hast du gut gemacht. Genauso hab ich mir das vorgestellt. Tee, Kaffee, was zu knabbern. Prima, und anscheinend hast du ja eine Menge Leute mobilisieren können.“
„Na ja, wir sind ungefähr fünfzehn, wenn alle kommen.“
„Ganz toll.“ Jonas steuerte auf das Tischchen in der Ecke zu. „Ich werde mich ein bisschen stärken, bevor wir anfangen.“
Tina wollte ihm gerade folgen, um ihm Kaffee einzuschenken, als es erneut an der Tür klingelte. Es war ihr Nachbar Benny von oben, und er hatte tatsächlich zwei Klappstühle dabei sowie einen irgendwie finster und ungepflegt aussehenden Freund. Hinter den beiden stand die dicke Yvette, die Nachbarin von unten, die ihre alte, kranke Mutter mitbrachte.
Tina schickte die vier ins Wohnzimmer, eilte in die Küche und kümmerte sich um den schwarzen Tee, als es schon wieder klingelte.
Jonas war vor ihr an der Tür und ließ Tinas ständig alkoholisierten Arbeitskollegen Holger und seine Frau herein, umarmte beide herzlich und begrüßte sie mit: „Ich wünsche euch Glück und Zufriedenheit!“
Auf die gleiche Weise empfing er Gottfried („Hausmeister an einer Schule“, stellte Tina ihn vor), Ramona, eine ehemalige Mitschülerin, und deren Bekannte. Außerdem kamen Gerlinde, eine Arbeitskollegin von Tina, und ihre Tochter, sowie schließlich Tabea Römer, eine Boutiquebesitzerin, bei der Tina schon so manches eingekauft hatte.
Die Römer, eine garantiert magersüchtige Person, präsentierte zur Überraschung aller ihre Zwillingsschwester, die wie eine exakte Kopie von ihr aussah, vom starken Make-up über die schwarz gefärbten Haare bis hin zur Magersüchtigkeit. Schien es Tina nur so, oder umarmte Jonas die beiden länger als alle anderen?
Wie auch immer, kurz darauf saßen oder standen alle im Wohnzimmer beisammen, beäugten sich und trauten sich kaum, ein Gespräch anzufangen. Bis schließlich Jonas die Initiative ergriff, jeden jedem vorstellte, allen das ,Du‘ aufs Auge drückte und jedem ein kleines Kompliment machte, sogar Holger, der so stark nach Alkohol roch, dass Tina sich für ihn schämte. Da es auch über sein Aussehen nichts Positives zu berichten gab, lobte Jonas die geschmackvolle Farbkombination seiner Krawatte.
Schließlich stellte sich Jonas an die hintere Wand des Wohnzimmers, dorthin, wo das Bild mit den prallen, blau blühenden Hortensien hing, legte die Fingerspitzen in Höhe seiner Taille zusammen und begann die Ansprache mit ein paar Worten zur eigenen Person.
„Hallo, ihr Lieben, ich bin Jonas Kirch, 58 Jahre alt, und ich wohne in Bonn. Ich habe nicht nur Theologie, sondern auch das Leben und die Menschen genau studiert, und glaubt mir – ich kenne mich aus.“ Er machte eine kleine Pause, dann hob er plötzlich die Hände und die Stimme. „Ich habe diese Anzeige in die Zeitung gesetzt, weil ich Mitstreiter suche, Mitstreiter in einem ganz besonderen Kampf!“ Jonas räusperte sich zweimal dezent, machte ein ernstes Gesicht und fuhr fort.
„Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben uns hier versammelt, weil wir alle – ja, auch ich – auf der Suche sind. Wir suchen nach dem Sinn unseres Lebens, nach einem Menschen, der uns liebt, vielleicht suchen einige von uns nach Arbeit, nach ein bisschen Freude, nach jemandem, der sie von ihren Schmerzen befreit. Manche werden sich fragen, was habe ich nur getan, dass ich arm, krank oder einsam bin, und sie werden sich schuldig fühlen. Aber nein, wir sind nicht schuld an unserem Elend! Wir sind nur unwissend! Dafür bin ich hier, liebe Freunde, um euch die Augen zu öffnen. Um euch zu sagen, wie ihr glücklich werdet, und um euch zu zeigen, was eurem Glück im Weg steht. Und glaubt mir, meine Mitstreiter, es ist immer dasselbe, was uns daran hindert, glücklich zu werden! Es ist immer er! Er, der Meister der Tarnung, der Täuschung, der Verführung! Er sorgt dafür, dass wir an leere Versprechungen glauben, dass wir uns klein fühlen, immer an die falschen Partner geraten, nie die richtige Arbeit und nie zu uns selbst finden! Er, der Inbegriff des Bösen! Er, Satan!“
Blitzende Augen hinter der Silberbrille. Eine bedeutungsvolle Pause.
Tina, die rechts von Jonas auf einem dicken Kissen auf dem Boden saß, schaute in die Gesichter der anderen: Erstaunen, Skepsis, Zustimmung, Angst. Alles da. Tina neigte zur Skepsis, aber sie war offen für alles, was Jonas sonst noch von sich geben würde.
Er redete weiter. „Vielleicht wundert ihr euch, dass ich nicht über Gott rede, aber ich setze voraus, dass wir alle gläubige Christen sind, egal welcher Richtung. Aber vielleicht zweifelt ihr gerade an eurem Glauben, weil der Teufel, der Unglaube, Hass und Neid sät, euch Dinge einflüstert, die gar nicht stimmen! Deshalb spreche ich nicht über Gott zu euch, sondern über Satan, der auf die Welt kam, um uns vom richtigen Weg abzubringen! Gott prüft uns damit, und das erste, das wir tun müssen, ist, das alles zu durchschauen. Und das tun wir, indem wir uns hier und heute zu einer Gemeinschaft zusammenschließen!“
Tina kratzte sich an den Narben hinter dem Ohr. Diese Veranstaltung erinnerte sie an die amerikanischen Erweckungsgottesdienste mit Gospel-Chor und hysterisch ausrastenden Gläubigen. Nun, hier konnte niemand singen, und der deutsche Gläubige an sich rastete auch nicht so schnell aus. Obwohl sich Jonas wirklich Mühe gab.
„Bringt mal jemand die Tafel rüber?“, bat er gerade und sah dabei Gottfried an. Der lehnte mit verschlossener Miene an der Wand und schaute auf die ihm eigene Art zurück: mit einem bohrenden Blick seiner sehr dunklen Augen, ohne mit dem Lid zu zucken. Viele Sekunden lang. Die meisten Leute hielten das keine 5 Sekunden aus. Jonas auch nicht.
Warum Gottfried das machte, wusste Tina nicht. Eigentlich war er ein fleißiger, hilfsbereiter, manchmal sogar freundlicher Mensch. Mit seinen dunklen, lockigen Haaren und dem genauso dunklen Vollbart sah er aus wie ein kleinerer und dünnerer Reinhold Messner. Aber er war deutlich unkommunikativer.
Immerhin stieß er sich von der Wand ab und half Jonas, das Flip-Chart aufzustellen. Tina hatte keine Ahnung, was jetzt kam.
„So, meine Lieben.“ Jonas ließ seinen Blick zu jedem einzelnen Anwesenden wandern. „Ich möchte jetzt eine Glaubensgemeinschaft mit euch gründen, eine große Gruppe von Freunden, eine Familie. Ihr braucht nichts zu unterschreiben, es kostet nichts, das Einzige, was ich möchte, ist, dass ihr mir vertraut. Ist jemand hier, der nicht mitmachen will?“
Niemand natürlich. Jonas lächelte begeistert und nahm einen Stift in die Hand. „Ich finde, jede Glaubensgemeinschaft braucht einen passenden Namen. Ich schreibe mal drei Vorschläge an die Tafel, und dann diskutieren wir darüber, ok?“
Jonas Kirch schrieb:
Von da an war es mit der Zurückhaltung vorbei. Es wurde diskutiert, kritisiert und umformuliert, was das Zeug hielt. Die Abstimmung eine halbe Stunde später ergab einen eindeutigen Sieger: ,Freie Gemeinde Glaube, Glück und Gerechtigkeit‘.
Sogar Gottfried behauptete, mit dem Namen zufrieden zu sein, obwohl er guckte, als habe man ihm ein Dutzend Schimpfwörter an den Kopf geworfen. Tabea Römer hingegen lächelte beseelt.
Tina hatte sie beobachtet: die Magersüchtige hatte an Jonas’ Lippen gehangen wie eine verliebte Giftschlange. Und hatte Jonas nicht ein paar Mal besonders nett zu ihr hinübergelächelt? War da etwa eine Konkurrentin aufgetaucht?
Den gleichen Verdacht hegte Tina auch gegen ihre stets elegant gekleidete Arbeitskollegin Gerlinde, die ebenfalls zwei bis drei Augen auf Jonas geworfen zu haben schien. Sie würde -
„Wieso bist du eigentlich qualifiziert, uns hier irgendwas beibringen zu wollen?“, hörte Tina plötzlich jemanden fragen. Schlagartig waren alle still, wandten die Köpfe Gottfried zu und drehten sie dann zurück zu Jonas.
Der stand immer noch in seinem weißen Anzug neben der Tafel, stellte seine Kaffeetasse beiseite, lächelte mild (geradezu päpstlich), legte den Stift weg und setzte sich auf einen Hocker, den Tina ihm überlassen hatte.
„Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen“, hob er mit seiner Samtstimme an. „Meine Eltern sind früh gestorben, und deshalb lebte ich lange bei meinen Großeltern auf einem Bauernhof. Ich war ein scheuer, nachdenklicher Junge, der gerne Gedichte las, kaum Freunde hatte und Pferde, Hunde und Katzen auf dem Hof mehr mochte als die Menschen. Am liebsten zog ich mich auf den riesigen, staubigen Dachboden mit den vielen, hölzernen Stützbalken zurück, auf den sich sonst niemand verirrte. Ich zimmerte mir in einer Ecke eine Art Hütte zusammen. Es herrschte immer ein mehrwürdiges Zwielicht dort oben.“
Jonas machte eine Pause und schaute gedankenverloren und ein wenig sehnsüchtig ins Leere. Dann seufzte er und fuhr fort: „Ich bin am 24. Dezember geboren. Meine Großmutter, die sehr gläubig war, hielt das für ein besonderes Zeichen und schenkte mir, als ich zwölf wurde, eine eigene Bibel, in der ich von da an ständig las. Ein halbes Jahr später, an einem warmen Sommerabend, verließ ich meine ,Hütte‘, um nach unten ins Schlafzimmer zu gehen, als ich auf einmal einen mir unbekannten, aber sehr angenehmen Geruch wahrnahm.“
Jonas fasste an das silberne Kreuz, das auf seiner Brust hing. Es war sehr still in Tinas Wohnzimmer. „Und mitten im dämmrigen Dachboden wurde ein schwaches, goldenes Licht sichtbar, das etwa einen Meter über dem Boden schwebte und funkelte wie ein Stern. Ich wusste, dass es die Seele meiner Mutter war. Ich empfing die Botschaft, dass ich dazu bestimmt sei, Gottes Wort zu verkünden und Satan zu bekämpfen. Meine Mutter erschien mir oft in diesen Jahren, als ich erwachsen wurde. Sie hat mir sehr viel beigebracht und mir Dinge aus dem Jenseits erzählt, die sehr schön waren, und manche, die sehr schrecklich waren.“
Beeindrucktes Schweigen. Tina lief eine Gänsehaut über die Arme. Nur Gottfried, der Zweifler und Nörgler, platzte mit einer Frage heraus, die zu diesem Zeitpunkt vermutlich sonst niemandem eingefallen wäre.
„Und wovon hast du in den letzten Jahren gelebt?“
„Von Spenden“, antwortete Jonas, „wie zum Beispiel die buddhistischen Mönche auch, und viele andere Prediger. So, meine lieben Mitstreiter! Jetzt möchte ich zum nächsten Punkt kommen: zu den Regeln. Heute beginne ich mit den ersten drei Regeln, und jedes Mal, wenn wir uns treffen, wird eine neue dazu kommen.“
Er erhob sich, nahm den Stift und trat an die Tafel. „Es ist wichtig, dass wir uns an die Regeln halten. Sie haben einen Sinn: Sie sollen uns bewusst machen, wer wir sind und wie wir uns vor dem Bösen schützen können. Die Regeln stehen übrigens auch auf den Kärtchen, die ich gleich verteilen werde.“
Er wandte sich der Tafel zu und schrieb seine drei ,Regeln‘ auf das blütenweiße Papier:
Regel 1: Sag dir jeden Tag, dass Gott dir eine besondere Fähigkeit mitgegeben hat. Denn: In uns allen lebt Gott. Wir wollen unsere Fähigkeit finden und eine Stärke daraus machen.
Regel 2: Trenne dich sofort und entschieden von allem Negativen, auch von negativen Menschen. Sie lenken uns von den wirklich wichtigen Dingen ab und untergraben unser Selbstwertgefühl. Denn: In uns allen steckt auch der Teufel, der Inbegriff aller Negativität. Wir aber wollen gegen ihn antreten.
Regel 3: Meide das Internet, die Zeitungen und die Fernsehnachrichten. Du wirst falsch informiert und überschüttet mit negativen Meldungen. Denn: Das Böse verführt uns und zieht uns in den Abgrund. Wir aber wollen glücklich werden.
Wieder herrschte Stille. Diese Regeln musste man erst einmal verdauen. Waren sie überhaupt einzuhalten? Wollte Tina wirklich nie mehr Nachrichten gucken? Nie mehr im Internet surfen? Nie –
„Ihr fragt euch sicher gerade, was das für komische Regeln sind, und ob man sich daran halten kann und soll“, meinte Jonas prompt. „Aber, liebe Freunde, dafür sind wir ja hier: um darüber zu reden.“
„Darf ich noch was anderes fragen?“, wagte sich Holger, der Alkoholiker, vor, eine Mischung aus Ehrfurcht und Aggressivität in der Stimme.
„Klar, nur zu.“
Und Holger stellte die Frage, mit der er auch die Kollegen im Büro zu nerven beliebte, und deren Sinn sich geschätzten 98 % der Anwesenden nicht so ohne weiteres erschloss: „Sind wir auch sicher hier?“
*
Königswinter - Samstag, 9.Februar, 19.00 Uhr
Andreas parkte den Wagen auf dem großen Platz neben dem Hotel und begann, seiner Oma herauszuhelfen. Das dauerte. Denn auf mysteriöse Weise verhakten sich ihre Arme, Beine und Füße ständig in Gurten, an Türkanten und unter den Sitzen.
Doch schon war Sascha zur Stelle, der ein paar Plätze weiter geparkt hatte. Er schnappte sich den zweiten Arm der Oma und gemeinsam führten sie sie in das feine Restaurant am Rhein, in dem Andreas seinen fünfzigsten Geburtstag nachzufeiern gedachte. Er hasste das.
Natürlich war nur der engere Kreis geladen. Am Tisch warteten schon seine Mutter, Sabine, Udo und Annika mit Sechsmonats-Bauch. Sein Journalistenbruder trieb sich irgendwo in Indien herum und wollte lieber im Sommer „mal vorbeikommen“. Andreas war über seine Abwesenheit nicht sonderlich traurig, das Essen würde auch so teuer genug werden.
Vor ein paar Tagen hatte sich Sascha laut gewundert, warum Andreas nicht mehr Kollegen eingeladen hatte. Daraufhin war er mit einem sehr unfreundlichen „Das mache ich schon noch!“ abgebügelt worden.
Nachdem Oma Elli endlich auf ihrem Platz saß, eilte die Bedienung mit den Speisekarten herbei. Elli nahm ihre erst gar nicht entgegen, sondern verkündete lauthals, sie wolle Reibekuchen essen. Die Kellnerin guckte, als habe sie das Wort noch nie gehört.
Schnell nahm sich Andreas’ Mutter der Oma an und versuchte, ihr ein leckeres Rehgericht aufzuschwatzen. Das dauerte. Dann redeten auch Sabine und Sascha auf die Frau ein wie auf ein krankes Pferd. Schließlich willigte sie ein.
Während man auf das Essen wartete, reichte Sascha zwei Ultraschallbilder seines Sohnes herum, auf denen Andreas außer interessanten Variationen von Schwarz und Weiß nicht viel erkennen konnte. Annika, mit langen, schwarzen Locken, genauso schwarzen Augen und in feuerroter Bluse, sah einfach prachtvoll aus und schien in sich selbst zu ruhen wie Buddha persönlich.
Sascha allerdings wirkte in letzter Zeit unausgeglichen, so, als wisse er immer noch nicht, ob er sich nun mit seiner Rolle als werdender Vater anfreunden sollte oder nicht. Natürlich fühlten sich sowohl Andreas’ Mutter als auch Sabine befähigt, Annika ein paar gute Ratschläge zum Thema ,Schwangerschaft & Geburt‘ zu geben.
Oma Elli schien aufmerksam zuzuhören, bis sie sich auf einmal Andreas, den sie noch immer für ihren Ehemann Erich hielt, zuwandte und ihn fragte, indem sie auf Sabine zeigte: „Was macht die denn hier?“
Sascha, das Plappermaul, grinste und klärte die Oma auf: „Das ist Andreas’ Freundin.“
„Wer ist Andreas?“, wollte die Oma wissen und runzelte die inzwischen 91jährige Stirn.
Und obwohl Andreas mit eindeutigen Gesten zum Ausdruck brachte, dass Sascha den Mund halten sollte, plapperte er einfach weiter.
„Aber Frau Montenar, der sitzt doch neben Ihnen.“
Nun war Elli komplett verwirrt. Da kam glücklicherweise das Essen. Kaum hatte sie den Teller mit dem Rehbraten vor sich stehen, als sie auch schon losnörgelte: „Was ist das denn?! Ich wollte doch Reibekuchen!“
Andreas atmete tief durch, setzte ein Lächeln auf, zog ihren Teller zu sich heran und sagte sanft, aber entschieden: „Das ist für mich. Elli, hier gibt es keine Reibekuchen. Wie wär´s mit einem großen Stück Torte und einem leckeren Kaffee?“
Elli, im Alter zum Süßmaul mutiert, nickte begeistert. Sie bekam ihre Schwarzwälder-Kirsch-Torte und anschließend noch ein Stück Kuchen mit viel Nougat und Marzipan, und zumindest bis zum Ende des Essens herrschte Friede. Abgesehen von den giftigen Blicken, die Elli ab und zu Sabine zuwarf.
Irgendwann fielen der Oma trotz zwei Tassen Kaffees die Augen zu, und fast wäre sie vom Stuhl gerutscht. Aber Andreas passte auf. Er nahm sie beim Arm, zog sie hoch und meinte: „So Elli, wir fahren jetzt nach Hause, es ist schon spät, und wir müssen morgen früh raus.“ Und zu den anderen gewandt: „Ich bringe sie eben weg und bin in 20 Minuten zurück.“
Vorsichtig bugsierte er Elli um diverse Stühle herum und an Sabine vorbei, die ihre Jacke über der Stuhllehne drapiert hatte. Plötzlich blieb die Oma wieder irgendwo hängen und kippte nach vorne. Andreas erwischte sie noch am Ärmel ihres Kleides, konnte den Sturz aber nicht aufhalten. Elli schlug, leicht seitlich verdreht, auf dem Boden auf und fing sofort an, vor Schmerz und Schreck laut zu jammern.
Innerhalb von 20 Sekunden waren alle um sie versammelt und redeten durcheinander. Sabine versuchte mit besorgtem Gesicht, die Frau an Schulter und Hüfte abzutasten, aber Oma Elli kreischte plötzlich los: „Gehen Sie weg, Sie Biest! Sie haben mir ein Bein gestellt! Nehmen Sie die Hände weg.“
Von dieser fixen Idee ließ sich Elli nicht abbringen. Und als sie in den Krankenwagen geschoben wurde, hatte sie noch ausreichend Kraft, Andreas ein „Erich, wieso betrügst du mich mit dem Flittchen?!“ hinterherzuzetern.
Andreas war begeistert - die zweite Hälfte seines Lebens fing ja gut an!
Kapitel 2
Bonn, Franzstraße - Freitag, 2. Mai (Drei Monate später), 17.20 Uhr
Hedwig stand im Wohnzimmer am Bügelbrett, bügelte Bettwäsche und sah dabei fern. Es lief ein Bericht über Bauern in der Eifel, als es plötzlich an der Haustür klingelte. Wer mochte das sein? Erwin hatte nichts davon gesagt, dass er vorbeikommen würde.
Immerhin erinnerte sie sich an seine mahnenden Worte und zog den Bügeleisenstecker heraus, bevor sie in den Flur ging. Durch das Fensterchen in der Tür erkannte sie eine mittelgroße Frau mit fast schwarzen, glatten, schulterlangen Haaren. Ein langer Pony fiel bis auf den oberen Rand der auffälligen, eckigen, roten Brille. Hedwig öffnete. Trotz des milden Wetters trug die Frau einen hellen, hoch zugeknöpften Trenchcoat.
Sie lächelte freundlich, hielt Hedwig die Hand hin und sagte: „Guten Tag, Frau Bach. Tut mir leid, ich hab mich ein bisschen verspätet, aber es ist so viel Verkehr in der Stadt.“
Hedwig schaute die Frau an, während ihr Gehirn auf Hochtouren zu arbeiten begann. Aber sie konnte sich beim besten Willen nicht an diese Person erinnern. Oder daran, sie heute eingeladen zu haben.
„Frau Bach“, lachte die Frau plötzlich gutmütig auf, „ich seh´s Ihnen an der Nasenspitze an - Sie können sich nicht mehr an unser Telefongespräch erinnern! Aber das macht doch nichts! Ich bin Polizeihauptkommissarin Silvia Falk von der Kripo Bonn, und ich hatte Sie angerufen wegen unseres Projekts ,Mehr Sicherheit für ältere Mitbürger‘. Wir hatten uns für heute verabredet, Frau Bach, damit ich Ihnen ein paar Fragen stellen und Sie beraten kann.“
Noch immer wollte sich Hedwigs Gehirn an Derartiges nicht erinnern... Obwohl, da war was gewesen, da hatte doch jemand angerufen, vor ein paar Tagen. Oder war es letzte Woche gewesen? Jedenfalls konnte sie die Frau nicht einfach vor der Tür stehen lassen!
„Kommen Sie rein“, bat sie und führte Frau Falk in die halbwegs aufgeräumte Küche. Dort bot sie ihr Kamillentee aus einer Thermoskanne an, aber Frau Falk lehnte dankend ab, setzte sich, immer noch im zugeknöpften Mantel, an den Tisch und zog eine Mappe aus ihrer großen, beigen Umhängetasche. Sie schlug sie auf und begann, sich zunächst Hedwigs Personalien zu notieren: Hedwig Bach, 86, verwitwet, ein Sohn, allein lebend.
Dann wollte sie etwas über Hedwigs Gesundheitszustand und ihre Ernährungsweise wissen, darüber, wer im Notfall für sie da war, wie sie versichert war, wie sie finanziell dastand.
Bis dahin hatte Hedwig gerne geantwortet. Es war ein schönes Gefühl, dass sich jemand für sie interessierte und ihr aufmerksam zuhörte, ohne sie dauernd zu unterbrechen. Aber über ihre Finanzen redete sie nicht so gern.
Sie schaute der Frau in die braunen Augen und überlegte, was sie sagen sollte. Ihr fiel auf, dass die Kommissarin eine Schicht Make-up aufgelegt hatte, die es schwer machte, ihr Alter zu schätzen. Sie mochte um die Vierzig sein, aber vielleicht war sie auch älter und -
„Frau Bach, ich bin von der Polizei und möchte mich um Ihre Sicherheit kümmern, Sie können mir vertrauen!“ Sie schenkte Hedwig ein sehr sympathisches Lächeln. „Bewahren Sie eine größere Geldsumme im Haus auf?“
Hedwig zögerte immer noch ein bisschen. Andererseits war es ihr unangenehm, dass sie der Frau von der Polizei nicht vorbehaltlos vertraute. Aber hatte sie überhaupt einen Ausweis vorgezeigt? Doch was nützte Hedwig der Ausweis, wenn sie gar nicht wusste, wie der auszusehen hatte?
Nein, die Frau wirkte glaubwürdig. „Ja, wissen Sie, ich traue den Banken nicht über den Weg. Deshalb hebe ich jeden Monat was vom Konto ab, für Weihnachtsgeschenke...oder den Notfall, verstehen Sie? Ich hab das Geld auch gut versteckt. Das ist doch nicht verboten, oder?“
Frau Falk, die Kommissarin, lachte. „Nein, natürlich nicht! Sie glauben ja gar nicht, wie viele Leute das machen! Aber wenn man schon viel Geld im Haus hat, sollte man es sicher aufbewahren und niemandem davon erzählen. Ich war kürzlich bei einem älteren Herrn zu Besuch, der hortet sein Geld unter dem Dielenboden. Clevere Idee. Aber die meisten Leute verstecken das Geld in Kleiderschränken, Schubladen oder in herumstehenden Dosen und Schachteln. Das ist natürlich leichtsinnig.“
„Ja, aber ich habe einen richtig großen Wandtresor, den hat mein Mann noch gekauft.“
„Sehr gut, Frau Bach. Einen mit Kombinationsschloss oder einen mit Schlüssel?“
„Mit Schlüssel.“
Frau Falk sah Hedwig mit gerunzelter Stirn an. Das Make-up machte die Falten irgendwie plastischer. „Und wie ist der Schlüssel gesichert?“
„Ich hab ihn -“
„Nein, sagen Sie nichts, Frau Bach!“ Die Frau stand auf. „Ich tue jetzt mal so, als wäre ich ein Einbrecher und würde nach dem Safe-Schlüssel suchen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich ihn finde. Wo ist Ihr Schlafzimmer?“
Hedwig fühlte sich ertappt. „Im ersten Stock.“
„Dann gucken wir uns das doch mal an.“
Hedwig nickte und ließ Frau Falk vorgehen. Sie selbst packte das Treppengeländer mit beiden Händen und stieg langsam, vorsichtig und leicht seitwärts die Stufen hinauf. Die Frau war schon oben im Flur verschwunden, als Hedwig erst auf halber Treppe war. Wie gut, dass die Zimmer im Obergeschoss immer ordentlich aufgeräumt waren. Darauf legte Hedwig Wert.
Jetzt war sie endlich auch oben angekommen und ging schwer atmend auf die offen stehende Schlafzimmertür zu. Man sah direkt auf das 35 Jahre alte Doppelbett in Mahagoni-Optik, und nun entdeckte Hedwig auch die Frau, die sich über eins der Nachttischchen gebeugt hatte und in einer Schublade herumstöberte.
Als Hedwig das Zimmer betrat, drehte sich Frau Falk um und hielt triumphierend einen Schlüssel in die Höhe.
„Wusste ich’s doch! So geht das natürlich nicht, Frau Bach, ich zeige Ihnen gleich mal, wie man einen Schlüssel richtig versteckt. Aber jetzt möchte ich mir erst noch den Tresor angucken. Wie viel Geld haben Sie denn überhaupt im Haus?“
Als die Frau Hedwig mit ihren braunen Augen wieder so komisch ansah, hatte sie für einen Moment das Gefühl, alles, aber auch alles falsch gemacht zu haben. Und trotzdem hörte sie sich im nächsten Augenblick sagen: „Ungefähr 6200,- Euro.“
„So viel?! Sie sind sehr leichtsinnig“, tadelte die Frau von der Polizei. Falls sie wirklich von der Polizei war. Denn jetzt fielen Hedwig auch die dunklen Handschuhe auf, die die Frau auf dem Weg nach oben übergestreift haben musste.
Als ,Kommissarin‘ Falk fragte: „Wo ist denn der Tresor?“, zog sich Hedwig wieder aus dem Schlafzimmer zurück, blieb im Flur stehen und sagte mit leidender Stimme: „Würden Sie jetzt bitte gehen... Mir ist nicht gut.“
Die Frau reagierte nicht so, wie Hedwig das von einer Polizeibeamtin erwartet hätte. Statt sich um ihr Wohlbefinden zu sorgen oder sich wenigstens zurückzuziehen, drängte Frau Falk: „Nur zwei Minuten, Frau Bach. Wo ist der Tresor?“
Das machte Hedwig Angst, ja, sie konnte kaum noch klar denken vor Angst und Aufregung. Sie war jetzt sicher, dass sie eine Verbrecherin im Haus hatte! Was sollte sie nur tun? Automatisch machte sie ein paar kleine Schritte nach links und stellte sich vor die Tür zum Gästezimmer.
„Wenn Sie nicht sofort gehen, rufe ich die Polizei!“, drohte sie mit kratziger Stimme, aber das schien die Frau nicht abzuschrecken.
Denn auf einmal ließ sie ihre Maske fallen und verlangte harsch: „Stellen Sie sich nicht so an! Ich will nur das Geld, und dann bin ich weg!“
„Das ist aber mein Geld!“, stellte Hedwig klar und setzte der Frau, die sie zur Seite zu schieben versuchte, so viel Widerstand entgegen, dass ihr das Herz bis zum Hals schlug.
Frau Falk packte Hedwig an beiden Oberarmen. „Sie haben doch anscheinend genug Rente, wenn Sie jeden Monat wer weiß was zurücklegen können! Aber ich brauche das Geld!“
„Das Geld gehört aber mir!“, keuchte Hedwig, während sie versuchte, sich aus dem Griff der Frau zu winden.
Die schubste Hedwig plötzlich zur Seite, so dass sie rückwärts gegen eine Kommode stolperte. Irgendwelcher Krimskrams, der darauf gestanden hatte, fiel zu Boden. Hedwig hingegen hielt sich noch auf den Beinen – auf sehr zittrigen Beinen. Als die Frau die Tür zum Gästezimmer aufstieß, fing Hedwig an zu schreien.
„Hilfe! Polizei! Hilfe!“
Sie drehte sich um und schwankte auf ihren puddingweichen Beinen ins Badezimmer, dessen Fenster nach vorne auf die Straße ging. Sie hatte die Hand schon am Fenstergriff, um das Fenster aufzureißen und die ganze Umgebung zusammenzubrüllen, als jemand sie von hinten an ihrer Strickjacke festhielt.
„Lassen Sie mich los!“, kreischte Hedwig. „Hilfe! Sie gemeine Verbrecherin! Lassen Sie -“
Hedwig traf ein Hieb gegen den rechten Oberarm, dass sie seitwärts taumelte, das Gleichgewicht verlor und stürzte. Genau in die Lücke zwischen Badewanne und Toilette. Ihre Handgelenke knickten ein, als sie sich abzustützen versuchte, aber noch spürte sie keinen Schmerz.
Neben ihr klappte die Frau den Toilettensitz hoch. Jetzt wurde Hedwig an den Schultern gepackt und hochgezogen. Sie wollte sich wehren, aber sie hatte kein Gefühl und keine Kraft mehr in den Händen. Die Frau, die nun auch schwer atmete, drehte Hedwig, die noch immer auf den Knien lag, ein Stück um, so dass sie nun vor der nackten Toilettenschüssel kniete.
Dann vergrub die Frau beide Hände in Hedwigs schlohweißem Haar, riss ihren Kopf kurz nach hinten und schleuderte ihn dann mit Gewalt nach vorne, genau auf die Kante der weißen Porzellanschüssel zu. Hedwig sah sie auf sich zukommen – und konnte nichts dagegen tun.
*
Königswinter-Vinxel - 19.45 Uhr
Sascha saß neben Annika auf dem Sofa und sah sich ein Wissensmagazin im Fernsehen an. Manchmal wunderte er sich, dass sie überhaupt noch aufrecht sitzen konnte, bei dieser riesigen, prallen Halbkugel, in die sich ihr Bauch verwandelt hatte. Seine Hand lag oben auf der straff mit einem roten Shirt umspannten Wölbung.
Er freute sich, genau wie Annika, wenn der kleine, ungeborene Gabriel dem Bauch von innen mit Ellenbogen, Knie oder Fuß unglaubliche Ausbeulungen verpasste. Natürlich fühlte sich Sascha dann unweigerlich an die Alien-Filme erinnert, aber diverse Ultraschallbilder bewiesen eindeutig, dass in Annikas Körper kein Monster mit langem Schädel und doppelter Zahnausstattung heranreifte.
Gerade schmiegte sie sich noch enger an ihn, und ihre Hand wanderte an seinem Bein entlang in Gebiete, die zurzeit ein wenig heikel reagierten. Manche Frauen (Sascha hatte sich informiert) waren in der Schwangerschaft dank schwerem Östrogenbefall geradezu unersättlich. Annika gehörte definitiv dazu.
Nie hätte er gedacht, dass ihm das zu viel werden könnte. Allmählich fragte er sich sogar, ob Sex in der 39. Woche nicht doch schädlich für seinen Sohn sein könnte, egal, was die ,Experten‘ behaupteten! Am Ende war Gabriel für den Rest seines Lebens gezeichnet, und das nur, weil seine Mutter nicht ganz zurechnungsfähig gewesen war!
Sascha griff nach Annikas Hand und hielt sie fest. „Soll ich dir ein Stück Schokolade holen?“
Sofort setzte sich Annika aufrecht hin. Sie hatte ihre dicken, schwarzen Haare hochgesteckt, weil ihr dauernd zu warm war. Sascha lebte in ständiger Angst, sie könne sich in einem weiteren Anfall von Schwangerschaftswahnsinn die Haare abschneiden. Er hielt seine Angst nicht für übertrieben, denn auch gerade wieder glühte ein Fünkchen Irrsinn in ihren dunklen Augen.
„Das wird dir noch leid tun“, prophezeite sie. „Wenn unser Kind auf der Welt ist, werden wir erst mal keine Zeit mehr für uns haben.“ Sie zog die nackten Beine auf das Sofa empor.
Sascha stand auf. „Wer sagt das eigentlich? Und außerdem, willst du vorarbeiten, oder was? Sex kann man nicht speichern! Ich -“
Sein Handy auf dem Couchtisch gab seinen unverwechselbaren Klingelton von sich. Das James Bond-Thema. Andreas war dran.
„Ja?“
„Wir haben möglicherweise einen Mord in der Franzstraße. Kommst du rüber? Ich bin gerade bei Udo Philipp und keine zwei Minuten vom Tatort entfernt.“
Natürlich zögerte Sascha keine Sekunde. „Klar, bin schon unterwegs.“
Annika guckte leidend. „Lässt du mich jetzt etwa den ganzen Abend allein?“
„Nein, mein Schatz.“ Sascha nahm die Autoschlüssel vom Regal. „Ich seh mir nur schnell die Leiche an, finde die richtigen Spuren, überführe den Täter und bin in einer Viertelstunde zurück! Bis nachher.“
Er eilte so rasch aus der Wohnung, dass er ihre Antwort kaum mitbekam. Er hörte auch nicht wirklich zu. Kurz darauf fuhr er die Langemarckstraße hinunter und entschied sich für den Weg über die Kennedy-Brücke.
Um Viertel nach acht traf Sascha in der Franzstraße ein. Alte, zum Teil dreistöckige Häuser, Bäume zu beiden Seiten der schmalen Einbahnstraße. Es war bedeckt, aber noch warm draußen.
Ein uniformierter Kollege stand in der Haustür und ließ ihn vorbei. Der Flur war nicht groß, aber furchtbar gediegen eingerichtet. Genau wie das Wohnzimmer, dunkle Eiche, beige-braune Polstermöbel, Nippes auf Schränken und Regalen, Häkel- und Brokatdeckchen. Ein leicht muffiger Geruch hing in der Luft.
Was überraschte, war das Bügelbrett mitten im Zimmer. Ein paar gebügelte und gefaltete Wäschestücke lagen auf dem gekachelten Couchtisch, ein halbvoller Wäschekorb stand auf einem der Sessel.
Walter von der Forensik, der im Raum nach Fingerabdrücken und anderen Spuren suchte, wandte sich um. Seine ausdrucksvollen Augen mit den langen, dunklen Wimpern strahlten immer verdächtig, wenn er Sascha sah. „Hallo! Andreas ist oben bei der Leiche.“
Warum Walter stets im dunkelgrauen Anzug antrat, wusste Sascha nicht. War er womöglich ein Undercover-Agent von FBI, CIA oder CSI Miami?
„Danke.“ Sascha federte die Treppe hoch und nahm schon von weitem ein pink-rotes Flirren wahr. Es stammte natürlich von Peers kurzärmeligem Hemd, in dem er sich im Badezimmer über einen am Boden liegenden Körper beugte.
Sascha trat näher. Rechts, am Waschbecken, stand Andreas und unterhielt sich mit einem gedrungenen, pummeligen Mann mit grauem Kinnbart, Goldrandbrille und wenig Haar, der ebenfalls einen tadellos sitzenden, dunkelgrauen Anzug trug. Als Andreas Sascha bemerkte, stellte er sie einander vor und fasste die ersten Erkenntnisse zusammen.
„Das ist mein Kollege Sascha Piel von der Mordkommission, und das ist Herr Bach, der Sohn der ermordeten Hedwig Bach.“ Man nickte sich zu. „Herr Bach hat seine Mutter jeden Abend angerufen, um zu hören, wie es ihr geht. Aber heute ging sie nicht ans Telefon, also ist er sofort hierher gefahren und hat seine Mutter im Bad gefunden.“ Andreas wies auf die Leiche neben der Toilette. „Zunächst dachte er, sie sei gefallen und unglücklich mit dem Kopf aufgeschlagen, aber –“
„Genau“, fiel Bach Andreas einfach ins Wort. Er sprach leise und schnell. „Aber dann dachte ich an das viele Geld, das Mutter im Haus hat, und hab im Tresor nachgesehen. Es müssen über 6000 Euro gewesen sein, und die sind weg. Natürlich hab ich Schlüssel und Tresortür mit einem Tuch angefasst. Wegen der Fingerab – “
„Äußerst umsichtig!“, lobte Andreas übertrieben. „Ich hatte Sie gerade gefragt, ob Sie Schulden haben, Herr Bach.“
„Und ich meine, ich hätte schon nein gesagt.“
„Was machen Sie beruflich?“, mischte sich Sascha ein.
Wurde der Mann nicht zwei Zentimeter größer, als er antwortete? „Ich bin Rechtsanwalt und verdiene genug.“
„Ja, finde ich auch“, brummte Sascha und wandte sich der Leiche zu.
Sie lag halb verdreht vor der Toilette, deren Deckel und Brille hochgeklappt waren. Die Vorderseite der WC-Schüssel war blutverschmiert.
Peer, der neben der Toten kniete, wandte den Kopf und lächelte Sascha mit seinen extrem hellblauen Augen an. „Ah, hallo, der Meister persönlich! Wann ist es denn so weit?“
„Wenn du meinen Sohn meinst, der kann jeden Tag kommen.“
„Aha.“ Peer deutete auf die Kopfwunde der toten Frau. Ihr Gesicht konnte man kaum erkennen, weil Blut und noch etwas anderes darüber gelaufen war, von der Stirn her, deren Knochen leicht auseinander klaffte. „Das hier passiert eher nicht bei einem simplen Sturz. Jemand hat Frau Bachs Kopf mehrmals gegen die Schüssel geschmettert. Meine erste Schätzung: sie ist seit zwei bis drei Stunden tot.“
Sascha hörte jemanden die Treppe heraufkommen. Wilfried, der Einbruchsexperte. Er trat ins nunmehr überfüllte Badezimmer und verkündete in seiner bedächtigen Art, indem er seine Blicke durch die dicke Brille umherschweifen ließ: „Ich konnte nirgendwo Einbruchsspuren finden. Alle Türen und Fenster sind intakt und der Tresor auch.“
„Woher wusste der Täter, wo der Tresorschlüssel ist? Hier sieht’s nicht so aus, als wär alles durchsucht worden“, bemerkte Andreas.
„Vielleicht hat er meine Mutter bedroht oder misshandelt, damit sie ihm den Schlüssel rausgibt.“ Bach machte ein entsetztes Gesicht, als er sich die Situation vorstellte, doch plötzlich wurde er energisch. „Kommen Sie mir jetzt nicht mit dem Argument, sie hätte den Täter gekannt – Sie wissen doch selbst, wie raffiniert sich Trickbetrüger Zutritt zu den Wohnungen älterer Menschen verschaffen! Obwohl ich sie mehr als einmal gewarnt habe, keine Fremden reinzulassen! Ich hab meine Mutter jedenfalls nicht umgebracht!“
Ja, das hatten schon ganz andere behauptet, erinnerte sich Sascha. „Warum hatte Ihre Mutter so viel Geld im Haus?“
„Sie wollte einem ihrer Enkel ein Auto zu Weihnachten schenken, und wahrscheinlich hat sie sich monatlich was zurückgelegt, zu den Banken hatte sie nämlich kein Vertrauen mehr“, erklärte Bach. „Sie hat eine ordentliche Rente und Geld aus Mieteinnahmen.“
Andreas rückte seine filigrane Metallbrille zurecht. „Wir haben Monatsanfang. Wissen Sie, ob Ihre Mutter heute eine größere Summe von der Bank geholt hat?“
„Kann sein. Denken Sie, der Täter hat sie dabei beobachtet? Und ist ihr sogar bis nach Hause gefolgt?“
„Alles schon vorgekommen“, bestätigte Andreas. „Wenn wir Glück haben, konnten die Kameras in der Bank was Brauchbares aufzeichnen.“
„Es ist Freitagabend“, warf Sascha ein.
„Genau, das ist doch mal ’ne Herausforderung. Versuch bitte, jemanden von der Bank aufzutreiben, der dir die Kameraaufzeichnungen mitgibt.“
Sascha verzog kurz das Gesicht, aber so übel war der Auftrag nicht: Alles war besser, als stundenlang den Launen der schwangeren Liebsten ausgeliefert zu sein! Er ließ sich von Bach den Namen der Bank seiner Mutter geben und ging nach unten, wo ihm Walter über den Weg lief.
„Fährst du schon wieder nach Hause?“ wollte dieser mit treuherzigem Augenaufschlag wissen.
„Nein, ich habe einen geheimen Sonderauftrag.“ Sascha zwinkerte ihm zu, verließ das Haus und setzte sich in den Dienstwagen. Dort telefonierte er mit der Zentrale. Der Kollege dort versorgte ihn mit einer Nummer der Frau von der Bank, mit der er sich in einer halben Stunde treffen wollte.
Schließlich rief er Annika an, um ihr zu sagen, dass er den Fall doch noch nicht gelöst habe, sondern ein Stündchen länger brauche.
„Am besten gehst du früh schlafen, und dann kaufen wir morgen was Schönes für unseren Gabriel. Was hältst du davon?“
Glücklich war sie damit anscheinend nicht, aber ihr Protest hielt sich in Grenzen.
*
Bonn, Polizeipräsidium - Samstag, 3. Mai, 9.25 Uhr
Andreas saß seit ungefähr einer Stunde an seinem Schreibtisch und suchte in den Dateien nach einschlägig vorbestraften Tätern, die für den gestrigen Raubmord in Frage kamen. Viel Auswahl hatte er nicht.
Er tippte sowieso eher auf einen Neu-Täter oder vielleicht noch eher auf einen Verwandten, Bekannten oder Nachbarn, der wusste, dass die alte Frau immer viel Geld im Haus aufbewahrte, und den Frau Bach, ohne Verdacht zu schöpfen, ins Haus gebeten hatte. Weit war Andreas jedenfalls bisher nicht gekommen. Auch die Aufzeichnungen aus den Überwachungskameras der Bank hatten nicht viel hergegeben. Nach dem Maifeiertag war die Bank regelrecht von Kunden überflutet worden, und kein einziger hatte sich, so weit Andreas das beurteilen konnte, besonders verdächtig verhalten. Während er aus dem Fenster schaute, durch das die schon warme Maisonne strahlte, dachte er ein Weilchen an Sabine, mit der er sich auf gewisser Ebene wunderbar verstand. Eine Ausnahme war sein Geburtstag gewesen, und vielleicht auch ihr Geburtstag in zwei Tagen. Er überlegte, ob er sie zum Essen einladen –
Sein Telefon klingelte. Sascha rief an. „Gibt’s was Neues in unserem Fall, das ich wissen müsste?“
„Nein, du musst schließlich nicht alles wissen.“
„Ja, mach dich nur lustig, ich bin eh schon schlecht drauf.“
„Wieso?“
„Einkaufsbummel mit Annika. Und das am Samstagvormittag!“
„Kauf dir doch zur Belohnung was Schönes. Oder geht getrennt einkaufen und dann gemeinsam was essen.“
„Annika wird sich bedanken, Herr Beziehungsexperte.“
Plötzlich hatte Andreas keine Lust mehr auf Saschas Jammerei. „Seit wann tust du alles, was Annika will?“
Das hätte er vielleicht nicht sagen sollen. Nach einer Schockpause haute Sascha ihm um die Ohren: „Das verstehst du nicht! Du warst noch nie mit einer Hochschwangeren zusammen – also red nicht so einen Scheiß!“
Andreas war sicher, Sascha würde das Gespräch erbost beenden, doch plötzlich erkundigte er sich in leicht steifem Ton: „Wie geht’s eigentlich deiner Oma?“
„Die sitzt im Rollstuhl und terrorisiert ihre Umgebung. Wenn nichts dazwischen kommt, fahr ich heute Nachmittag hin und übe wieder ein bisschen Laufen mit ihr.“
„Behauptet sie immer noch, Sabine hätte ihr ein Bein gestellt?“
„Ja, und du weißt, dass du daran nicht ganz unschuldig bist. Sie ist fest davon überzeugt, ich hätte eine Affäre mit Sabine.“
Jetzt lachte der Kerl sogar. „Dann sieh mal zu, wie du dich aus der ,Affäre‘ ziehst! Ich kann dir da nicht helfen!“
„Meine Mutter meint, wir sollten Elli in ein anderes Heim verlegen. Sie will sich nächste Woche ein paar ansehen. Mit mir.“
„Nette Freizeitbeschäftigung.“
Im Hintergrund rief jemand: „Sascha, bist du fertig? Ich will endlich fahren!“
„Stimmt“, gab Andreas zurück, „deine hört sich viel amüsanter an.“
Man wünschte sich gegenseitig einen schönen Tag und legte auf. Andreas wollte eben ein paar Überlegungen zu Papier bringen, als jemand nach zartem Klopfen die Tür öffnete und hereinkam. Die blonde Renate, mit einem Schnellhefter in der Hand.
„Wir haben eine Menge fremder Fingerabdrücke gefunden, die aber leider nicht registriert sind.“
Irgendetwas war seltsam an ihrem Gesicht. Besonders an ihrem Blick. Oder waren die Falten weniger geworden? Hatte sie wieder ein paar Kilo zugenommen? Sie sah irgendwie...überraschend gut aus. Nun starr sie doch nicht so an! Er sah auf den Hefter und streckte die Hand danach aus. „Der Bericht von Peer?“
„Ja, unter anderem. Die Frau ist an der schweren Kopfverletzung verstorben. Ich geh dann gleich nach Hause. Tschüss. Bis Montag.“
Andreas hob den Blick, um noch einmal gründlich Renates merkwürdiges Gesicht zu studieren, aber sie hatte sich schon abgewandt und eilte davon. Er schickte ihr ein irritiertes „Tschüss!“ hinterher.
*
Alfter-Witterschlick - Sonntag, 4. Mai, 17.30 Uhr
Der Raum war groß und sehr voll, aber halbwegs akzeptabel eingerichtet: rundum bis gut 1,20 m mit dunklen Holzpaneelen verkleidet, darüber cremefarbene Wände mit Drucken berühmter Maler. Ein Bild sah nach van Gogh aus, ein anderes nach Monet … oder wie der hieß. In der Mitte des Raums hatte man mehrere Tische zusammengeschoben, auf denen inzwischen Gläser, Flaschen und hier und da auch Teller standen.
Tabea mochte nichts essen. Manche Leute hielten sie wahrscheinlich für magersüchtig, doch das war sie nicht. Sie fand sich keineswegs zu dick und hätte gerne eine paar Kilos zugelegt, aber ihr Magen war so überempfindlich. Besonders die Gegenwart anderer Menschen nahm ihr oft jeden Appetit. Da brauchte nur so ein Kerl wie dieser Holger, der ständig nach Alkohol stank, neben ihr zu sitzen, und schon schnürte sich ihr derart der Magen zu, dass sie kaum noch ihr Mineralwasser herunterbekam. Oder jemand wie diese fette Yvette mit ihrem Dreifachkinn und den hässlichen Zähnen! Das fand Tabea einfach nur eklig. Genau wie diese komischen, einfach grässlichen Narben von Tina. Sie versuchte zwar immer, alles hinter ihren Haaren zu verstecken, aber Tabea hatte sie trotzdem gesehen.
Und es gab noch mehr Menschen in diesem Raum, deren Äußeres Tabeas zugegebenermaßen sehr niedrige Ekelgrenze überschritt. Von einigen kannte sie immer noch nicht die Namen: Weiter hinten im Raum saß eine Frau mit scheußlich fettigen, strähnigen Haaren, oder dort drüben ein Mann mit tiefschwarzen Rändern unter den Fingernägeln, oder dieser finstere Typ, den Benny mitgebracht hatte und dessen Namen sie sich weigerte zu behalten und auf dessen Händen und Armen sich so komische, schorfige Flecken breitgemacht hatten. Wenn sie nur an ihn dachte, kam ihr fast das Mittagessen hoch!
Als sie einen Würgereiz verspürte, konzentrierte sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf Jonas, der im rechten Winkel zu ihr unter einem verschwommen wirkenden Werk in Pastellfarben am Kopfende des Tisches saß.
Anscheinend hatte er sie schon länger beobachtet. Als sie ihm in die graugrünen Augen schaute, schenkte er ihr ein liebevolles Lächeln. Tabea lächelte verlegen zurück. Das hatte Tina, die gleich links von ihm saß, mitbekommen, denn sie berührte Jonas am Arm und fing an, sich mit ihm zu unterhalten. Der hatte sich ihr auch sofort zugewandt!
Wegen des Geräuschpegels im Raum konnte Tabea nicht viel von dem verstehen, was Tina sagte, aber sie konnte deutlich sehen, wie sie den Mann mit Blicken verschlang. Dieses ordinäre Weibsbild musste aufgehalten werden!
Aber fast noch übler war Tinas alternde Arbeitskollegin Gerlinde, die sich heute einen Platz an Jonas’ anderer Seite erkämpft hatte. Sie glaubte doch tatsächlich, Chancen bei ihm zu haben! Mit ihrer spießigen 08/15-Kleidung und ihrer biederen Frisur! Sie war –
Jonas erhob sich und bat um Ruhe. Trotzdem dauerte es eine gute Minute, bis die Aufforderung bei allen im Raum angekommen war. Doch dann herrschte absolute Stille. Alle Gesichter waren zu Jonas gedreht, der die Fingerspitzen seiner zarten, gepflegten Hände zusammenlegte und mit seiner kräftigen und zugleich sanften Stimme anhob: „Liebe Freunde und Mitstreiter! Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Seit unserer Gründung vor drei Monaten hat unsere Gemeinde viele Gläubige hinzugewinnen können.“
Allerdings. Das konnte man riechen. Tabea zog vorsichtig Luft durch die Nase. Vielleicht sollte mal jemand ein Fenster öffnen!
„Euch ist sicher aufgefallen, dass es allmählich eng wird in den Gasträumen, in denen wir uns treffen. In einem Jahr, vielleicht schon früher, werden wir einen richtig großen Saal anmieten müssen, und das wird teuer. Deshalb habe ich darüber nachgedacht, ob wir unser Geld nicht lieber dafür ausgeben, uns ein eigenes Gemeinde-Zentrum zu bauen, mit Halle und allem, was dazugehört.“
Ein Moment überraschter Stille. Dann ging die Diskussion los. Tabea war natürlich von Jonas´ Vorschlag begeistert. Klang das nicht ganz danach, dass der Mann plante, endlich sesshaft zu werden? Hier in Bonn, an der Seite von Tabea Römer?!
Sie sah sich um: Tina lächelte zufrieden. Sie wirkte, als habe sie längst von Jonas’ Idee gewusst. Das entfachte sofort wieder ihre Eifersucht. War die Frau blind? Sah sie nicht, dass sie einen anderen Verehrer hatte? Konnte sie Jonas nicht denen überlassen, die ihn mehr brauchten?!
Unwillkürlich wandte sich Tabea nach rechts. Zwei Plätze weiter saß dieser vollbärtige Waldschrat, der die meiste Zeit nur Augen für Tina hatte. Im Moment machte er ein noch missmutigeres Gesicht als sonst. Dass sich Jonas in Bonn niederlassen wollte, schien ihm in keinster Weise in den Kram zu passen.
Wenn sich da nicht eine Tragödie anbahnte!
*
Gottfried war in den Anblick von Tinas Profil vertieft, als er merkte, dass er beobachtet wurde. Er sah sich um und blickte in die blaugrünen Katzenaugen der mageren Tabea. Sie wusste, was los war. Ärger stieg in ihm hoch. Was ging sie das an?!
Andererseits – sie war genauso hinter Jonas her wie Tina, vielleicht sollte er sie zu seiner Verbündeten machen. Er schenkte ihr den Hauch eines Lächelns. Hoffentlich verstand sie das nicht falsch. Wenigstens sah sie woanders hin.
Zurück zu Tina. Sie würden perfekt zusammenpassen, sie war keine Schönheit, aber eine Persönlichkeit. Die meisten Leute in diesem Raum hatten sich im Lauf der letzten Monate ihre Lebensgeschichten erzählt: Hier war definitiv das geballte Elend der ganzen Gegend versammelt.
Es wurmte Gottfried, dass Tina so gar nicht zu begreifen schien, was er für sie empfand. Vielleicht tat sie auch nur so, weil sie ihn für langweilig hielt. Für dumm. Für verschroben. Vielleicht sogar für verrückt.
Doch wirklich verrückt waren hier einige andere! Dieser Holger zum Beispiel, der neben Tabea saß und praktisch den halben Saal mit seiner Fahne belästigte. Dieser Mann hatte die buschigsten Augenbrauen, die Gottfried je gesehen hatte. Er schien zu glauben, dass niemand bemerkte, wie er immer wieder unter den Tisch schaute, vor die Tür ging oder auffällig unauffällig mit den Augen die Wände und Decken (laut Ehefrau Fiona) nach Kameras und Abhörgeräten absuchte.
Keine Drogen, lautete eine von Jonas´ Regeln. Für Holger galt das anscheinend nicht. Wahrscheinlich verstand er die Regeln gar nicht, weil der Alkohol ihm schon das Hirn zerfressen hatte. Was mochte bloß in so einem Kopf vorgehen?
*
Kopfschmerz, leichte Übelkeit, Verärgerung. Holgers Körper verlangte nach einem Schnäpschen. Aber das ging ja hier nicht. Was machte er überhaupt hier?
Holger griff nach dem Kaffeelöffel (so weit war es schon – seine Finger zitterten!) und rührte vehement den Kaffee um. Er war wegen seiner Fiona hier. Vielleicht auch deshalb, weil man in der großen Gruppe schön untertauchen konnte. Falls es nicht auch hier Spione (oder Teufel) gab.
Holger ließ, wie aus Versehen, den Kaffeelöffel zu Boden fallen, was beim momentanen Geräuschpegel nicht weiter auffiel, bückte sich und schaute rasch unter den Tisch: da war niemand. Als er wieder hochkam, fing er einen mahnenden Blick von Fiona auf, die ein paar Tische weiter weg zwischen mehreren älteren Frauen saß.
Er lächelte schwach, legte den Löffel hin und strich mit den Fingern über seine buschigen Augenbrauen. Dann lehnte er sich auf dem Stuhl zurück und schaltete auf abwesend. Trotzdem bekam er am Rande mit, worüber diskutiert wurde: über ein neues Gemeindezentrum, und woher man das Geld dafür nehmen sollte.
Das war ihm so was von herzlich egal. Warum erzählte Jonas nicht was über den Teufel? Das fand er hochinteressant, das hatte sich in seinem Kopf festgesetzt und war nicht wieder von alleine herausgefallen wie so vieles andere. Natürlich musste er höllisch aufpassen, dass er nicht mit falschen Informationen gefüttert wurde, denn wer weiß, vielleicht gehörte ja Jonas selbst zu ihnen.
Aber das, was Jonas jetzt sagte, interessierte Holger nicht. Also ließ er sich berieseln. Etwa eine halbe Stunde später aber hatte er das dringende Bedürfnis, aufzustehen, sich durch die sitzenden Leute zu quetschen und vor die Tür zu gehen.
Dort sah er erstens nach, ob niemand an der Tür lauschte, und zweitens ließ er sich an der Theke im eigentlichen Lokal einen doppelten Korn ausschenken.
*
Benjamin schaute Holger mit leicht verächtlichem Blick hinterher. Der alte Saufkopf würde sich doch garantiert draußen einen hinter die Binde gießen! Schwächling! Er hingegen, Benjamin Fiedler, fühlte sich stark, denn er hatte es geschafft. Seit zwei Jahren war er clean! Und er würde es auch bleiben!
Gerade ertönte wieder Jonas´ Stimme: „Gut, meine Freunde, wir sind uns also einig. Wir werden von nun an auf ein Gemeindezentrum hinsparen und das, was wir entbehren können, auf ein gemeinsames Treuhandkonto einzahlen.“
Davon hielt Benjamin nicht viel. Sein Ausbildungsgeld war nicht wirklich üppig. Ab und zu eine Zwei-Euro-Spende – mehr war nicht drin.
Andererseits fühlte er sich wohl in der Gemeinde. Es tat ihm gut, hier zu sein. Denn manchmal klopfte die Versuchung doch auch an seine Tür. Er war den Teufel in sich noch nicht ganz losgeworden, aber er gab sich immerhin die allergrößte Mühe. Nicht so wie Holger. Oder ein paar andere Leute. Die würden es nie schaffen, ihr Leben zu ändern und glücklich zu werden.
Was hatte Jonas neulich gesagt?
Wer immer wieder den gleichen Versuchungen erliegt, wird nie zu seinem inneren Kern vorstoßen, wird nie ein freier, guter und glücklicher Mensch werden. Er könnte genauso gut auch tot sein.
*
Bonn-Geislar - Sonntagabend, 21.45 Uhr
„Mensch, Manni, du warst auch schon fitter!“, lachte Gerd, stellte die beiden Eiweiß-Drinks auf dem Tischchen ab und setzte sich.
„Ach, komm schon, du warst auch ganz schön am Japsen!“, stellte Manfred klar und trank ein paar Schlucke von dem kalten Zeug. „Aber das ging heute schon viel besser als die letzten Male.“
Trotzdem hatte er das Gefühl, dass sein Gesicht glühte und dass seine Beine überanstrengt waren, als sei er einen Marathon gelaufen. Hoffentlich schaffte er es noch mit dem Fahrrad bis nach Hause. Das hatte man davon, wenn man drei Monate keinen Sport machte!
Sie saßen draußen, mit Blick auf die Tennisplätze, auf denen es jetzt ruhiger wurde. Es dämmerte allmählich, und Manfred wartete auf Brigittes Anruf. Kurz nach zehn Uhr war es so weit. Sein Handy klingelte, und Brigitte fragte nach, wann er denn zu Hause sei.
„Spätestens um Viertel vor elf, wenn kein Stau ist.“
Gerd, der ihm gegenübersaß, grinste.
„Ja, klar hab ich Licht am Fahrrad. Nein, ich hab keinen Alkohol getrunken. Ja, ich weiß, dass ich morgen um halb sieben aufstehen muss! Ja, bis gleich!“ Manfred legte das Handy beiseite. „Warum müssen Weiber immer nerven?“
Auf dieses Thema stieg Gerd gleich ein. Sie schimpften über nörgelnde Frauen, die ständig alles kontrollieren mussten, das sauer verdiente Geld der Männer zum Fenster hinaus warfen und auch noch immer Recht haben wollten. Das Übliche eben. Bis Manfred sich auf die Oberschenkel schlug und meinte: „So, jetzt muss ich aber.“
Er zog sich schnell um, setzte sich auf sein neues, teures Fahrrad und machte sich auf den Weg Richtung Schwarzrheindorf.