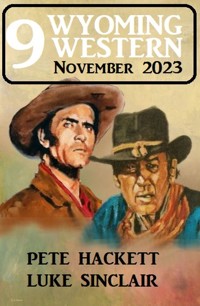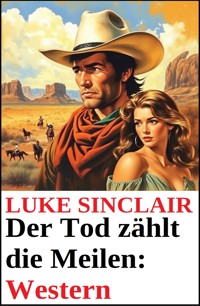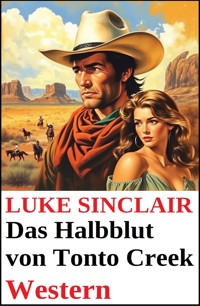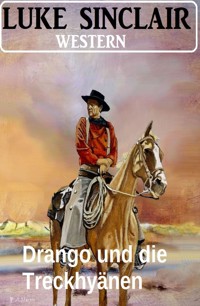Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Nur Larry durchschaute sein blutiges Spiel“ Der Gaul wieherte schrill und knickte in der Hinterhand ein, als der Reiter ihn zurückriss. Flynn hatte gerade noch Zeit, die Beine hochzureißen, damit er nicht unter das stürzende Pferd geriet. Er zog das Tier mit harter Hand auf die Seite und riss das Gewehr aus dem Scabbard. Er wartete darauf, dass der Staub zur Seite wehte und ihm die Sicht freigab. Er wusste, dass der Gaul nicht mehr aufstehen würde. Denn er hatte das dumpfe Klatschen der Kugel gehört, als sie in den Pferdeleib geschlagen war. Das Bellen der Schüsse hatte jetzt aufgehört, aber das Geschrei war noch da. Sie kamen, um einen weißen Mann zu töten und seinen Skalp und seine Waffen zu nehmen, wie sie das schon viele Male getan hatten. Flynn hatte schon seit Stunden gespürt, dass sie da waren; sein Instinkt hatte es ihm gesagt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luke Sinclair
Der Teufel mit dem Stern: Wichita Western Roman 140
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Der Teufel mit dem Stern: Wichita Western Roman 140
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Der Teufel mit dem Stern: Wichita Western Roman 140
Luke Sinclair
„ Nur Larry durchschaute sein blutiges Spiel“
Der Gaul wieherte schrill und knickte in der Hinterhand ein, als der Reiter ihn zurückriss. Flynn hatte gerade noch Zeit, die Beine hochzureißen, damit er nicht unter das stürzende Pferd geriet. Er zog das Tier mit harter Hand auf die Seite und riss das Gewehr aus dem Scabbard. Er wartete darauf, dass der Staub zur Seite wehte und ihm die Sicht freigab. Er wusste, dass der Gaul nicht mehr aufstehen würde. Denn er hatte das dumpfe Klatschen der Kugel gehört, als sie in den Pferdeleib geschlagen war.
Das Bellen der Schüsse hatte jetzt aufgehört, aber das Geschrei war noch da. Sie kamen, um einen weißen Mann zu töten und seinen Skalp und seine Waffen zu nehmen, wie sie das schon viele Male getan hatten. Flynn hatte schon seit Stunden gespürt, dass sie da waren; sein Instinkt hatte es ihm gesagt.
Aber was hätte es für einen Sinn gehabt, umzukehren? Wenn er genug Munition hatte und eine gute Deckung, konnte er es vielleicht eine Weile aushalten. Larry Flynns einzige Deckung war nur sein sterbendes Pferd.
Jetzt konnte er sie auch sehen: Eine wilde Horde mit dem fanatischen Willen, zu töten, mit bemalten Gesichtern und flatternden Haaren und bunten Federn an Lanzen und Gewehren.
Ein zügelloser Haufen auf zähen, staubigen Pferden. Sie mussten ihn bereits für geschlagen halten, denn sie ritten direkt in sein Feuer.
Den vordersten Reiter fegte Flynn mit einer Kugel vom Pferd. Ohne genau zielen zu können, jagte er die Kugeln so schnell aus dem Lauf, wie er den Repetierbügel vor und zurück reißen konnte.
*
Eines der Pferde überschlug sich in einer Wolke von Staub. Ein anderes stolperte darüber und schmetterte seinen Reiter auf den Boden. Larry Flynn feuerte pausenlos in das Gewirr von Staub, Pferde- und Menschenleibern. Einer der Apachen schoss einen Pfeil ab, der sich mit dumpfem Schlag in den Pferdekörper bohrte. Das todwunde Tier bäumte sich hoch und schleuderte Flynn zurück. Das Gewehr glitt ihm fast aus seinen schweißnassen Händen. Ein Apache rannte zu Fuß gegen ihn an. Flynn hob das Gewehr und krümmte den Finger, aber die Waffe war leer. Flynn ließ sie fluchend fallen und riss den Revolver heraus. Die Kugel traf den Apachen mitten in die Brust und warf ihn in den Staub.
Nur fünf Kugeln noch blieben Flynn — und sein Messer.
Aber die Apachen brachen ihren Sturm in diesem Moment plötzlich ab. Sie rissen ihre Pintos herum, spritzten auseinander und versuchten, die Kiefern beiderseits des staubigen Weges zu erreichen. Sie hassten es, in gezieltes Feuer zu laufen und liebten von jeher den Hinterhalt und den überraschenden Angriff.
Eine Atempause für Flynn, aber er wusste, dass sie wiederkommen würden.
Er steckte den Revolver ein und hob das Henry-Gewehr auf. Er verbrannte sich die Finger an dem glühendheißen Lauf, aber er achtete nicht darauf. Hastig schob er neue Patronen in das Röhrenmagazin. Dabei blickte er immer wieder zu den Kiefern hinüber. Er konnte hier nicht bleiben, denn sie würden ihn einkreisen.
Er angelte nach der Wasserflasche und schaute zu der niedrigen Felsbarriere, die den Blick zum Horizont versperrte. Dort konnte er sich unter Umständen eine Stunde länger halten.
Er rannte los, solange noch Hoffnung bestand, die Felsen zu erreichen. Aber er hatte sich getäuscht. An ihrem Geschrei hörte er, dass sie wieder hinter ihm her waren. Und jetzt hatte er nicht einmal mehr das tote Pferd als Deckung. Er blieb stehen und drehte sich um. Breitbeinig, das Gewehr in den Händen, stand er auf dem staubigen Weg und wartete auf sie, bereit, zu töten und zu sterben.
Einen schoss er noch nieder. Den nächsten konnte er nur noch mit einem Kolbenhieb vom Pferd holen. Er wich einer Lanze aus, prallte gegen den Pferdekörper und wurde zur Seite geschleudert. Er bekam eines der reiterlosen Pferde zu fassen und wollte sich auf dessen Rücken schwingen. Das Tier scheute. Er stolperte, und seine Füße schleiften über den Boden. Eine Hand umklammerte noch immer das Gewehr. Das Geschrei war rings um ihn. Die Indianer spielten Katz und Maus mit ihm.
Schließlich gelang es ihm dennoch, auf den Rücken des Gaules zu kommen, und er richtete sich auf. Er drosch den stählernen Lauf seines Henry-Gewehres in eines der bemalten Gesichter und stieß dem Gaul rücksichtslos die Sporen in die Flanken. Das Pferd wieherte schrill und raste los. Jemand versuchte, ihn aufzuhalten. Er duckte sich. Der Anprall warf ihn auf den Hals des Apachenponys und traf das andere Pferd direkt in die Seite. Es stürzte wiehernd in den Staub. Flynn setzte darüber hinweg und trieb das von panischem Schrecken erfasste Tier in das offene Land hinaus.
Sie kamen hinter ihm her, sich gegenseitig mit lauten Schreien anfeuernd. Jetzt begann es ein Spiel zu werden, das ihnen Spaß bereitete. Eine Menschenjagd, bei der sie Geschicklichkeit und Ausdauer beweisen konnten. Ein Spiel, das bereits bei halbwüchsigen Kriegern sehr beliebt war. Nur für Leslie Flynn war es eine Jagd auf Leben und Tod.
Apachen verstanden es, auch das Allerletzte aus einem Pferd herauszuholen und die Kräfte eines Tieres bis zum völligen Zusammenbruch genau einzuschätzen. Flynn blieb nichts anderes übrig, als sein Tier ebenso schonungslos zu hetzen. Aber so sehr er sich auch abmühte, seine Verfolger kamen näher. Zwei überholten ihn an der rechten Flanke und drängten ihn in Richtung eines seichten Höhenrückens ab. Flynn war überzeugt, dass sich dort weitere Apachen befanden, aber er konnte nichts anderes tun, als ihrem Druck nachzugeben.
Das Tier unter ihm keuchte, und seine Lungen pumpten wie ein Blasebalg. Der Höhenrücken schob sich links an ihm vorbei, und wie er erwartete, tauchten dort plötzlich drei Reiter auf, die schreiend ihre Waffen schwenkten und ihn zu den anderen Flankenreitern zurückzutreiben versuchten. Auf diese Weise wollten sie ihn hetzen, bis sein Gaul zusammenbrach.
Flynn setzte hart die Sporen ein und hielt auf ein Kieferngehölz zu, das etwa eine Meile entfernt war.
Schüsse knatterten zu ihm herüber, aber aus dem vollen Lauf ihrer Gäule heraus trafen sie natürlich nicht. Das Pferd unter Flynn wurde bereits langsamer, der Atem scharf und heiser, und es war mindestens noch eine halbe Meile bis zu jenem Gehölz.
Die beiden Flankenreiter schoben sich dicht an ihn heran. Sie besaßen die schnellsten und ausdauerndsten Pferde, und Flynn hatte offenbar nicht eines der besten erwischt. Aber er ließ sich von ihnen nicht wieder nach der anderen Seite zurückdrängen. Er feuerte einen Schuss auf sie ab, und sie vermieden es, noch näher zu kommen. Sie schienen zu wissen, dass sein Gaul früher oder später doch den Kürzeren ziehen musste. Flynn war nicht imstande, noch mehr aus dem Indianerpony herauszuholen, auch war er den primitiven hölzernen Apachensattel nicht gewöhnt.
Es waren noch etwa zweihundert Yard bis zu jenem Kieferngehölz, als der Gaul in irgendein Loch trat und stürzte. Flynn flog durch die Luft und knallte auf den Boden. Irgendwo prallte seine Wasserflasche gegen einen Stein. Der Gaul überschlug sich, und Flynn rollte durch den Staub außer Reichweite der schlagenden Hufe. Ein paar Augenblicke blieb er benommen liegen, dann hob er den Kopf.
Sie waren jetzt schon ziemlich nahe. Er packte sein Gewehr und sprang hoch. Eine Lanze knirschte neben ihm in den harten Boden und blieb leicht schwingend darin stecken. Er feuerte einen hastigen Schuss ab, traf aber nicht. Der Reiter schwenkte ab und beschrieb einen Bogen. Im Laufen raffte Flynn seine Wasserflasche vom Boden auf und ging hinter einem Stein in Deckung.
Die Apachen trieben ihre Pintos wild hin und her. Ihre Schreie klangen wie das Gekläffe einer erregten Hundemeute, die einen verwundeten Bären gestellt hat. Flynn feuerte rasch hintereinander, um ihnen zu zeigen, dass er nicht gewillt war, ihnen irgendeine Chance zu geben. Aber er konnte die sich schnell bewegenden Ziele nicht treffen. Sein Atem ging keuchend, und die Hände zitterten ihm von der Anstrengung des harten Rittes. Der Pulverdampf seiner eigenen Waffe wehte ihm beißend ins Gesicht. Es war nur noch eine Frage von Augenblicken, bis sie ihn hatten.
Er stellte das Feuer ein, um die wenigen Patronen, die ihm noch verblieben, nicht nutzlos zu vergeuden. Mit rasselndem Atem wartete er, dass sie seine Deckung umgehen und ihm in den Rücken kommen würden.
Ein junger Krieger hielt sein Gewehr mit der rechten Hand über den Kopf und stieß es mit ruckartigen Bewegungen immer wieder nach oben. Dabei schrie er schrill und bellend und drehte sein schnaubendes Pferd im Kreis, bis der aufsteigende Staub ihn fast einhüllte. Dann preschte er plötzlich los, seinen Gaul hart mit den Fersen bearbeitend. Sein Geschrei war schrill und entnervend, besonders wenn man allein war und die Munition bald ausging.
Jetzt wurde es ernst für Flynn. Dieser junge Krieger war in eine gefährliche Kampfeshysterie verfallen, und er riss die anderen mit. Dem Sieger gehörte der Ruhm, der Skalp und die Beute. Dem Besiegten blieb nur der Tod, namenlos irgendwo in der Weite der Wüste.
Der feine Sand knirschte, als Leslie Flynn seine Zähne hart aufeinander presste und das Gewehr hob. Aber er konnte den Apachen nicht treffen, da er sich tief auf sein Pferd duckte. Flynn musste den Gaul erschießen. Der Apache schnellte sich wie eine Eidechse von dem stürzenden Pferd weg und rannte auf Flynn zu. Die Kugel verfehlte ihn um Haaresbreite. Flynn riss den Bügel seiner Henry vor und ließ ihn zurück schnappen. Die leere Hülse sprang rauchend aus dem Schloss, und schon riss er den Abzug durch. Aber der Schuss blieb aus. Es machte nur klick.
Flynns Lippen pressten sich aufeinander. Der Apache sprang vor ihm hoch, und ein Schuss riss ihn zu Boden, schleuderte seinen zuckenden Körper in den heißen Sand. Wer hatte diesen rettenden Schuss abgefeuert?
Verblüfft fuhr Flynn herum und erblickte zwei Reiter, die aus dem Gehölz hervorbrachen und auf ihn zuhielten. Zuerst glaubte er, dass eine Sinnestäuschung ihn narrte, aber da lag der tote Apache vor ihm, und die anderen schwenkten ab und verschwanden zwischen den Felsen.
Wenn diese beiden Reiter allein waren, dann mussten sie verrückt sein, sich auf so etwas einzulassen. Noch immer fassungslos starrte Flynn ihnen entgegen. Beide ritten kräftige Tiere und kamen rasch näher.
„He“, schrie der eine, „worauf wartest du denn noch, Mann?“ Er nahm einen Fuß aus dem Steigbügel und streckte Flynn die Hand entgegen. „Mach schon, damit wir von hier verschwinden können!“ Er blickte dorthin, wo die Apachen verschwunden waren. „Die lieben keine derartigen Überraschungen, aber sie werden wiederkommen, sobald sie sich gefasst haben.“
Flynn grapschte nach seinem Wasserbehälter, lief auf den Reiter zu und zog sich hinter ihm auf das Pferd. Ein großer Brauner mit kräftigen Muskeln. Der große Mann, der vor Flynn im Sattel saß, war ein kräftiger Kerl, der bereits zu Fettansatz neigte. Er gab dem zweiten Mann mit dem Gewehr einen Wink, voranzureiten, und zog dann den Braunen herum.
„Jeaah!“ Sie galoppierten auf das Kieferngehölz zu.
Inzwischen hatten die Apachen sich von ihrer Überraschung erholt, die durch das Auftauchen der fremden Reiter entstanden war, und setzten ihnen nach.
„Sie kommen“, knirschte der Mann vor ihnen, nach einem Blick über die Schulter.
„Wir werden ihnen gleich einheizen“, sagte der andere, der mit Flynn zusammen auf dem Pferd saß. „Da vorn zwischen den Bäumen haben wir Deckung.“
Sie sprangen von den Pferden, als sie den Rand des Gehölzes erreicht hatten. Flynn hielt sein Gewehr hoch. „Habt ihr noch ein paar Kugeln für das Ding da übrig?“
„In meinen Satteltaschen“, sagte der große Mann und lud seine Waffe durch. Erst jetzt bemerkte Flynn, dass er einen Stern an seinem verschwitzten grauen Hemd trug.
Seine beiden Retter eröffneten das Feuer, während Flynn sich zwei Hände voll Patronen vom Kaliber 44—40 in die Hosentasche schob. Erst dann lud er mit schnellen Fingern seine Henry.
Das schnelle Feuer der Repetiergewehre trieb die Apachen zurück. Es war nicht die Art des Kampfes, die ihnen gefiel, und sie unternahmen keinen weiteren Versuch, gegen das Kieferngehölz anzustürmen. Sie hatten Zeit, auf ihre Stunde zu warten.
Flynn wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Danke“, sagte er, „ihr seid im richtigen Augenblick gekommen.“
„Du brauchst dich nicht zu bedanken“, erwiderte der Mann mit dem Stern, ohne Flynn dabei anzusehen. Er hatte nur seinen Gefährten im Auge. „Wir haben das nicht getan, weil du uns leid getan hast, sondern weil wir im selben Boot sitzen. Ich dachte mir, drei Gewehre haben eine bessere Chance gegen die Roten als zwei. Und entdeckt hätten sie uns sowieso. Es ist besser, wenn wir für die nächste Zeit zusammenbleiben.“
Flynn schaute auf das trockene, heiße Land hinaus und nickte.
„Wir haben sie erst einmal zurückgeschlagen“, fuhr der Mann mit dem Stern fort. „Für’s erste werden sie uns wohl in Ruhe lassen.“ Er richtete sein Gewehr auf seinen Begleiter, den er unentwegt beobachtet hatte. „Du wirst mir den Schießprügel erst einmal wiedergeben.“
Der andere Mann warf das Gewehr auf den Boden und sagte: „Vor wem hast du wohl mehr Angst, Keenan, vor den Apachen oder vor mir?“
„Heb es auf!“, sagte der Mann mit dem Stern nur.
„Ich denke nicht daran. Und was willst du jetzt tun?“
Ohne den Mann aus den Augen zu lassen angelte Keenan unter seiner Deckenrolle eine kurze Eisenkette hervor, an deren Enden Handschellen befestigt waren. Er warf sie dem andern zu und sagte: „Los, erst die eine Seite!“
Der Mann schaute erst auf Flynn und dann auf Keenan und ließ unschlüssig die Kette in der Hand baumeln. Er schien zu überlegen, wie Flynn sich wohl bei der Sache verhalten würde.
„Wenn es nicht anders geht, bringe ich dich auch tot zurück“, sagte Keenan fast beiläufig.
Der Mann ließ die eine Eisenschelle um sein linkes Handgelenk schnappen, und Keenan besorgte den Rest mit ein paar schnellen Griffen. Dann wandte er sich Flynn zu.
„Ich bin Sheriff Keenan“, sagte er ruhig, „und mit meinem Gefangenen auf dem Weg nach Little Creek.“
„Chuck Bennet“, nickte der andere und fragte ironisch: „Kennst du Little Creek? Ein geradezu reizendes Städtchen.“
Keenan wandte sich zu ihm um. Mit einer schnellen Bewegung packte er die Kette und riss sie mit einem harten Ruck zu sich heran. Chuck Bennet stolperte nach vorn, und der zweite Ruck ließ ihn auf die Knie fallen.
„So, und jetzt gibst du mir das Gewehr hoch!“
Chuck Bennet hockte vor Keenan im Staub und starrte auf seine blutigen Handgelenke. Sein Mund war nur noch ein dünner, blasser Strich. Aber er schluckte es, er hatte keine andere Wahl. Er hob das Gewehr auf und reichte es dem Sheriff.
„Das hättest du dir ersparen können“, sagte Keenan.
Chuck Bennet stand auf. Er sah Flynn an und sagte: „Jetzt hast du ihn schon ein wenig kennengelernt. Jim Keenan, Sheriff von Cole. Travis’ Gnaden.“
„Halts Maul!“, fuhr Keenan ihn an und sagte zu Flynn: „Er ist ein guter Redner, und er wird dir eine Menge Lügen erzählen, ehe wir uns wieder trennen, in der Hoffnung, dass du dich mit ihm verbündest. Aber vergiss zwei Dinge nicht, Fremder, was auch geschieht, er ist ein Mörder, und ich werde ihn nach Little Creek bringen.“
Flynn nickte. „Ich mische mich nicht gern in fremde Angelegenheiten. Aber vorläufig sind wir von Little Creek noch weit weg und sollten uns um die Apachen kümmern.“
„Vor allem brauchen wir Wasser“, sagte Keenan. „Wie viel hast du noch?“
Larry Flynn schüttelte seine Blechflasche. „Ein Drittel voll, vielleicht etwas mehr.“
Keenan machte ein unzufriedenes Gesicht.
„Er dachte, du hättest mehr“, sagte Chuck Bennet.
„Tut mir leid“, zuckte Flynn mit den Schultern. „Bis Outlaw Hole sind es noch zehn Meilen. Wenn wir dort Wasser finden, können wir es bis zu Brickers Farm schaffen.“
„Kennst du den Weg?“ fragte Keenan.
Flynn nickte nur. „Aber so lange es hell ist, können wir von hier nicht weg. Da draußen haben wir keine Chance gegen die Apachen.“
„Über Chancen wollen wir erst gar nicht reden“, knurrte Keenan. „Ist wohl besser, wir ruhen uns so lange aus und halten abwechselnd Wache.“
Er löste eine Seite von Chuck Bennets Kette, schlang sie um einen Baumstamm und schloss sie dann wieder um Bennets Handgelenk.
„Das kannst du dir sparen, Sheriff“, sagte Flynn. „Die Apachen sind seine Wächter. An ihnen kommt er nicht vorbei.“
„Ich mache nicht gern die Augen zu, wenn ein Mörder in meiner Nähe frei herumläuft.“
Chuck Bennet schnaufte verächtlich und machte es sich so bequem, wie es seine Lage ermöglichte.
Flynn übernahm die erste Wache, während Keenan sich in den Schatten legte. Die Luft war still und heiß und versetzte das Land in unwirkliche Bewegungen. Er spürte die Müdigkeit in sich aufkommen, aber er wusste, dass er wach bleiben musste. Er ging zwischen den Bäumen hindurch bis zur anderen Seite des kleinen Gehölzes. Aber auch hier war alles ruhig, fast zu ruhig.
Als er zu den anderen zurückgekehrt war, bemerkte er weit entfernt auf einer Bodenwelle drei Reiter. Sie saßen unbeweglich auf ihren Pferden und schauten zu der kleinen Baumgruppe herüber. Aber sie unternahmen nichts. Entweder wollten sie sehen, wie wachsam die weißen Männer waren, oder sie wollten sie dazu verleiten, ihre Kugeln zu verschwenden.
„Willst du ihnen nicht einen Denkzettel verpassen?“, fragte Chuck Bennet hinter ihm. Er hatte sie also auch gesehen.
„Ich warte lieber, bis sie noch näher kommen“, sagte Flynn. Er wandte sich um. Jim Keenan schlief, er musste ziemlich erschöpft sein.
„Glaubst du, sie tun dir den Gefallen?“
„Vielleicht. Wenn Apachen so deutlich zu sehen sind, dann wollen sie gesehen werden und bezwecken auch etwas damit.“
Chuck Bennet blinzelte gegen die Sonne zu ihm hoch. Seine Kette rasselte leise, als er sich bewegte, aber Keenan wachte nicht auf davon.
„Hör mal, Flynn, was dieser Sheriff dir auch erzählt, ich bin kein Mörder. Ich habe in Notwehr einen Mann erschossen, und dafür werden sie mich aufhängen.“
„Warum erzählst du das mir und nicht dem Richter?“, fragte Flynn unbeeindruckt. Chuck Bennet spuckte auf den Boden.
„Richter“, knurrte er verächtlich, „es gibt keinen Richter in dieser verdammten Stadt. Und wenn es einen gäbe, dann würde er auf Cole Travis’ Lohnliste stehen.“
Flynn deutete mit dem Gewehr auf den schlafenden Keenan. „Das da ist ein ordentlicher Sheriff und du sein Gefangener. Alles andere geht mich nichts an. Ist verdammt nicht meine Sache.“
„Eine Kanaille ist er, aber das wirst du noch merken. Er hat dich da nur herausgehauen, weil er dich braucht und weil er glaubte, du hättest mehr Wasser.“
„Ich sagte schon, es geht mich nichts an“, sagte Flynn kalt.
„Ich will ja auch gar nicht, dass du irgendetwas für mich tust. Ich will nur, dass du mir glaubst. Dass irgendein Mensch mir glaubt.“
Entweder war der Bursche wirklich unschuldig, oder er war der ausgekochteste Kerl, der Flynn je begegnet war.
„Mir kommen vor Rührung fast die Tränen“, sagte Keenan plötzlich. Er hatte also nur so getan, als schliefe er, und Flynn fragte sich im Augenblick, wer von beiden wohl gerissener war.