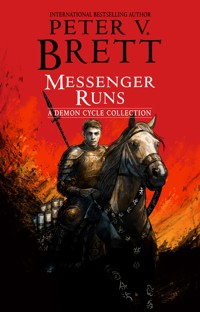13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Demon Zyklus
- Sprache: Deutsch
Der lange erwartete vierte Band von Peter V. Bretts Dämonensaga.
Die Welt der Menschen ist in Aufruhr. Nacht für Nacht steigen die Dämonen aus der Tiefe auf, um die Bewohner der Städte und Dörfer in Angst und Schrecken zu versetzen. Seit nicht nur ein, sondern zwei Männer aufgestanden sind, um gegen die finsteren Wesen zu kämpfen und die Völker der Menschen endlich zu befreien, herrscht allerdings Krieg – denn Arlen und Jardir könnten verschiedener nicht sein. Nicht einmal ein Zweikampf der beiden konnte den Zwist beenden, doch nun müssen sie sich ihrer größten Herausforderung stellen: dem Kampf gegen die Dämonenkönigin. Gemeinsam oder allein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1391
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Von Peter V. Brett sind imWILHELM HEYNE VERLAGerschienen:
Das Lied der Dunkelheit
Das Flüstern der Nacht
Die Flammen der Dämmerung
Der Thron der Finsternis
Der große Basar
Das Erbe des Kuriers
PETER V. BRETT
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der Originalausgabe:
THE SKULL THRONE
Aus dem Amerikanischen von Ingrid Herrmann-Nytko
Redaktion: Charlotte Lungstrass
Copyright © 2015 by Peter V. Brett
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Grafiken: Lauren K. Cannon
Karte: Andreas Hancock
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München,
Covermotive: unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock / Slava Gerj
Satz: Schaber Datentechnik, Wels
ISBN: 978-3-641-14076-2 V006
twitter.com/HeyneFantasySF
Für Lauren
PROLOG
Kein Sieger
333 NR – Herbst
Nein!« Inevera streckte die Arme aus und griff ins Leere, als der Par’Chin sich und ihren Gemahl über die Klippe in die Tiefe stürzte. Und dabei die Hoffnung der gesamten Menschheit mit in den Abgrund riss.
Auf der anderen Seite des Kampfplatzes stieß Leesha Papiermacher gleichfalls einen Schrei aus. Die strengen Gesetze des Rituals, die den Ablauf des Domin Sharum bestimmten, waren vergessen, als Zeugen beider Parteien an den Rand des Steilhangs rannten, sich zusammendrängten und gemeinsam in die Dunkelheit hinabspähten, die die Kämpfenden verschlungen hatte.
Mithilfe von Everams Licht konnte Inevera im Dunkeln genauso gut sehen wie am helllichten Tag, denn die Welt glitzerte im Schimmer der Magie. Doch Magie zog es dahin, wo Leben war, und dort unten gab es kaum etwas außer nacktem Fels und Erdreich. Die beiden Männer, die noch vor wenigen Augenblicken von einem Glanz umgeben gewesen waren, der so hell strahlte wie die Sonne, waren im matten Schein der Magie verschwunden, die überall an die Oberfläche strömte.
Inevera drehte ihren Ohrring, dessen eingearbeiteter hora-Stein auf das Gegenstück abgestimmt war, das ihr Gemahl trug, aber sie hörte nichts. Ahmanns Ohrring konnte außer Reichweite oder bei dem Sturz zerbrochen sein. Oder es gibt nichts mehr zu hören. Sie unterdrückte einen Schauder, als der kalte Bergwind über sie hinwegstrich.
Sie blickte auf die anderen, die sich am Rande des Abgrunds versammelt hatten, forschte in ihren Mienen, suchte nach einem Beweis für Verrat, einem Anzeichen dafür, dass einer von ihnen dies hatte kommen sehen. Sie prüfte auch die Magie, die von diesen Menschen ausging. Ihr Stirnreif aus mit Siegeln versehenen Münzen aus Elektron ließ sie nicht so flüssig Gedanken lesen, wie ihr Gemahl es mithilfe der Krone des Kaji vermochte, aber sie wurde immer geschickter darin, Gefühle zu deuten. Die gesamte Gruppe war eindeutig schockiert. Zwar gab es Unterschiede in der Intensität, doch keiner hatte damit gerechnet, dass der Kampf ein solches Ende nehmen würde.
Sogar Abban, dieser selbstgefällige Lügner, der immer etwas zu verbergen hatte, war entsetzt. Er und Inevera waren erbitterte Rivalen gewesen, hatten stets versucht, sich gegenseitig zu schaden, aber er liebte Ahmann so sehr, wie ein ehrloser khaffit es überhaupt nur konnte. Und sollte Ahmann tatsächlich tot sein, hatte Abban mehr zu verlieren als jeder andere.
Ich hätte den Tee des Par’chin vergiften sollen, dachte Inevera und sah in Gedanken wieder das arglose Gesicht des Par’chin vor sich, an dem Abend, als er mit dem Speer des Kaji aus der Wüste zurückkehrt war. Ich hätte ihn mit einer in Gift getauchten Nadel stechen können. Ich hätte ihm auch eine Viper in die Kissen schmuggeln können, während er vor dem alagai’sharak schlief. Unter dem Vorwand, er hätte mich beleidigt, hätte ich ihn auch mit meinen bloßen Händen töten können. Es war mein größter Fehler, dass ich es Ahmann überließ, ihn zu beseitigen. Tief in seinem Herzen war Ahmann zu aufrichtig, um einen Mord oder Verrat zu begehen, auch wenn das Schicksal von Ala auf dem Spiel stand. War. Sie benutzte bereits die Vergangenheitsform, und dabei war er erst seit wenigen Augenblicken verschwunden.
»Wir müssen sie finden.« Jayans Stimme klang meilenweit entfernt, obwohl ihr ältester Sohn direkt neben ihr stand.
»Ja«, stimmte Inevera zu, deren Gedanken immer noch wild durcheinanderwirbelten. »Obwohl es im Dunkeln schwierig sein wird.« Schon hallten die Schreie der Winddämonen von den Klippen wider, untermalt vom tiefen Grollen der in den Bergen heimischen Steindämonen. »Wenn ich die hora auswerfe, werden sie uns führen.«
»Zum Horc mit dieser Warterei!«, schrie die Jiwah Ka des Par’chin, drückte mit den Schultern Rojer und Gared beiseite, warf sich auf den Bauch und schwang die Beine über den Rand der Klippe.
»Renna!« Leesha wollte nach ihrem Handgelenk greifen, aber Renna war zu flink für sie und befand sich im Nu außerhalb ihrer Reichweite. Die junge Frau strahlte im lichten Glanz der Magie, nicht so gleißend hell wie der Par’chin, aber intensiver als jeder andere, den sie je gesehen hatte. Ihre Finger und Zehen gruben sich in die Felswand wie Dämonenkrallen und brachen Risse in den Stein, die ihr Halt gaben.
Inevera wandte sich an Shanjat. »Folge ihr. Und markiere deinen Weg.«
Shanjat ließ sich nichts von der Furcht anmerken, die sich in seiner Aura zeigte, als er die Felswand hinabstarrte. »Ja, Damajah.« Er schlug sich mit der Faust gegen die Brust, schlang seinen Speer und den Schild über den Rücken, warf sich bäuchlings hin und glitt über den Rand. Dann kletterte er vorsichtig nach unten.
Inevera fragte sich, ob er der Aufgabe gewachsen sein würde. Shanjat war ein starker Mann, aber in dieser Nacht hatte er keine Dämonen getötet und besaß nicht diese übermenschliche Kraft, die es Renna erlaubte, sich mit bloßen Händen und Füßen ihren eigenen Pfad zu schaffen.
Doch der kai’Sharum überraschte sie und vielleicht sogar sich selbst, als er viele dieser Spalten und Ritzen nutzte, die die Gemahlin des Par’chin für ihren eigenen Abstieg in den Stein brach. Schon bald war auch er in der Düsternis verschwunden.
»Wenn du deine hora-Würfel werfen willst, dann mache es sofort, damit wir mit der Suche beginnen können«, forderte Leesha Papiermacher sie auf.
Inevera blickte die Hure aus dem Norden an, verbiss sich ein höhnisches Lächeln und behielt ihre Miene heiterer Gelassenheit bei. Natürlich wollte sie zusehen, wenn Inevera die Würfel auswarf. Zweifelsohne brannte sie förmlich darauf, alles über die Siegel der Weissagung zu lernen. Als hätte sie Inevera nicht schon genug gestohlen.
Keiner der anderen wusste es, aber die Würfel hatten ihr verraten, dass Leesha Ahmanns Kind unter ihrem Herzen trug und somit alles in Gefahr brachte, was Inevera aufgebaut hatte. Sie kämpfte gegen den Drang an, ihr Messer zu ziehen und dieser Hure auf der Stelle das Kind aus dem Leib zu schneiden. Auf diese Weise wäre das Problem gelöst, noch ehe es entstehen konnte. Und niemand konnte sie aufhalten. Die Nordländer durfte man keinesfalls unterschätzen, aber ihren Söhnen und zwei sharusahk-Meistern wären sie nie und nimmer gewachsen.
Sie atmete rhythmisch ein und aus und fand ihre Mitte. Inevera hätte nichts lieber getan, als all ihre Wut und Angst an dieser Frau auszulassen, aber es war nicht Leeshas Schuld, dass Männer in ihrem Größenwahn die folgenschwersten Dummheiten begingen. Ganz sicher hatte sie versucht, den Par’chin daran zu hindern, Ahmann zu diesem Zweikampf zu fordern, so wie Inevera sich bemüht hatte, ihren Gemahl dazu zu bewegen, nicht auf die Forderung einzugehen.
Aber vielleicht war dieser Kampf unvermeidlich gewesen. Vielleicht gab es auf Ala keinen Platz für zwei Erlöser, und einer musste weichen. Doch nun gab es gar keinen Befreier mehr, und das war bei Weitem das Schlimmste, was der Menschheit überhaupt passieren konnte.
Ohne Ahmann würde das Bündnis der Krasianer zerbrechen, und die Damaji wären wieder die streitsüchtigen Kriegsherren von ehedem. Zuerst würden sie Ahmanns dama-Söhne töten, sich dann gegeneinander wenden, und dann? Zum Abgrund mit dem Sharak Ka.
Ineveras Blick wanderte zu Damaji Aleverak von den Majah, der anfangs das größte Hindernis auf Ahmanns Weg zur Macht gewesen war und sich später als sein wertvollster Ratgeber entpuppte. Seine Loyalität gegenüber dem Shar’Dama Ka stand außer Frage, doch das würde ihn nicht davon abhalten, Maji zu töten, Ahmanns Sohn mit einer Gemahlin aus dem Stamm der Majah, damit dieser nicht eines Tages Aleveraks Sohn Aleveran ersetzen konnte.
Ein Erbe wäre möglicherweise imstande, die Einheit der Stämme auch weiterhin aufrechtzuerhalten, aber wer sollte das sein? Ihre Würfel sagten, dass keiner ihrer Söhne für diese Aufgabe bereit sei, allerdings würden diese das anders sehen und die Machtbefugnisse, die ihnen vorläufig verliehen worden waren, niemals aufgeben. Jayan und Asome waren seit jeher Rivalen gewesen, und mächtige Verbündete würden sich um beide scharen. Falls die Damaji das krasianische Volk nicht auseinanderrissen, so würden vermutlich ihre Söhne diese Spaltung bewirken.
Ohne ein Wort zu sagen, begab sich Inevera an den Ort, an dem noch wenige Momente zuvor die zwei Kontrahenten gekämpft hatten. Beide hatten Blut verloren, das auf den Boden getropft war. Sie kniete nieder, presste die Handflächen auf die entsprechenden Stellen und befeuchtete sie mit dem Blut. Dann nahm sie die Würfel in die Hand und schüttelte sie. Die Krasianer stellten sich im Kreis um sie auf, sodass die Leute aus dem Norden sie nicht sehen konnten.
Ineveras Würfel waren aus dem Gebein eines Dämonenprinzen geschnitzt und mit Elektron beschichtet. Es war der machtvollste Satz hora, den eine dama’ting je besessen hatte, mit Ausnahme der ersten Damajah. Sie pochten und vibrierten vor Energie und glühten grell in der Dunkelheit. Sie warf die hora, und die Siegel der Weissagung flackerten auf. Die Würfel verteilten sich auf die ihnen eigene unnatürliche Art, blieben liegen und bildeten ein Muster aus Symbolen, das sie deuten musste. Die meisten Menschen hätten damit nicht das Geringste anfangen können. Selbst dama’ting stritten sich über die Auslegung eines Wurfs, aber Inevera las die Würfel genauso leicht wie auf Pergament geschriebene Worte. Jahrzehntelang hatten sie ihr in Zeiten des Aufruhrs und des Tumults Weisung gegeben, doch wie so oft war ihre Antwort vage und bot wenig Trost.
– Es gibt keinen Sieger. –
Was hatte das zu bedeuten? Waren bei dem Sturz in die Tiefe beide ums Leben gekommen? Ging der Kampf dort unten weiter? Tausend Fragen stürmten auf sie ein, und sie warf die hora ein zweites Mal aus. Doch die Antwort blieb dieselbe, wie sie bereits gewusst hatte.
»Und?«, fragte die Hure aus dem Norden. »Was sagen sie?«
Inevera verkniff sich eine scharfe Erwiderung, denn sie wusste, wie wichtig ihre nächsten Worte waren. Am Ende entschied sie, dass die Wahrheit – oder ein großer Teil der Wahrheit – vielleicht die richtige Antwort war, um die von Ehrgeiz zerfressenen Intriganten, die sie umgaben, in Schach zu halten.
»Es gibt keinen Sieger«, entgegnete sie. »Der Kampf geht dort unten weiter, und Everam allein weiß, wie er enden wird. Wir müssen sie finden, so schnell wie möglich.«
Der Abstieg vom Berg dauerte Stunden. Die Dunkelheit verlangsamte nicht ihr Tempo – sämtliche Mitglieder dieser erlesenen Gruppe konnten im Licht der Magie sehen –, aber mittlerweile wurde dieser Weg von Felsen- und Steindämonen belagert, die buchstäblich mit der Bergflanke verschmolzen. Winddämonen zogen am Himmel ihre Kreise und stießen ihre misstönenden Schreie aus.
Rojer nahm seine Fiedel, entlockte den Saiten die traurige Melodie des Liedes vom Erlöschenden Mond und wehrte damit den Angriff der alagai ab. Amanvah hob ihre Stimme und begleitete ihn, und ihre durch hora verstärkte Musik erfüllte die Nacht. Trotz der aufbrandenden Verzweiflung, die drohte, die Palme, das Sinnbild von Ineveras innerer Mitte, zu zerbrechen, war sie stolz auf ihre Tochter.
Eingehüllt in die seltsame Magie, die der Sohn des Jessum beherrschte, waren sie vor den alagai geschützt, aber sie kamen nur langsam voran. Inevera juckte es in den Fingern, den Elektronstab von ihrem Gürtel zu nehmen, die Dämonen, die sich ihnen in den Weg stellten, damit einfach beiseitezufegen und schleunigst zu ihrem Gemahl zu eilen, aber sie wollte den Nordländern nicht die wahre Kraft dieses Zauberstabs enthüllen, und außerdem hätte sie durch seine Benutzung nur noch mehr alagai angelockt. Also sah sie sich gezwungen, sich dem ruhigen Tempo anzupassen, das Rojer vorgab, obwohl Ahmann und der Par’chin in diesem Augenblick wahrscheinlich in irgendeinem vergessenen Tal verbluteten.
Sie verdrängte diese Vorstellung. Ahmann war von Everam auserwählt. Sie musste darauf vertrauen, dass Er Seinem Shar’Dama Ka in der Zeit der größten Bedrängnis ein Wunder gewährte.
Er lebte. Es musste einfach so sein.
Leesha schwieg, während sie hinunterritten, und nicht einmal Thamos war so unklug, sie zu stören. Der Graf mochte zwar in den meisten Nächten das Bett mit ihr teilen, aber sie liebte ihn nicht, wie sie Arlen geliebt hatte … oder Ahmann. Es hatte ihr das Herz zerrissen, bei diesem Kampf zuzusehen.
Anfangs schien Arlen im Vorteil zu sein, und wenn sie hätte bestimmen können, wer als Sieger hervorgehen sollte, dann hätte sie sich für ihn entschieden. Aber in den letzten Tagen hatte Arlens gequälte Seele eine Art Frieden gefunden, und sie hatte gehofft, er könne Ahmann dazu zwingen, sich zu ergeben und den Kampf zu beenden, ohne dass einer von ihnen zu Tode kam.
Sie hatte aufgeschrien, als Ahmann Arlen mit dem Speer des Kaji durchbohrt hatte – vielleicht die einzige Waffe auf der ganzen Welt, die ihn verletzen konnte. In diesem Augenblick war in ihrem Kampf eine Wende eingetreten, und zum ersten Mal drohte ihr Zorn auf Ahmann sich in Hass zu verwandeln.
Doch dann stürzte Arlen sich und seinen Gegner lieber in den Abgrund, als den Kampf zu verlieren. Als Ahmann in der Tiefe verschwand, drehte sich ihr der Magen um. Das Kind, das sie unter ihrem Herzen trug, war noch keine acht Wochen alt, aber sie hätte schwören können, dass es mit den Füßen trat, als sein Vater in die Finsternis hinabstürzte.
Während des Jahres, das seit ihrer ersten Begegnung mit Arlen vergangen war, hatten seine Kräfte noch weiter zugenommen. Manchmal schien es, als gäbe es nichts, wozu er nicht imstande wäre, und selbst Leesha fragte sich, ob er vielleicht doch der Erlöser war. Er konnte sich vor dem Aufprall dort unten schützen, indem er sich einfach in Nebel auflöste. Ahmann war dazu nicht in der Lage.
Aber auch Arlens Fähigkeiten waren Grenzen gesetzt, und Ahmann hatte dies in einer Weise vorgeführt, die niemand erwartet hatte. Leesha erinnerte sich noch lebhaft an Arlens Sturz, der erst ein paar Wochen zurücklag. Aus großer Höhe war er im Tal auf das Steinpflaster gefallen, seine Knochen waren zerschmettert und sein Schädel eingedrückt gewesen wie die Schale eines hartgekochten Eis, das man gegen einen Tisch schlägt.
Wenn Renna ihnen nur nicht hinterhergestürmt wäre. Die Frau wusste etwas von Arlens Plänen. Mehr, als sie verriet.
Lange bevor sie den Fuß des Berges erreichten, machten sie eine Kehrtwende und umgingen den Pass, der von Kundschaftern beider Armeen beobachtet wurde. Vielleicht war ein Krieg unvermeidlich, aber keine Seite wollte, dass er noch in dieser Nacht ausbrach.
Die Gebirgspfade schlängelten sich in Serpentinen, und es gab viele Abzweigungen. Mehr als einmal musste Inevera die Würfel befragen, um den richtigen Weg zu finden. Während sie auf dem Boden kniete und die hora auswarf, wartete der Rest der Gruppe voller Ungeduld. Leesha hätte zu gern gewusst, was die Frau in dem Wirrwarr von Symbolen erkannte, doch sie selbst wusste immerhin genug, um nicht an der Aussagekraft der Würfel zu zweifeln.
Die Morgendämmerung war nahe, als sie die erste von Shanjats Markierungen fanden. Inevera beschleunigte ihr Tempo, und die anderen folgten ihr. Sie eilten den Pfad entlang, während der Horizont sich allmählich violett färbte.
Die Kundschafter, die am Fuß des Bergs im Hinterhalt lagen, hatten sie nicht bemerkt. Aber Ineveras Leibwachen, Ashia und Shanvah, waren heimlich den Hang hinaufgeklettert und schlossen sich schweigend der Gruppe an. Der Prinz aus dem Nordland warf einen Blick auf sie, schüttelte jedoch abschätzig den Kopf, als er erkannte, dass es sich um Frauen handelte.
Endlich schlossen sie zu Renna und Shanjat auf, die sich gegenseitig argwöhnisch belauerten, während sie warteten. Shanjat stellte sich eilig vor Inevera hin und schlug sich mit der Faust gegen die Brust, während er sich verneigte. »Hier endet der Pfad, Damajah.«
Sie saßen ab und ließen sich von dem Krieger an eine nahegelegene Stelle führen, wo sich im Boden eine Vertiefung von der Größe eines Mannes befand. Aufgeworfenes Erdreich und Gesteinssplitter zeugten von einem heftigen Aufprall. Der Boden war mit Blut bespritzt, aber man sah auch Fußabdrücke – ein Zeichen dafür, dass der Kampf weitergegangen war.
»Bist du der Spur gefolgt?«, erkundigte sich Inevera.
Shanjat nickte. »Sie verschwindet nicht weit von hier. Ich hielt es für das Beste, deine Befehle abzuwarten, ehe ich mich zu weit entfernte.«
»Renna?«, sprach Leesha die junge Frau an.
Die Jiwah Ka des Par’chin starrte auf den Krater. In ihren Augen lag ein glasiger Blick, ihre kraftvolle Aura verriet nichts. Sie nickte knapp. »Stundenlang sind wir im Kreis gelaufen und haben die Gegend durchkämmt. Nichts. Es ist, als wären ihnen plötzlich Flügel gewachsen.«
»Ob sie von einem Winddämon verschleppt wurden?«, mutmaßte Wonda.
Renna zuckte die Achseln. »Schätze, das wäre möglich, aber ich kann es mir kaum vorstellen.«
Inevera nickte. »Kein Dämon könnte jemals meinen ehrwürdigen Gemahl berühren, ohne dass er es zulässt.«
»Wo ist der Speer?«, fragte Jayan. Inevera blickte ihn betrübt an. Sie wunderte sich nicht, dass ihr ältester Sohn sich mehr für die geweihte Waffe interessierte als für das Wohlergehen seines Vaters, und trotzdem machte es sie traurig. Asome besaß zumindest den Anstand, solche Gedanken für sich zu behalten.
Shanjat schüttelte den Kopf. »Wir haben die heilige Waffe nirgends gefunden, Sharum Ka.«
»Das hier ist frisches Blut«, sagte Inevera und richtete den Blick auf den Horizont. Bis zur Morgendämmerung waren es nur noch wenige Minuten, aber für eine letzte Weissagung mochte die Zeit reichen. Sie griff in ihren hora-Beutel und umklammerte die Würfel so fest, dass die Kanten sich schmerzhaft in ihre Hand gruben, als sie sich anschickte, neben dem Krater hinzuknien.
Normalerweise hätte sie die empfindlichen Würfel nicht einmal dem Licht der Vormorgendämmerung ausgesetzt. Sie hätte es gar nicht gewagt. Direktes Sonnenlicht zerstörte Dämonenknochen, und selbst indirektes Licht konnte sie dauerhaft beschädigen. Doch das Elektron, mit dem sie die Würfel beschichtet hatte, schützte sie selbst im prallen Sonnenschein. Bei Tageslicht erschöpften sich die magischen Kräfte der Würfel rasch, genauso wie der Speer des Kaji seine Macht verlor, aber wenn sich die Nacht herabsenkte, luden sie sich wieder auf.
Sie spürte, wie ihre Hände zitterten, als sie sie ausstreckte. Ein paar Sekunden lang musste sie ein- und ausatmen, um ihre Mitte zu finden, ehe sie weitermachen konnte. Dann berührte sie zum zweiten Mal in dieser Nacht das Blut ihres Gemahls, mit dessen Hilfe sie versuchte, Aufschluss über sein Schicksal zu bekommen.
»Gesegneter Everam, Schöpfer aller Dinge, lass mich wissen, was aus den Kämpfenden geworden ist, Ahmann asu Hoshkamin am’Jardir am’Kaji, und Arlen asu Jeph am’Strohballen am’Bach. Ich bitte dich, verrate mir, welches Schicksal ihnen zuteilwurde und was die Zukunft für uns bereithält.«
Die Magie vibrierte in ihren Fingern, und sie warf die hora. Dann starrte sie auf das Muster.
Wenn man die Würfel nach etwas befragte, das in der Gegenwart stattfand oder in der Vergangenheit geschehen war, sprachen sie mit kalter – wenn auch oftmals mysteriöser – Gewissheit. Die Zukunft hingegen veränderte sich dauernd, jede Entscheidung war wie Sand, der unablässig vom Wind bewegt wird. Die Würfel gaben Hinweise, wie Markierungspfosten in der Wüste einen Weg anzeigten, aber je weiter man blickte, umso mehr Pfade zweigten ab, bis man sich in den Dünen verlor.
Ahmanns Zukunft war immer voller Gegensätze gewesen. Es gab eine Zukunft, in der er als Retter der Menschheit auftrat, deren Schicksal er in seinen Händen hielt, aber es gab auch eine, in der ihm ein Tod in Schmach und Schande beschieden war. Vieles deutete darauf hin, dass er von alagai-Krallen getötet wurde, aber immer stand auch jemand bereit, um ihm ein Messer in den Rücken zu stoßen und ihm einen Speer durchs Herz zu treiben. Es gab Menschen, die ihn mit ihrem Leben beschützen würden, und solche, die nur auf eine Gelegenheit zum Verrat warteten.
Etliche dieser Wege waren nun versperrt. Was auch immer passiert war, Ahmann würde so schnell nicht zurückkehren, vermutlich überhaupt nicht mehr. Bei dem Gedanken durchlief Inevera ein eiskalter Schauer der Angst.
Die anderen warteten mit angehaltenem Atem auf ihre Worte, und Inevera wusste, dass das Schicksal ihres Volkes davon abhing, was sie jetzt sagte. Sie erinnerte sich daran, was die Würfel ihr vor vielen Jahren verraten hatten:
– Der Erlöser wird nicht geboren. Er wird geschaffen. –
Falls Ahmann nicht zurückkehrte, würde sie einen neuen Erlöser hervorbringen.
Sie betrachtete die zahllosen Möglichkeiten, die ihr zeigten, wie ihre Liebe dem Untergang geweiht war, und aus den übrigen suchte sie sich eine aus. Sie wies ihr den einzigen Weg, der es ihr erlaubte, ihre Macht zu behalten, bis ein passender Nachfolger für Ahmann gefunden war.
»Der Erlöser hat sich in Gefilde begeben, in denen wir ihn nicht erreichen können«, verkündete Inevera schließlich. »Er verfolgt einen Dämon bis hinunter zu Nies Abgrund.«
»Dann ist der Par’chin also doch ein Dämon«, stellte Ashan fest.
Die Würfel sagten nichts dergleichen, aber Inevera nickte. »Es hat den Anschein.«
Gared spuckte auf den Boden. »Die Würfel sagten ›Erlöser‹. Sie sagten nicht ›Shar’Dama Ka‹.«
Der Damaji wandte sich ihm zu und betrachtete ihn, als sei er ein Insekt, das sich nicht einmal zu zerquetschen lohnte. »Sie sind ein und derselbe.«
Jetzt spuckte Wonda aus. »Beim Horc, das ist doch Blödsinn!«
Jayan sprang vor und ballte die Faust, als wolle er sie schlagen, aber Renna stellte sich zwischen die beiden. Die Siegel auf ihrer Haut flackerten hell, und selbst Ineveras hitzköpfiger ältester Sohn traute sich nicht, sie anzugreifen. Es wäre ihm alles andere als dienlich, wenn er ausgerechnet vor den Männern niedergeschlagen würde, die er davon überzeugen musste, ihm den Thron zu überlassen.
Jayan wandte sich wieder an seine Mutter. »Und wo ist der Speer?«, verlangte er zu wissen.
»Er ging verloren«, lautete ihre Antwort. »Man wird ihn wiederfinden, wenn Everam es so will, und nicht eher.«
»Dann geben wir also einfach auf?«, fragte Asome. »Und überlassen Vater seinem Schicksal?«
»Selbstverständlich nicht!« Inevera richtete das Wort an Shanjat. »Suche weiter nach der Spur, und wenn du sie gefunden hast, gehst du ihr nach. Folge jedem umgeknickten Grashalm und jedem lockeren Stein. Komme nicht ohne den Erlöser oder verlässliche Nachrichten über sein Schicksal zurück, und wenn es tausend Jahre dauert.«
»Ja, Damajah.« Shanjat schlug sich mit der Faust an die Brust.
Nun wandte sich Inevera an Shanvah: »Du begleitest deinen Vater. Gehorche ihm, und sorge für seinen Schutz. Sein Auftrag ist auch der deine.«
Die junge Frau verneigte sich schweigend. Ashia drückte ihre Schulter, und ihre Blicke begegneten sich. Dann brachen Vater und Tochter auf.
Leesha drehte sich zu Wonda um. »Sieh dich auch ein bisschen um. Aber sei in einer Stunde zurück.«
Wonda grinste und zeigte eine Zuversicht, die Inevera mit Neid erfüllte. »Ich hatte nicht vor wegzubleiben, bis meine Haare grau werden. Der Erlöser kommt und geht, aber er kommt wieder, warte nur ab.« Im nächsten Moment war auch sie verschwunden.
»Ich mache mich auch auf die Suche«, verkündete Renna, aber Leesha hielt sie am Arm fest.
Renna funkelte sie wütend an. Hastig ließ Leesha sie los, aber sie wich keinen Schritt zurück. »Bleibe noch einen Moment, bitte.«
Selbst die Leute aus dem Norden fürchten den Par’chin und seine Gemahlin, dachte Inevera. Das merkte sie sich gut, während sie zusah, wie die beiden Frauen ein Stück zur Seite gingen, um sich ungehört miteinander zu unterhalten.
»Ashan, komm mit mir«, sagte sie zu dem Damaji gewandt. Sie entfernten sich von den anderen, die immer noch wie vom Donner gerührt dastanden.
»Ich kann es nicht glauben, dass er verschwunden sein soll.« Ashans Stimme klang hohl. Seit über zwanzig Jahren waren er und Ahmann wie Brüder gewesen. Er war der erste dama, der Ahmanns Aufstieg zum Shar’Dama Ka unterstützt hatte, und er war fest von dessen Göttlichkeit überzeugt. »Das alles erscheint mir wie ein Traum.«
Inevera kam gleich zur Sache. »Du musst als Andrah den Schädelthron beanspruchen. Du bist der Einzige, der das tun kann, ohne einen Krieg zu entfachen, und der Einzige, der nach der Rückkehr meines Gemahls diesen Platz freiwillig wieder räumen würde.«
Ashan schüttelte den Kopf. »Wenn du glaubst, das wäre so einfach, dann irrst du dich, Damajah.«
»Es war der Wunsch des Shar’Dama Ka«, erinnerte sie ihn. »Du hast vor ihm und vor mir einen Eid geschworen.«
»Dieser Eid bezog sich darauf, dass er in der Schlacht während der Zeit des Erlöschenden Mondes fallen würde, und dafür gäbe es viele Zeugen«, stellte Ashan richtig. »Und nicht darauf, dass er auf irgendeinem abgeschiedenen Berg von einem Nordländer getötet würde. Der Thron sollte an Jayan oder Asome gehen.«
»Er selbst hat dir gesagt, dass seine Söhne für diese Bürde noch nicht reif genug sind«, fuhr Inevera fort. »Denkst du, das hätte sich während der letzten vierzehn Tage geändert? Meine Söhne sind gerissen, aber noch fehlt es ihnen an Weisheit. Die Würfel sagen, dass sie in ihrem Kampf um den Thron Everams Füllhorn zerreißen werden, und sollte einer von ihnen die mit Blut besudelten Stufen hinaufgehen und den Thron einnehmen, wird er ihn nicht aufgeben, wenn sein Vater zurückkommt.«
»Falls er überhaupt zurückkommt«, warf Ashan ein.
»Er wird zurückkehren«, behauptete Inevera. »Wahrscheinlich verfolgt von dem gesamten Horc. Und wenn dem so ist, braucht er Eintracht anstatt Zwist. Sämtliche Armeen von Ala müssen sich ihm unterstellen, und er wird weder die Zeit noch den Wunsch haben, zuerst einen seiner Söhne töten zu müssen, um seine Macht wiederzuerlangen.«
»Das gefällt mir nicht«, gab Ashan zu bedenken. »Ich habe niemals nach Macht gestrebt.«
»Es ist inevera«, betonte sie. »Deine persönlichen Wünsche sind unwichtig, und gerade wegen deiner Bescheidenheit vor Everam bist du der Einzige, der den Schädelthron einnehmen darf.«
»Mach schnell«, sagte Renna, als Leesha sie beiseitezog. »Wir haben schon genug Zeit verplempert, als wir auf euch gewartet haben. Arlen ist irgendwo da draußen, und ich muss ihn finden.«
»Dämonenscheiße!«, schnauzte Leesha. »Ich kenne dich nicht besonders gut, Renna, aber gut genug, um zu wissen, dass du keine zehn Sekunden an mich verschwenden würdest, wenn das Schicksal deines Mannes immer noch ungewiss wäre. Du und Arlen, ihr habt das Ganze geplant. Wo steckt er jetzt? Was hat er mit Ahmann gemacht?«
»Nennst du mich eine Lügnerin?« Renna stieß ein Knurren aus. Sie zog ein böses Gesicht und ballte die Fäuste.
Aus irgendeinem Grund machte diese aggressive Geste Leesha noch sicherer, dass sie richtig getippt hatte. Zwar glaubte sie nicht, dass Renna sie tatsächlich angreifen würde, aber für alle Fälle hielt sie eine Prise Blendpulver bereit, mit dem festen Vorsatz, es notfalls auch zu benutzen.
»Bitte«, sagte sie mit ruhiger Stimme. »Wenn du etwas weißt, dann verrate es mir. Ich schwöre beim Schöpfer, dass du mir vertrauen kannst.«
Ihre Worte schienen Renna ein wenig zu besänftigen, und sie lockerte ihre Fäuste, jedoch ohne die Arme zu senken. Die Handflächen nach außen gekehrt, stand sie vor Leesha. »Du kannst mich auf den Kopf stellen und schütteln, aber du wirst keine Antwort finden.«
»Renna.« Leesha bemühte sich, nicht die Fassung zu verlieren. »Mir ist klar, dass wir zwei nicht die besten Freundinnen sind. Unsere ersten Begegnungen waren nicht gerade von Erfolg gekrönt. Du hast auch keinen Grund, mich zu mögen, aber das hier ist kein Spiel. Mit deiner Geheimnistuerei bringst du jeden in Gefahr.«
Renna gab ein bellendes Lachen von sich. »Da redet die Richtige! Ausgerechnet du wirfst mir Heimlichkeiten vor.« Mit dem Zeigefinger stach sie Leesha in die Brust, und der Stoß war immerhin so heftig, dass sie einen Schritt zurücktaumelte. »Du bist doch diejenige, in deren Bauch das Kind dieses Dämons aus der Wüste heranwächst. Glaubst du etwa im Ernst, das wäre keine Gefahr für andere?«
Leesha spürte, wie ihr Gesicht kalt wurde, aber sie ging ihrerseits zum Angriff über, weil sie fürchtete, Schweigen könnte als Bestätigung aufgefasst werden. »Wer hat dir diesen Blödsinn erzählt?«
»Du selbst«, konterte Renna. »Ich kann hören, wenn am anderen Ende eines Getreidefelds ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt. Arlen kann das auch. Wir beide haben gehört, was du zu Jardir sagtest. Du trägst sein Kind in dir und hast vor, es dem Grafen unterzuschieben.«
Das stimmte. Diese abgeschmackte Intrige hatte ihre Mutter ausgeheckt, und Leesha war so töricht gewesen, darauf einzugehen. Nach der Geburt des Kindes würde sich die Farce vermutlich nicht aufrechterhalten lassen, aber bis dahin hatte sie noch sieben Monate Zeit, um Vorbereitungen zu treffen – oder wegzulaufen und sich zu verstecken –, bevor die Krasianer kamen, um ihr Kind zu holen.
»Ein Grund mehr für mich, mir Sorgen um Ahmann zu machen«, versetzte Leesha und hasste sich selbst für den flehenden Tonfall, der in ihrer Stimme mitschwang.
»Ich habe keine Ahnung, wo er ist«, erklärte Renna. »Und wir verschwenden nur Zeit. Anstatt zu reden, sollten wir uns lieber auf die Suche machen.«
Leesha nickte. Sie wusste, wann sie sich geschlagen geben musste. »Bitte verrate Thamos nichts. Ich werde es ihm zu gegebener Zeit sagen, wirklich und wahrhaftig. Aber nicht jetzt, wenn sich die Hälfte der krasianischen Armee nur ein paar Meilen entfernt von uns befindet.«
Renna schnaubte durch die Nase. »Ich bin doch nicht blöd. Wie konnte eine Kräutersammlerin wie du überhaupt schwanger werden? Sogar ich ungebildeter Bauerntrampel weiß, dass der Mann seinen Schwanz rausziehen muss, ehe es so weit ist.«
Leesha senkte den Blick, außerstande, Renna weiter in die Augen zu sehen. »Dieselbe Frage habe ich mir auch schon gestellt.« Sie zuckte mit den Schultern. »Aber überall gibt es Leute, deren Eltern nicht aufgepasst haben.«
»Was andere Leute machen oder nicht machen, kümmert mich nicht«, erwiderte Renna. »Ich frage mich nur, ob die klügste Frau im ganzen Tal Holz im Kopf hat anstatt eines Verstandes. Hat dir noch nie einer erklärt, wie ein Kind entsteht?«
Leesha fletschte die Zähne. Renna hatte durchaus Grund, sich zu wundern, aber es stand ihr nicht zu, sie zu verurteilen. »Wenn du mir deine Geheimnisse vorenthältst, sehe ich keinen Grund, dir meine anzuvertrauen.« Mit einer weit ausholenden Geste deutete sie auf das Tal. »Und jetzt geh! Tu so, als würdest du nach Arlen suchen, bis wir dich nicht mehr sehen können, und dann lauf zu ihm. Ich werde dich nicht aufhalten.«
Renna grinste. »Als ob du das könntest.« Im nächsten Moment war sie verschwunden.
Wieso nehme ich mir ihre Vorwürfe so zu Herzen?, fragte sich Leesha. Sie strich sich leicht über den Bauch und wusste den Grund.
Weil sie recht hatte.
Als Leesha Ahmann zum ersten Mal küsste, war sie von Couzi betrunken gewesen. Sie hatte nicht vorgehabt, an diesem Nachmittag mit ihm zu vögeln, aber sie hatte sich auch nicht gesträubt, als er sie nahm. Törichterweise hatte sie geglaubt, er würde sich nicht in sie ergießen, bevor sie verheiratet waren, aber Krasianer betrachteten es als Sünde, wenn ein Mann seinen Samen verschwendete. Als seine Stöße heftiger wurden und er anfing zu stöhnen, hätte sie sich ihm entziehen können. Andererseits wollte auch sie, dass er bis zum Schluss in ihr blieb, wollte spüren, wie das Glied eines Mannes in ihr zuckte und pulsierte, und zum Horc mit dem Risiko. Diesen Kitzel, diese Begierde, hatte sie zu ihrem eigenen Vergnügen voll ausgekostet.
An diesem Abend hatte sie eigentlich einen Tee aus Pomeranzenblättern aufbrühen wollen, stattdessen wurde sie von Ineveras Aufpassern entführt, und die Nacht endete damit, dass sie Seite an Seite mit der Damajah gegen einen Seelendämon kämpfte. Am nächsten Tag trank Leesha eine doppelte Menge des Tees, und jedes Mal, nachdem sie mit Jardir in den Kissen gelegen hatte, nahm sie dieses Mittel, um eine Schwangerschaft zu verhindern, aber dann kam es so, wie ihre ehemalige Lehrerin Bruna zu sagen pflegte: »Ein starkes Kind findet manchmal einen Weg, sich im Mutterschoß einzunisten, egal was man dagegen unternimmt.«
Inevera betrachtete Thamos, den Prinzling aus dem Norden, als dieser vor Ashan stand. Er war ein kräftiger Mann, groß gewachsen und muskulös, aber nicht ohne eine gewisse Eleganz. Er bewegte sich wie ein Krieger.
»Du möchtest sicher, dass deine Männer das Tal durchkämmen«, sagte er.
Ashan nickte. »Und du willst bestimmt, dass sich deine Leute auf die Suche machen.«
Thamos nickte. »Jeweils hundert Mann?«
»Fünfhundert«, verbesserte Ashan. »Unter dem Frieden des Domin Sharum.«
Inevera entging nicht, wie der Prinzling auf die Zähne biss. Die Krasianer konnten mit Leichtigkeit fünfhundert Männer für diese Suche entbehren, sie machten lediglich einen Bruchteil der Armee des Erlösers aus. Thamos hingegen wollte nicht so viele Leute von seinem Heer abziehen.
Nichtsdestotrotz blieb dem Prinzling gar nichts anderes übrig, als nachzugeben, und er stimmte zu. »Wer garantiert mir, dass deine Krieger den Frieden einhalten werden? Das Letzte, was dieses Tal braucht, ist ein Krieg.«
»Meine Krieger werden selbst bei Tageslicht ihre Gesichter mit dem Schleier bedecken«, erwiderte Ashan. »Keiner würde es wagen, sich diesem Befehl zu widersetzen. Ich habe eher Bedenken, was deine Männer angeht. Ich möchte vermeiden, dass sie wegen eines Missverständnisses zu Schaden kommen.«
Bei dieser Entgegnung bleckte der Prinzling die Zähne. »Ich denke, notfalls wüssten sie sich zu wehren. Aber wieso ist das Verhüllen des Gesichts eine Garantie für Frieden? Ein Mann, der nicht fürchten muss, erkannt zu werden, fürchtet auch keine Strafe.«
Ashan schüttelte den Kopf. »Es ist ein Wunder, dass ihr unzivilisierten Wilden überhaupt so lange in der Nacht überleben konntet. Ein Mann erinnert sich an das Gesicht eines Gegners, der ihm einen Schaden zugefügt hat, und solche Feindschaften lassen sich nur schwer verdrängen. In der Nacht tragen wir Schleier, damit alle als Brüder nebeneinander kämpfen und ihre Blutfehden vergessen. Wenn deine Männer ihre Gesichter verhüllen, wird es in diesem von Everam verfluchten Tal kein weiteres Blutvergießen geben.«
»Gut«, antwortete der Prinzling. »Abgemacht.« Er deutete eine Verbeugung an, womit er einem Mann, der ihm ein Dutzend Mal überlegen war, kaum den notwendigen Respekt zollte, machte auf dem Absatz kehrt und marschierte davon. Die anderen Nordländer folgten ihm.
»Diese Nordländer werden ihre Respektlosigkeit noch teuer bezahlen«, sagte Jayan.
»Mag sein«, erwiderte Inevera. »Aber nicht heute. Wir müssen nach Everams Füllhorn zurückkehren, und zwar auf schnellstem Weg.«
1
Die Suche
333 NR – Herbst
Die Sonne ging unter, als Jardir aufwachte. Er fühlte sich benommen. Er lag in einem Bett, wie es im Norden üblich war – ein einziges großes Kissen anstatt vieler kleiner. Das Bettzeug war grob, ganz anders als die weiche Seide, an die er sich gewöhnt hatte. Der Raum war kreisrund, und ringsum gab es Fenster aus mit Siegeln verstärktem Glas. Er musste sich in einer Art Turm befinden. Im draußen herrschenden Zwielicht dehnte sich unbewohnte Wildnis aus, eine ihm völlig fremde Landschaft.
Wo in Ala bin ich?
Stechende Schmerzen durchzuckten ihn, als er sich bewegte, aber an Schmerzen war er gewöhnt. Er umarmte sie, und sie waren vergessen. Mühsam und mit ungewöhnlich steifen Beinen hievte er sich hoch und setzte sich auf. Er schlug die Decke zurück. Seine Beine steckten von den Füßen bis zu den Schenkeln in Gipsverbänden. Die angeschwollenen, rot, violett und gelb verfärbten Zehen lugten an den Enden heraus, so nahe, aber er hätte sie nicht berühren können. Probeweise krümmte er sie, ohne auf die Schmerzen zu achten, und war zufrieden, wenn er mit der kleinsten Bewegung belohnt wurde.
Es war wie damals, als er noch ein Kind gewesen war und ein anderer Junge ihm den Arm gebrochen hatte. Er erinnerte sich noch lebhaft an das Gefühl der Hilflosigkeit während der Wochen, als der Bruch verheilte.
Unwillkürlich griff er zum Nachttisch und nach seiner Krone. Selbst bei Tage enthielt sie ausreichend gespeicherte Magie, um ein paar gebrochene Knochen zu heilen, vor allem, wenn die Brüche bereits gerichtet waren.
Seine Finger griffen ins Leere. Er wandte den Kopf und blickte einen Moment lang verdutzt um sich, ehe ihm dämmerte, was los war. Seit Jahren behielt er seine Krone und den Speer immer in Reichweite, doch beides fehlte.
Unvermittelt stürzten die Erinnerungen auf ihn ein. Er entsann sich wieder, wie er auf dem Berggipfel mit dem Par’chin gekämpft hatte. Wie der Sohn des Jeph sich in Rauch auflöste, als Jardir ihn angriff. Unmittelbar darauf nahm er wieder eine stoffliche Gestalt an, packte den Speer mit schier übermenschlicher Kraft und wand ihm die Waffe aus den Händen.
Dann drehte sich der Par’chin um und schleuderte den Speer in die Tiefe, als würde er lediglich eine abgeknabberte Melonenschale wegwerfen.
Mit der Zunge befeuchtete Jardir seine rissigen Lippen. Sein Mund war trocken, die Blase war voll, und beide Bedürfnisse mussten befriedigt werden. Das Wasser, das man für ihn bereitgestellt hatte, schmeckte frisch, und mit einiger Mühe gelang es ihm, den Nachttopf zu benutzen, den seine tastenden Finger auf dem Boden unter dem Bett fanden.
Seine Brust war fest bandagiert, und wenn er sich bewegte, knirschten die Rippen. Über den Bandagen trug er ein Gewand aus dünnem Stoff – von gelbbrauner Farbe, wie er bemerkte. Vielleicht war das die Art des Par’chin, ihn zu verspotten.
Der Raum hatte keine Tür, lediglich eine Treppe führte von unten ins Zimmer. In seiner derzeitigen Verfassung reichte das aus, um ihn zu einem Gefangenen zu machen. Es gab weder einen anderen Ausgang, noch ging die Treppe nach oben weiter. Er befand sich in der Spitze des Turms. Der Raum war sparsam möbliert. Neben dem Bett stand ein kleiner Tisch, und es gab einen einzigen Stuhl.
Auf der Treppe erklang ein Geräusch. Jardir erstarrte und lauschte. Seine Krone und den Speer hatte man ihm weggenommen, aber nachdem er jahrelang durch diese beiden Artefakte Magie in sich aufgesogen hatte, war sein Körper Everams Abbild so nahe gekommen, wie es einem Sterblichen überhaupt nur möglich war. Er besaß die scharfen Augen eines Falken, sein Geruchssinn war ausgeprägt wie der eines Wolfs, und er nahm die leisesten Geräusche wahr, ähnlich wie eine Fledermaus.
»Bist du dir auch ganz sicher, dass du mit ihm fertigwirst?«, fragte die Erste Gemahlin des Par’chin. »Ich hatte schon Angst, er würde dich da draußen auf der Klippe töten.«
»Keine Sorge, Ren«, antwortete der Par’chin. »Ohne den Speer kann er mir nichts antun.«
»Am helllichten Tag kann er das schon«, widersprach Renna.
»Nicht mit zwei gebrochenen Beinen«, erwiderte der Par’chin. »Da kannst du ganz beruhigt sein, Ren. Wirklich und wahrhaftig.«
Wir werden ja sehen, Par’chin.
Er hörte einen schmatzenden Laut, als der Sohn des Jeph jeden weiteren Protest seiner jiwah mit einem Kuss auf ihren Mund erstickte. »Du musst ins Tal zurückkehren und die Dinge im Auge behalten. Jetzt gleich, bevor sie Verdacht schöpfen.«
»Leesha Papiermacher ahnt bereits etwas«, bestätigte Renna. »Und mit ihren Vermutungen trifft sie beinahe ins Schwarze.«
»Das spielt keine Rolle, solange es bei Vermutungen bleibt«, meinte der Par’chin. »Stell du dich nur weiterhin dumm, egal was sie sagt.«
Renna lachte kurz auf. »Ay, das fällt mir nicht schwer. Es macht mir Spaß, sie zur Weißglut zu bringen.«
»Vergeude nur nicht zu viel Zeit damit«, mahnte der Par’chin. »Du musst für den Schutz des Tals sorgen, aber so, dass es nicht zu sehr auffällt. Halte dich zurück. Mach den Leuten Mut, aber die Last sollen sie selbst tragen. Wenn ich kann, schlittere ich ins Tal, aber du bist die Einzige, die mich sehen darf. Niemand sonst soll wissen, dass ich am Leben bin.«
»Das schmeckt mir nicht«, meuterte Renna. »Ein verheiratetes Paar muss zusammenbleiben.«
Der Par’chin seufzte. »Es geht aber nicht anders, Ren. Mit dieser List habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Ich kann es mir nicht leisten zu verlieren. Wir sehen uns ja bald wieder.«
»Ay«, entgegnete Renna. »Ich liebe dich, Arlen.«
»Und ich liebe dich, Renna«, sagte der Par’chin. Wieder küssten sie sich, und dann hörte Jardir rasche Schritte, als die Frau die Turmtreppe hinunterlief. Der Par’chin jedoch kletterte weiter nach oben.
Jardir überlegte kurz, ob er so tun sollte, als ob er schliefe. Vielleicht würde er dann etwas erfahren, oder das Element der Überraschung verschaffte ihm einen Vorteil.
Letzten Endes verzichtete er darauf. Ich bin der Shar’Dama Ka. Mich zu verstellen ist unter meiner Würde. Ich will dem Par’chin in die Augen blicken und sehen, was aus dem Mann geworden ist, den ich früher einmal kannte.
Er stemmte sich im Bett hoch und umarmte die Woge aus Schmerzen, die durch seine Beine schoss. Seine Miene war gelassen, als der Par’chin eintrat. Dieser trug schlichte Kleidung, ähnlich der, die er bei ihrer ersten Begegnung anhatte. Ein weißes, verblichenes Baumwollhemd, eine abgetragene Hose aus grobem Drillich, über der Schulter eine lederne Kuriertasche. Er ging barfuß, Hosenbeine und Hemdsärmel waren hochgekrempelt, damit die Siegel zu sehen waren, die er sich mit Tinte in die Haut eintätowiert hatte. Das sandfarbene Kopfhaar hatte er sich abrasiert, und unter den zahllosen Tätowierungen konnte Jardir das vertraute Gesicht kaum noch erkennen.
Selbst ohne seine Krone spürte Jardir die Macht der Symbole, doch die Stärke, die sie verliehen, forderte einen hohen Preis. Der Par’chin glich eher einem Stück Pergament aus den Heiligen Rollen der Bannsiegel als einem Menschen.
»Was hast du mit dir angestellt, alter Freund?« Er hatte die Worte nicht laut aussprechen wollen, aber irgendetwas trieb ihn dazu.
»Du wagst es noch, mich als deinen Freund zu bezeichnen, nach allem, was du mir angetan hast?«, entgegnete der Par’chin. »Ich habe mich nicht zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Du bist schuld daran!«
»Ich?«, fragte Jardir verblüfft. »Habe ich etwa Tinte genommen und deinen Körper damit verunstaltet?«
Der Par’chin schüttelte den Kopf. »Du hast mich in der Wüste ausgesetzt, damit ich dort verrecke. Ohne Waffen und ohne eine schützende Zuflucht. Und du hast genau gewusst, dass ich mich eher dem Horc verschreiben würde, als mich von den alagai töten zu lassen. Mein Körper war das Einzige, was du mir nicht weggenommen hast, das Einzige, was mir blieb, um darauf Siegel zu zeichnen.«
Das genügte, um Jardir zu verraten, wie der Par’chin hatte überleben können. In Gedanken sah er seinen Freund allein in der Wüste, blutend und kurz vor dem Verdursten, wie er alagai mit den bloßen Händen tötete.
Es war großartig. Er hatte grenzenlosen Ruhm auf sich gehäuft.
Der Evejah verbot das Tätowieren der Haut, aber er verbot viele Dinge, die Jardir bereits getan hatte, um im Sharak Ka zu obsiegen. Er wollte den Par’chin verfluchen, aber seine Kehle schnürte sich zusammen, als er erkannte, dass er die Wahrheit sprach.
Jardir erschauerte, als ihn plötzlich Zweifel beschlichen wie ein eisiger Windhauch. Alles, was geschah, entsprach Everams Willen. Es war inevera, dass der Par’chin überlebte, damit sie sich wiederbegegnen konnten. Die Würfel sagten, einer von ihnen beiden könnte der Erlöser sein. Jardir hatte sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, sich dieses Namens würdig zu erweisen. Er war stolz auf seine Leistungen, aber er konnte nicht abstreiten, dass sein ajin’pal, der tapfere Außenseiter, in Everams Augen möglicherweise der Ehrenvollere war.
»Du hast dich eines Rituals bedient, das du nicht verstehst, Par’chin«, sagte er. »Domin Sharum ist ein Zweikampf auf Leben und Tod, und du hast gesiegt. Warum lässt du mich am Leben? Warum gehst du den Weg nicht zu Ende und beanspruchst deinen Platz als Anführer im Ersten Krieg?«
Der Par’chin seufzte. »Wenn ich dich umbringe, betrachte ich das nicht als einen Sieg, Ahmann.«
»Dann gibst du also zu, dass ich der Erlöser bin?«, vergewisserte sich Jardir. »Wenn dem so ist, dann gib mir meinen Speer und meine Krone zurück, knie vor mir nieder, und die Sache ist ausgestanden. Alles soll vergeben und vergessen sein, und wir können wieder Seite an Seite gegen Nie kämpfen.«
Der Par’chin stieß ein Schnauben aus. Er stellte die Kuriertasche auf den Tisch und griff hinein. Die Krone des Kaji glänzte im schwindenden Tageslicht, und die neun eingearbeiteten Juwelen funkelten. Jardir gierte förmlich nach diesem Objekt. Wenn er seine Beine hätte gebrauchen können, wäre er jetzt aufgesprungen und hätte sich der Krone bemächtigt.
»Die Krone ist hier.« Der Par’chin ließ den gezackten Reif um einen Finger kreisen wie ein Kinderspielzeug. »Aber der Speer gehört dir nicht. Du bekommst ihn erst wieder, wenn ich mich dazu entschließe, ihn dir zurückzugeben. Er befindet sich in einem Versteck, wo du niemals hingelangst, auch nicht mit zwei gesunden Beinen.«
»Die Krone und der Speer sind heilig! Sie gehören zusammen!«, protestierte Jardir.
Der Par’chin stieß wieder einen Seufzer aus. »Nichts ist heilig, Ahmann. Ich sagte dir schon einmal, dass der Himmel eine Lüge ist. Wegen dieser Worte drohtest du, mich zu töten, aber das macht sie nicht weniger richtig.«
Jardir öffnete den Mund zu einer Entgegnung, zornige Worte kamen über seine Lippen, doch der Par’chin unterbrach ihn. Mit festem Griff packte er die um seinen Finger kreiselnde Krone und hielt sie in die Höhe. Während er das tat, pulsierten die Siegel auf seiner Haut kurz in einem gleißenden Licht, und die in die Krone eingeritzten Symbole begannen zu glühen.
»Dieses Artefakt«, sagte der Par’chin, »ist ein dünner Reif aus dem Schädel eines Seelendämons und neun Hörnern, beschichtet mit einer durch Siegel verstärkten Legierung aus Silber und Gold. Zusätzlich wurden Edelsteine eingearbeitet. Es handelt sich um ein Meisterwerk der Kunst des Bannzeichnens, aber mehr auch nicht.«
Er lächelte. »Dasselbe gilt für deinen Ohrring.«
Jardir zuckte zusammen. Seine Hand fuhr an sein Ohrläppchen, in dem sonst der Ring steckte, den Inevera ihm zu ihrer Vermählung geschenkt hatte. »Hast du vor, mir nicht nur den Thron zu stehlen, sondern auch noch meine Erste Gemahlin?«
Der Par’chin lachte. Es war ein von Herzen kommendes, unverstelltes Lachen, wie Jardir es seit Jahren nicht mehr gehört hatte. Er kam nicht umhin, sich einzugestehen, wie sehr er es vermisst hatte.
»Ich bin mir nicht sicher, was eine größere Belastung wäre«, sagte der Par’chin. »Ich will beides nicht. Ich habe eine Frau, und bei meinem Volk ist schon eine einzige mehr als genug.«
Jardir merkte, wie ein Lächeln an seinen Mundwinkeln zupfte, und er machte keinen Hehl aus seiner Belustigung. »Eine würdige Jiwah Ka ist sowohl Halt und Stütze als auch eine Bürde, Par’chin. Diese Frauen zwingen uns, das Beste aus uns zu machen, und das ist niemals einfach.«
Der Par’chin nickte. »Wirklich und wahrhaftig!«
»Warum hast du dann meinen Ohrring gestohlen?«, fragte Jardir.
»Ich bewahre ihn nur für dich auf, solange du unter meinem Dach weilst. Ich kann nicht zulassen, dass du Hilfe herbeiholst.«
»Wie bitte?«
Der Par’chin legte den Kopf schräg und sah ihn durchdringend an. Jardir konnte spüren, wie der Sohn des Jeph bis tief in seine Seele hineinblickte, so wie Jardir in den Gedanken der Menschen lesen konnte, wenn er seine Krone aufhatte. Er fragte sich, wie der Par’chin dies ohne die Hilfe der Krone fertigbrachte.
»Du weißt es wirklich nicht«, bemerkte der Par’chin nach einer Weile. Er gab ein bellendes Lachen von sich. »Du erteilst mir eheliche Ratschläge und hast keine Ahnung, dass deine eigene Frau dir nachspioniert!«
Der spöttische Tonfall ärgerte Jardir. Er verzog wütend das Gesicht, obwohl er eine gleichmütige Miene beibehalten wollte. »Was soll das heißen?«
Der Par’chin griff in seine Tasche und fischte den Ohrring heraus. Es war ein schlichter Reif, an dem eine zierliche, mit Siegeln versehene Kugel hing. »Hier drin steckt ein winziges Stück Dämonenbein, das in zwei Hälften zerbrochen wurde. Die andere Hälfte befindet sich im Ohrring deiner Gemahlin. So kann sie alles hören, was sich in deiner Umgebung abspielt.«
Schlagartig wurde Jardir vieles klar, was er bis jetzt als ein undurchschaubares Mysterium aufgefasst hatte. Dieser Ohrring erklärte, wieso seine Gemahlin sämtliche seiner Pläne und Geheimnisse zu kennen schien. Gewiss, die Würfel verschafften ihr einen Wissensvorsprung, aber meistens sprachen die alagai hora in Rätseln. Dabei hätte er sich denken können, dass die gerissene Inevera sich nicht ausschließlich auf die Würfel verlassen würde.
»Dann weiß sie also, dass du mich verschleppt hast?«, fragte Jardir.
Der Par’chin schüttelte den Kopf. »Ich habe die Energie, die von dem Ohrring ausgeht, blockiert. Deine Gemahlin wird dich nicht finden, bevor wir das hier zu Ende gebracht haben.«
Jardir verschränkte die Arme vor der Brust. »Was sollen wir zu Ende bringen? Du willst dich mir nicht unterwerfen, und ich erkenne dich nicht als Anführer an. Es ist dieselbe Situation wie vor fünf Jahren im Labyrinth.«
Der Par’chin nickte. »Damals brachtest du es nicht über dich, mich zu töten. Dadurch wurde ich gezwungen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Jetzt biete ich dir dasselbe an.« Mit diesen Worten warf er die Krone quer durch den Raum.
Instinktiv fing Jardir sie auf. »Warum gibst du sie mir zurück? Die Krone vermag meine Verletzungen zu heilen. Und sowie ich genesen bin, dürfte es dir schwerfallen, mich hierzubehalten.«
Der Par’chin zuckte die Achseln. »Ich glaube nicht, dass du ohne den Speer von hier weggehen würdest, aber für alle Fälle habe ich der Krone die magische Energie entzogen. Nur ein sehr geringer Teil der Magie, die aus dem Horc an die Oberfläche dringt, erreicht die Spitze dieses Turms. Dazu ist er zu hoch.« Er zeigte auf die ringsum in die gekrümmte Wand eingelassenen Fenster. »Und jeden Morgen reinigt die Sonne den gesamten Raum. Die Krone verleiht dir weiterhin die Gabe des verstärkten Sehens, aber viel mehr auch nicht. Dazu müsste sie erst wieder mit Magie aufgeladen werden.«
»Und warum gibst du sie mir zurück?«, wiederholte Jardir seine Frage.
»Ich wollte mit dir ein Gespräch führen. Und ich möchte, dass du meine Aura siehst, während wir uns unterhalten. Du sollst wissen, dass ich die Wahrheit spreche, dass ich eine feste Überzeugung habe, die sich in meine Seele eingebrannt hat. Vielleicht verstehst du es dann.«
»Was soll ich verstehen?«, hakte Jardir nach. »Dass der Himmel eine Lüge ist? Nichts, was sich in deine Seele eingebrannt hat, kann mich davon überzeugen, Par’chin.« Trotzdem setzte er sich die Krone auf. Sofort wurde der im Halbdunkel liegende Raum lebendig. Vor Erleichterung atmete Jardir tief durch, wie der blinde Mann, dessen Geschichte im Evejah erzählt wurde und dem Kaji das Augenlicht zurückgab.
Er blickte durch die Fenster. Die Landschaft, die bis jetzt nur aus Schatten und vagen Umrissen bestanden hatte, ließ nun scharfe Konturen erkennen, beleuchtet von der Magie, die aus Ala an die Oberfläche strömte. Alles Lebendige enthielt in seinem innersten Kern einen Funken Energie, und Jardir sah das Glühen dieser Kraft in Baumstämmen, in dem daran haftenden Moos und in jedem Tier, das im Geäst und der Borke lebte. Diese Magie durchzog einfach alles, angefangen von den Grashalmen der Steppe bis hin zu den Dämonen, die über das Land pirschten und durch die Lüfte segelten. Die alagai reflektierten diese Magie am stärksten, sie funkelten wie Leuchtfeuer und weckten in ihm einen urtümlichen Trieb, diese Kreaturen zu jagen und zu töten.
Es stimmte, was der Par’chin gesagt hatte. Bis in die Spitze des Turms drang nur ein schwacher Abglanz dieser magischen Energie vor, das Licht war hier trüber. Dünne Ranken aus Magie drifteten die Wände hinauf, angezogen von den in die Glasfenster eingeritzten Siegeln. Die Symbole flimmerten, wenn sie mit der Energie des Horc in Berührung kamen, und bildeten einen Schutzschirm gegen die alagai.
Doch obwohl der Raum nicht viel Magie enthielt, strahlte der Par’chin heller als ein Dämon. Eigentlich hätte sein Anblick unerträglich sein müssen, aber das Gegenteil war der Fall. Diese herrliche Erscheinung faszinierte den Betrachter, die Magie wirkte wie eine Labsal und eine Verlockung. Mithilfe der Krone dehnte Jardir seinen Geist aus und versuchte, sich ein wenig von dieser Energie einzuverleiben. Nicht so viel, dass der Par’chin etwas merkte, aber vielleicht genug, um die Heilung zu beschleunigen. Ein hauchdünner Faden aus Magie schlängelte sich durch die Luft in Richtung Jardir, wie ein Schwaden Weihrauch.
Der Par’chin hatte seine Augenbrauen abrasiert, aber die Siegel über seinem linken Auge zogen sich in einer unverkennbaren Geste nach oben. Seine Aura veränderte sich und verriet eher Nachdenklichkeit als Unmut. »Aha! Das kann ich leider nicht zulassen.« Abrupt kehrte sich der magische Fluss um und strömte wieder zu dem Par’chin zurück.
Äußerlich ließ Jardir sich nichts anmerken, aber er glaubte ohnehin, dass es völlig gleichgültig war, wie er sich gebärdete. Der Par’chin hatte recht. Er selbst konnte in der Aura des Mannes lesen, sah alle seine Gefühle, und zweifelsohne war sein alter Freund imstande, in derselben Weise Jardirs Gedanken und Emotionen zu entziffern. Der Par’chin war ruhig, konzentriert, und er führte gegen Jardir nichts Böses im Schilde. Er war nicht auf Täuschung aus. Aber er war sehr müde und hegte die Befürchtung, Jardir könne zu fanatisch sein, um unvoreingenommen über seine Worte nachzudenken.
»Verrate mir, warum ich hier bin, Par’chin«, sagte Jardir. »Wenn es stimmt, was du immer gesagt hast, und du die Welt tatsächlich von den alagai befreien willst, warum bist du dann mein Feind? Ich stehe kurz davor, deinen Traum zu erfüllen.«
»Du irrst dich«, widersprach der Par’chin. »So schnell, wie du glaubst, ist dieses Ziel nicht zu erreichen. Und die Art und Weise, wie du vorgehst, widert mich an. Du unterjochst und bedrohst die Menschen, angeblich zu deren eigenem Wohl, und dabei ist dir jedes Mittel recht. Ihr Krasianer kleidet euch mit Vorliebe in schwarze oder weiße Gewänder, aber die Welt lässt sich nicht in Schwarz und Weiß einteilen. Die Welt ist bunt, und es gibt viele Schattierungen von Grau.«
»Ich bin kein Narr, Par’chin«, warf Jardir ein.
»Manchmal bin ich mir da nicht so sicher«, erwiderte der Par’chin, und seine Aura bestätigte diesen Vorwurf. Es schmeckte wie bitterer Tee, dass sein alter Freund, dem er so viel beigebracht und den er immer respektiert hatte, so schlecht über ihn dachte.
»Warum hast du mich dann nicht getötet und den Speer und die Krone an dich genommen?«, wollte Jardir wissen. »Die Zeugen waren an den Ehrenkodex gebunden. Mein Volk hätte dich als den Erlöser akzeptiert und wäre dir in den Sharak Ka gefolgt.«
Zorn fraß sich wie eine Feuersbrunst durch die ruhige Aura des Par’chin. »Du hast es immer noch nicht begriffen«, fauchte er. »Ich bin nicht der verdammte Erlöser! Genauso wenig wie du der Erlöser bist! Die Menschheit als Ganzes muss sich selbst erlösen, und nicht auf einen Einzelnen warten, der sämtliche Menschen errettet! Everam ist lediglich ein Name, mit dem wir eine Idee, eine Vorstellung, bezeichnen. Und nicht irgendein Gigant im Himmel, der gegen die Schwärze des Weltalls ankämpft.«
Jardir presste die Lippen zusammen. Er wusste, dass der Par’chin die Stichflamme sah, die bei dieser Gotteslästerung durch seine Aura zuckte. Vor Jahren hatte er dem Par’chin damit gedroht, ihn zu töten, sollte er jemals wieder solche ketzerischen Schmähungen ausstoßen. Die Aura des Par’chin forderte ihn nun heraus, seine Drohung wahrzumachen.
Jardir war ernsthaft versucht, ihn anzugreifen. Er hatte die Macht der Krone noch nicht wirklich an dem Par’chin ausprobiert, und jetzt, da er sie auf seiner Stirn trug, war er keineswegs mehr so hilflos, wie es den Anschein hatte.
Doch da war noch etwas in der Aura seines ajin’pal, das ihn zögern ließ. Er war für einen Angriff gewappnet und würde ihn abwehren, aber über ihm schwebte ein Bild, das zeigte, wie alagai in einer Welt tanzten, die lichterloh brannte.
Seine Befürchtungen würden eintreten, wenn sie keine Einigung erzielten.
Jardir holte tief Luft, umarmte seine Wut und ließ sie beim Ausatmen entweichen. Der Par’chin auf der anderen Seite des Raums hatte sich nicht vom Fleck gerührt, aber seine Aura drückte Friedfertigkeit aus, wie ein Sharum, der seinen Speer senkt.
»Was spielt es für eine Rolle«, sagte Jardir schließlich, »ob Everam ein Gigant im Himmel ist oder ein Name, der als Sinnbild steht für Ehre und Mut, die Tugenden, die uns der Nacht trotzen lassen? Wenn die Menschheit als Ganzes handeln soll, dann muss es einen Anführer geben.«
»So wie ein Seelendämon Drohnen anführt?«, fragte der Par’chin und hoffte, Jardir in einen Widerspruch zu verwickeln.
»Ganz genau so«, bestätigte Jardir. »Die Welt der alagai war immer ein Schatten unserer eigenen Welt.«
Der Par’chin nickte. »Ay, in einem Krieg braucht man Generäle, aber die sollten dem Volk dienen, und nicht umgekehrt.«
Jetzt war es Jardir, der eine Augenbraue hochzog. »Glaubst du, dass ich meinem Volk nicht diene, Par’chin? Ich bin nicht der Andrah, ich sitze nicht selbstgefällig auf meinem Thron und schwelge im Überfluss, während mein Volk blutet und verhungert. In meinen Ländern gibt es keinen Hunger. Und es gibt keine Verbrechen. Ich selbst gehe in die Nacht hinaus, um mein Volk zu beschützen.«
Der Par’chin stieß ein harsches, spöttisches Lachen aus. Jardir hätte es als Beleidigung aufgefasst, wäre nicht ein Hauch von Ungläubigkeit durch seine Aura gehuscht. Er beherrschte sich.
»Deshalb spielt es eine Rolle«, sagte der Par’chin. »Weil du diese Dämonenscheiße tatsächlich glaubst! Du bist in Länder einmarschiert, die dir nicht gehören! Tausende von Männern wurden ermordet, ihre Frauen vergewaltigt und ihre Kinder versklavt! Aber du glaubst, deine Seele sei rein, weil das Heilige Buch dieser Leute ein kleines bisschen von eurem Heiligen Buch abweicht! Du sorgst dafür, dass sie vor Dämonen sicher sind, ay, aber ein Huhn auf dem Schlachtblock nennt den Schlächter nicht ›Erlöser‹, weil er den Fuchs verjagt hat!«
»Der Sharak Ka ist nahe, Par’chin«, betonte Jardir. »Ich habe aus solchen Hühnern Falken gemacht. Die Männer in Everams Füllhorn beschützen jetzt selbst ihre Frauen und Kinder.«
»Das tun die Talbewohner auch«, sagte der Par’chin. »Aber sie wurden zu Kämpfern, ohne sich gegenseitig umzubringen. Ohne auch nur eine einzige Frau zu schänden. Ohne ein Kind aus den Armen seiner Mutter zu reißen. Um Horclinge zu töten, wurden wir nicht selbst zu Dämonen.«
»Und du denkst, ich bin einer?«, fragte Jardir. »Ein Dämon?«
Der Dämon aus der Wüste. Jardir hatte diesen Namen oft gehört, aber nur im Tal wagte man es, ihn offen auszusprechen. Er nickte.
»Deine Leute sind dumm, Par’chin, und du bist auch nicht besser, wenn ihr mich auf eine Stufe mit den alagai stellt. Ihr mordet und schändet vielleicht nicht, aber ihr habt es auch nicht geschafft, euch in Eintracht zu verbünden. Eure Herzöge aus dem Norden sind untereinander zerstritten und wetteifern um die Macht, während sich vor ihren Füßen der Abgrund auftut und Nies Legionen sich zum Sturm bereitmachen. Nie kümmert sich nicht um eure Moral. Sie kümmert sich nicht darum, wer unschuldig ist und wer verderbt. Sie kümmert sich nicht einmal um ihre alagai. Ihr Ziel ist es, die Menschen zu vernichten.
Dein Volk lebt von geborgter Zeit, Par’chin. Und die Schulden werden eingefordert am Tag des Sharak Ka, wenn eure Schwäche die Menschen zu Fleisch macht, an dem der Horc sich gütlich tut. Dann werdet ihr euch wünschen, ihr hättet tausend, ja tausend mal tausend Morde begangen, wenn das nötig gewesen wäre, um euch auf den Kampf vorzubereiten.«
Der Par’chin schüttelte traurig den Kopf. »Du bist wie ein Pferd mit Scheuklappen, Ahmann. Du siehst nur, was deine eigene Überzeugung stützt, und für alles andere bist du blind. Nie kümmert sich nicht, weil es Nie überhaupt nicht gibt, verdammt noch mal!«
»Worte sind nichts als hohler Klang, Par’chin«, sagte Jardir. »Mit Worten kann man keine alagai töten oder bewirken, dass es Everam nicht gibt. Worte allein sind nicht imstande, uns alle für den Sharak Ka zu vereinen, bevor es zu spät ist.«
»Du sprichst von Einigkeit, aber du verstehst nicht, was das heißt«, warf der Par’chin ihm vor. »Was du Einigkeit nennst, bedeutet für mich Unterwerfung. Sklaverei.«
»Es geht darum, dass alle ein gemeinsames Ziel verfolgen, Par’chin«, sagte Jardir. »Dass sie sich darin einig sind, Ala von den Dämonen zu befreien.«
»Einigkeit ist nicht gegeben, wenn sie von einem einzigen Mann abhängt«, erwiderte der Par’chin. »Was ist, wenn dieser Mann plötzlich nicht mehr da ist? Wir alle sind sterblich.«
»Die Einigkeit, die ich geschaffen habe, wird überdauern«, behauptete Jardir. »So schnell zerfällt sie nicht.«
»Nein?«, zweifelte Arlen. »Während meines Besuchs in Everams Füllhorn habe ich viel gelernt, Ahmann. Die Herzoge im Norden haben keinerlei Einfluss auf dein Volk. Deine dama werden von Jayan keine Befehle annehmen. Deine Sharum werden Asome nicht anerkennen. Keiner der Männer wird sich Inevera unterordnen, und deine Damaji würden sich eher gegenseitig umbringen, als gemeinsam am selben Tisch zu speisen. Es gibt keinen, der deinen Platz auf dem Thron einnehmen kann, ohne dass ein Bruderkrieg ausbricht. Deine von dir so hoch geschätzte Einigkeit wird zerbröseln wie ein Palast, der aus Sand gebaut ist.«
Jardir merkte, wie sich seine Kiefermuskeln verspannten. Er knirschte mit den Zähnen. Natürlich hatte der