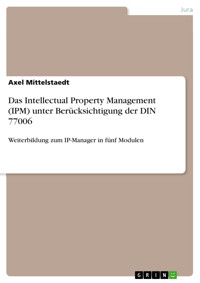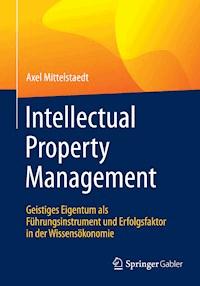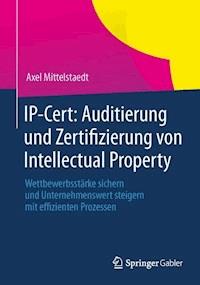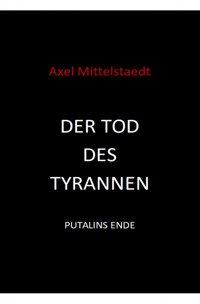
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte eines jungen Russen, der Zeuge würde, wie Wladimir Josefowitsch Putalin, von niemandem gehindert, als Staatsoberhaupt der Russischen Föderation in der Ukraine mit Hilfe der Soldaten der russischen Streitkräfte die allerschrecklichsten und abscheulichsten Verbrechen beging. Die russische Gesellschaft, die in Apathie und Passivität verharrte, ließ ihn gewähren, und die Welt-gemeinschaft schien zaudernd und eher kraftlos zu sehen, wie das Volk der Ukraine von Putalin nach dem mörderischen Überfall in die Knechtschaft geführt werden sollte. Boris Leginski, Informatiker, Programmierer und Hacker, erkannte die Möglichkeit, dem Verbrechen Einhalt zu gebieten und dieses Geschehen aufzuhalten. Dazu setzte er die Mittel der Künstlichen Intelligenz ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Axel Mittelstaedt
DER TOD
DES
TYRANNEN
Putalins Ende
Axel Mittelstaedt, von Haus aus Jurist, interessiert sich über die Fragen des Rechts und der Gerechtigkeit hinaus ganz allgemein für prozessuale Phänomene, etwa die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins und den Prozess der Zivilisation. Er ist davon überzeugt, dass gerade infolge dieser fortschreitenden Evolutionen das starre Festhalten an einmal eingetretenen Zuständen und das Festzurren einer Gesellschaft auf historisch entstandene Gegebenheiten jeweils zum Scheitern verurteilt sind.
Dies ist die Geschichte eines jungen Russen, der Zeuge wurde, wie Wladimir Josefowitsch Putalin, von niemandem gehindert, als Staatsoberhaupt der Russischen Föderation in der Ukraine mit Hilfe der Soldaten der russischen Streitkräfte die allerschrecklichsten und abscheulichsten Verbrechen beging. Die russische Gesellschaft, die in Apathie und Passivität verharrte, ließ ihn gewähren, und die Weltgemeinschaft schien zaudernd und eher kraftlos zuzusehen, wie das Volk der Ukraine von Putalin nach dem mörderischen Überfall in die Knechtschaft geführt werden sollte. Boris Leginski, Informatiker, Programmierer und Hacker, erkannte die Möglichkeit, den Verbrechen Einhalt zu gebieten und dieses Geschehen aufzuhalten. Dazu setzte er die Mittel der Künstlichen Intelligenz ein.
Inhalt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Impressum
Text: ©2025 Copyright by Axel Mittelstaedt
Umschlag: ©2025 Copyright by Axel Mittelstaedt
Verantwortlich für den Inhalt:
Axel Mittelstaedt
Am Beethovenpark 17
50935 Köln
Druck: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
In Erinnerung an Georg Elser
Was von dem, was passiert, ist Zufall, was Menschenwerk?
1.
Nadja Golina war eine junge Moskowiterin von noch nicht dreißig Jahren. Sie war in einem großzügigen, eher liberalen Elternhaus aufgewachsen. Ihre Mutter war Lehrerin für Sprachen an einer höheren Schule, der Vater unterrichtete das Recht an einer der Hochschulen in Moskau. Geschwister hatte sie keine. Nadja hatte sich nach dem Schulabschluss für ein Studium der Geschichte und der Philosophie an der Moskauer Lomonossow-Universität entschieden.
Als talentierte und engagierte Studentin wurde sie von ihren Professoren gefördert. Sie erhielt ein Begabtenstipendium für das Fach Philosophie, das sie an die deutsche Universität in Heidelberg führte. Sie war froh und fühlte sich erleichtert, dass sie zu diesem Zeitpunkt Russland verlassen konnte. Ihr Land hatte bereits vor Jahren die Krim annektiert und sich Gebiete im Osten der Ukraine größere Gebiete einverleibt. Es deutete sich bereits an, dass die russische Führung weiter in diesem Sinn vorgehen würde.
Während ihres Aufenthaltes in der Stadt am Neckar lernte die sprachbegabte Nadja Deutsch und konnte schon nach kurzer Zeit den Lehrveranstaltungen folgen und sich dann auch etwas verständigen und ein wenig mit anderen Studenten unterhalten. Die Universität hatte Sprachkurse für ausländische Studenten eingerichtet, an denen Nadja engagiert teilnahm. Für das Erlernen der deutschen Sprache hatte sie zusätzlich einen Trick angewandt, den ihre Mutter ihr verraten hatte. Sie nahm sich ein zunächst nur einfaches deutsches Buch vor, ein Kinderbuch, und begann, laut darin zu lesen. Es klang zunächst auch für ihre eigenen Ohren seltsam. Als sie die nähere Bekanntschaft einer deutschen Kommilitonin machte, Helga Lund, bat Nadja sie, ihr gelegentlich bei ihren Leseversuchen zuzuhören und mit ihr zu arbeiten. Davon profitierte Nadja in hohem Maße, konnte sich aber auch bei Helga revanchieren, die sich entschlossen hatte, Russisch zu lernen. Beide freundeten sich an. Bald wurden die deutschen Texte, die Nadja las, anspruchsvoller. Ihre Deutschkenntnisse entwickelten sich erfreulich.
Bei einer ihrer gemeinsamen Vorlesesitzungen fragte Nadja Helga, ob sie Russland kenne. „Nicht gut“, meinte Helga, „oder besser: kaum. Ich war selbst nie dort. Russland ist mir sehr fremd und auch, wie ich gestehen muss, etwas ungewöhnlich und auch ein wenig unheimlich. Russland scheint etwas ganz Eigenes zu sein, kaum vergleichbar mit anderen Ländern. Dabei hat es mit seiner Kultur durchaus etwas Faszinierendes, aber im Übrigen auch wenig Anziehendes. Da wirkt sich aus, dass Russland international, schonend ausgedrückt, schon häufig in wenig einnehmender Art und Weise aufgetreten ist und auftritt. Ich erwähne nur Ungarn 1956, Tschechoslowakei 1968, Afghanistan in den 1980er Jahren, Tschetschenien und Syrien. „Kennst du Menschen, die in Russland waren und mein Land kennengelernt haben?“, wollte Nadja dann wissen. „Na ja, ein entfernter Verwandter von mir war über zehn Jahre nach dem 2. Weltkrieg in russischer Kriegsgefangenschaft. Er war, wie viele andere, die das auch erlebt haben, einigermaßen traumatisiert und erzählte zu seinen Lebzeiten nur wenig über seine Erlebnisse während dieser Gefangenschaft. Aber aus seinem langen Aufenthalt in Russland brachte er keine Abneigung gegen die Russen selbst mit. Vielmehr hatte er einen großen Hass auf den Bolschewismus und die Bolschewiken entwickelt. Und dann habe ich auch noch einen älteren Vetter, der in den 1990er Jahren längere Zeit in Russland verbracht hat. Mit ihm habe ich mich damals intensiv ausgetauscht. Er war von deinem Land und seiner Kultur sehr fasziniert und auch angetan. Aber dort bleiben kam für ihn nicht in Betracht.“
„Ja, man muss wohl Russe sein, um Russland lieben zu können“, äußerte Nadja. „Dabei ist es wirklich liebenswert. Aber ich selbst mache auch einen Unterschied zwischen unserem Land und seiner jeweiligen Führung.“ „In der Tat sorgt sie, schon solange ich denken kann, nicht gerade dafür, dass die Sympathien für Russland in der Welt überhandnehmen“, bestätigte Helga das.
Dann bemerkte Nadja zu Helga: „Ich erlebe bei meinem Aufenthalt hier in Deutschland etwas, womit ich nie gerechnet hätte. Ich kann hier einfach leben und handeln, ohne mich ständig fragen zu müssen, welche unangenehmen Konsequenzen mir drohen, wenn ich dies oder jenes tue oder unterlasse. Natürlich muss man sich immer Gedanken über die Folgen seines Handelns machen, aber es ist etwas ganz anderes, ständig in Furcht leben zu müssen, wie ich das in Russland als Normalzustand erlebt und gar nicht weiter hinterfragt oder gar problematisiert habe. So zu leben, passiert wohl eher unbewusst und wird einem gar nicht klar. Ohne Auslandserfahrung kann es das auch kaum werden. Das Leben hier in Deutschland ist einfach leichter und unbeschwerter, und ich frage mich, ob das vielleicht der Grund dafür ist, dass die Menschen in diesem Teil der Welt weniger belastet und einfach glücklicher aussehen als bei mir zuhause. Natürlich kann man auch in Russland leben und noch nicht einmal schlecht, wenn man eine gute Ausbildung und einen qualifizierten Beruf hat und nicht aneckt. Aber die Angst und ein latentes Misstrauen sind doch immer präsent. Und Lüge und Verstellung auch. Ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben findet nicht statt!“
Helga sagte dazu, bei dieser Schilderung der Zustände und des Lebens in Russland müsse sie an einen verstorbenen Großonkel denken, der in Deutschland die Nazizeit als junger Mann erlebt hatte. Er habe einmal zu ihr gesagt: „Wenn man sich ein wenig vorgesehen hat, konnte man damals in Deutschland eigentlich ganz gut leben.“ Helga sei innerlich entsetzt gewesen, als sie das hörte. Natürlich war ihr bewusst, dass viele Menschen damals im III. Reich verschont geblieben waren und wenig auszustehen hatten. Aber „ganz gut leben“? Doch nur, wenn man im Sinne der Machthaber germanisch-kräftig-deutsch im Sinne von arisch war oder sich zumindest total anpasste. Aber doch in keiner Weise, wenn man körperlich oder geistig behindert war oder schwul, oder als Angehöriger der Sinti und Roma oder gar Jude im Ergebnis der Negativauslese und dem Schrecken nicht entging. An all denen tobte sich das Nazi-Regime mit seiner menschenfeindlichen Bestialität und Brutalität in entsetzlichster Weise aus, und die damalige Zivilgesellschaft ließ in ihrem Mangel an Mitgefühl und ihrer Erbarmungslosigkeit und ihrer Gleichgültigkeit den allerschlimmsten Verrat an der Menschlichkeit zu. Was Helga aber zusätzlich an der Bemerkung ihres Großonkels schockiert hatte, war die stillschweigende Aufgabe des Anspruchs auf Würde. Sich ständig in Acht nehmen müssen und nur deswegen „eigentlich ganz gut leben“ können – war denn das eines Menschen würdig, eines Geschöpfes, das neben der Veranlagung zum Bösen aber auch das Göttliche in sich trägt und die Fähigkeit, sich zwischen beiden Polen entscheiden zu können? Es war doch eher die Preisgabe seines menschlichen Wesens und seiner Würde!
Sie diskutierte diese Erwägungen mit Nadja. Die russische Freundin sagte zu ihr: „Meine vor einiger Zeit verstorbene Großmutter Irina, bei uns nennt man die Oma Babuschka, war Anfang der 30er Jahre geboren worden und hatte die Jahre des Stalinschen Terrors zweimal miterlebt, einmal als kleines Mädchen und junge Jugendliche vor dem Krieg und dann noch einmal, sehr viel bewusster, als jüngere erwachsene Frau in den Jahren nach dem Kriegsende. Meine Babuschka erzählte mir mehrfach, dass es für ihre Eltern, aber auch andere Familienangehörige, in dieser schwierigen Zeit am allerwichtigsten war, die eigene Würde nicht zu verlieren. Dafür durfte man sich allerdings nicht zu sehr exponieren. Keine dieser Personen hatte denn auch eine besondere Karriere gemacht. Sie alle haben ein eher bescheidenes Leben geführt.“
Für Nadja als Kind hatte der Begriff der Würde, aus dem Munde ihrer Babuschka vernommen, etwas Erhabenes. Späterhin, als sie begann, Dinge zu hinterfragen, wurde es Nadja wichtig, darüber nachzudenken, was unter diesem Begriff zu verstehen sei. Ihr kam es so vor, dass den Menschen ihrer Umgebung, auf die das Wort Würde bezogen werden sollte, lediglich wichtig war, sich nicht in Schuld verstricken zu lassen und ein Mindestmaß an Verantwortung zu zeigen, auf das nicht verzichtet werden konnte, auch um den Zusammenhalt der Familie nicht zu gefährden. Alles hatte mit einer bestimmten Zurückgezogenheit zu tun, in gewisser Weise mit einer Einbuße an Lebendigkeit. Schon damals fragte sie sich, ob unter „Würde“ nicht vielleicht doch mehr verstanden werden könnte oder sollte, als was ihr vorgelebt wurde. Ihr schien, dass das Streben nach Würde sich nach dem Verständnis der ihr bekannten Menschen auf das Verhalten im Bereich des Privaten beschränkte; ein Trachten nach würdegemäßen Verhältnissen darüber hinaus, etwa insgesamt innerhalb des Gemeinwesens aller, konnte sie aber nirgends erkennen. Dieser Widerspruch, der andere allerdings nicht im gleichen Maße zu stören schien, verstummte für Nadja aber allmählich entsprechend den steigenden schulischen Anforderungen in den höheren Klassen und den Herausforderungen ihres anschließenden Studiums. Der allgemein in Russland wachsende Lebensstandard tat ein Letztes, um Zweifel zu übertönen oder gar zu zerstreuen. Und schließlich wurde Nadjas Aufmerksamkeit immer mehr auch von ihren attraktiven Kommilitonen eingefangen.
Nadjas Großmutter hatte sehr dezidierte Überzeugungen. „Der ganze Bolschewismus war eine einzige Lüge“, sagte sie einmal zu Nadja. „Das russische Volk und neben ihm noch eine Reihe anderer wurden auf groteske Weise betrogen. Den Bolschewiken lag nicht im Geringsten an den Werten, die Marx und Engels veranlasst hatten, ihre Philosophie zu verbreiten. Sie missbrauchten deren Ideen zu dem alleinigen Zweck, die Macht an sich zu reißen und deren Erhalt zu sichern. Der Rest war eine irrwitzige propagandistische Inszenierung. Alles war auf Lügen aufgebaut. Was immer die Macht vermag, soviel Destruktivität sie auch auslebt, eins kann sie nicht: die Wahrheit töten. Und deswegen musste das ganze System irgendwann wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen, was dann ja auch geschehen ist, trotz der überall präsenten Geheimdienste und der verbreiteten Denunziation. Das Regime konnte sich auch nicht mit dem aufrechterhalten, was es anderen Völkern weggenommen hatte. Wenn sich Russland nicht weiterbewegt, sagte sie, wird sich der Kollaps unweigerlich wiederholen. Aber nicht nur Russland muss sich ändern, wir Russen müssen es!“
„Im Augenblick hat man nicht den Eindruck, dass die Machtverhältnisse in Russland instabil wären“, meinte Helga. „Wie soll oder kann es denn dazu kommen, dass das System erneut kollabiert?“ „Das weiß ich auch nicht“, antwortete Nadja, „Ich habe meine Oma gefragt, wie es erklärt werden könnte, dass die Menschen in Russland das aushalten, was sie beschrieben hatte. Sie sagte mir dazu, es liege an einem fatalen Gemisch an innerer Bereitschaft der Menschen, sich unterdrücken zu lassen und zu leiden, und an der Fähigkeit der Mächtigen, Angst und Misstrauen zu säen und den daraus entstehenden lähmenden, mutlosen Zustand der russischen Gesellschaft aufrechtzuerhalten, notfalls mit Gewalt. Das Endergebnis ist eine unfassbare, historisch stabile Aufspaltung des russischen Volks in eine kleine Schicht, die die Macht besitzt und ausübt, und den großen Rest, der sich damit zufriedengibt, ungestört vor sich hin zu leben, und auch damit, dass die Machtclique ungestört ihre Politik betreiben kann.“
„Aber verraten sie damit nicht ihre Würde?“ wollte Helga wissen. „Sie scheinen damit kein Problem zu haben“, entgegnete Nadja. „Sie begnügen sich mit einem relativen, eingeschränkten Würdebegriff, der ihnen im Leben keine allzu großen Probleme beschert! Sie können nicht erkennen, dass die Würde eines Menschen allein abhängig ist von der moralischen Qualität seines Wollens und Handelns. Sie sind dieser Einsicht nicht fähig, sie würde ihnen die Grundlage ihrer Existenz allzu sehr gefährden. Das können sie nicht zulassen.“
„Was du schilderst, unterscheidet sich schon sehr von der Realität in unseren Bereichen Europas“, merkte Helga an, „wie ist das zu erklären, dass es diesen Unterschied gibt? Ich meine, soweit sind unsere Völker geografisch ja doch gar nicht voneinander entfernt.“ „Ja schon“, setzte Nadja nach, „aber ihre Geschichte ist jeweils ganz anders verlaufen. Unser Volk ist tief geprägt durch die schrecklichen Erfahrungen mit einfallenden und unterdrückenden Fremden. Ich erwähne nur die Mongolen und Tartaren, die das ganze Mittelalter hindurch die damalige Bevölkerung Russlands gepeinigt und ausgebeutet haben. Diese Erfahrung hat sich in die DNA unseres Volks eingefräst. Es hat eine unverhohlene Angst vor dem Einfall fremder Horden und daraus ein großes, wohl übersteigertes Sicherheitsbedürfnis entwickelt.“
„Aber gegenwärtig“, wandte Helga ein, „bedroht doch niemand dein Volk, niemand will es dominieren und unterjochen!“ „Das ist ein Riesenproblem, das du da ansprichst. Dem Volk wird mit der Staatspropaganda suggeriert, dass das doch so ist. Als Resultat duldet das russische Volk die unterdrückende Beherrschung durch die eigenen Machteliten, die es ihm ersparen, so die Propaganda, von fremden Despoten unterdrückt zu werden! Das Volk hat noch nicht verinnerlicht, dass ihm keine fremden Völker mir Dominanzvorhaben mehr gefährlich werden, dass sich die geschichtliche Situation in dem Punkt entscheidend geändert hat. Und es hat auch nicht nachvollzogen, dass Russland als Superatommacht über ein Verteidigungspotential verfügt, das es regelrecht unangreifbar macht. Aber, wie gesagt, es gibt in Russland Kräfte, denen diese Umstände in die Hände spielen, weswegen sie die russische Xenophobie und das Sicherheitsbedürfnis der Russen pflegen und dafür sorgen, dass sich daran nichts ändert.“
2.
Das Fach Philosophie forderte Nadja. Oder vielmehr forderte sie sich selbst. Sie entschloss sich, in dem begonnenen Semester, wie alle anderen Studenten des Fachs ihres Niveaus, eine Seminararbeit abzuliefern. Der Assistent am Lehrstuhl, der das Seminar praktisch durchführte, war für ihre Betreuung zuständig. Sein Name war Jakob Laut, er war Jude, was allgemein bekannt war. Er meinte einmal zu Nadja: „Die Philosophie ist griechisch und deutsch.“ Nadja ging dem nach und stellte fest, dass er damit weitgehend recht hatte, zumal keine international beachtete philosophische Lehre von Russland ihren Ausgang genommen hatte. Allerdings bemerkte Nadja bei Gelegenheit gegenüber Jakob Laut, wenn die Philosophie griechisch und deutsch ist, sollte nicht vergessen werden, dass sie auch jüdisch sei, zumal der vielleicht größte russische Philosoph, Simon Frank, selbst Jude war. Aber schließlich seien auch Spinoza, Moses Mendelssohn, Moses Hess, Husserl, Bergson und andere berühmte Denker wie Erich Fromm, Hannah Arendt und Karl Popper Juden gewesen, Karl Marx nicht zu vergessen. Und ob Philosophieinteressierte nicht zusätzlich auch in die englischsprachige Welt und ferner nach China, Japan, Indien und Arabien blicken sollten?
Als die Themen der Arbeiten vergeben waren, erkundigte Nadja sich bei Helga, wofür sie sich entschieden hatte. „Mich interessiert die Frage nach dem höchsten Gut, dass es für Menschen gibt“, gab sie an. „Ich finde es bemerkenswert, dass einige der großen Philosophen sich ihr zugewandt, sie aber sehr unterschiedlich beantwortet haben. Platon betrachtete nicht das Leben als solches als Höchstes Gut, sondern erst das „gute Leben“. Nach Seneca ist das summum bonum die ethisch-moralisch richtige und charakterfeste innere Einstellung des Menschen. Virtus nennt er das, Tugend. Schopenhauer ist da ganz anders. Für ihn ist das höchste Gut die Heiterkeit. Und nichts als das! Ich finde das äußerst sympathisch. Für Kant muss der Mensch eine Einheit von Tun des Guten und Sich-Freuen am Guten erreichen. Dann ergebe sich als höchstes Gut eine Welt, in der alle Menschen in dem Maß glücklich sind, wie sie das aufgrund der moralischen Qualität ihres Handelns verdienen. Subjektive Faktoren müssen ebenso beachtet werden, wie objektive. Auch das macht den Reiz des Themas für mich aus. Und du – was möchtest du untersuchen?“ fragte Helga zurück. „Ich finde es fordernd, und es würde mir Spaß machen, mir Gedanken zu machen über das Verhältnis dreier philosophischer Themen zueinander: das ist einmal der bekannte Appell aus der griechischen Antike „gnothi seauton“, sich selbst zu erkennen, andererseits die kantische ethische Anforderung an das menschliche Tun gemäß dem kategorischen Imperativ und drittens der Wahlspruch der Aufklärung nach Kant, der aufgefordert hat, den Mut zu haben, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen und wissend und weise zu werden – sapere aude. Welche Beziehung haben diese drei Elemente philosophischen Denkens zueinander?“
Die beiden Studentinnen verabredeten, sich erneut auszutauschen, wenn erste Ergebnisse entstanden seien. Kurz darauf trafen sie sich wieder. Nachdem Helga von ersten konzeptuellen Gedanken zu ihrem Thema berichtet hatte, war sie gespannt, von Nadja zu erfahren, was ihr durch den Kopf gegangen war. Nadja gestand, dass sie nur auf Fragen gestoßen sei. „Was heißt nur“, wollte Helga wissen, „Kant hat bekanntlich seine vier berühmten Fragen gestellt. Sie kommen ganz schlicht daher und scheinen ganz einfach zu sein und beantwortet werden zu können. Dabei sind sie ein wesentlicher Teil seiner hochkomplexen Philosophie. Als bloße Fragen und auch ohne, dass er dazu die passenden Antworten gleich mitgeliefert hat. Die muss der Angesprochene schon selbst finden. Sapere aude!“
Nadja berichtete, dass ihre erste Frage die Selbsterkenntnis betraf: „Wie soll ich mich selbst erkennen können, wenn ich mich nicht meines eigenen Verstandes frei bedienen kann? Dann die zweite: Wie kann ich wissen, dass ich mich ohne Leitung eines anderen meines eigenen Verstandes bediene, wenn ich keine Klarheit habe, wer ich denn bin, ob ich es wirklich selbst bin, der Besitzer dieses Verstandes ist, dessen ich mich bedienen will? Und dann: Wenn ich, nach existentialistischen Gedanken nur insoweit existiere, wie ich agiere: wie kann ich denn ein eigenes Leben hinkriegen, wenn ich nicht weiß, ob ich es denn bin, der da handelt. Und – vorläufig – zuletzt: Muss ich nicht versuchen, mein Handeln an den Erfordernissen des kategorischen Imperativs zu messen, um zu verstehen, was ich mache und ob ich mich bei der Ausrichtung meines Tuns tatsächlich autonom meines eigenen Verstandes bediene? Gelingt es mir dabei, psychische Abwehrmechanismen, wie Verdrängung, Rationalisierung, Sublimierung, Projektion usw. zu überwinden und auszuschalten?“
„Das scheint mir darauf hinauszulaufen“, meinte Helga dazu, „dass jeder Mensch mit wirklich hohen Anforderungen konfrontiert ist. Aber das braucht Menschen keineswegs zu überfordern. Jeder kann das Maß seiner eigenen Pflichterfüllung finden. Er muss nur denken! Nur! Uns ist das Leben geschenkt worden, nicht das leichte Leben. Ich habe das mal irgendwo auf Englisch gelesen: Life is not meant to be easy, it´s meant to be lived!“
„Schön! Ja“, ging Nadja darauf ein, „und ich frage mich: Läuft das sapere aude nicht auf ein vivere aude hinaus, habe Mut zu leben? Mich hat schon vor einiger Zeit gewundert, dass Kant nicht eine fünfte Frage gestellt, der eigentlich keiner mehr ausweichen kann, wenn er sie einmal gehört hat: Was ist das Leben? Sie ist wichtig!“ „Weil sie sich an den Einzelnen adressiert als: Was ist mein Leben?“ „Ja, genau!“
Dann kam Nadja wieder auf das Thema der menschlichen Würde zurück: „Ist es nicht so, dass erst ein solches Leben, das nicht easy ist, also ein anspruchsvolles, forderndes und autonomes, selbstbestimmtes, der Würde des Menschen entspricht? Ist es nicht unwürdig, das Leben geschenkt zu bekommen haben und es dann nicht zu leben?“
„So ist es“, meinte Helga, „auch wenn das im Ergebnis dem verbreiteten Wunsch der Menschen nach Annehmlichkeiten und Bequemlichkeit sehr zuwiderläuft. Alle Menschen sind als solche wertvoll, aber nicht alle sind wertvolle Menschen. Ihr ganz persönlicher Wert sinkt in dem Maße, wie sie in ihrer Haltung und ihrem Verhalten moralischen Anforderungen nicht genügen oder gar widersprechen.“
„Ich muss dabei unwillkürlich an unseren Präsidenten Putalin denken. Helga, dies ist jetzt total vertraulich, bitte behalte es unbedingt für dich: Er tritt die Freiheit, das Recht und die Pflicht zur Wahrheit mit Füßen. Er hat sich für eine Verhaltensweise entschieden, die moralische Anforderungen einfach total negiert. Mit seiner Einstellung und Handlungsweise hat er seine eigene Würde in meinen Augen hochgradig beschädigt. Sein Verhalten scheint dabei für ihn selbst alternativlos zu sein, weil er starken Zwängen unterliegt. Und zwar von seiner Erziehung und Prägung durch den russischen Geheimdienst her, dem er lange angehörte, was ihn allerdings nicht entschuldigt. Er muss, für ihn anscheinend ausweglos, die frühere imperiale Größe Russlands wieder anstreben. Dafür ist ihm kein Opfer zu groß – das andere bringen müssen.“
„Dabei hatte Putalin bei uns in Deutschland früher einmal einen erstaunlich guten Ruf. Ein früherer Bundeskanzler hat ihn damals einen lupenreinen Demokraten genannt, was er bis heute nicht widerrufen hat. Der Deutsche Bundestag huldigte Putalin mit standing ovations, nachdem dieser im September 2001 vor dem Plenum in seiner Rede in deutscher Sprache Dinge von sich gegeben hatte, die man aus heutiger Sicht nur als lupenreine Verstellung bezeichnen kann. Putalin ist als Mensch wertvoll, aber ist er auch ein wertvoller Mensch? Ich sag jetzt mal was ganz schlimmes“, sagte Helga dazu, „denn mir fällt dazu ein krass kennzeichnender Begriff ein, den es im Deutschen eigentlich gar nicht gibt: Abmensch.“ „Klingt schrecklich!“ wand Nadja ein. „Ja, aber das passt für einen, der so ist. Nach allem, was ich über Putalin weiß, ist er für mich ein Abmensch, so wie Hitler auch ein Abmensch war. Er ist damit nicht der einzige, es gibt leider auch viele andere! Natürlich ist auch ein Abmensch ein Mensch und als solcher grundsätzlich wertvoll. Aber sein Wert als der konkrete Mensch, der er ist, ist extrem reduziert entsprechend der Wertverminderung, die er sich durch sein Wollen und Handeln selbst zugefügt hat.“
„Na ja, jedenfalls eine einfallsreiche Wortbildung! Aber ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt“, kommentierte Nadja Helgas Überlegung. „Ich versuche es auch einmal: Absoluter Ichling. Gibt es das Wort im Deutschen?“ „Ja, ich meine, ich hätte das schon einmal gehört. Aber Glückwunsch: Deine Wahl trifft den Charakter ziemlich genau! Ichling – das ist im Übrigen auch mein Eindruck“ fuhr Helga fort. „Es kommt Putalin letztlich allein auf Putalin an. An Russland, so wie er sein Land behandelt und seine Menschen, liegt ihm gar nichts. Meinen negativen Eindruck von seiner Person hat er selbst begründet, als er 2014 die „grünen Männchen“ in die Krim einmarschieren ließ und in nicht zu überbietender Schamlosigkeit in die Fernsehkameras der Welt log, als er sagte, er wüsste nicht, was da vor sich ging. In dem Moment war mir klar, dass von diesem Menschen von da an nichts Gutes mehr zu erwarten war.“
3.
Nadja stellte ihre Arbeit fertig und legte sie Jakob Laut vor. Nachdem er sie gelesen hatte, gratulierte er ihr und teilte ihr mit, dass der beurteilende Professor sie sehr gut benotet hätte. „Mit dieser Leistung wird dein Stipendium wahrscheinlich verlängert werden können. Der Lehrstuhl würde das befürworten.“ „Ich habe auch daran gedacht, noch länger zu bleiben, denke aber, dass ich nach Moskau zurückkehren sollte, nicht nur wegen meiner Eltern, die ihr einziges Kind vermissen. Ich möchte dort zu einem anderen Thema forschen, auch unter geschichtswissenschaftlichen Gesichtspunkten. Es geht dabei um die philosophisch-psychologische Deutung des Phänomens der Gewaltherrschaft. Wir haben davon in Russland über Jahrhunderte reichlich genießen können. Es gibt sozusagen genügend Anschauungsmaterial.“ „Wir verfügen hierüber in Deutschland auch nicht gerade wenig. Adolf Hitler hatte in dieser Hinsicht den Vogel abgeschossen zusammen mit den ihm ergebenen und blind folgenden Deutschen.“ „Ja, er war aber nicht der Letzte geblieben, denkt man mal an Mao, Pinochet, Pol Pot und andere. Helga hat für diese Herrschertypen den Begriff des Abmenschen gebildet. Das scheint es ganz gut zu treffen. Mich interessieren aber zusätzlich die für diese Menschen immer notwendigen Komplementärfaktoren, in erster Linie die Menschen, die einen solchen Abmenschen und sein Treiben überhaupt erst möglich machen – Schergen.“ „Klingt spannend!“ bemerkte Jakob dazu. „Halt mich dazu bitte auf dem Laufenden!“
4.
Nach dem Auslaufen des Stipendiums kehrte Nadja in die russische Hauptstadt zurück. Sie hielt den Kontakt mit Helga zusammen mit ihr aufrecht. Sie wechselten Textbotschaften, digital und analog, sofern sie das Ferngespräch nicht gelegentlich vorzogen.
Nadja schloss in Moskau ihr Studium in beiden Fächern ab, die ihr gleich wichtig waren. Nachdem sie die Diplomprüfungen mit gutem Erfolg bestanden hatte, einigte sie sich mit ihrem Geschichtsprofessor, eine Dissertation zu schreiben und mit ihm ein Thema abzustimmen. Sie entschied sich für das Thema „Voraussetzungen und Umstände der Entstehung, der Herrschaft und des Untergangs faschistischer Regime.“ Es wurde akzeptiert.
Während des Studiums hatten die faschistischen Staaten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter dem Aspekt der Gewaltherrschaft sie im besonderen Maß interessiert, was vielleicht daran lag, dass ihr Großvater väterlicherseits als jungen Mann von den deutschen Nazis kurz vor Ende des Kriegs als vermeintlicher russischer Partisan ermordet worden war. Nadja stellte die Arbeit fertig und legte sie ihrem Doktorvater vor. Das Thema war entsprechend ihren Vorüberlegungen „Voraussetzungen und Umstände der Entstehung, der Herrschaft und des Untergangs faschistischer Regime.“ Nach Prüfung der Arbeit legte ihr Doktorvater ihr allerdings nahe, die Dissertation zurückzuziehen und nicht zu verteidigen. Er hatte gemerkt, dass die Arbeit mehr als nur vage Anspielungen auf die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit in Russland und der ganzen russischen Föderation enthielt. Immerhin riet er ihr nicht, die Arbeit inhaltlich abzuändern. Es wäre ihr auch intellektuell unredlich erschienen, und es hätte auch jeden wissenschaftlichen Anspruch negiert, zu unterdrücken, in welchem Maß die Wirklichkeit der Verhältnisse in ihrem Staat den Kriterien entsprach, die die unterschiedlichen Faschismustheorien für die Entstehung und das Vorhandensein dieser rechtsextremen Gesellschaftsform entwickelt hatten.
Nach dem Scheitern ihrer Promotion kam für Nadja eine berufliche Tätigkeit in der Forschung nicht mehr in Betracht. Und es gelang ihr auch nicht, eine der raren Stellen für Historiker außerhalb des akademischen Bereichs zu bekommen; der Doktortitel wurde überall vorausgesetzt. Schließlich war sie froh, auch ohne akademischen Abschluss im Bibliothekswesen eine in diesem Bereich einigermaßen attraktive Anstellung zu finden.
5.
Boris Leginski, den seine Mutter Anfang der 1990er Jahre zur Welt gebracht hatte, wuchs in einer Familie auf, die man außerhalb Russlands als einfach bürgerlich bezeichnen würde. Der bereits vor einiger Zeit verstorbene Vater hatte in einem Verlag in Moskau gearbeitet, seine Mutter war Hausfrau und Angestellte in einem Bauunternehmen. Seine wichtigste Bezugsperson war seine Großmutter mütterlicherseits, die für die berufstätigen Eltern seine Erziehung übernommen hatte. Er war ihr Lieblingsenkel. Um Wanja, seinen älteren Bruder, kümmerten sich in der Kindheit die Eltern des Vaters.
Ja, Wanja. Sein wirklicher Vorname war Iwan. Er war, wie Boris, unverheiratet und Mathematiklehrer an einer Moskauer Hauptschule. Das Fach entsprach seinem Naturell. Es stand für ein geschlossenes, logisch perfektes und unangreifbares System, das sich mit dem ungeordneten und alles andere als perfektem System des Lebens, seinem Chaos, nicht auseinanderzusetzen brauchte. Boris bezeichnete sein Verhältnis zu seinem Bruder als nicht sehr eng. Dessen Verhalten und seine Einstellungen waren und blieben Boris fremd.
Fremd war Boris auch, dass sein Bruder ein gläubiger und leidenschaftlicher Anhänger der russisch-orthodoxen Kirche war. Wanja besuchte regelmäßig Gottesdienste in den Kirchen Moskaus und hatte sich bei mehreren Gelegenheiten als ausgesprochen überzeugter Parteigänger des Patriarchen Kyrill I. gezeigt. Boris verstand die Frömmigkeit seines Bruders als Ausdruck einer besonders intensiven Empfindung seiner russischen Identität. Für Wanja gehörten seine russische Volkszugehörigkeit und die orthodoxe Religiosität untrennbar zusammen. Dazu dozierte er gelegentlich: „Der Rang Moskaus als Drittes Rom verleiht Russland eine göttliche Legitimität und einen besonderen Machtanspruch. Seitdem der römisch-katholische Glaube, der nach russisch-orthodoxer Auffassung kein authentisch christlicher ist, in der Hauptstadt des Römischen Reichs, Rom, einzig zugelassen war und nachdem Konstantinopel durch die Muslime 1453 erobert worden war, ist Moskau das wahre Rom, das Dritte Rom. Die russische Geschichte verwirklicht als einzige die christliche Heilsgeschichte. Das rechtfertigt die Richtung der russischen Politik, das Einflussgebiet der russischen Orthodoxie über die Grenzen Russlands hinaus auszudehnen. Und mehr noch: Das ist sogar christlich geboten!“
„Das ist mir viel zu apodiktisch“, entgegnete Boris. „Ist denn das Christentum nicht die Religion des Lebens und damit der Toleranz allen Lebens, so wie es als geschaffenes existiert?“ hielt Boris seinem Bruder entgegen. „Ja und nein“, warf Wanja da ein, „denn das Leben existiert ja nicht nur als geschaffenes, sondern auch als verführtes und verfälschtes durch die Kräfte des Antichristen in seinen vielfältigen Formen. Dann muss es in die richtigen Bahnen gelenkt werden, und dazu ist das Dritte Rom berufen!“ Wanja fühlte sich weder bemüßigt noch verpflichtet, näher auf Boris´ Frage einzugehen. Boris wiederum fühlte sich nicht davon abhängig, einen Bruder zu haben, der anders war und dachte als Wanja. Er empfand auch keine Regung, auf Wanja einzuwirken. Dafür war er an Wanja dann doch nicht ausreichend interessiert. Wanja sollte sein Leben führen können, so wie es ihm zugefallen war. Seines Glückes Schmid – war das nicht die Sache eines jeden einzelnen?
Boris seufzte bei sich – man kann sich seine Geschwister nicht aussuchen.
6.
Eines Morgens hatte Boris ein Erlebnis, das er nie wieder vergessen würde. Er befand sich gerade in der Moskauer U-Bahn auf dem Weg von seiner Arbeit nach Hause. Als die U-Bahn in einer Station hielt, sah er in dem Zug, der an dem Bahnsteig auf der gegenüberliegenden Seite hielt, eine junge Frau, die, kurz nachdem er sie erblickt hatte, seinen Blick aufgriff und erwiderte. Sie sahen sich unverwandt an und konnten die Augen nicht voneinander abwenden. Boris bemerkte plötzlich, dass er begann, ein wenig zu zittern, was ihm in einer solchen Situation noch nie passiert war. Dann ging ein kurzes Beben durch ihn hindurch. Nie zuvor hatte er etwas Ähnliches empfunden oder erlebt. Irgendeine Regung auf dem Gesicht der Frau konnte Boris nicht wahrnehmen, sie blieb scheinbar vollkommen kontrolliert und ungerührt, wendete die Augen aber nicht von ihm ab. Fast gleichzeitig setzten sich die beiden Züge in entgegen gesetzter Fahrtrichtung in Bewegung, und Boris konnte nur noch erkennen, dass die Frau, genau wie er, versuchte, ihn so lange anzublicken, wie das möglich war. Nie hatte sich Boris so allein gefühlt, wie in dem Moment, als der Augenkontakt abriss.
Boris Leginski war mit Anfang 30 diplomierter Informatiker, Programmierer und Softwareentwickler und seinem Selbstverständnis nach gegenwärtig vor allem als gewiefter und inzwischen erfahrener Hacker tätig. Das Examen als Informatiker hatte er als Zweitbester seines Jahrgangs bestanden. Bester war sein Freund Alexej Badinski, ebenfalls staatlich ausgebildeter und mehrfach prämierter Informatiker und Hacker. Boris hatte nicht den Eindruck, dass Alexej wirklich der qualifiziertere Informatiker war, aber sein Freund war einfach der bessere Examenstyp und konnte in der Prüfungssituation besser auftrumpfen als er selbst. Bei seinem exzellenten Abschluss war die russische Armee auf Alexej aufmerksam geworden, die die Rüstung und Bewaffnung digitalisieren wollte. Dafür brauchte sie qualifizierte Informatiker. Boris hielt zu ihm lockeren Kontakt und erfuhr von Alexej nur gerade streng vertraulich, dass er bei der Modernisierung der Atombewaffnung der russischen Föderation eingesetzt werden sollte. Ein weiterer sehr guter Absolvent dieses Jahrgangs, Igor, der mit beiden, Boris und Alexej, auch befreundet war, war kurz nach dem Examen mit seiner jungen Frau in die USA ausgewandert.
Boris war eine vergleichsweise unscheinbare, eher durchschnittliche Erscheinung, mittelgroß, nicht besonders athletisch, ganz hübsch, ein männlicher Typ, der auch durchaus sympathisch wirkte. Das erleichterte ihm den Zugang zu anderen Menschen, zu Männern wie auch zu Frauen. Dabei half ihm auch, dass er es nicht nötig hatte, in der Begegnung mit ihnen aufzutrumpfen und in besonderem Maß auf den Eindruck zu achten, den er auf sie machte. Es freute ihn einfach, ihnen zu begegnen.
Als einer der Besten seines Examensjahrgangs war Boris ehrgeizig, seine Hackerkompetenz auf höchstes Niveau zu bringen und sie dort zu halten. Was ihn schon während des Studiums besonders interessiert hatte, war das noch sehr neue Thema der Künstlichen Intelligenz. Ihn trieb im Eigentlichen ein eher technokratischer Impuls; nie wäre er auf die Idee gekommen, sich als Intellektuellen zu bezeichnen. Er las wenig, und wenn, dann sagte ihm Unterhaltungsliteratur am meisten zu. Gern schaute er sich auch Filme im Fernsehen, gelegentlich auch im Kino an. Dabei standen Krimis im Vordergrund, Autorenfilme waren ihm zu kompliziert und eigentlich ein Gräuel. Ihm reichte es, sich mit den Problemen in seiner Berufswelt auseinanderzusetzen. In der Musik bevorzugte er russische Folklore, Balalaika-Konzerte hörte er sich gelegentlich gern an, aber auch russische Männer-, speziell Mönchschöre. In der Klassik sagte ihm vieles von Tschaikowski zu, am meisten die Ballettwerke, aber auch Romeo und Julia. Er konnte es zulassen, wenn die Emotionen in ihm angesprochen wurden. Die sechste Symphonie von Pjotr Tschaikowski war ihm allerdings zu schwer und zu problematisch.
Als besonders qualifizierter Absolvent seines Studiengangs wurde Boris von Vertretern des russischen Auslandsgeheimdienstes angesprochen, die ständig nach außerordentlich befähigten Hackern suchten. Sie wollten sie zur Destabilisierung westlicher Demokratien einsetzen. Der Geheimdienst bot außergewöhnlich günstige Arbeitsbedingungen und vor allem eine für Boris Verhältnisse äußerst üppige Bezahlung, die es erträglich erscheinen ließen, dass die Arbeitszeiten im Wesentlichen nachts lagen. Die Arbeit selbst fand Boris ganz interessant, sie forderte ihn indes wenig, und Boris hatte kaum je das Gefühl, ausgelastet zu sein. Er konnte seinen Interessen nachgehen.
Boris wurde auch eine günstige und privilegiert gelegene Dienstwohnung angeboten. Dieses Angebot lehnte Boris jedoch ab. Er fühlte sich in seiner Behausung, die er schon seit einiger Zeit bewohnte und an die er gewöhnt war, überaus wohl. Im Übrigen dachte er, es wäre vielleicht nicht nachteilig, jedenfalls insoweit ein wenig unabhängig zu bleiben. Allerdings machte er sich nichts vor: Vom Eintritt in den öffentlichen Dienst dieser Art an würde seine Wohnung rund um die Uhr akustisch und optisch überwacht werden. Die Möglichkeit dazu würde der russische Staat sich nicht entgehen lassen. Aber Boris sorgte dafür, dass es in seiner gesamten Wohnung keine versteckten Wanzen oder Kameras gab. Er hatte sie äußerst gründlich danach abgesucht und wiederholte das in unregelmäßigen Abständen immer häufiger.
Auslandsreisen hatte Boris nie unternommen, mit Ausnahme von ein paar Sommerurlauben, die er in der Türkei verbracht hatte. In den Hotelanlagen bei Antalya an der türkischen Riviera war er aber, schon mit Rücksicht auf seine berufliche Position und das Bewusstsein, nie unbeobachtet zu sein, immer unter Russen geblieben. Nie litt er unter dem Eindruck, ihm würde etwas fehlen.