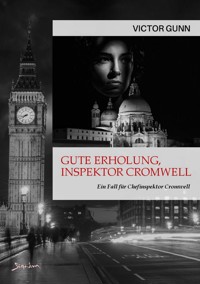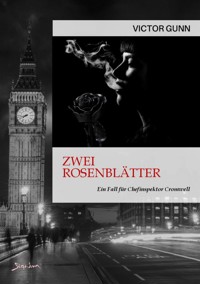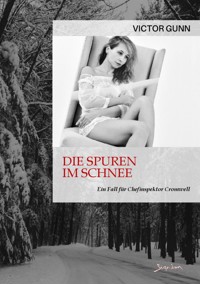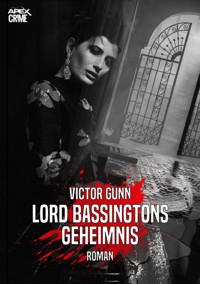6,99 €
Mehr erfahren.
Das Hochmoor von Bodmin in der Grafschaft Cornwall ist eine sehr einsame Gegend. Ausgerechnet dort findet die bildhübsche Krankenschwester Stella einen Toten. Er wurde ermordet. Am Tatort erscheinen Chefinspektor Bill Cromwell und sein Assistent Johnny Lister.
Old Iron nimmt die Sache in die Hand...
Der Roman Der Tod im Moor von Victor Gunn (eigentlich Edwy Searles Brooks; * 11. November 1889 in London; † 2. Dezember 1965) erschien erstmals im Jahr 1960; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
VICTOR GUNN
Der Tod im Moor
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DER TOD IM MOOR
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Das Buch
Das Hochmoor von Bodmin in der Grafschaft Cornwall ist eine sehr einsame Gegend. Ausgerechnet dort findet die bildhübsche Krankenschwester Stella einen Toten. Er wurde ermordet. Am Tatort erscheinen Chefinspektor Bill Cromwell und sein Assistent Johnny Lister.
Old Iron nimmt die Sache in die Hand...
Der Roman Der Tod im Moor von Victor Gunn (eigentlich Edwy Searles Brooks; * 11. November 1889 in London; † 2. Dezember 1965) erschien erstmals im Jahr 1960; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
DER TOD IM MOOR
Erstes Kapitel
Der Schrei, der aus dem nebligen Dunkel des Moors herübertönte, jagte Stella Pemberton einen solchen Schauer über den Rücken, dass die Taschenlampe zur Erde fiel, mit der sie den einsamen Wegweiser hatte anleuchten wollen.
»Du meine Güte!«, stieß sie hervor. »Was war denn das?«
Sie blickte sich furchtsam um, konnte aber auf der Straße nur Nebelschwaden sehen, die im Licht der Scheinwerfer ihres kleinen Austin gespenstisch herumwirbelten. Nach allen Seiten hin erstreckte sich das dunkle, melancholische Hochmoor von Bodmin.
Der Schrei wiederholte sich nicht. Er war von der Seite gekommen, die dem Wegweiser gegenüberlag, der, wie sie zu ihrem Ärger feststellte, nach Tolgesset wies. Es war also nicht der Weg, den sie suchte. Sie horchte in das Dunkel hinein; stammte der Schrei von einem Menschen oder von einem Tier?
Mit der aufgehobenen Taschenlampe in der Hand, ihren warmen Reisemantel eng um ihren schlanken Körper geschlungen, überquerte sie die Straße und rief laut ins Dunkel hinein. In der Weite des Raums klang ihre Stimme nur dünn und schwach. Der Widerhall des furchtbaren Aufschreis tönte noch immer in ihren Ohren; dabei hatte sie den Eindruck, dass er, wie plötzlich erstickt, unvermittelt abgebrochen worden war.
Das Mädchen ging nun über den unebenen Grund aufs Moor hinaus, wobei sie mit ihrer Taschenlampe den Boden ableuchtete. Sie war ganz sicher, dass der furchtbare Laut nicht von sehr weit her aus dieser Richtung kam. Es war zwar noch nicht völlig dunkel, aber der wolkenverhangene Oktoberhimmel ließ die Dämmerung vorzeitig hereinbrechen. Der Nebel, der mit unheimlicher Schnelligkeit über das Moor zog, hatte die Sicht noch verschlechtert. So war es sehr gut, dass Stella eine Taschenlampe bei sich hatte; sie stellte fest, dass sich der Boden vor ihr senkte, und blieb stehen.
»Ist dort jemand?«, rief sie.
Keine Antwort. Überhaupt kein Laut. Das leise Brummen eines Flugzeugs, das hoch am Himmel vorüberzog, schien das Schweigen und die Ruhe des Moors nur noch zu vertiefen. Nun wurde Stella unsicher und spähte in den wirbelnden Nebel hinaus, der hier, abseits der Straße auf dem Feld, noch dichter zu sein schien.
Vielleicht hatte sie sich geirrt. Vielleicht stammte der Aufschrei nur von einem Nachtvogel oder einem anderen Tier. In jedem Falle war es töricht von ihr gewesen, von der Straße abzugehen. Ohne wirklichen Grund wurde ihr plötzlich ängstlich zumute. Sie schauderte, blickte unschlüssig zurück und ließ den Lichtkegel ihrer Taschenlampe im Kreis herumwandern.
Schließlich entschloss sie sich, zur Straße zurückzukehren. Sie stieg den Abhang wieder hinauf, wobei ihre Füße im weichen Moos des Moorbodens einsanken. Jetzt war sie ganz sicher, dass sie diesen merkwürdigen Schrei verkannt hatte. Hier auf dem Moor war niemand; jedenfalls kein Mensch.
Nun kamen ihr andere Bedenken: Was, wenn sie die Straße nicht wiederfände? Im Nebel war sie ja leicht zu verfehlen. Bilder von Morlandponys, die elend in Sumpflöchern umgekommen waren, fielen ihr ein. Vielleicht hatte ein solches Tier vorhin den Schrei ausgestoßen. Sie stapfte weiter und blieb plötzlich mit wild klopfendem Herzen stehen; der Boden vor ihr senkte sich von neuem - sie ging wieder bergab -, und dabei hätte sie schwören können, dass sie bergauf gehen musste, um zur Straße zu gelangen. Sie war also, ohne es zu merken, im Halbkreis gegangen. In diesem Augenblick griff der Strahl ihrer Taschenlampe ein Stückchen weiter und traf auf etwas Weißes. Zögernd ging sie auf dieses Etwas zu, und es wurde ihr kaum bewusst, dass der Boden unter ihren Füßen wieder weicher wurde. Er war in der Tat schon so schwammig wie am Rande eines Tümpels.
»Oh!«, stieß sie überrascht hervor.
Sie blieb ganz still stehen und starrte auf den weißen Gegenstand. Beim Schein ihrer Lampe, die in ihrer zitternden Hand schwankte, konnte sie jetzt erkennen, dass es ein weißseidener Schal war, der aus dem halboffenen Mantel eines Mannes hervorschaute. Der Mann lag regungslos auf dem Rücken im Gras. Ganz in der Nähe tag ein weicher Hut.
Sofort veränderte sich Stellas Benehmen. Der Strahl der Taschenlampe schwankte nicht mehr, da ihre Hand nicht mehr zitterte. Ihre Furcht war vorbei. Sie war Krankenschwester, und für sie war ein Verletzter ein Mensch, der ihre Hilfe brauchte. So rannte sie denn zu dieser Gestalt hin, kniete neben ihr nieder - und wieder ging ein Schauer durch ihren schlanken Körper. Dieser Mann hier brauchte keine Hilfe mehr, denn sein Schädel war zerschmettert, und der Tod musste auf der Stelle eingetreten sein. Sein Gesicht war völlig eingeschlagen und bot einen Anblick, der die stärksten Nerven erschüttern musste.
»Armer Kerl...«, flüsterte Stella heiser.
Es konnte sich hier unmöglich um einen Unglücksfall handeln. Solche Verletzungen zog sich niemand bei einem Sturz zu. Es gab auch an dieser Stelle keinen hervorstehenden Stein, über den der Mann hätte stolpern können, denn der grasige Boden war weich und von Wasser durchtränkt. Nein, dieser Mann war durch einen Schlag mit einem Mordwerkzeug zu Boden gestreckt worden. Wohl mit mehr als einem Schlag, mit vielen Schlägen! Ein einziger Schlag hätte ihm keine so furchtbaren Verletzungen zufügen können.
Noch etwas fiel ihr auf. Hier war kein Gegenstand zu sehen, mit dem der, Schlag hätte geführt werden können. Stellas Taschenlampe, die den Boden in der Nähe der Leiche ableuchtete, zeigte nur Gras. Diese Tatsache erschreckte sie noch mehr; denn dieser Mann war nicht umgekommen - er war ermordet worden, und sein Mörder konnte noch nicht weit fort, musste noch ganz in der Nähe sein. Diese Überlegung veranlasste Stella Pemberton zu sofortiger Flucht.
Sie rannte den Abhang hinauf - nur fort von der grausigen Gestalt auf dem Boden. Sie war einer Panik nahe, als sie sich klarwurde, dass sie in ihrer Angst blindlings in immer dichter werdendem Nebel herumrannte.
Zweifellos hatte sie sich auf dem Moor verirrt. Sie hatte keine Ahnung mehr, in welcher Richtung die Straße lag. Mit Gewalt zwang sie sich, stehenzubleiben und zur Ruhe zu kommen. Ihr Benehmen war doch lächerlich. Weit fort konnte die Straße ja nicht sein! Höchstens zwei- oder dreihundert Meter! Wenn sie systematisch suchte, musste sie sie also finden können. Sie konnte sich noch genau erinnern, dass sich der Boden gesenkt hatte, dass sie abwärts gegangen war. Also musste sie jetzt aufwärts gehen. Wenn sie in gerader Richtung bergauf ging, musste sie auch die Straße finden.
Sie machte sich auf den Weg - aber bald verließ sie die Ruhe wieder, zu der sie sich gezwungen hatte. Hier, wo sie entlangkam, konnte sie nämlich gar nicht bergauf gehen, denn der Boden war völlig eben. Große Felsblöcke lagen überall verstreut, immer wieder tauchten neue aus dem Nebel auf und zwangen sie, ihre Richtung zu ändern. Sie begann zu fürchten, dass sie sich vielleicht vom Wege fortbewegte; dabei verfolgte sie der Gedanke, dass der Mörder ganz in der Nähe sein müsste.
Wie erstarrt blieb sie plötzlich stehen - ein Laut war zu ihr gedrungen, der erste Laut, den sie in dieser grauen, schweigenden Wildnis vernommen hatte. Er schien von einem schweren Stiefel, der gegen einen Felsbrocken gestoßen war, herzurühren; jemand musste wohl gestolpert sein. Der Strahl ihrer Taschenlampe fuhr kreuz und quer durch den Nebel, und sie hörte das leise Geräusch von Schritten, die näher kamen.
Mit Gewalt unterdrückte sie ein Aufkreischen, als nun eine Gestalt aus dem Nebel auftauchte - ein großer, breitschultriger Mann, der in dem unsicheren Licht riesig und grotesk verzerrt aussah. Eine Sekunde später sah sie, dass der Mann mit einem rauen Dufflecoat bekleidet war, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Mit dem schweren Stock, den er in der Hand trug, wirkte er ausgesprochen drohend und furchterweckend.
Jetzt kreischte Stella wirklich auf. Dann wandte sie sich, von panischer Angst ergriffen, um und rannte blindlings fort.
»Hallo! Warten Sie doch!«
Die tiefe Stimme klang befehlend, aber Stella befolgte die Aufforderung nicht. Dieser Mann war doch ganz sicher der Mörder! Sie rannte weiter, und ihre Angst wurde zur Panik, als sie hinter sich schwere Schritte hörte. Plötzlich stolperte sie über einen Stein, den sie in ihrer Angst nicht gesehen hatte, und stürzte schwer zu Boden. Bevor sie noch aufstehen konnte, stand der fremde Mann über ihr und ließ den Schein seiner eigenen Taschenlampe auf ihr Gesicht fallen.
»Großer Gott! Ein Mädchen! Ich wollte Ihnen keine Angst einjagen, Miss«, fuhr er fort, und seine Stimme klang überrascht. »Es tut mir sehr leid. Aber es war falsch von Ihnen, so blindlings wegzurennen. Haben Sie sich etwa verletzt?«
Starke Finger schoben sich unter ihren Arm, und sie wurde hochgezogen. Sie war noch immer wie benommen, noch immer voll Furcht, aber die kräftige, freundliche Stimme klang recht beruhigend. In dem unsicheren Licht sah sie ein junges, wettergebräuntes Gesicht, das sie besorgt ansah. Die Kapuze war zurückgefallen.
»Nein, ich habe mich nicht verletzt«, antwortete sie leise.
»Nun, dann ist es ja gut! Aber was, zum Teufel, suchen Sie hier im Moor - so weit von der Straße entfernt?«, fragte der Mann. »Waren Sie es, die vor zehn Minuten einen furchtbaren Schrei ausstieß?«
»Vor zehn Minuten?«, unterbrach sie ihn.
Sie konnte es gar nicht glauben. Sie hatte das Gefühl, dass mindestens eine Stunde vergangen war, seit sie auf der Straße gestanden und versucht hatte, die Worte auf dem Wegweiser zu entziffern.
»Sie haben den Schrei also auch gehört?«, fuhr sie fort. »Warum sind Sie dann nicht sofort dort hingeeilt?«
»Verdammt - ich kam, so schnell ich konnte. Ich stand ja auf der anderen Seite des Blackmire-Sumpfes«, wandte er ein. »Ich war auch nicht sicher... Hören Sie, ich bin Andrew Trehearne vom Deepdale-Hof. Ich suchte auf dem Moor ein paar Schafe, die sich verlaufen hatten. Das letzte, was ich hier zu finden erwartete, war ein hübsches Mädchen. Das heißt - ich meine - aber Sie brauchen mich doch deswegen nicht so ängstlich anzusehen!«
Nun klang seine Stimme verlegen. Er hielt seine Taschenlampe noch immer auf ihr Gesicht gerichtet, und die Schönheit ihrer Züge beeindruckte ihn; das kastanienbraune Haar, das in Locken unter ihrem kleinen Hut hervorquoll; ihre sanften, braunen, intelligenten Augen; die weiche Kurve ihres Kinns und der reizende Schwung ihres rotlippigen Mundes, hinter dem weiße Zähne schimmerten.
»Sie haben also den Aufschrei auch gehört«, wiederholte sie und rückte von ihm ab. »Ich stand gerade auf der Autostraße und versuchte den Wegweiser zu entziffern. Wo liegt denn die Straße eigentlich? Ich ließ meinen Wagen am Wegweiser stehen und stieg aus... Ich möchte das High-Tor-Krankenhaus finden, aber auf dem Wegweiser stand nur Nach Tolgesset.«
»Das Krankenhaus liegt ein Stück weiter - Sie haben auf den falschen Wegweiser gesehen«, erklärte er ihr. »Noch eine Meile weiter die Straße entlang, und Sie hätten den Wegweiser gefunden, den Sie suchten... Aber warten Sie - der Schrei kann also nicht von Ihnen gekommen sein.«
»Könnten Sie nicht den Strahl Ihrer Lampe anderswohin richten?«
»Wie? Entschuldigen Sie bitte.« Er senkte die Taschenlampe zu Boden. »Aber Sie sehen ja ganz verstört aus!«
Er fügte nicht hinzu, dass sie trotzdem oder gerade deshalb bildhübsch aussah. Vielleicht war es ihre Erregung, die das Blut in ihre Wangen steigen ließ und damit den Reiz ihres Gesichts erhöhte. Ihre Augen blitzten.
Inzwischen hatte sich Stella etwas beruhigt. Seine freundliche Haltung enthielt ja wirklich nichts Drohendes. Ihr gefiel auch sein Gesicht. Aber die Worte kamen aus ihrem Mund, bevor sie sie zurückhalten konnte.
»Ich hatte Angst!«
»Vor mir?«
»Ja - zuerst. Ich hielt Sie für... Aber jetzt habe ich keine Angst mehr. Hören Sie, dort drüben liegt ein Toter im Moor...«
»Aber...«
»Ich hörte den Aufschrei, als ich gerade auf den Wegweiser sah. Der Schrei klang so verzweifelt, dass ich auf das Moor hinausging und mich überall umsah«, fuhr sie rasch fort. »Dann - in einer kleinen Senke - fand ich ihn endlich. Er ist tot. Sein Gesicht ist völlig zerschmettert. Ich versuchte, wieder auf die Straße zurückzufinden, als ich Sie kommen hörte, und da dachte ich...« Sie hielt inne. »Ich meine, als Sie aus dem Nebel auftauchten, sahen Sie doch so furchterweckend und riesig aus...«
»Wollen Sie damit etwa andeuten, dass Sie glaubten, ich hätte jemanden umgebracht?«, unterbrach er sie verwundert. »Ich konnte gar nicht verstehen, warum Sie vor mir wegrannten, und so rief ich Ihnen zu, doch stehenzubleiben. Aber - was sagten Sie da von einem Toten? Sind Sie Ihrer Sache sicher?« Sein Tonfall hatte sich geändert und klang jetzt ungläubig. »Wie sollte ein Toter aufs Moor kommen? Haben Sie sich da nicht etwa von einem eigenartig geformten Granitblock täuschen lassen?«
»Nein, nein - gewiss nicht! Wie hätte ich mich irren können! Sein zerschmettertes Gesicht, das Blut - es rann noch über seinen weißen Schal... Es war grauenhaft! Ich bin gewiss daran gewöhnt, Blut und Wunden zu sehen, aber so etwas Entsetzliches ist mir noch niemals vor Augen gekommen...«
»Nun, regen Sie sich jetzt nicht wieder auf«, fiel er ein, als er ihr Grauen sah. »Er lag in einer kleinen Senke, sagten Sie? Das muss irgendwo in der Nähe des Blackmire-Sumpfes sein. Da werde ich wohl besser nachsehen gehen.« Er wunderte sich zwar, warum sie mit Wunden und Blut vertraut sein wollte, stellte aber keine Frage. »Je eher wir den armen Kerl finden, umso besser. Vielleicht ist er auch noch gar nicht tot.«
»Doch, er ist tot«, sagte Stella ruhig.
Er nahm ihren Arm, und nun gingen sie beide zusammen auf die Suche. Er war höchst begierig zu erfahren, wer dieses schöne Mädchen war, das allein im Moorland herumlief. Aber Stella war, obwohl jetzt nicht mehr so erregt, doch noch keineswegs beruhigt. Ein Mörder sieht schließlich nicht immer wie ein Mörder aus, und zudem trug dieser Mann einen schweren Stock in der Hand - einen Stock, mit dem er dem Toten seine furchtbaren Wunden ohne weiteres hätte zugefügt haben können. Eigentlich wollte sie nur fort - zurück zur Straße - zu ihrem Auto, aber er hielt ihren Arm fest und ging mit ihr durch den Nebel. Offenbar war ihm die Gegend so vertraut, dass er hier jeden Schritt und Tritt kannte.
Stella war zum ersten Mal im Moorland von Bodmin. Noch vor einer Stunde hatte ihr die Gegend, trotz ihrer Düsternis, im klaren Licht des Abends ein Gefühl von Freiheit gegeben, wie das bei weitem, offenem Land oft der Fall ist. Dann war plötzlich, wie aus dem Nichts heraus, der Nebel über die Straße geflutet und hatte sie gezwungen, die Fahrtgeschwindigkeit zu mäßigen. Gleichzeitig hatten sich am Himmel schwere Wolken zusammengezogen und vorzeitig die Nacht hereinbrechen lassen.
Sie fühlte, wie er fest ihren Arm hielt, und fragte sich, was dieser Mann auf dem Moor gesucht haben mochte. Hatte er sich wirklich nach verlorenen Schafen umgesehen? Das klang doch nicht sehr glaubhaft! Sie konnte auch nicht vergessen, dass er das einzige menschliche Wesen war, das sie zu Gesicht bekommen hatte, seit der Schrei aus dem Nebel an ihr Ohr gedrungen war.
»In einer kleinen Senke, sagten Sie?«, fragte Andrew in ihr Nachdenken hinein.
»Ich - ich glaube es wenigstens. Ich konnte ja nicht viel erkennen. Ich hatte nur den Eindruck, dass sich der Boden dort senkte. Es war nicht sehr weit von der Straße weg - in gerader Linie meine ich.«
»Sie werden schon recht haben. Ein paar hundert Meter von der Straße ab beginnt ja schon der Sumpf«, meinte er, aber seine Stimme klang verwundert. »Sie können noch von Glück sagen, dass Sie nicht in den Sumpf hineingerieten, denn es hat in den letzten Tagen viel geregnet, und dann ist der Sumpf immer gefährlich.«
Sie wusste genau, dass er ihren Worten nicht so recht glauben wollte. Aber gerade diese Erkenntnis trug dazu bei, sie zu beruhigen, denn in diesem Falle konnte er ja unmöglich der Mörder sein. Aber vielleicht verstellte er sich - wieder begann ihr Herz schneller zu schlagen. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sich der Boden, auf dem sie gingen, senkte.
»Wenn Sie recht haben, so müsste der Tote hier irgendwo in der Nähe liegen«, meinte Andrew, verlangsamte seinen Schritt und ließ den Strahl seiner Lampe nach rechts und links gleiten. »Kurz vor uns liegt der Sumpf; wir sind jetzt beinahe an seinem Rand angelangt. Fühlen Sie denn nicht, wie weich hier das Gras ist?«
»Sie glauben mir wohl nicht?«, fragte sie bitter. »Aber vielleicht sind wir hier nicht am richtigen Platz - ich meine, die Leiche könnte ziemlich weit links von uns oder auch rechts von uns liegen. Ich habe die Orientierung völlig verloren. Es kommt mir vor, als ob wir furchtbar weit gegangen wären.«
»Nur, weil auch ich für eine Weile die Richtung verloren hatte«, gab er zu. »Ich kenne zwar das Moor recht gut, ab r bei diesem Nebel kann man sehr leicht die Richtung verlieren - einen Augenblick!«, fügte er schnell hinzu. »Was ist denn das dort drüben? Dort liegt doch etwas Weißes!«
Er lief rasch zu der Stelle hin, auf die er gedeutet hatte, wobei er ihren Arm losließ. Der Anblick, der sich ihm dort bot, war so grauenhaft, dass seine Stimme stockend klang, als er wieder zu sprechen anfing.
»Mein Gott - Sie hatten recht!«
Stella trat neben ihn.
»Kennen Sie ihn?«
»Aber nein! Wie könnte ihn überhaupt jemand erkennen? Sein Schädel ist ja völlig eingeschlagen, und sein Gesicht...« Andrew brach ab und wandte den Strahl seiner Lampe von der Leiche fort. »Aber ich glaube nicht, dass er aus der Gegend stammt. Die Art seiner Kleidung - diesen Mantel kann er in Polryn oder Bodmin gar nicht gekauft haben!« Er wandte sich zu Stella und legte ihr die Hand auf die Schulter. »Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Worte anzweifelte. Bei einem solchen Anblick ist es ja kein Wunder, dass Sie Angst bekamen!«
»Was sollen wir jetzt tun?«
»Die Polizei benachrichtigen - und so schnell wie möglich«, erwiderte er prompt. »Der arme Kerl ist ja zweifellos tot. Rühren Sie ihn nicht an und fassen Sie ihm nicht in die Tasche! Das alles müssen wir der Polizei überlassen. Kehren wir lieber zur Straße zurück.«
Wieder nahm er ihren Arm und führte sie fort. Sie stiegen den Hügel hinauf, und zu ihrer Überraschung fand Stella, dass die Straße ganz in der Nähe vorbeiführte. Ihr Gefährte fand sie ohne Schwierigkeit. Ihr getreuer kleiner Austin stand noch dort, wo sie ihn verlassen hatte; seine Rücklichter schimmerten durch den Nebel.
»Oh, wie froh bin ich!«, rief Stella atemlos. »Es ist ja, wie wenn man wieder in das normale Leben zurückkehrt! Ich sah diesen Wegweiser und hielt an, um die Aufschrift zu lesen.«
»Tolgesset ist kein Dorf«, sagte er. »Der Weg führt nur zum Tolgesset-Hof, der Martin Penney gehört. Mein eigener Hof, Deepdale, liegt ein paar Meilen weiter nach Süden auf der anderen Seite der Straße. Sprachen Sie nicht davon, dass Sie das Krankenhaus finden wollten?«
»Ja.«
»Es liegt eine Meile weiter und dann einen Seitenweg entlang«, erklärte er. »Wollen Sie einen Besuch dort machen?«
»Nein, ich werde dort arbeiten.«
»Arbeiten? Sie meinen doch nicht...«
»Ich bin Krankenschwester.«
»Na so was! Das hätte ich nie gedacht!«
Andrew war höchst überrascht. Jetzt verstand er auch, was sie gemeint hatte, als sie sagte, sie sei an Blut und Wunden gewöhnt.
»Sie sehen gar nicht wie eine Krankenschwester aus«, fuhr er offen fort. »Dazu sind Sie viel zu elegant - zu hübsch...« Er hielt inne. »Verdammt - so meinte ich es eigentlich gar nicht. Es muss ja wohl viele hübsche Krankenschwestern geben. Glücklicherweise hatte ich bis jetzt mit Schwestern nicht viel zu tun. Übrigens haben Sie mir Ihren Namen noch nicht gesagt.«
»Ich heiße Stella Pemberton. Ich fuhr heute von London ab und habe mich schrecklich verspätet. Wie spät ist es denn eigentlich?«, fragte sie ängstlich. »Man erwartet mich im Krankenhaus gegen fünf...«
»Dann haben Sie sich aber wirklich verspätet«, unterbrach er sie nach einem Blick auf seine Armbanduhr. »Es ist jetzt fast drei Viertel acht. Sie werden also im High-Tor-Krankenhaus als Schwester arbeiten? Da haben die Patienten des alten Mayhew aber wirklich Glück!«
Sie wurde rot.
»Vielen Dank, dass Sie mich wieder zur Straße gebracht haben«, sagte sie eilig. »Ich glaube, ich sollte jetzt wohl weiterfahren, sonst wird Doktor Mayhew sich wundem...«
»Haben Sie etwa Angst vor dem alten Gorilla?«
»Gorilla? Ja, ich glaube schon...«
»Lassen Sie sich von ihm nicht ins Bockshorn jagen«, riet ihr Andrew. »Doktor Huntley Mayhew ist hier allgemein gefürchtet. Der Schrecken des Ortes! In Deepdale und Polryn hat jeder Angst vor ihm!« Er lachte. »Von ihm und von dem alten Blazey werden wir hier im Moor auf Trab gehalten!«
Sie erkundigte sich nicht, was er damit eigentlich meine; aber seine Beschreibung Doktor Mayhews stimmte mit ihrer Ansicht von der furchterregenden Persönlichkeit ihres neuen Chefs durchaus überein. Doktor Mayhew hatte ihr schon Angst eingeflößt, als sie bei der Agentur in London mit ihm wegen der Anstellung verhandelte. Seine durchdringenden Augen, seine scharfen Fragen, mit denen er sich nach ihrer Ausbildung erkundigte, zusammen mit seiner riesigen Größe, hatten ihr ein Gefühl ihrer eigenen Winzigkeit und Bedeutungslosigkeit eingeflößt. Es war für sie nicht gerade ermutigend, jetzt zu hören, dass Andrew Trehearne den Doktor als Gorilla bezeichnete.
»Ich muss jedenfalls sofort hinfahren«, meinte sie rasch. »Ach du meine Güte! Der Doktor wird schrecklich böse auf mich sein, weil ich so spät komme.«
»Sie kommen doch jetzt in jedem Falle zu spät«, erklärte er. »Die schlimme Geschichte hier kann Sie doch nur eine halbe Stunde gekostet haben, allerhöchstens eine dreiviertel Stunde. Sie sagten, dass Sie um fünf Uhr im Krankenhaus sein sollten?«
»Ja, aber ich hatte unterwegs eine Panne - irgendetwas war am Vergaser nicht in Ordnung.« Sie brach ab, kletterte gewandt in den Wagen und setzte sich ans Steuer. »Geradeaus, sagten Sie? Bis zum nächsten Wegweiser?«
»Oh, nein!«, unterbrach sie Andrew fest.
Er hatte inzwischen nachgedacht. Das Naheliegendste für sie war zweifellos, unverzüglich ins High-Tor-Krankenhaus zu fahren und von dort aus die Polizei anzurufen, nachdem sie Doktor Mayhew von ihrem furchtbaren Erlebnis berichtet hatte. Aber Andrew war es klar, dass er sich in diesem Fall von ihr zu trennen hatte, wenn nicht schon hier auf der Straße, so doch sobald sie im Krankenhaus angelangt waren. Das passte ihm nicht. Er wollte mehr von ihr erfahren - wollte sie bei voller Beleuchtung sehen - wollte ihrer sanften, anziehenden Stimme noch weiter lauschen können. Ein Mittel, mit dem er sich diese Wünsche erfüllen konnte, fiel ihm sofort ein.
»Der Nebel wird dichter«, fuhr er fort, während er um den Wagen herumging und sich dann auf den Sitz neben die Fahrerin setzte. »Selbst wenn ich Ihnen den Weg ins Krankenhaus zeigte, würde es zu lange dauern, bis wir die Polizei verständigten. Weit« besser ist es, wenn Sie nach Bolventor zurückkehren. Es ist nicht weit. Dort liegt am Anfang des Orts, direkt an der Hauptstraße, der Jamaica-Gasthof. Außerdem brauchen Sie jetzt etwas Alkoholisches und ich übrigens auch.«
»Aber...«
»Von dort können Sie auch das Krankenhaus anläuten und erklären, warum Sie sich verspätet haben. Auf diese Weise sparen wir Zeit, und je eher wir der Polizei von dem Toten Nachricht geben können, umso besser.«
»Nun, ich weiß nicht recht...«
»Ich werde Inspektor Clapp in Polryn anläuten und ihm von der Leiche Bescheid geben. Natürlich werden wir im Gasthof auf ihn warten müssen, denn er wird sich doch sicherlich von uns an den Tatort führen lassen. Selbstverständlich werden Sie Doktor Mayhew auch sagen müssen, dass Sie sich dadurch vermutlich noch weiter verspäten werden. Denn die Polizei wird Sie mit Sicherheit längere Zeit aufhalten. Höchstwahrscheinlich wird Clapp auch einen Bericht nach Bodmin durchgeben müssen. Hier auf dem Moor sind Morde ja nicht alltäglich, und es wird sicher einen großen Tumult geben.«
Er sprach so sicher und bestimmt, dass sie gar nicht fähig war, Einwendungen zu machen. Er war offenbar auch nicht gewillt, solche Einwendungen zu berücksichtigen. So ließ sie eine Minute später den Motor an und fuhr vorsichtig den Weg zurück, den sie vor noch nicht einer Stunde gekommen war.
Zweites Kapitel
Der Jamaica-Gasthof, schon in den alten Tagen der Postkutsche berühmt, war ein sehr einsam gelegenes Wirtshaus mitten im Bodmin-Moor, das an einem nebligen Abend besonders einsam wirkte. Aus seinen erleuchteten Fenstern fiel warmes Licht durch den Nebel, als Andrew Trehearne Stella zum Parkplatz des Gasthofs dirigierte. Hier standen noch mehrere andere Wagen, denn das Wirtshaus war auch als Autoraststätte weithin bekannt.
Als Stella die altertümliche Halle mit ihrer niedrigen Decke betrat, entzückten sie die geschwärzten Deckenbalken, die polierten Zinnteller und die andern Überbleibsel aus früheren Tagen. Die warme Luft duftete nach Tabak, Alkohol und delikaten Speisen. Im Sommer wurden hier große Mengen der berühmten cornischen Pasteten konsumiert, wenn die Touristen, wie selbstverständlich, in diesem Gasthof Station machten.
»Ich werde Ihnen etwas zu trinken holen, während Sie Doktor Mayhew anrufen«, meinte Andrew praktisch. »Sagen Sie ihm, warum Sie sich verspätet haben. Erklären Sie ihm, dass es nicht Ihre Schuld ist.«
Stella dachte bei sich, als sie zum Telefon ging, dass dieses interessante alte Gasthaus wohl einst Schmugglern und Straßenräubern als Treffpunkt gedient hatte. Sie konnte sich gut vorstellen, wie pittoreske Banditen es sich an der wuchtigen Eichenbar gemütlich machten. Aber das Telefon war durchaus modern, und sie hatte keine Schwierigkeit, mit dem High-Tor-Krankenhaus Verbindung zu bekommen. Eine Männerstimme meldete sich am Apparat - eine weiche, kultivierte Stimme, die unmöglich die Doktor Mayhews sein konnte.
»Kann ich mit Doktor Mayhew sprechen?«
»Wer ist denn dort?«
»Ich bin Stella Pemberton.«
»Ach so - Schwester Pemberton! Wir erwarten Sie schon seit längerer Zeit«, sagte die Stimme. »Ich bin Doktor Thurlow; wir werden viel miteinander zu tun haben. Ist Ihnen etwas zugestoßen? Von wo rufen Sie denn an?«
»Ich glaube, ich sollte wohl mit Doktor Mayhew sprechen, wenn Sie nichts dagegen haben«, erwiderte Stella. »Ich hatte eine Panne - nein, eigentlich war es keine Panne. Ich habe eine Leiche im Moor gefunden.«
»Meine Güte! Unfall?«
»Nein, ein Mord.«
»Wie schrecklich! Warten Sie! Ich glaube, Sie sollten es wirklich Doktor Mayhew berichten. Sie haben mir einen schweren Schock versetzt, Schwester Pemberton.«
Eine Minute später lauschte Stella der harten, ärgerlichen Stimme Doktor Huntley Mayhews, des Chefarztes des Krankenhauses. Offenbar hatte ihm Doktor Thurlow schon Bescheid gesagt.
»Miss Pemberton? Was höre ich da von einem Ermordeten, dessen Leiche Sie aufgefunden haben?«, erkundigte sich Mayhew. »Wie kommt es, dass Sie in eine so scheußliche Sache hineingezogen wurden? Erklären Sie mir das bitte, Miss Pemberton. Ich machte mir schon Sorgen um Sie, da Sie ja schon seit Stunden hier sein sollten.«
»Ja, ich weiß, Sir - aber ich wurde aufgehalten«, antwortete Stella aufgeregt. »Mein Wagen hatte eine Panne, und ich musste ihn in einer Garage wieder in Ordnung bringen lassen. Als ich dann über das Moor fuhr, geriet ich in den Nebel...«
»Ja, ja - aber was ist mit dem Toten?«, unterbrach sie Mayhew ungeduldig. »Haben Sie denn die Leiche auf der Straße gefunden? In diesem Falle kann es sich doch wohl nur um einen Autounfall handeln.«
Daraufhin schilderte sie ihm ihr Erlebnis in kurzen, knappen Sätzen. Ihren Worten folgte ein Schweigen, und als dann Doktor Mayhew zu reden begann, klang seine Stimme weniger scharf.
»Ach so...«, meinte er langsam. »Ja, das sieht wirklich nach Mord aus. Ein sehr hässliches Erlebnis für Sie, Miss Pemberton - an Ihrem ersten Abend in Cornwall. Aber ich glaube, es war recht unklug von Ihnen, auf den Schrei hin die Straße zu verlassen. Ich möchte jedoch im Augenblick darüber nicht sprechen. Ohne Zweifel glaubten Sie, recht zu handeln. Aber Sie hätten sich dabei leicht verirren können, und es traf sich sehr glücklich, dass dieser Trehearne Sie aufgefunden hat. Ja, natürlich müssen Sie dort die Polizei erwarten. Wahrscheinlich werden sich die Beamten von Ihnen zum Tatort führen lassen.«
Nach einigen weiteren Worten konnte Stella einhängen. Sie fühlte sich erleichtert, denn Doktor Mayhew war verständnisvoller gewesen, als sie erwartet hatte. Andrew war natürlich sehr erfreut, als sie in die Halle zurückkam und ihm von dem Gespräch berichtete.
»Das geht also in Ordnung«, meinte er vergnügt. »Jetzt brauchen Sie sich ja nicht mehr übermäßig abzuhetzen. Nun kann ich zum Apparat gehen und meine Telefongespräche führen.«
»Sie haben - hier noch nichts davon verlauten lassen?«
»Hier? Nein, das sollten wir lieber nicht tun.«
»Ich muss immerfort an die Leiche dort draußen im Moor denken«, erklärte Stella mit leiser Stimme. »War es denn recht von uns, den Toten dort einfach liegen zu lassen?«
»Was hätten wir sonst tun können? Ich konnte Sie doch nicht allein bei ihm lassen, und wie hätten wir die Polizei benachrichtigen sollen, wenn ich bei Ihnen geblieben wäre? Aber - macht das denn etwas aus? Der arme Kerl ist tot, und es ist ganz unwahrscheinlich, dass ihn jemand bei diesem Nebel auffindet.«
Stella nickte. Jetzt konnte sie Andrew ohne Mantel und bei Licht sehen, und dabei machte er einen guten Eindruck. Sein Gesicht war viel freundlicher und anziehender, als sie zunächst angenommen hätte. Auch seine Redeweise war nicht die eines Bauern; er sprach fast ohne cornischen Akzent. Zum ersten Mal fühlte sie sich in seiner Gesellschaft wohl.
Er ging zum Telefon und wurde rasch mit der Polizei in Polryn verbunden, der Kleinstadt, die das Zentrum von diesem Teil des Moors war. Eine volle Stimme meldete sich am Apparat.
»Hier ist die Polizeiwache Polryn. Wer ist dort?«
»Es ist etwas passiert, Davy«, erwiderte Andrew, der die Stimme Davy Merrins, des Polizeisergeanten, erkannt hatte. »Ein armer Kerl ist auf dem Moor ermordet worden. Ich spreche hier vom Jamaica-Gasthof aus.«
»Ach, du bist das, Andrew? Mach doch keine dummen Witze mit mir...«
»Das ist kein Witz, Davy. Leider sind wir keine kleinen Jungen mehr«, erwiderte der junge Mann. »Es ist ernst, Davy, mein Ehrenwort. Komm nur, so schnell du kannst, her! Am besten bringst du auch Doktor Weston mit.«
»Einen Augenblick...«, kam die entsetzte Antwort. »Was hast du da gesagt? Ein Mord? So etwas hatten wir hier noch nicht, solange ich denken kann!«
»Dann ist es eben der erste, Davy«, erwiderte Andrew grimmig. »Der Mann wurde am Rande des Blackmire Sumpfes erschlagen. Sein Gesicht und sein Schädel sind völlig zerschmettert. Aber vertrödele nicht unnütz Zeit am Telefon, sondern komm lieber sofort her!«
»Jawohl, mein Junge, das tue ich auch«, erwiderte der Sergeant. »Ich will nur dem Inspektor Bescheid sagen - dann kommen wir beide hin. Ein Mord? Donnerwetter - das ist aber eine große Sache!«
Andrew hängte ein und ging in die Ecke zurück, in der Stella Platz genommen hatte.
»In etwa einer Viertelstunde wird die Polizei hier sein«, sagte er, als er sich neben sie setzte. »Aber Sie haben ja noch gar nichts getrunken!«
»Ich wartete auf Sie.«
Sie hatte sich einen Sherry kommen lassen, während er sich ein Bier bestellt hatte. Stella sah etwas nervös aus.
»Beruhigen Sie sich nur, Miss Pemberton«, riet er ihr. »Wir können jetzt nichts tun, als auf die Polizei warten. Inzwischen möchte ich, dass Sie mir etwas von sich erzählen. Wie kommt es, dass ein so hübsches Mädchen wie Sie in diese traurige, einsame Gegend verschlagen wird, um für einen alten Tyrannen wie Mayhew zu arbeiten?«
»Ist er denn wirklich ein solcher Tyrann?«
»Ich will Sie nicht voreingenommen machen«, erklärte Andrew rasch. »Er wird wohl nicht so schwarz sein, wie man ihn malt. Aber er hat in Polryn einen recht schlechten Ruf. Die Leute haben vor ihm Angst, und er benimmt sich, als ob er sie noch mehr einschüchtern möchte.«
Während Andrew sprach, studierte Stella sein Gesicht. Ihr gefielen die kleinen Fältchen an seinen Mundwinkeln und der Ausdruck seiner Augen, in denen stets ein Lachen lauerte. Könnte dieser liebenswürdige junge Mann denn ein Mörder sein? Sie machte sich über ihre frühere Furcht lustig und hatte auch nichts dagegen, seine doch eigentlich recht indiskreten Fragen zu beantworten. Ihr gemeinsames schauriges Erlebnis hatte jene Schranken niedergerissen, die sonst sicherlich zwischen ihnen bestanden hätten.
»Ich habe die Stellung im High-Tor-Krankenhaus angenommen, weil das Angebot so gut war, dass ich es nicht ablehnen mochte«, sagte sie offen. »Wie viele Schwestern können denn fünfundzwanzig Pfund netto pro Woche bei freier Station bekommen?«
»Donnerwetter! Fünfundzwanzig Pfund! Ich hatte gar keine Ahnung, dass Schwestern so viel verdienen!«
»Das tun sie auch nicht - dieses Angebot ist ganz außergewöhnlich.«
»Dabei alles frei?«
»Ja. Ich habe mein eigenes Zimmer, das Essen, die Kleidung und sogar die Wäsche umsonst. Doktor Mayhew versicherte mir, dass die fünfundzwanzig Pfund netto sind.«
»Und wo ist dabei der Haken?«, erkundigte sich Andrew.
»Ach, das habe ich mich auch schon gefragt«, erwiderte Stella. »Es ist fast zu schön, um wahr zu sein.«
»Was haben Sie denn zu tun, wenn Sie so viel Geld verdienen?«, fragte er neugierig. »Müssen Sie etwa gefährliche Irre betreuen? Oder haben Sie eine Arbeitszeit, die kein Ende nimmt?«
»Nichts dergleichen. Die Arbeitszeit ist sogar ungewöhnlich kurz. Jeden Nachmittag von zwei bis halb fünf habe ich frei. Sonst bin ich allerdings ziemlich angebunden.«
»Das verstehe ich wirklich nicht.«
»Es ist ganz einfach«, meinte Stella, die über sein verwundertes Gesicht lächeln musste. »Doktor Mayhew suchte eine Schwester, die nur eine Patientin, eine Lady Christina Pangalos, zu betreuen hat. Sie ist eine alte Dame, die schon mehrere Jahre als Patientin im Krankenhaus lebt...«
»Pangalos?«, unterbrach sie Andrew und zog die Stirn kraus. »Diesen Namen habe ich doch schon gehört. Gibt es da nicht einen Sir Paul Pangalos? Hat er nicht etwas mit Erdöl zu tun?«
»Ja. Sir Paul war Ölmillionär, ist aber schon tot. Lady Pangalos hat keine Kinder und fühlt sich sehr einsam«, erklärte ihm Stella. »Doktor Mayhew sagte mir, sie sei ein bisschen eigensinnig, aber sonst leicht zu behandeln. Sie bat ihn, ihr eine Schwester zu besorgen, die ihre Muttersprache fließend beherrscht. Sie ist nämlich Spanierin.«
Andrew riss erstaunt die Augen auf.
»Sie können fließend Spanisch sprechen?«
»Gewiss!«
»Kluges Mädchen!«, meinte Andrew lobend. »Ich wünschte, ich könnte auch eine Fremdsprache. Aber ich bin einer von den unglücklichen Menschen, die kein Sprachtalent haben.« Er hielt inne. »Aber Sie sind doch nicht etwa Spanierin?«
»Natürlich nicht. Ich bin Engländerin. Aber mein Vater ist Weinimporteur. Nach dem Kriege, als das Interesse an spanischen Weinen in England zunahm, entschloss er sich, nach Spanien zu gehen und sich ausschließlich mit dem Import spanischer Weine zu beschäftigen«, erklärte sie. »Er zog also mit meiner Mutter und mir nach Spanien; meine Eltern wohnen jetzt noch dort. Man lebt dort billiger - auch das Klima ist viel besser. Wir haben eine schöne Villa in Sitges. Sitges liegt an der Küste, etwa fünfzig Kilometer von Barcelona entfernt. Das Klima entspricht meinem Vater sehr, denn in England hatte er fast immer Schmerzen in der Brust.«
»Aber wenn es dort so schön ist, was tun Sie dann in England - noch dazu um diese Jahreszeit?«, erkundigte sich Andrew und sah sie nachdenklich an. »Selbst fünfundzwanzig Pfund in der Woche sind doch kaum eine so große Verlockung, um...«
»Ach, ich lebe schon seit Jahren wieder in England«, erwiderte Stella. »Genauer gesagt - seit drei Jahren«, fügte sie nach kurzem Nachdenken hinzu. »In Sitges bei meinen Eltern hatte ich nichts zu tun, nachdem ich die Schule verlassen hatte. Das wurde mir mit der Zeit zu langweilig. Da ich schon als Kind den Wunsch hatte, Krankenschwester zu werden, überredete ich meine Eltern, mich nach London als Lernschwester in das St.-Margaret-Krankenhaus zu schicken. Dort erhielt ich meine Ausbildung und legte auch meine Prüfungen ab. Mein Beruf macht mir Freude.«
»Aber dort verdienten Sie wohl nicht genug?«
Sie lachte.
»Sie glauben wohl, ich sei nur auf Geld versessen, wie?«, fragte sie mit einer Sanftmut, die er bewunderte. »So bin ich gar nicht. Aber wer hat schließlich nicht gern Geld? Als ich in einer Schwesternzeitung die Annonce las, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, mich um die Stellung zu bewerben. Sie schien geradezu wie für mich geschaffen, da ich fließend Spanisch spreche. In der Anzeige stand: Gut ausgebildete Schwester für Privatpatientin auf dem Land gesucht - perfekte spanische Sprachkenntnisse unbedingt erforderlich - sehr hohes Gehalt - leichte Arbeit. Bewerbungen durch persönliche Vorstellung bei der Simpson Agentur. Ich wusste, dass diese Agentur zuverlässig ist, und so bewarb ich mich.«
»Sie erhielten den Posten...«
»Ich hörte, dass verschiedene andere Schwestern bereits vorgesprochen hatten, aber abgelehnt worden waren«, meinte Stella nachdenklich. »Nicht nur, weil ihr Spanisch nicht gut genug war. Ich hatte eine Unterredung mit Doktor Mayhew, der selbst nach London gekommen war. Ach du meine Güte! Die Angst, die er mir zuerst einjagte! So hart - so groß - so streng! Er hatte sich sogar einen spanischen Dolmetscher mitgebracht!«
Andrew lachte.
»Doktor Mayhew ist ein schlauer Fuchs«, meinte er. »Er wollte sich eben nicht hereinlegen lassen. Natürlich konnte er durch den Dolmetscher leicht feststellen, dass Sie die Sprache wie eine Spanierin beherrschen, und so erhielten Sie die Stelle.«
»Es war wohl nicht nur mein Spanisch, Mr. Trehearne. Doktor Mayhew überzeugte sich auch eingehend von meiner Qualifikation«, verbesserte ihn Stella. »Wie ich erfuhr, ist Lady Pangalos schon alt und hinfällig, wenn sie auch vielleicht noch eine Reihe von Jahren zu leben hat. Sie soll auch nicht immer leicht zu behandeln sein. Seit Jahren sehnt sie sich nach jemandem, der sie an ihre Heimat erinnert, mit dem sie sich in ihrer Muttersprache unterhalten kann. Wahrscheinlich hat sie manche Eigenheiten«, fügte das Mädchen nachdenklich hinzu. »Jedenfalls wollte sie nicht, dass Doktor Mayhew eine Krankenschwester aus Spanien für sie kommen ließ. Sie bestand vielmehr auf einer englischen Schwester, da sie sich im High-Tor-Krankenhaus wohl fühle. Sie behauptete, dieses Krankenhaus sei viel besser als jedes spanische.«
»Das beweist doch nicht, dass sie merkwürdig oder verschroben ist«, erwiderte Andrew. »Es ist im Gegenteil ein Zeichen von gesundem Menschenverstand.« Er betrachtete Stella, ohne seine Bewunderung für sie zu verhehlen. »Erst wenn sie an Ihnen nicht schon auf den ersten Blick Gefallen finden sollte, würde ich an ihrem Verstand zweifeln.«
Stella schlug die Augen nieder.
»Hoffentlich kann ich sie zufriedenstellen«, sagte sie leise. »Aber es ist schrecklich, dass heute etwas so Furchtbares auf dem Moor passieren musste - gerade an meinem ersten Abend hier. Es hat mich ganz verstört. Ich schrieb Doktor Mayhew, ich würde heute Nachmittag um fünf im Krankenhaus ein treffen. Jetzt ist es schon nach acht; wer weiß, wann ich dort ankomme. Wie dumm von mir, in meinem Wagen herzufahren. Ich hätte den Zug nehmen sollen!«
»Darüber zu sprechen, hat keinen Sinn mehr!« Andrew zuckte die Achseln. »Was ist Ihnen denn unterwegs zugestoßen? Sie erwähnten doch vorhin etwas von einer Panne...«