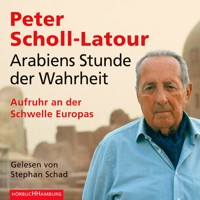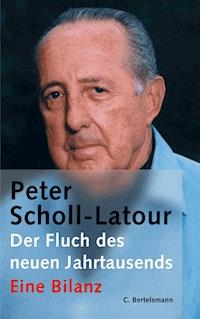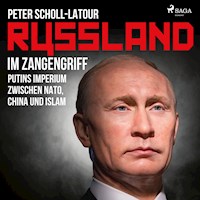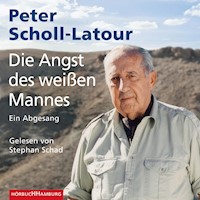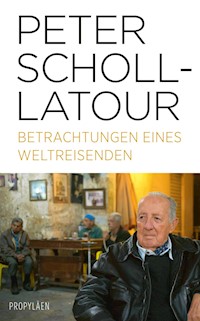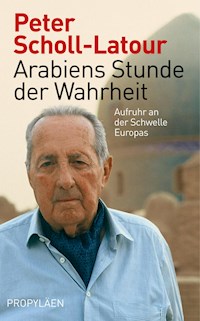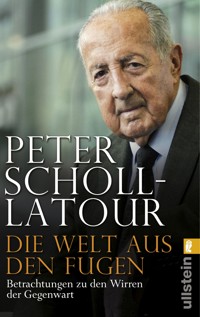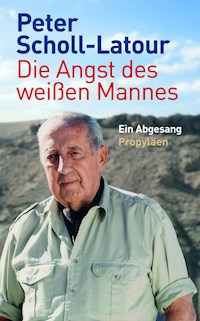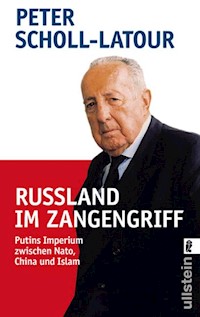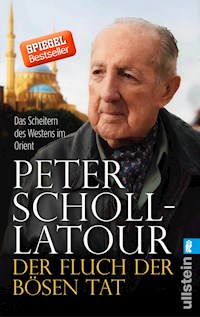9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Peter Scholl-Latour kennt Indochina wie kaum ein anderer, er ist mit allen Ländern zwischen dem Golf von Bengalen und dem Golf von Tonking vertraut: Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand, Burma und Singapur. Außerdem kennt er den mächtigen Nachbarn China. Seit er 1945 an Bord eines französischen Truppentransporters zum ersten Mal dorthin reiste und Augenzeuge der indochinesischen Tragödie wurde, hat er seine Erlebnisse und Erfahrungen zu einer Folge eindrucksvoller Bilder verdichtet. Eine Reportage höchsten Ranges, erfüllt von scharf umrissenen, ungeheuer lebendigen Figuren, bewegt von der Turbulenz der Ereignisse. "Ein Abenteuerbuch, das zugleich ein Lehrbuch für angewandte Politik ist." Frankfurter Allgemeine Zeitung "Das ist das beste deutsche Indochina-Buch." Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Was hat sich in den Ländern Indochinas seit Ende des Zweiten Weltkrieges wirklich ereignet? Peter Scholl-Latour kennt die Region wie kaum ein anderer, er ist mit allen Ländern zwischen dem Golf von Bengalen und dem Golf von Tonking vertraut: Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand, Myanmar und Singapur. Außerdem kennt er den mächtigen Nachbarn China. Seit er 1945 an Bord eines französischen Truppentransporters erstmals dorthin reiste, hat er die Stationen einer nicht endenden Tragödie miterlebt. Die Beobachtungen und Erfahrungen jener Jahre haben sich in diesem Buch zu eindrucksvollen Bildern verdichtet. Der Autor bietet eine Reportage höchsten Ranges, in der Menschen und Ereignisse, aber auch die Exotik dieser Länder lebendig werden und in der sich Zusammenhänge und Einsichten wie von selbst ergeben.
Der Autor
Peter Scholl-Latour, geboren 1924 in Bochum. Promotion an der Sorbonne in Paris in den Sciences Politiques, Diplom an der Libanesischen Universität in Beirut in Arabistik und Islamkunde. Seitdem in vielfältigen Funktionen als Journalist und Publizist tätig, unter anderem als ARD-Korrespondent in Afrika und Indochina, als ARD- und ZDF-Studioleiter in Paris, als Programmdirektor des WDR-Fernsehens, als Chefredakteur und Herausgeber des Stern und als Vorstandsmitglied von Gruner + Jahr. Seine TV-Sendungen erreichen höchste Einschaltquoten, seine Bücher haben ihn zu Deutschlands erfolgreichstem Sachbuchautor gemacht.
Peter Scholl-Latour verstarb am 16. August 2014.
Von Peter Scholl-Latour sind in unserem Hause außerdem erschienen:
Die Welt aus den Fugen
Arabiens Stunde der Wahrheit
Die Angst des weißen Mannes
Der Weg in den neuen Kalten Krieg
Zwischen den Fronten
Rußland im Zangengriff
Koloß auf tönernen Füßen
Weltmacht im Treibsand
Kampf dem Terror – Kampf dem Islam?
Peter Scholl-Latour
Der Tod im Reisfeld
Dreißig Jahre Krieg in Indochina
Mit einem aktuellen Vorwortdes Autors
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Lizenzausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage September 2013© Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart 1979Vorwort zu dieser Ausgabe: © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013
ISBN978-3-8437-0555-4
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: FinePic®, München (Landschaft) und ullstein bild – ddp (Autorenfoto)
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden
eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Vorbemerkung
Dieses Buch ist aus der Erinnerung geschrieben und gibt ein persönliches Erlebnis wieder. In dreißig Jahren Indochina habe ich die Erfahrung gemacht, daß die subjektive Berichterstattung oft die ehrlichste Methode ist, der Wirklichkeit oder – wenn man vor dem großen Wort nicht scheut – der Wahrheit näherzukommen.
P. S.-L.
Inhalt
Vorbemerkung
Vorwort zur Neuausgabe von 2013
DER ERSTE INDOCHINA-KRIEG: Die Franzosen
Ihr fahrt in die falsche Richtung: An Bord der »Andus«, Ende 1945
Buddha auf dem Tiger: Cochinchina, Anfang 1946
Onkel Hos Pakt mit dem französischen General: Haiphong, im Frühjahr 1946
Das neue Gesicht des Krieges: Saigon, Anfang 1951
Der Edelmann und die Hiobsbotschaften: Hanoi, Anfang 1951
Der streitbare Bischof: Phat Diem, 1951
An der Grenze Chinas: Lai Tschau, 1951
Nach der Niederlage von Dien Bien Phu: Hanoi, im Sommer 1954
Bei den letzten Außenposten: Son Tay, im Sommer 1954
Stellung im Reisfeld: Auf der Nationalstraße Zehn, im Sommer 1954
Das letzte Gefecht: Hung Yen, im Juli 1954
Gefangenenaustausch: Hai Thon, im Sommer 1954
Flug über die Demarkationslinie: Zwischen Hanoi und Saigon, im Sommer 1954
Auftakt einer neuen Tragödie: Saigon, im Sommer 1954
DER ZWEITE INDOCHINA-KRIEG: Die Amerikaner
Le sourire khmer: Kambodscha, im Frühjahr 1965
Der amerikanische Stil: Vietnam, im Frühjahr 1965
Bei den Marines: Vietnam, 17. Breitengrad, im Herbst 1966
Victor Charlie will sich nicht zeigen: Kim-Son-Tal, im Herbst 1966
Die Gipfelkonferenz zählt die Tage des Vietcong: Manila, im Herbst 1966
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit: Laos, im Herbst 1966
»Zu ihrer Rettung vernichtet«: Vietnam, im Herbst 1967
Bereit für die Revolution: Kambodscha, im Frühjahr 1970
Auflösung und Flucht: Hue, Ostern 1972
Die Vietnamisierung der Särge: Saigon, im Frühjahr 1972
Opium und Geheimdienst: Goldenes Dreieck, im Sommer 1973
Pol Pot ante portas: Kambodscha, im August 1973
Gefangener des Vietcong: Südvietnam, im August 1973
Fieberträume auf Bali: Bali, im März 1975
Die letzten Tage von Saigon: Saigon, im April 1975
Indochina, mon amour: Im Flugzeug, Ende April 1975
DER DRITTE INDOCHINA-KRIEG: Die Chinesen
Umerziehung und neue Fronten: Ho-Chi-Minh-Stadt, im August 1976
Sparta am Roten Fluß: Hanoi, im August 1976
Der Feind aus dem Norden: Im nördlichen Grenzgebiet Vietnams, August 1976
Skorpione in einer Flasche: Hanoi, im August 1976
Erdbeben in China: Peking, Ende August 1976
Der Stellvertreter-Krieg in Kambodscha: Kambodschanisch-thailändische Grenze, im Februar 1979
»China packt die vietnamesische Schlange am Schwanz«: Bangkok, im Februar 1979
Nachschub für die »Roten Khmer«: Kyon Yai, Ende Februar 1979
Cocktails und Bonzen im roten Laos: Vientiane, im März 1979
Der verlassene Königsweg: Pakse, im März 1979
Krisenstimmung am Mekong: Vientiane, im März 1979
Bilanz eines begrenzten Krieges: Hongkong, im März 1979
Der Drache und der Polarbär: Peking, im März 1979
Zu Gast bei Sihanouk: Peking, im März 1979
Wandzeitungen und Haute Couture: Peking, im März 1979
Der Indochina-Krieg dreht sich im Kreise: Kunming, im März 1979
Gefährten seit dreißig Jahren: Pan Qi, im März 1979
Marx und Mohammed: Kunming, im März 1979
Epilog in Europa: Paris – Bonn, im August 1979
Nachwort zur Taschenbuchausgabe 1992
Chronik des Indochina-Krieges
Vorwort zur Neuausgabe von 2013
Im Laufe meines langen Lebens habe ich mir einen Sport daraus gemacht, sämtliche Länder dieser Erde zu bereisen. Das ist mir auch gelungen, mit Ausnahme von ein paar Atollen im Pazifik und ein paar winzigen Eilanden der Karibik. Ich war stets auf der Suche nach der Authentizität fremder Kulturen und den Spuren ihrer oft brutalen Exotik. Die letzte Lücke wurde geschlossen, als ich vor wenigen Jahren die ehemals portugiesische Inselhälfte von Timor, die Republik Timor Leste, erforschte.
Immer wieder wurde mir die Frage gestellt, wo ich mich denn am wohlsten gefühlt, welche Region mich am tiefsten beeindruckt und in ihren Bann gezogen hätte. Die Antwort war stets die gleiche, und sie kam immer spontan: »Indochina, mon amour«, der Titel eines Kapitels des vorliegenden Buches, der häufig plagiiert wurde. In Frankreich gilt der Spruch: »On revient toujours à ses premières amours« – Man kehrt stets zu seiner ersten Liebe zurück, und das dürfte bei mir für jene einst französischen Besitzungen am Mekong und am Roten Fluß gelten, deren Faszination ich als junger Mann erlegen war. Ähnlich ist es wohl auch dem englischen Autor Graham Greene ergangen, als er den Stoff für seinen »Stillen Amerikaner« sammelte.
Paradoxerweise waren selbst die Soldaten des französischen Expeditionscorps diesem Charme verfallen, als sie – in tragischer Verkennung des Zeitenwandels – in den Dschungeln und Reisfeldern von Vietnam, Kambodscha und Laos einem verspäteten imperialen Traum nachjagten und dabei unter schweren Verlusten scheiterten. »Le Mal jaune« hat Jean Lartéguy, ehemaliger Para-Offizier in Indochina, seinen persönlichen Rückblick überschrieben. Damit war nicht irgendeine tropische Krankheit gemeint, sondern die schmerzliche Nostalgie, mit der die Veteranen dieses sinnlosen, aber romantischen Abenteuers in Fernost gedachten, als sie – wenige Jahre nach der Niederlage von Dien Bien Phu – in den trostlosen Schluchten des Atlas in die blutigen Exzesse des Algerienkrieges verwickelt wurden.
Historische Bedeutung und die angespannte Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit sollten die ehemaligen französischen Kolonien in Ostasien erst gewinnen, als das spärliche Truppenaufgebot, über das die IV. Republik verfügt hatte, durch die kolossale Streitmacht der USA abgelöst wurde, die eine angeblich von Hanoi ausgehende Ausbreitung des Kommunismus im Keim ersticken sollte. Die Präsidenten Eisenhower und Kennedy waren dem Irrtum erlegen, die revolutionäre marxistische Botschaft Ho Chi Minhs könne bis nach Indien ausstrahlen und – einem Domino-Effekt gehorchend – die brodelnden Menschenmassen des gesamten südasiatischen Kontinentalblocks gegen den Westen mobilisieren.
Mit dem Einsatz von einer halben Million GIs und einer Bombardierungsintensität, die den ungeheuren Vernichtungsaufwand des Zweiten Weltkrieges übertraf, würden die USA den Aufruhr der fanatisierten gelben Zwerge Südostasiens binnen weniger Monate zerschmettern, so lautete damals die Überzeugung des Pentagons und der weltweiten Medienlandschaft. Wer hätte damals – zumal in Deutschland, das die zermalmende Wucht amerikanischer Kriegführung an den Stränden der Normandie erlebt hatte – verstehen können, daß das Eingreifen der USA in den begrenzten Raum zwischen dem siebzehnten Breitengrad und der Südspitze von Camau in einem »Quagmire«, einem Sumpf versacken würde? Wer hätte ahnen können, daß am Ende eines wenig glorreichen Engagements von fast zehn Jahren die schmähliche Flucht der Amerikaner aus ihren letzten Quartieren von Saigon stehen würde? Als ich – auf Grund meiner intensiven Erfahrungen im französischen Indochina – schon während der ersten Phase nach der Landung der US-Marines in Danang in meiner Berichterstattung ernsthafte Zweifel am Erfolg dieses gigantischen Unternehmens äußerte, stieß ich auf Kritik und Spott. Damals übte ich zum ersten Mal die Rolle des einsamen »Rufers in der Wüste« aus, des unkonventionellen Abweichlers von der vorherrschenden Meinung, der ich mein ganzes Leben lang treu geblieben bin und in der ich selten widerlegt wurde.
Die Magie Indochinas hat in meinem beruflichen und auch privaten Leben entscheidend nachgewirkt. Wenn sich nicht neuerdings Ströme von Touristen über dieses entzauberte Wunderland ergössen, könnte ich mir sogar vorstellen, in einem verwunschenen Gehöft am Ufer des Mekong meine Tage zu beschließen. Aber das würde voraussetzen, daß sich die grandiose Unberührtheit und freundliche Schicksalsergebenheit der Eingeborenen erhalten hätten, die nun nur noch in meiner Phantasie weiterleben. So bleibt mir wenigstens als flüchtiger Glücksmoment mein letzter Aufenthalt im wiedererstandenen Stadtzentrum von Hanoi erhalten. Dort hatte ich mich als einsamer Europäer auf den Steinbänken am »Kleinen See« einer Runde hochbetagter Asiaten beigesellt. Es kam zwar kein Gespräch auf, aber wir genossen die brüderliche Gemeinsamkeit des Greisenalters, während wir wortlos auf das stille Wasser des »petit lac« blickten. Auf dessen Grund soll der Sage zufolge eine riesige Schildkröte über das Zauberschwert jenes fernen vietnamesischen Nationalhelden wachen, der die weit überlegenen Horden des Mongolen-Kaisers Kublai Khan in der Schlacht von Bac Dang vernichtete und so seine Nation vor der totalen Unterwerfung und Assimilation durch das chinesische Reich der Mitte bewahrte.
Im vorliegenden Buch geht es nicht um meine persönlichen Befindlichkeiten, sondern um die Frage, inwieweit das Schicksal Indochinas das Weltgeschehen beeinflußt hat. Wenn man von dem Kompromiß absieht, zu dem sich Washington 1953 nach dem massiven Durchbruch der Volksbefreiungsarmee Mao Tse-tungs in Korea gezwungen sah, haben die USA die erste spektakuläre Niederlage ihrer Geschichte in Vietnam erlitten. Psychologisch hat sich die »Superpower« von dieser Demütigung bis heute nicht erholt, vielmehr ist dieser Koloß, dessen Potential und technologischer Vorsprung zur Stunde noch unerreicht sind, seitdem von einem militärischen Fehlschlag zum anderen gestolpert.
Der Krieg gegen den Irak Saddam Husseins misslang total und beschwor ein verhängnisvolles Chaos herauf, auch wenn der Diktator von Bagdad gefangen und hingerichtet wurde. In Afghanistan beobachten wir zur Stunde, wie nach mehr als zehnjähriger Terroristen-Bekämpfung die als teuflische Verbrecher geschmähten »Taleban« im Begriff stehen, die Macht in Kabul wieder an sich zu reißen. Die absurden Entgleisungen des sogenannten Arabischen Frühlings haben die Unfähigkeit dieser Weltmacht bloßgelegt, den Geboten der psychologischen Kriegführung gerecht zu werden und auf die Tücken des »asymmetric war« in angemessener Form zu reagieren. Im pazifischen Raum, dem Barack Obama seine prioritäre Aufmerksamkeit widmen will, sieht sich Amerika außerstande, den paranoiden Drohgebärden der nordkoreanischen Kim-Dynastie mit gebührender Strenge zu begegnen.
Kaum war der Kalte Krieg zwischen Ost und West, zwischen Washington und Moskau, mit der Selbstauflösung der Sowjetunion und dem Zerplatzen der kommunistischen Utopien zugunsten der Atlantischen Allianz entschieden, da verstrickten sich die USA in einen diffusen, globalen Feldzug gegen die unterschiedlichen Formen des islamischen Extremismus. Vor allem aber gab sich die Volksrepublik China als ungeheuerlicher Machtfaktor zu erkennen und schickt sich an – laut Analysen erfahrener Experten – die USA binnen zwanzig Jahren auf den zweiten Rang zu verweisen. Entgegen allen Befürchtungen hat jedoch das Einrücken der nordvietnamesischen »Bo Doi« in Saigon seinerzeit keinen geopolitischen Erdrutsch ausgelöst. Wenn man den zahllosen Filmen aus Hollywood Glauben schenkt, hätten die GIs in der »Hölle« von Vietnam sogar ganze Serien von Heldentaten vollbracht. Vielleicht ist der imaginäre Fiebertraum von »Apocalypse now« den düsteren Schimären dieses asiatischen »Horrors« noch am nächsten gekommen.
Was nun das wiedervereinigte Vietnam betrifft, so bemüht sich das ideologisch verkrustete Regime von Hanoi um eine zögerliche marktwirtschaftliche Öffnung und die mühselige Ausrichtung auf das Vorbild der ostasiatischen »Tigerstaaten«. Es kam immerhin im Innern zur allmählichen Aussöhnung zwischen Nord und Süd sowie zu einer spürbaren Anhebung des Lebensstandards der bislang darbenden Bevölkerung. Einen Nachahmungseffekt hat jedoch das heroische Experiment Ho Chi Minhs bei keinem einzigen seiner südostasiatischen Nachbarn ausgelöst. Zwar üben die Funktionäre aus Hanoi in der verschlafenen Hauptstadt von Laos, Vientiane, noch eine schikanöse Kontrolle aus, aber das Königreich Thailand jenseits des Mekong entfaltet hier eine weit überlegene Anziehungskraft, und von Norden her gewinnt das diskrete Vordringen der Volksrepublik China ständig an Boden.
Kambodscha hat jede Bevormundung durch seine vietnamesischen Erbfeinde längst abgeschüttelt. Der kriegserprobten Armee Hanois, die die Allmacht Amerikas in die Schranken wies, ist es nicht gelungen, in einem konventionellen Feldzug, der so gar nicht ihrer bewährten Praxis als Partisanen und Untergrundkämpfer entsprach, den Widerstand der »Roten Khmer« zu brechen und das einst so attraktive Königreich des Prinzen Sihanouk zu unterjochen. Es war für mich ein düsteres Erlebnis, als ich im Jahr 1980 im Dschungel der Provinz Siem Reap Zugang zu einer Kampfeinheit der Roten Khmer fand, zu den »Kriegern der Apokalypse«, wie ich sie in meiner Fernsehdokumentation nannte. Es berührte seltsam, daß ich mit jenen führenden Männern – Kieu Samphan und Yeng Sari – zusammentraf, ja mit ihnen tafelte, die für den abscheulichen Massenmord am eigenen Volk verantwortlich waren, und dabei von jenen Kindersoldaten bedient wurde, die kurz zuvor noch die Feinde ihres Steinzeitkommunismus durch das Überstülpen von Plastiktüten zu ersticken pflegten.
In unserer schnellebigen Zeit verblaßt allmählich das Vietnam-Syndrom und wird durch eine seltsame Anhäufung von posttraumatischen Verwirrungen bei den heimgekehrten Soldaten der Irak- und Afghanistanfeldzüge verdrängt. Immerhin bleibt als Fazit bestehen, daß zwischen Saigon und Danang der Traum einer weltweiten »Pax americana« zerbrach und das Gerede vom »Ende der Geschichte« jeden Sinn verlor.
Als im Sommer 2013 Barack Obama im Emirat Qatar diskrete Gespräche mit den unlängst noch als ruchlose Terroristen geschmähten Taleban aufnahm, um mit ihnen einen halbwegs reibungslosen Abzug der alliierten ISAF-Kontingente aus Afghanistan auszuhandeln, drängte sich die Erinnerung an den endlosen Schacher um einen Waffenstillstand in Vietnam auf, zu dem sich zu Beginn der siebziger Jahre Präsident Nixon und sein Außenminister Henry Kissinger bereitgefunden hatten. Was am Ende besiegelt wurde, war die Preisgabe des südvietnamesischen Staatsgebildes und der mit Amerika verbündeten Armee des Generals Nguyen Van Thieu, der sich verraten fühlte. Eine vergleichbare Entwicklung dürfte sich bei den geheimen Kontakten anbahnen, die zwischen den Bevollmächtigten des Weißen Hauses und den Emissären des Mullah Omar aus Kandahar aufgenommen wurden. Der vom Westen als gefügiger Staatschef eingesetzte Hamid Karzai muß befürchten, daß sein Regime ebenso schonungslos der Willkür seiner Gegner ausgeliefert wird, wie das einst in Südvietnam geschah.
Die kommunistische Führung der Lao-Dong-Partei von Hanoi sieht Gefahren eines ganz anderen Ausmaßes auf sich zukommen. Seit langem wird auf den in Peking gedruckten Landkarten die immense Fläche des Südchinesischen Meeres inklusive der dortigen Archipele Spratly und Paracel als integrierter Territorialbesitz des Reiches der Mitte dargestellt. Wenn dem so wäre, würde Peking über die dort georteten reichen Vorkommen an Erdöl und Gas verfügen und seine Hoheitsgewässer bis in die unmittelbare Nachbarschaft der philippinischen, malaysischen und vietnamesischen Küsten ausdehnen. Die Lebensader des gewaltigen maritimen Verkehrs zwischen dem Indischen und dem Pazifischen Ozean geriete unter chinesische Kontrolle, eine Perspektive, die für die kraftstrotzenden Anrainer dieser Region, zumal für Amerika, Indien und Japan, absolut unerträglich wäre.
Schon bereiten sich die Geschwader der US Navy auf eine solche Konfrontation vor, während China seine raketenbestückte U-Boot-Flotte fieberhaft ausbaut. Am energischsten widersetzte sich bereits die Volksrepublik Vietnam dieser angestrebten Expansion seines nördlichen Nachbarn und schreckte sogar vor bewaffneten Zwischenfällen nicht zurück. Die Krisenstimmung rund um die South China Sea hat bewirkt, daß zwischen Washington und Hanoi eine Interessengemeinschaft, ja eine strategische Partnerschaft entstanden ist, die vor fünfzig Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Im Raum des Westpazifiks bereitet sich ein gigantisches Kräftemessen vor, bei dem die ehemaligen Kolonialmächte Europas – auf Grund selbstverschuldeter Schwäche und der Verstrickung in die Querelen des Orients – rat- und tatenlos ins Abseits gedrängt sind.
DER ERSTE INDOCHINA-KRIEGDie Franzosen
Ihr fahrt in die falsche Richtung
An Bord der »Andus«, Ende 1945
Der Truppentransporter »Andus«, 26 000BRT, war von der Royal Navy ausgeliehen. Es lief so manches auf Pump bei den französischen Streitkräften in jenen Tagen. Die Nation hatte sich von der Niederlage des Jahres 1940 weder moralisch noch materiell erholt. Die britischen Seeleute der »Andus« blickten mit einiger Verwunderung auf die Angehörigen dieser Kolonialarmee, die sie nach Fernost geleiten und die dort offenbar das französische Versagen im Mutterland wettmachen sollten. Der Krieg gegen Japan, in den de Gaulle sich noch in aller Eile hatte drängen wollen, war zu Ende gegangen, ohne daß eine einzige französische Einheit daran teilgenommen hätte. In Sichtweite der »Andus« folgte ein anderes Truppenschiff ähnlicher Tonnage. Neben dem Union Jack führte es die niederländische Fahne. Holländische Kolonial-Truppen waren nach Batavia unterwegs. Im Roten Meer begegnete die »Andus« ganzen Konvois, die in entgegengesetzter Richtung nach Europa steuerten und an deren Masten Siegeswimpel flatterten. An Deck standen britische Veteranen des Burma-Feldzugs, die auf ihre heimischen Inseln, in den Frieden und den Alltag zurückkehrten. Durch den Feldstecher konnte man ihre von der Tropensonne geröteten Gesichter erkennen, auf denen sich die hemmungslose Freude spiegelte, den Gefahren des Dschungels und eines unerbittlichen Gegners entronnen zu sein. Die Engländer winkten den französischen Soldaten der »Andus« sowie den Holländern ausgelassen zu. Durch ein Megaphon war eine englische Stimme mit spöttischem Unterton zu hören: »You are going the wrong way … Ihr fahrt in die falsche Richtung!« – »Was wollen diese Briten schon wieder?« fragte ein beleibter französischer Schreibstuben-Major mit tiefer Mißbilligung in der Stimme.
Es war eine absurde Situation. In London, wo seit kurzem die Labour Party regierte, hatte man sich kurzerhand entschlossen, den Empire-Träumen – Kipling hin, Kipling her – den Rücken zu kehren und den indischen Subkontinent in die Unabhängigkeit zu entlassen. In Burma hatte die britische Armee nach anfänglichen Rückschlägen eine letzte große Schau abgezogen. Mit der geschwellten Brust des Siegers konnte sie nun von der Szene abgehen, und Admiral Mountbatten würde dem Abschied von Delhi Statur und Allüre verleihen. Doch die Unterlegenen der ersten Runde, die Zufallssieger der letzten Stunde, Franzosen und Holländer, die klammerten sich an die Fata Morgana ihrer einstigen überseeischen Herrlichkeit, an Indochina und an Indonesien.
Die jungen französischen Offiziere litten unter der Enttäuschung, zu spät zu kommen und nunmehr einem zweitrangigen Unternehmen entgegenzusehen. Manche hatten unter de Gaulle bei den »Freien Franzosen« gedient – von der Vichy-Regierung als Landesverräter deklariert – oder hatten sich in Nordafrika unter amerikanischem Oberbefehl der Armee angeschlossen; die meisten jedoch hatten die Demütigung der deutschen Besatzung auskosten müssen. Diese Schmach der Niederlage und der Unterwerfung suchten sie nun im Wasser des Mekong-Stroms und des Roten Flusses abzuwaschen. Insgeheim bangten sie davor, in ein befriedetes, in Treue zu Frankreich verharrendes Indochina zurückzukehren. Es dürstete sie nach exotischem Abenteuer, nach den émotions fortes – dem starken Erlebnis. Vermutlich hatten die wenigsten dieser Leutnants Jean-Paul Sartre gelesen, aber sie waren auf ihre Art Existentialisten in Uniform. Sie suchten die Wege der Freiheit, les Chemins de la Liberté in einem tropisch-kriegerischen Saint-Germain-des-Prés ihrer Phantasie. »Endlich ein Stück Erde finden ohne Asphalt …« schrieb einer von ihnen in sein Tagebuch.
An Bord der »Andus« befanden sich zwei Kompanien Fremdenlegionäre. Zu zwei Dritteln waren sie Deutsche. Die meisten von ihnen kamen aus französischer Kriegsgefangenschaft, wo sie halb verhungert waren. Sie hatten sich nach Indochina gemeldet, weil sie die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihren im Osten vermißten Angehörigen ohnehin aufgegeben hatten oder weil sie sich ganz einfach satt essen wollten. Einige hatten bei der SS gedient und wollten die Entnazifizierungsverfahren in der Heimat meiden. Die deutschen Legionäre sangen abends ihre alten Wehrmachtslieder, wo von Erika und Heide, von Lore und Försterwald die Rede war. Sie ahnten nicht, daß die Gegner von gestern, die des Refrains von der Madelon überdrüssig geworden waren, diese martialischen Weisen Germaniens übernehmen und daß zwanzig Jahre später französische Rekruten zum Takt der Blauen Dragoner marschieren würden.
Die interessantesten Fälle waren die belgischen Legionäre. In Wirklichkeit handelte es sich um Franzosen, die, um in dieser Ausländertruppe dienen zu können, eine falsche Staatsangehörigkeit angegeben hatten. Es waren keine schweren Jungens oder gewöhnliche Kriminelle, wie sie vor 1939 häufig in der Legion untergetaucht waren. Die falschen Belgier waren französische Kollaborateure, die im Krieg auf deutscher Seite in der »Legion gegen den Bolschewismus« und später in der SS-Brigade »Karl der Große« gedient hatten. Soweit sie nicht durch Einsätze gegen die eigene Résistance im Mutterland belastet waren, hatte de Gaulle ihnen die Chance der Rehabilitierung geboten. Fünf Jahre Dienst in der Fremdenlegion in Indochina, und mit weißer Weste könnten sie wieder in die Heimat zurückkehren. Neben den Deutschen, unter denen Prahler und Mythomane das große Wort führten und wo es von angeblichen U-Boot-Kapitänen und Ritterkreuzträgern wimmelte, machten die »belgischen Franzosen« einen ernsten und nachdenklichen Eindruck. Die Trümmer der Brigade »Charlemagne« hatten in Pommern Nachhutgefechte gegen die vorrückenden Russen geführt und waren dort weitgehend aufgerieben worden, ehe die Überlebenden den Führerbunker in der Reichskanzlei verteidigen durften.
Im Gegensatz zu den regulären Freiwilligen für Fernost, die die japanische Kapitulation in ihren Einschiffungs-Lagern bei Marseille mit Enttäuschung quittiert hatten, betrachteten die ehemaligen französischen Ostfrontkämpfer die kriegerische Kursänderung mit heimlicher Genugtuung. »Unser wirkliches Ziel ist nicht Saigon oder Hanoi«, so flüsterte ein blutjunger Legionär, der unter der Anonymität des weißen Képi den Namen eines berühmten französischen Geschlechts verbarg, »Indochina ist nur eine Durchgangsstation. Das wirkliche Ziel unseres Einsatzes wird schon in naher Zukunft Wladiwostok und die sowjetische Fernost-Provinz heißen.« Der Ost-West-Konflikt, der Kalte Krieg hatte begonnen. Das hatte sich sogar auf der »Andus« herumgesprochen, während sie durch die phosphoreszierenden Fluten des Indischen Ozeans auf die Straße von Malakka zusteuerte.
Die Kajüten waren überbelegt und stickig. Nachts standen die Soldaten, solange sie konnten, auf Deck, schnappten Luft, spielten Belote und spähten in die immer wärmer und feuchter werdende Dunkelheit. Auch die Angehörigen des weiblichen Hilfspersonals, die sogenannten AFAT, trieben sich um diese Zeit in der Nähe der Rettungsboote herum und warteten auf die galante Gesellschaft eines Offiziers. Dann genügte es, die Plane beiseite zu schieben, um zwischen Ruderbänken und Steuer ein Liebesnest zu finden. Die meisten dieser Armee-Mädchen bewegten sich unter so vielen Männern völlig ungeniert. Sie waren stark geschminkt und so burschikos, daß sehr bald die Vermutung aufkam, sie hätten gute Gründe, das Mutterland zu meiden, die einen, weil sie einen deutschen Besatzungssoldaten geliebt, die anderen, weil sie ihr uraltes Gewerbe in einem Wehrmachts-Bordell ausgeübt hätten. Es gab eben viele Neider und viel Samenkoller an Bord der »Andus«.
Ein schmalbrüstiger Kavallerieleutnant, der mit seinem blonden Schnurrbart und blassem Teint besser in einen Proust-Roman gepaßt hätte, zitierte ein Gedicht von Hérédia. »Wie ein Falkenflug … Müde ihr hochmütiges Elend zu ertragen … Trunken von einem kriegerischen und brutalen Traum …«, so klangen die schwülstigen Verse der »Conquistadors«, die jedem französischen Gymnasiasten vertraut waren. »… über den Bug ihrer weißen Caravellen geneigt, entdeckten sie bei Nacht jene neuen Gestirne, die aus der Tiefe des Meeres in ein unbekanntes Firmament stiegen.«
Buddha auf dem Tiger
Cochinchina, Anfang 1946
Sobald die Wagenkolonne Saigon verlassen hatte und die Gummibaum-Plantagen der nordwestlichen Nachbarprovinz erreichte, wurden die Spuren des Partisanenkrieges sichtbar. Die Asphaltstraße war durch tiefe Gräben zerwühlt, die die Bauern unter Anleitung der roten Kommissare bei Nacht immer wieder ausheben mußten. Die Ausschachtungen waren so regelmäßig, daß sie von den Franzosen »Klaviertasten« genannt wurden. Der Morgenhimmel färbte sich im Osten grüngelb. Wir fuhren in Richtung Tay Ninh, und bald entdeckten wir jenseits der Palmwedel und der endlosen Reisfelder einen finsteren Gebirgskegel, der sich bedrohlich aus der platten Ebene erhob. Der Felsen hieß »schwarze Jungfrau« und signalisierte die kambodschanische Grenze. Wer ahnte damals schon, daß eines Tages die amerikanischen GI’s zu dieser »Black Virgin« wie zu einer Rachegöttin aufblicken würden.
Wir ließen die Fahrzeuge und die Straße hinter uns. Horden von Affen huschten durch das Bambusdickicht. Viel zu schnell stieg die Sonne zum Zenit. Das Vogelgezwitscher erstarb mit der aufkommenden Hitze. Das Grün der Pflanzen wurde schwarz. Die Luft flimmerte. Für das Commando handelte es sich um ein Routine-Unternehmen. Die Soldaten gingen so lange als klar erkennbare Silhouetten über die Dämme, die die nackten Reisfelder unterteilten, bis von irgendwo auf sie gefeuert wurde. Die Gefahr war gering, die vietnamesischen Freischärler der ersten Stunde waren kümmerlich bewaffnet und noch schlechter ausgebildet. Verluste bei den Franzosen gab es nur, wenn Angehörige der »Kempetai«, der japanischen Feldgendarmerie, die in Saigon als Kriegsverbrecher gesucht wurden, die Aufständischen verstärkten und anleiteten. Stunden dauerte nun schon der Marsch, der sich in einem halben Bogen um die »Schwarze Jungfrau« zur kambodschanischen Grenze bewegte. Die Reisfelder waren von der Sonne zu steinhartem Ziegel gebrannt worden. Wie in einer Fiebervision blickten die Männer des Commandos auf die Risse im lehmigen Boden und das unregelmäßige Muster der verdorrten Pflanzenstummel. Der Schweiß lief brennend in die Augen. Aus einem Gehöft, das im Bambus verborgen lag, fielen ein paar Schüsse. Die Franzosen orteten die Richtung, pflanzten das Bajonett auf ihre speziell für den Nahkampf getrimmten Sten-Maschinenpistolen und stürmten aus der Hüfte schießend auf das Dickicht zu. Ein paar Schatten huschten über das Reisfeld, gerieten in die Garbe des leichten Maschinengewehrs, das bereits in Stellung gegangen war, und kippten um.
Wir näherten uns den Toten. Es war ein jämmerlicher Anblick: kleine gelbe Puppen mit verrenkten Gliedern. Ihre altmodischen Lebel-Gewehre lagen wie Spielzeuge neben ihnen. Die dürren sehnigen Beine steckten in kurzen Hosen. Von Uniformierung war nicht die Rede, aber auf ihre schwarzen Kittel hatten sie den roten Stoffetzen mit dem gelben Stern genäht, das Wahrzeichen der indochinesischen Revolution. Die Gefallenen waren also keine Angehörigen jener seltsamen Cao Dai-Sekte, die in Tay Ninh ihr bombastisches Heiligtum besaß und ebenfalls gegen die Franzosen kämpfte, sondern es handelte sich um Partisanen des Vietminh, jener kommunistischen Befreiungsfront Vietnams, die von nun an unter wechselnden Bezeichnungen die Weltöffentlichkeit dreißig Jahre lang in Atem halten sollte.
Die Dörfer im Umkreis waren beim Nahen der fremden Soldaten von ihren Einwohnern fluchtartig verlassen worden. Es waren bescheidene rechteckige Hütten. Die Möblierung beschränkte sich auf eine breite Holzpritsche und ein paar Matten. Aber nirgendwo fehlte der Ahnenaltar. In diesen Katen herrschten peinliche Ordnung und Sauberkeit. Sie wären für einen Europäer durchaus bewohnbar gewesen. Die Soldaten füllten ihre Feldflaschen in den dickbauchigen Tonkrügen, die vor jedem Haus standen. Das Wasser war schlammig und lauwarm. Kein Wunder, daß die Ausfälle durch Amöbenruhr immer zahlreicher wurden. Vor dem Weitermarsch wurde Feuer gelegt. Ein Streichholz genügte, und schon brannten die Strohdächer lichterloh. Die Wasserbüffel, die die Reisbauern bei ihrer Flucht zurückgelassen hatten, wurden abgeknallt. Auch ein kleiner Cao-Dai-Tempel ging in Flammen auf. Es gelang mir, durch den Qualm noch einen letzten Blick auf den schmucklosen Tisch zu werfen, wo die Heiligen dieser konfusen synkretistischen Religion aufgereiht waren. Ein kleiner dickbauchiger Buddha aus Ton fiel mir auf, der mit einem spitzbübischen Lächeln die Patschhändchen hob und dabei auf einem Tiger ritt.
Beim nächsten Überfall büßte das Commando einen Toten und zwei Verwundete ein. Dafür trieben die Leichen von zehn roten Partisanen im fauligen Wasser des nahen Irrigationsgrabens. In einem größeren Gehöft fand die Lagebesprechung statt. Oberst Ponchardier, von seinen Soldaten »Pascha« genannt, war mißmutig. Das war kein Krieg nach seinem Geschmack. Der gedrungene, wie ein Catcher gebaute Mann, der ein wenig aussah wie der Schauspieler Lino Ventura, hatte seine Sondertruppe einmal darauf getrimmt, gemeinsam mit dem britischen Special Air Service über Singapur abzuspringen. Die Partisanenbekämpfung in Cochinchina war dafür kein Ersatz. Ponchardier war von seinen Männern nicht zu unterscheiden, wie er mit nacktem Oberkörper auf dem grünen Dschungelhut saß und die Maschinenpistole stets in Reichweite hielt. Am Koppel trug er eine altertümliche Autohupe, die er im Einsatz gelegentlich quäken ließ, wie andere zum Sammeln blasen. Der »Pascha« war mit seiner kleinen Einheit von 150 Mann dem französischen Oberbefehlshaber in Indochina unmittelbar unterstellt. Seine Soldaten grüßten nur die eigenen Offiziere und blickten mit einiger Herablassung auf die übrigen Regimenter des Expeditionskorps herab, die ihnen nach Saigon gefolgt waren.
Als junger Offizier war Ponchardier schon 1940 zu den »Freien Franzosen« de Gaulles gestoßen und hatte im französischen Untergrund der Besatzungszeit mit seinem Bruder Dominique, der ihm verblüffend ähnlich sah, die Widerstandsorganisation »Sosias« gegründet. Mit Hilfe eines gezielten Bombardements der Royal Air Force hatte er die inhaftierten Résistance-Kämpfer aus dem Gestapogefängnis von Amiens befreit. Bruder Dominique hatte die halb heldischen, halb pikaresken Taten dieses seltsamen Paares in seinem Buch »Pflastersteine der Hölle« festgehalten und das eigenartige Gefühl beschrieben, das einen Untergrundchef überkommt, wenn er das erste Mal mit nackter Hand einen Verräter in den eigenen Reihen erwürgen muß. Pierre Ponchardier ist einige Jahre nach dem Ende des Algerienfeldzuges als Admiral – denn er kam aus der Marinefliegerei – über Senegal tödlich abgestürzt. Dominique hingegen brachte es zum Botschafter in Bolivien und Hochkommissar in Dschibuti. Aber als seinen größten Erfolg betrachtete er die Massenauflage der Spionage-Serie, die den Abenteuern des »Gorilla« gewidmet war. Der »Gorilla«, so meinte de Gaulle einmal, als er seinen Botschafter empfing, sei wohl Dominique selbst.
Das Commando Ponchardier galt als rauhe Truppe von Abenteurern und Schlägern. Aber auch brave Söhne aus sogenannten guten Familien waren dabei, die der Enge ihrer bürgerlichen Umgebung entfliehen wollten. An Originalen fehlte es nicht: Ein China-Experte mit einem riesigen Adler auf der tätowierten Brust, der die ergötzlichsten Anekdoten über die Söhne des Himmels zu erzählen wußte; zwei Pariser Titis, die dem Zuhältermilieu entsprungen schienen und denen man zutraute, daß sie von dem Plünderungsrecht, das dem Commando angeblich im Kampfgebiet zugestanden war, Gebrauch machten; ein paar junge Einzelkämpfer des Nachrichtendienstes DGER, sie waren nach der japanischen Kapitulation im Gebirge von Tonking abgesprungen und hatten dort die demoralisierten Trümmer der alten französischen Indochina-Armee vorgefunden, die sich während des Krieges zu Pétain bekannt hatte und im März 1945, als sie sich in letzter Stunde anschickte, gemeinsame Sache mit den Alliierten zu machen, von den Soldaten des Tenno mühelos zerschlagen worden war. Die Außenprovinzen und ethnischen Minderheiten der Grande Nation waren stark vertreten: Elsässer und Korsen, Bretonen und Basken. Man konnte sich schlecht vorstellen, wie diese Männer nach der Entmobilisierung wieder in ein normales Zivilleben zurückfinden würden. Dem »Pascha« waren sie teilweise selbst nicht ganz geheuer. »Wenn ich das nächste Mal eine Truppe aufstelle«, so brummte er einmal, »werde ich mir artige und solide Jungens aussuchen. Auf die Dauer sind die tapferer und ausdauernder als die Ganoven, denen sehr schnell der Schwung abgeht.«
Die Offiziere des Commandos sollten sehr unterschiedlichen Schicksalen entgegengehen. Den Hauptmann Quilici, der wie ein korsischer Bandit d’honneur wirkte, traf ich zwanzig Jahre später als Oberst der Fallschirmjäger der Marineinfanterie im Tschad wieder, wo er die nördlichen Oasen in der Tibesti- und Enedi-Wüste inspizierte. Oberleutnant Augustin, der schon damals den mönchischen Typus verkörperte, wie er im französischen Offizierskorps häufig ist – Säbel und Ziborium blicken hier auf uralte Verbindungen zurück – , kehrte nach dem Algerien-Fiasko der Armee den Rücken und entsagte als Laienbruder in einem Dominikanerkloster dem Glanz der Waffen. Die erstaunlichste Karriere durchlief Capitaine Trinquier, der in der französischen Konzession von Schanghai bei der Kolonialinfanterie gedient hatte, ehe er zu der Truppe Ponchardiers stieß. Der »Pascha« empfand wenig Sympathie für diesen mediterran-schönen, allzu eleganten Mann, der selbst im indochinesischen Busch mit einem Seidenhalstuch herumlief und sich durch gewählte Redensarten hervortat. Niemand hätte Trinquier damals zugetraut, daß er in der letzten Phase des französischen Fernost-Krieges hinter den Linien des Vietminh die Widerstandsnester des profranzösischen Gebirgsvolkes der Meo organisieren oder daß er im Nordafrika-Feldzug mit der unerbittlichen Ausmerzung des Terrorismus in der Kasbah von Algier beauftragt würde. Am Ende war er nach dem Generalputsch gegen de Gaulle und seinem Ausscheiden aus der Armee kurzfristig als Oberbefehlshaber der Katanga-Gendarmerie in die Dienste des Präsidenten Moïse Tschombé getreten.
Auf dem Weitermarsch stießen wir überraschend auf eine Gruppe kambodschanischer Bauern. Sie näherten sich im Gänsemarsch. Als Khmer waren sie an der dunklen Haut, an den gekräuselten Haaren und am Sarong zu erkennen, den sie um die Hüfte gewickelt hatten. Beim Anblick der französischen Soldaten knieten sie nieder und falteten die Hände in einer uralten Geste der Unterwerfung. Wir hatten kambodschanisches Siedlungsgebiet erreicht. Die Häuser längs der Wasserläufe standen auf Pfählen. Sogar die Landschaft veränderte sich. Die Reisfelder wurden hier durch einsam stehende, zerzauste Zuckerpalmen beherrscht. Im nächsten Dorf wurden kräftige Kambodschaner als Träger rekrutiert. Sie stellten sich gern den Franzosen zur Verfügung, wenn es galt, ihre Erbfeinde, die Vietnamesen, zu töten. Im Gefecht überwanden sie schnell ihre erste Panik und brachen bei jeder Schießerei in kindliche Heiterkeit aus.
Das alte französische Fort von Tay Ninh mit seinen Schießscharten, Zinnen und Türmen lag – aus der Ferne gesehen – wie ein Spielzeug in der Abendsonne. Es stammte aus der frühen Zeit der Kolonisation, als die ersten französischen Eroberer in Cochinchina noch gegen Flußpiraten kämpften. Über den Klappbetten wurden Moskitonetze aufgespannt. Die Dunkelheit kam plötzlich, und die Nacht war klebrig schwül. Die Soldaten aßen ihre Rationen. Irgendwo war Rotwein beschafft worden. Es ging laut zu in den Kasematten der altertümlichen Festung. Im Laufe des Nachmittags war ein Trupp der politischen Sonderpolizei aus Saigon eingetroffen, überwiegend Eurasier. Sie hatten Gefangene verhört. Dabei war gefoltert worden, wie wir bei unserer Ankunft im Fort erfuhren. Den Verdächtigen waren die Köpfe so lange in Wasserkübel getaucht worden, bis sie geständig wurden. Man nannte das la baignoire – die Badewanne. La gégéne, die elektrische Tortur mit Hilfe eines kleinen Generators, war damals in Indochina noch nicht gebräuchlich. Aber die Asiaten, so hieß es, verfügten über raffinierte und schreckliche Methoden, um die Widerspenstigen zum Sprechen zu bringen. Wehe übrigens dem Europäer, der den Partisanen lebend in die Hände fiel! Wir hatten mehrfach die Leichen von Franzosen in den Gewässern Cochinchinas treiben sehen, denen die Hoden in den Mund gestopft und die mit einem Bambusrohr gepfählt worden waren. Während die Truppe lärmte und nach kambodschanischen Mädchen verlangte, standen die vorgeschobenen Außenposten zu zweit und dritt am Rande des Dschungels. In dieser gefährlichen Einsamkeit schien die Wildnis von den Geräuschen der Tierwelt zu dröhnen. Je kleiner ein Insekt war, desto mehr Lärm veranstaltete es. Dazwischen huschte und raschelte es. In der nächtlichen Natur fand ein gnadenloses Jagen und Morden statt. Nur die Angst vor der Blamage hinderte die Posten daran, wahllos in diese trappelnde, surrende und quietschende Umwelt zu schießen, in deren Schutz die Späher des Feindes heranschleichen konnten, ohne gehört zu werden.
Die Offiziere verwerteten in einem Turmzimmer die Informationen, die ihnen ein Nachrichtenagent aus Saigon unterbreitete. Der Spezialist vom Zweiten Büro war ein Halbchinese mit einem lauernden Vogelgesicht. Er hatte maßgeblich an den Folterungen teilgenommen. Die Franzosen hatten die meisten Illusionen verloren, mit denen sie ursprünglich nach Indochina zurückgekehrt waren. Damals waren die Sonderbeauftragten de Gaulles – teilweise schon vor der japanischen Kapitulation – über den Aufstandszonen der Eingeborenen mit Fallschirmen abgesprungen, weil man in Paris glaubte, die antijapanischen Guerilleros würden sie als Freunde und Befreier begrüßen. Die meisten dieser Wagemutigen waren sehr schnell unter schrecklichen Qualen umgebracht worden. Die Überlebenden – so der spätere Premierminister Pierre Messmer – mußten froh sein, wenn die roten Partisanen sie in Bambuskäfige sperrten, wo sie der Bespeiung der Bevölkerung ausgesetzt und mit faulen Eiern beworfen wurden.
Der Mann vom Zweiten Büro wies auf eine Veränderung in der politischen Lage im Raum Tay Ninh hin. Ursprünglich hatte das Expeditionskorps den Hauptfeind in Indochina bei jenen Sekten und Gruppen gesucht, die mit den Japanern paktiert und sich die Unabhängigkeit von Tennos Gnaden erhofft hatten. Das war in den Provinzen rings um Tay Ninh vor allem die Mischreligion des Cao Dai mit anderthalb Millionen Menschen. Im eigentlichen Mekong-Delta, am Rande der Schilfebene, war es die kriegerische Buddhistenbewegung der Hoa Hao, die rund 600 000 Gefolgsleute zählte. Doch neuerdings sahen sich diese wirren religiösen Eiferer, die über kampftaugliche Milizen verfügten, ihrerseits durch das Hochkommen der roten Revolutionsfront des Vietminh bedroht. Sie reagierten mit instinktiver Feindseligkeit gegen die materialistische Ideologie der kommunistischen Kommissare, der »Can Bo«, die mit apostolischer Hingabe die Reisbauern aufwiegelten, und suchten bereits nach einem Auskommen mit der früheren Kolonialmacht unter der Voraussetzung, daß die Franzosen die Autonomie von Cao Dai und Hoa Hao respektieren würden. Von nun an war klar, daß die Sekten wertvolle Verbündete sein könnten, denn sie allein schienen über die unentbehrliche geistige Motivierung zu verfügen, um der ideologischen Sturmwelle des Kommunismus standzuhalten.
Der antikommunistische Flügel des vietnamesischen Nationalismus hatte noch das klägliche Schauspiel des Kaisers von Annam, Bao Dai, zu deutsch »Bewahrer der Größe«, vor Augen, der im April 1945 von den Japanern zum Staatsoberhaupt eines unabhängigen vietnamesischen Reiches proklamiert worden war und sich dabei auf die Nippon-freundliche Dai-Viet-Partei und die Mandarine von Hue stützte. Bao Dai, der 1925 als Zwölfjähriger Kaiser geworden war, hatte sich nur ein paar Wochen behaupten können gegenüber jenem ziegenbärtigen Partisanenführer aus dem nördlichen Tonking, der unter dem Namen Ho Chi Minh in Hanoi die »Demokratische Republik Vietnam« ausgerufen hatte. Ho Chi Minh war für die französischen Nachrichtendienste kein Unbekannter. Als junger Photolaborant war er nach Frankreich gekommen und bereits 1920 bei der Gründung der Kommunistischen Partei Frankreichs in Tours als fernöstlicher Genosse zugegen gewesen. Später war er durch die Schule der Komintern gegangen, ehe er im Zweiten Weltkrieg von der südchinesischen Grenze aus mit einem Häuflein Getreuer den Kampf gegen die Japaner aufnahm. Zu jener Zeit genoß Ho Chi Minh paradoxerweise die Unterstützung des amerikanischen Geheimdienstes OSS, der in der chinesischen Provinzstadt Kunming basiert war und den Vietminh, die nationale Sammelbewegung der vietnamesischen Kommunisten, mit Waffen und Geld unterstützte.
Der »Pascha« hoffte in jenen Tagen noch, daß sein Commando zu großen Taten berufen sein könnte. In der südlichen Hälfte Indochinas hatte das französische Expeditionskorps in einem Feldzug von Englands Gnaden wieder Fuß fassen können. Aber nördlich des 16. Breitengrades, so war im Potsdamer Abkommen verfügt worden – in Tonking, in Annam und in Nordlaos –, waren die chinesischen Soldaten Tschiang Kai-scheks, die Divisionen des Kuomintang, mit der Entwaffnung der Japaner beauftragt worden. Sie hatten sich als neue Besatzungsmacht etabliert und dachten offenbar gar nicht daran, diese unerhoffte Eroberung an die ehemaligen französischen Kolonialherren zurückzugeben. Wenn es nach Roosevelt gegangen wäre, der ein dezidierter und romantischer Antikolonialist war, hätte kein französischer Soldat mehr nach Indochina zurückgedurft. Aber Roosevelt war tot, als der Tenno kapitulierte, und die Briten sahen es wohl ganz gern, daß Franzosen und Holländer sich in ihren ehemaligen Besitzungen, die die Japaner in Aufruhr und Chaos hinterlassen hatten, festkrallten. Vielleicht sollten sie dort den Ansturm des asiatischen Nationalismus auf eine Pufferzone in Indochina und Indonesien ablenken, in deren Schutz Großbritannien – in den Augen der Franzosen immer noch das »perfide Albion« – seine weitsichtige und liberale Commonwealth-Politik auf dem indischen Subkontinent einleiten würde.
In jener Nacht von Tay Ninh waren sich die französischen Para-Offiziere bereits im klaren, daß das Schicksal Vietnams nicht im Schlamm des Mekong-Deltas und im südlichen Cochinchina entschieden würde, sondern in jenem rauhen und feindseligen Norden – damals noch Tonking genannt – , wo die Soldaten der Nationalarmee Tschiang Kai-scheks und die Kommunisten Ho Chi Minhs sich in feindseliger und mißtrauischer Koexistenz gegenüberstanden. Dem »Pascha« war eine geheime Mitteilung des General Leclerc, des französischen Oberbefehlshabers, zugekommen, der zufolge sich das Commando auf die Möglichkeit eines Fallschirmabsprungs über Hanoi vorzubereiten habe. Das Unternehmen würde allerdings erst in die operative Phase treten, wenn eine ausreichende französische Landungsflotte am Cap Saint-Jacques zusammengestellt und zum Auslaufen nach Tonking bereit wäre. Die Offiziere nahmen die Ankündigung des Einsatzes mit gemischten Gefühlen auf. Bei den letzten Übungssprüngen über dem Feldflugplatz Bien Hoa hatte sich herausgestellt, daß die Fallschirme unter dem Klima und der unzureichenden Wartung gelitten hatten. Es war zu schweren Unfällen gekommen, denn zusätzliche Bauchfallschirme gab es nicht. Im übrigen schien man in Paris den fanatischen Kampfgeist der Vietnamesen sowie das Massenaufgebot der Chinesen erheblich zu unterschätzen.
Am frühen Morgen war ein unerwarteter Regenguß niedergegangen. Die Feuchtigkeit war von der Sonne schon aufgesogen, als ich auf das Heiligtum der Cao Daisten, ein riesiges gelbes Gebäude im Stil einer französischen Kathedrale, zuging. Der Dschungel auf den steilen Hängen der »Schwarzen Jungfrau« glänzte zu dieser Stunde in sattem Grün. Die Normalisierung war wohl schon weiter gediehen, als wir ursprünglich angenommen hatten, denn die Kathedrale war beim morgendlichen Gottesdienst mehr als zur Hälfte gefüllt. Der Papst der Cao-Dai-Sekte war nach Thailand geflüchtet, doch der größte Teil seines Klerus – es gehörten ein Kardinalskollegium und mehrere Bischöfe dazu – war an Ort und Stelle geblieben, wurde von den Franzosen nicht behelligt und ging in dem gewaltigen, halligen Kirchenschiff seinen seltsamen Riten nach. Dort wo sich in einem katholischen Gotteshaus der Hochaltar befunden hätte, blickte aus einem strahlenumgebenen Dreieck ein riesiges Auge auf die Gemeinde. Die Geistlichen waren je nach Rang in blaue, rote und gelbe Seidengewänder gehüllt, die in einer spitzen Ku-Klux-Klan-Kapuze endeten. Die gewöhnlichen Gläubigen kleideten sich in Weiß. Das Gebetsgemurmel erinnerte an das Rezitieren christlicher Litaneien und buddhistischer Sutren. Immer wieder verbeugte sich die Gemeinde, und die Gongs dröhnten ohne Unterlaß. Weihrauchschwaden stiegen zu dem mystischen Auge auf. Diese kuriose Mischreligion des Cao Dai war nicht älter als das 20. Jahrhundert. Zu ihren Heiligen die besondere Verehrung genossen, zählten Buddha, Konfuzius, Jesus Christus und … der französische Dichter Victor Hugo. Am Eingang der Kathedrale waren diese Propheten des Cao Dai in naiven bunten Stuck-Skulpturen abgebildet. Die französischen Besucher belustigten sich vor allem über die Darstellung Victor Hugos, der offenbar wegen seiner humanistischen Botschaft als Autor der »Miserables« in dieses Pantheon aufgenommen worden war. Victor Hugo blickte in der grünen Gala-Uniform eines Mitgliedes der Académie Française auf den Palmenhain vor dem Gotteshaus. Mich berührte der Umstand, daß der bärtige Kopf unter dem Dreispitz des Académicien dem überlieferten Porträt des Karl Marx in frappierender Weise ähnelte. Im Grunde bestand hier kein Anlaß zum Spott. Religionsgründungen sind wohl stets mit Seltsamkeiten verbunden. Der Cao Dai würde mit Sicherheit kein dauerhaftes Phänomen sein. Aber in seiner fanatischen Hingabe, seiner Suche nach fremden Modellen, seinem nationalen Engagement war er in mancher Beziehung mit jener ideologisch verbissenen Untergrundreligion der vietnamesischen Kommunisten verwandt, die in Hanoi einen Teil der Macht bereits an sich gerissen hatte und deren Jünger im Mekong-Delta immer zahlreicher wurden.
Die Franzosen glaubten, ihre Annamiten zu kennen. In Cochinchina war eine ganze eingeborene Bourgeoisie entstanden, die französische Sprache und Lebensart angenommen, ja sogar die französische Staatsangehörigkeit erworben hatte, Ärzte, Anwälte, Plantagenbesitzer. Doch unterhalb dieser Elite lebte ein Volk, das allenfalls den Ethnologen der Ecole d’Extréme-Orient und manchen Missionaren vertraut war. Diese Nhaques, diese Reisbauern, wie sie verächtlich genannt wurden, waren im Ersten Weltkrieg wegen ihrer angeblichen militärischen Untauglichkeit nur als Train-Soldaten verwendet worden. Die sogenannten Indochina-Experten, die old hands, wie diese unbelehrbaren Dummköpfe des Kolonialismus mit einem respektablen angelsächsischen Wort bezeichnet wurden, hatten den ankommenden Soldaten des Expeditionskorps erzählt, daß die Annamiten niemals in der Dunkelheit kämpften, aus Angst vor den Geistern, den »Ba Cui« und den Tigern. Sehr bald stellte sich heraus, daß in Vietnam die härteste Kriegerrasse Asiens lebte und daß die Nacht ihr eigentliches Element war.
Unter der sektiererischen Skurrilität verbarg sich oft ein todernster politischer Kern. So sollten wir später an einem Arm des Mekong der absonderlichen Gemeinde des »Heiligen von der Kokospalme« begegnen. Einem buckligen annamitischen Geschäftsmann war plötzlich die göttliche Eingebung gekommen, eine neue Religion zu gründen. Er pflegte auf einer Kokospalme zu meditieren. Der Bucklige hatte sehr schnell eine Gemeinde um sich gesammelt, die sich seltsamen Kulthandlungen unterzog, asketische Regeln befolgte und sich in braune Kutten kleidete. Ihrem Propheten zuliebe, der auf Grund seiner Körperbehinderung nicht auf dem Rücken schlafen konnte, ruhten seine Jünger stets auf der Flanke. Ihr zentrales Heiligtum befand sich auf dieser Pfahlsiedlung im Strom, aber die verschnörkelten Kirchen der braunen Mönche reichten bald bis in die Vororte von Saigon.
Mir war ein riesiger Globus aufgefallen, den sie auf einer breiten Plattform mitten im Fluß aufgestellt hatten. Auf dieser Erdkugel war das heutige Vietnam in überdimensionaler Verzerrung dargestellt und reichte am Rande des Pazifischen Ozeans von Kamtschatka bis Australien. Was diese Darstellung ihrer Heimat denn bedeute, hatte ich einen frommen Greis gefragt, der mit seinen sieben Barthaaren einem taoistischen Heiligen glich. Der Mönch hatte in erstaunlich reinem Französisch geantwortet: »Wenn Vietnam einmal wiedervereinigt und frei ist – Cochinchina, Annam, Tonking in einem Staat – , dann werden wir so groß und mächtig sein, wie dieser Globus es dartut.« Daß die religiöse Gärung in diesem zerrissenen Land das Aufkommen einer neuen Epoche, eines neuen vietnamesischen Menschen ankündigte, das hatte kein französischer Administrator oder Kolonialoffizier rechtzeitig begriffen. Aber welcher römische Prokonsul oder Zenturio in der syrischen Provinz hatte wohl um die Zeitwende geahnt, daß die mystischen Vorgänge im Volk der Juden das Ende seines Imperiums und eine totale Bewußtseinsveränderung der antiken Welt einleiten würden.
Bevor das Commando seine ständige Unterkunft in einem weitläufigen chinesischen Sippenhaus am Boulevard Galieni auf halbem Weg nach Cholon erreichte, wurde der Konvoi durch einen ungewöhnlichen Auflauf blockiert. In Dreierreihen, aber ohne Waffen, marschierte ein langer Zug Soldaten aller Waffengattungen – Offiziere an der Spitze – durch die Straßen der Saigoner Innenstadt. Wir fragten die Zuschauer, was sich hier abspiele. Ein Grüppchen französischer Kriegsgegner und linker Antikolonialisten, so hieß es, hätte ein Pamphlet verteilt, das den Abzug Frankreichs aus Indochina forderte und dem Expeditionskorps vorwarf, es habe statt honneur et patrie Ehre und Vaterland, honneur et profit auf seine Fahnen geschrieben. Die kleine Druckerei dieser »Defaitisten-Gruppe« war von den militärischen Demonstranten bereits zertrümmert worden. Jetzt hallten die Sprechchöre durch die Rue Catinat: »De Gaulle au pouvoir« – De Gaulle an die Macht! General de Gaulle war im Januar 1946 von seinem Amt als Chef der provisorischen Regierung Frankreichs überraschend zurückgetreten. Er hatte damit gegen das Wiederaufkommen des Parteienhaders, gegen den inneren Zerfall Frankreichs protestieren wollen und sich zornig in sein Landhaus von Colombey-les-Deux-Eglises zurückgezogen. Die Armee von Indochina, in der das gaullistische Element stark war, sah sich plötzlich verwaist, zumal die Parteien der französischen Linken gegen den Feldzug in Fernost zu agitieren begannen. Nicht nur die Sympathien der französischen Kommunisten waren eindeutig auf seiten der vietnamesischen Nationalisten. »De Gaulle an die Macht!« tönte es noch ein paarmal. Dann gelang es einer Streife der Militärpolizei, die Manifestanten mühelos in ihre Kasernen zurückzuschicken. Es sollte zwölf Jahre dauern, ehe der gleiche Ruf – auf dem Forum von Algier von einer gewaltigen Menschenmenge aufgegriffen – den Sturz der Vierten Republik einleitete.
Onkel Hos Pakt mit dem französischen General
Haiphong, im Frühjahr 1946
Die Bucht von Halong bot ein gespenstisches Bild. Aus dem dunkelgrünen, regungslosen Meer tauchte ein Heer von bizarren Kalkfelsen auf, sobald die Nebeldecke sich ein wenig lüftete. Ein dünner, kalter Regen, crachin genannt, ging unaufhaltsam nieder. Die Soldaten der französischen Landungsflotte standen fröstelnd an der Reling und sehnten sich schon nach der Hitze Saigons. Aus dem Dunst tauchten immer mehr Dschunken auf. In den primitiven Wohnkajüten der flachen Boote hausten ganze Sippen. Mit ihren dunkelbraunen Segeln huschten die Dschunken wie Fledermäuse über das Wasser. Die vietnamesischen Bootsleute suchten den Kontakt mit der fremden Invasionsarmee. Sie waren in Fetzen gekleidet und boten ein paar Fische und Krabben zum Verkauf an. Sie mußten unter schrecklichem Mangel leiden, denn sie stürzten sich auf die Speisereste, die aus den Luken fielen, fischten sogar die leeren Konservenbüchsen auf und sammelten sie wie Kostbarkeiten. Auf den ersten Blick waren diese Fischer aus Halong ein recht freundliches Völkchen. Sie schnatterten ohne Unterlaß. Als die Soldaten mit den Mädchen schäkern wollten und diese zurücklächelten, stellten die Franzosen mit Entsetzen fest, daß ihre Zähne schwarz lackiert waren.
Drei Tage lang lag nun schon die Flotte vor der nordvietnamesischen Hafenstadt Haiphong. General Leclerc war an Land gegangen, um mit den nationalchinesischen Kommandeuren zu verhandeln. Im Prinzip hatte die Regierung Tschiang Kai-scheks schon Ende Februar der Ablösung ihrer Truppen nördlich des 16. Breitengrads durch die Franzosen zugestimmt. Aber die Autorität des Generalissimo über seine War-Lords der Provinz Jünnan, die mit ihren plündernden Haufen in Tonking eingefallen waren, schien begrenzt zu sein. Die nationalchinesische Soldateska war wie eine Heuschreckenplage über Nordvietnam hereingebrochen. Sie hatte geplündert, vergewaltigt und sich wie in einem eroberten Land aufgeführt. Der Abzug kam ihr höchst ungelegen.
Am vierten Tag hallte Artilleriefeuer durch die phantastische Felsenlandschaft der Halong-Bucht. Dem französischen Oberkommandierenden war die Geduld gerissen. Ein Sturmkommando war an der Küste gelandet, und der Kreuzer »Le Triomphant« war die Mündung des Roten Flusses in Richtung auf die Hafenkais von Haiphong hochgesteuert. Der Kreuzer wurde von Küstenbatterien beschossen, aber mit ein paar Salven brachte er den Widerstand zum Schweigen. Über den chinesischen Stellungen ging die weiße Fahne hoch, und die landenden Franzosen stellten zu ihrer Verwunderung fest, daß die feindlichen Geschütze, mit denen die Soldaten aus Jünan nichts anfangen konnten, von japanischen Kriegsgefangenen bedient worden waren.
Ich wurde nicht müde, die nationalchinesischen Soldaten zu beobachten. An den Vietnamesen gemessen, waren sie relativ hochgewachsen. Sie trugen eine himmelblaue Uniform mit dicken Wickelgamaschen. Beim Marsch warfen sie ihre Schuhe am liebsten über die Schulter und liefen barfuß. Im Gegensatz zu den Tonkinesen, die sich neugierig um die Neuankömmlinge drängten und sie ausfragten, stand zwischen Franzosen und Chinesen eine psychologische Scheidewand, die nie durchbrochen wurde. Die Söhne des Himmels verfügten zwar über fabrikneue Lastwagen von General Motors und führten jeden Morgen in den Parks von Haiphong unter furchterregendem Gebrüll Leibesübungen vor, aber sie wirkten wie ein mittelalterlicher Kriegshaufen. Die wohlhabenden chinesischen Kaufleute von Haiphong, die von ihren Landsleuten aus dem Norden nicht weniger ausgeplündert wurden als die einheimischen Vietnamesen, blickten mit Abscheu auf diese Horden und gaben ihrer konfuzianischen Geringschätzung für alles Soldatische freien Lauf.
Von einem ganz anderen Schlag waren die kriegsgefangenen Japaner. Die Disziplin dieser Armee war immer noch intakt, und die Offiziere liefen wichtigtuerisch zwischen ihren Untergebenen herum wie gestiefelte Kater. Die Japaner stauten sich später zu Tausenden an den Quais und kehrten nach der ersten Niederlage ihrer mehrtausendjährigen Geschichte an Bord amerikanischer Frachter ins Land der aufgehenden Sonne zurück.
Zum ersten Mal ahnten die französischen Administratoren und Ostasien-Experten, die nach Tonking zurückkehrten, daß sie einer völlig veränderten Welt und gewaltigen, unkontrollierbaren Kräften gegenüberstanden. Am schnellsten begriff General Leclerc de Hautecloque die neue Situation. Er war sehr zu Unrecht in einem Roman Hemingways als arroganter Junker skizziert worden. Leclerc hatte ab 1940 in Zentralafrika die ersten versprengten Trüppchen Freier Franzosen gesammelt und war mit ihnen im Lauf der drei folgenden Jahre quer durch die Wüste des Tschad und Libyens bis an die Gestade des Mittelmeers gezogen. Mit seiner Zweiten Panzerdivision war er im Sommer 1944 in der Normandie gelandet, und General Eisenhower war galant genug, diese französische Einheit als erste alliierte Truppe in Paris einrücken zu lassen. Leclerc hat ihm das schlecht gedankt, denn gegen den ausdrücklichen Befehl des Alliierten Oberbefehlshabers war er im Winter 1944/45 über die Vogesen in die Rheinebene nach Straßburg vorgestoßen und hatte dort, einem romantischen Eid gemäß, den er unter den Palmen der Oase Kufra geleistet hatte, die Tricolore auf dem Münster gehißt. Dieser schlanke eigenwillige Mann, der sich nie von seinem Spazierstock trennte, war in Nordvietnam auf einen ungleichen Komplizen gestoßen, auf den Revolutionär Ho Chi Minh.
Die wenigsten Franzosen, die sich damals in Indochina befanden, haben den tieferen Sinn der geheimen Kontakte zwischen Leclerc und »Onkel Ho«, wie er in jenen Tagen bei seinen Gefolgsleuten hieß, erfaßt, schon gar nicht jener Admiral Thierry d’Argenlieu, der im Auftrag de Gaulles, mit allen administrativen Vollmachten ausgestattet, als Hochkommissar Frankreichs nach Fernost gekommen war. D’Argenlieu, ebenfalls ein Gaullist der ersten Stunde, war vor dem Krieg Abt eines Karmeliter-Klosters gewesen. In Indochina führte er sich wie ein verspäteter Kreuzritter auf, sperrte sich gegen jeden Kompromiß mit den Feinden Frankreichs und wurde in der Pariser Linkspresse als »blutiger Mönch« bezeichnet.
Der Nationalist Ho Chi Minh hatte instinktiv begriffen, daß ein Verbleiben der Chinesen in Tonking für die Unabhängigkeit Vietnams weit verhängnisvoller sein würde als ein vorübergehendes Paktieren mit den Franzosen. Schließlich hatte die französische Kolonialherrschaft nur knapp hundert Jahre gedauert, aber seit zwei Jahrtausenden wehrte sich das vietnamesische Volk gegen die Vasallisierung und die totale Assimilation durch das Reich der Mitte. Hinzu traten aktuelle politische Überlegungen. Die Kuomintang-Chinesen, die eine marxistische Regierung unter Führung der Nationalen Sammlungsfront Vietminh vorgefunden hatten, mißtrauten dem Volkstribun Ho Chi Minh, der im gleichen ideologischen Lager stand wie ihr Todfeind Mao Tse-tung. Auch in Indochina hatte es bürgerliche Nationalisten gegeben, auf das chinesische Beispiel Tschiang Kai-scheks ausgerichtet. Sie hatten bereits 1931 einen Aufstand gegen die Franzosen ausgelöst, der von den Kolonialbehörden im Blut erstickt worden war. Zu jener Zeit hatte die Kommunistische Partei Indochinas es ebenfalls mit Hilfe französischer Marxisten zu ein paar Zellenbildungen gebracht. Die Stunde Hos schlug erst, als die Wechselfälle des Zweiten Weltkriegs seinen überlegen organisierten Partisanentrupps die große Chance zuspielten. Im Troß des Kuomintang waren die bürgerlichen Nationalisten der Bewegung »Viet Nam Quoc Dan Dang« oder VNQDD nach Hanoi zurückgekehrt, und die Chinesen hatten Ho Chi Minh gezwungen, diese Klassenfeinde, die er zutiefst haßte, in seine Regierung aufzunehmen. Zwischen Vietminh und VNQDD kam es im Winter 1945/46 zu immer heftigeren Auseinandersetzungen, so daß für Ho Chi Minh die baldige Ablösung der Chinesen durch die Franzosen zu einer Frage des Überlebens wurde.
General Leclerc seinerseits sah in dem Marxisten Ho Chi Minh einen potentiellen Verbündeten. Das französische Kolonialreich gehörte seit der Niederlage von 1940 ohnehin der Vergangenheit an und sollte durch neue, liberale Verflechtungen zwischen dem Mutterland und seinen Überseegebieten abgelöst werden. Ho Chi Minh hatte den Verbleib der Republik Vietnam in einem gemeinsamen Staatenverbund mit Frankreich vorgeschlagen. Wesentliche vietnamesische Souveränitätsrechte auf dem Gebiet der Diplomatie, der Verteidigung und der Währungspolitik wollte er bis auf weiteres an Paris delegieren. Eine seltsame Absprache kam damals zustande: die Landung der Franzosen nördlich des 16. Breitengrades rettete die Kommunisten Tonkings vor der Umklammerung durch die verbündeten Kräfte des Kuomintang und des VNQDD; innenpolitisch würde die Vierte Französische Republik, die eben durch Referendum bestätigt worden war, den Vietminh in Nordvietnam freie Hand lassen. Die Franzosen handelten sich dafür den Abzug der Soldaten Tschiang Kai-scheks und den Verbleib Indochinas in jenem französischen Übersee-Verbund ein, der im neuen Verfassungstext den Namen Union Française trug.
Beide Parteien ahnten wohl, daß sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatten. In der französischen Armee bestand kein echter Wille zur Entkolonisation, und den meisten konservativen Offizieren waren diese roten Vietminh-Kommissare ein Greuel. Nachdem die beutebeladenen Chinesen schließlich über die Grenze nach Kwang Si und Jünan in das Reich der Mitte zurückmarschiert waren, räumten die Revolutionskomitees des Vietminh zunächst einmal unter ihren bürgerlichen Rivalen auf und massakrierten die führenden Mitglieder des VNQDD im Städtchen Yen Bai. Die Franzosen sahen tatenlos zu, wie diese antikommunistischen Gegenkräfte, die ihnen in den späteren Jahren so bitter fehlen würden, liquidiert wurden. Insgeheim brannten die Obersten des Expeditionskorps darauf, nach Abzug der lästigen Chinesen und dem Gemetzel von Yen Bai sobald wie möglich auch die Vietminh an der Gurgel zu packen und die pax franca mit Waffengewalt in Fernost wiederherzustellen.
Die Vietnamesen ihrerseits machten aus ihren tatsächlichen Absichten kein Hehl. Auf jede Mauer, auf den Asphalt jeder Straße war das magische Wort »Doc Lap« in riesigen Lettern mit roter Farbe gepinselt. »Doc Lap« hieß »Unabhängigkeit«, und nur ein Narr konnte davon ausgehen, daß diese fanatischen Nationalisten marxistischen Glaubens auf die volle Souveränität endgültig verzichten, daß sie jemals eine wie auch immer geartete Unterordnung unter Paris akzeptieren würden. Andere Wandaufschriften forderten mit gleicher Eindringlichkeit die Einheit der »Drei Ky«, der drei Landesteile Vietnams: Cochinchina, Annam und Tonking. Die Revolutionäre des Vietminh hatten erfahren, daß die maßgeblichen französischen Finanzkreise im Umkreis der Banque de l’Indochine notfalls bereit waren, das übervölkerte Delta des Roten Flusses mit den darbenden Massen des Nordens seinem Schicksal zu überlassen sowie die unwirtlichen Gebirge Zentralannams abzuschreiben. Sie wußten aber auch, daß diese Einflußgruppen auf ihren Besitz in Cochinchina, auf die Reisebene am Mekong, die einträglichen Gummiplantagen des Südens, nicht verzichten und aus diesem Landesteil eine separate Republik von Frankreichs Gnaden machen wollten.
Haiphong bot in jenen Wochen ein seltsames Bild. Neben der Tricolore wehte die nunmehr offizialisierte rote Fahne des Vietminh mit dem gelben Stern. Die junge Republik Vietnam verfügte über eine eigene Armee, die in rostbraune Uniformen gekleidet war. Die Soldaten trugen dazu grüne Tropenhelme. Ihre Waffen stammten meist aus japanischen Arsenalen. Gemeinsam mit französischen Kolonialinfanteristen wurden diese kleinen Männer des Onkel Ho zu gemischten Patrouillen ausgeschickt. In Wirklichkeit standen sich diese Zufallspartner wie Hund und Katze gegenüber. Die französischen Stäbe betrachteten es als eine Demütigung, daß sie von gleich zu gleich mit diesen Heckenschützen verhandeln mußten, deren militärischer Anführer, ein gewisser Vo Nguyen Giap, seine strategischen Kenntnisse als Geschichtslehrer erworben hatte. Die Tatsache, daß Giap ein Bewunderer des Feldherrn Bonaparte war, brachte ihm nur mitleidiges Lächeln ein.
Die kalte Regenzeit war abrupt zu Ende gegangen. Innerhalb einer Woche verwandelte sich Tonking in einen Glutofen. Die zerklüfteten Vorgebirge waren jetzt zum Greifen nahe. Jedermann spürte, daß Nordvietnam ein beschwerlicher Kriegsschauplatz sein würde. Haiphong war – mit Ausnahme von zwei Plätzen, die einem französischen Provinzstädtchen Ehre gemacht hätten – eine unansehnliche Ortschaft. Doch in diesem Frühlingsmonat erblühten die Flamboyants und Jacarandas in feuerroter und violetter Pracht.
Ich war damals neben einem Kanal untergebracht, in einer ziemlich trostlosen Gegend, wo die häßlichen Außenbezirke von Haiphong in die monotone Weite der Reisfelder übergingen. Jede Nacht klangen aus den nahen Dörfern revolutionäre Kampflieder. Mit dem Fernglas beobachteten wir das Exerzieren der Vietminh-Miliz, die in Ermangelung von Gewehren oft mit Bambusstöcken hantierte. Als eines Morgens im Kanal die verstümmelten Leichen von drei französischen Pionieren dem Meer zutrieben, wußten wir, daß die Tage des trügerischen Stillhaltens, des Modus vivendi, gezählt waren. Eine Woche später wurde ich wieder nach Saigon abgeordnet und schiffte mich in der Halong-Bay auf dem Kreuzer »Tourville« ein. In der roten Abendsonne bot sich mir ein Schauspiel von atemberaubender Herrlichkeit. Aus den stillen Fluten der Bucht, die im späten Licht wie pures Gold glänzte, erhoben sich die schwarzen Kalkfelsen wie barbarische Grabsteine. Die Dschunken zogen weite Kurven und bewegten sich vor dem untergehenden Gestirn wie Insekten, die um eine Flamme kreisen.
Das neue Gesicht des Krieges
Saigon, Anfang 1951
Vier Jahre später saß ich im Flugzeug Paris – Saigon, in einer DC4-Maschine, die drei Tage und zwei Übernachtungen in Kairo und Karatschi brauchte, um am Ziel zu sein. Die meisten Passagiere waren kräftige Männer im wehrfähigen Alter. Sie trugen militärischen Borstenhaarschnitt, waren aber alle in Zivil, denn die indischen Behörden, die widerwillig genug die Zwischenlandung dieser Air France-Maschine in Kalkutta duldeten, wollten keine französischen Uniformen sehen. Die Pariser Presse hatte die Hiobsbotschaft aus Fernost in großen Schlagzeilen gebracht. Zuerst waren die Verteidigungspläne für das Delta des Roten Flusses durch Verrat in die Hände des Gegners gefallen. Dann hatte der damalige französische Generalstabschef, der den ominösen Namen »Revers«, das heißt Rückschlag oder Niederlage, trug, die verspätete Räumung jener Grenzgarnisonen beschlossen, die Tonking gegen die chinesischen Nachbarprovinzen abschirmen sollten.
Diese Außenposten befanden sich in tödlicher Gefahr seit die siegreichen Armeen Mao Tse-tungs bis in die Südregion von Kwangsi und Jünan vorgedrungen waren. Die Volksrepublik China hatte offen für Ho Chi Minh Partei ergriffen, lieferte Material an die roten Verbündeten und bildete in Nanning die vietnamesische Revolutionsarmee nach den bewährten Methoden des Volksbefreiungskrieges aus. Auf dem Rückzug aus dem Grenzstädtchen Cao Bang war eine französische Kolonne von dreitausend Mann auf den Haarnadelkurven der gebirgigen Dschungelpiste in einen Hinterhalt geraten und praktisch aufgerieben worden. Die Garnison von Lang Son rettete sich nur durch überstürzte Flucht unter Zurücklassung des gesamten Materials. Mit dem Sieg der maoistischen Revolution waren die französischen Sperrriegel in Nordindochina unhaltbar geworden. Die Pariser Gazetten bereiteten die französische Öffentlichkeit, die sich ohnehin vom Fernost-Feldzug distanzierte, wenn sie ihn nicht wütend bekämpfte, auf die entscheidende Niederlage des Expeditionskorps im Dreieck des Roten Flusses vor. Der schmutzige Krieg – la sale guerre, hieß der Indochina-Krieg in den Pamphleten der KPF, und in Marseille, wo die Docker häufig die nach Saigon auslaufenden Schiffe bestreikten, gingen die Verstärkungen im Schutz der Dunkelheit an Bord. Sogar die Särge der Gefallenen wurden heimlich ausgeladen.
Ich war dieses Mal als Journalist nach Saigon gekommen. Ich brauchte nicht lange zu suchen, um den »Pascha« zu finden. Er saß schwitzend in einem Appartement der Rue Catinat und bastelte so liebevoll an einem komplizierten Sendegerät, als sei es eine Höllenmaschine. Es war ihm nicht anzumerken, daß er inzwischen die ersten zwei Admiralssterne erhalten hatte. Der »Pascha« war dabei, ein neues Commando