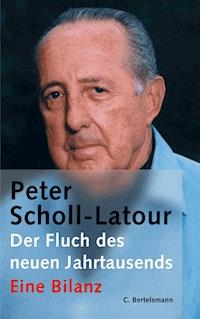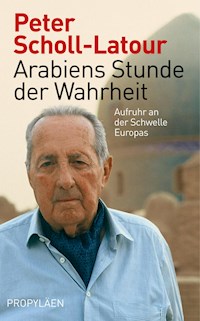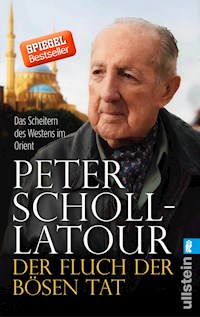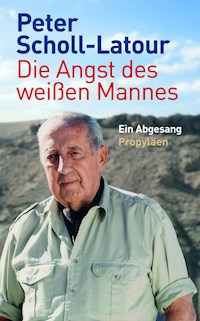
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Wahl eines amerikanischen Präsidenten mit afrikanischen Wurzeln und pazifischer Heimat ist Sinnbild eines tiefgreifenden Wandels, der weit über die USA hinausweist. Der fünfhundertjährige Siegeszug des »weißen Mannes« ist Geschichte. Die ehemals koloniale Welt ist im Aufbruch begriffen - demographisch, wirtschaftlich, politisch. Dabei wendet sie sich vom Westen ab, sucht neue Leitbilder, besinnt sich auf eigene Stärken und Traditionen. Die Maßstäbe der Welt werden zurecht gerückt, die Verlierer von einst sind die Gewinner von morgen. Mit dem ihm eigenen Gespür für welthistorische Veränderungen schildert Peter Scholl-Latour seine jüngsten Eindrücke aus Südostasien und Lateinamerika, den beiden dynamischsten Regionen des neuen Zeitalters. Eindrucksvoll gelingt es ihm, die aktuellen Konflikte und Umbrüche dieser Länder vor dem Hintergrund ihrer kolonialen Vergangenheit zu beleuchten. Mit profundem Wissen spürt er dem verblassenden Erbe der holländischen, portugiesischen oder spanischen Kolonisten nach, das zunehmend überlagert wird vom erwachenden Selbstbewusstsein der einstigen Kolonialvölker und vom wachsenden Einfluss der neuen Weltmacht China. Wer verstehen will, wie sich die Welt heute verändert, der findet hier dank der sechzigjährigen Erfahrung Peter Scholl-Latours als Chronist des Weltgeschehens und seiner beispiellosen Kenntnis der Länder dieser Erde verlässliche Auskunft. Entdecken Sie auch das Hörbuch zu diesem Titel!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
INHALT
Präludium
Wachablösung
7
Canto primeiro: Ost-Timor
Portugals letzter Gesang
17
Canto segundo: Bali
Im Vorfeld des Fünften Kontinents
88
Canto terceiro: Ozeanien
Das andere Ende der Welt
128
Canto quarto: Java
Indonesische Schattenspiele
205
Canto quinto: Philippinen
Die Inseln des Magellan
245
Canto sexto: China
»Zittere und gehorche!«
281
Canto sétimo: Kasachstan
Die Macht der Steppe
337
Canto oitavo: Kirgistan
Die Enttäuschung der »Tulpen-Revolution«
393
Epilog
Der Nachlaß
431
Personenregister
451
Bildnachweis
458
Canto primeiro
OST-TIMOR
Portugals letzter Gesang
»Nehmt Rat von jenen, die Erfahrung bieten,
Die lange Jahre, Monate durchschritten.
Hält der Gelehrte sich auch in Bewahrung,
Vermittelt doch viel Wissen die Erfahrung.«
Aus den »Lusiaden« (Canto decimo) von Luís Vaz de Camões
Ein Trümmerfeld wird unabhängig
Dili, im März 2008
Vor zwei Stunden ist die kleine brasilianische Maschine vom Typ Embraer im nordaustralischen Hafen Darwin gestartet. Die östliche Sunda-Insel Timor, die unter der Tragfläche auftaucht, ist von tiefen Klüften durchzogen, von tropischem Dickicht überwuchert. Ein vorzügliches Partisanengelände. Die martialische Beurteilung entspricht nicht etwa der Zwangsvorstellung, der »déformation professionnelle« eines gealterten Kriegskorrespondenten. Diese winzige Republik Timor-Leste, eine Inselhälfte von den Ausmaßen Schleswig-Holsteins mit knapp einer Million Einwohnern, die erst am 20. Mai 2002 als 191. Mitglied der Vereinten Nationen anerkannt wurde, ist in den vergangenen Jahrzehnten von einer ganzen Serie grauenhafter Konflikte heimgesucht worden. Schätzungsweise ein Viertel der Bevölkerung ist dabei ums Leben gekommen.
An Warnungen hatte es nicht gefehlt. In diesem fernen südostasiatischen Fetzen des verflossenen portugiesischen Kolonialreiches herrsche weiterhin Mord und Totschlag, hieß es in den offiziellen Mitteilungen. Tatsächlich steht die Hauptstadt Dili unter Ausnahmezustand. Blauhelme der UNO überwachen nächtens das Ausgangsverbot. Während das Flugzeug auf der kurzen Rollbahn zum Stehen kommt, fällt der Blick auf die grau getönten Kampfhubschrauber der australischen Streitkräfte, die unweit der schneeweißen Helikopter der Vereinten Nationen geparkt sind. Im bescheidenen Abfertigungsgebäude, das mitsamt einer komfortablen VIP-Lounge nach den Verwüstungen des Jahres 2006 in aller Eile wiederhergerichtet wurde, kommt jedoch kein Gefühl akuter Bedrohung auf.
Das liegt vor allem an der Gastlichkeit des deutschen Teams der »Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit«, die in Ermangelung einer permanenten diplomatischen Vertretung der Bundesrepublik in Dili die deutsche Interessenvertretung mit Effizienz und beruflichem Engagement wahrnimmt. Es ist nicht das erste Mal, daß ich in entlegenen Krisenzonen die Betreuung durch die GTZ schätze. Dabei stellte ich stets fest, daß diese Experten des Wiederaufbaus auf möglichst großen Abstand zu den im Land operierenden Streitkräften oder Okkupationstruppen bedacht sind. Das gilt sogar für die Bundeswehr in Afghanistan. Die GTZ zieht es vor, ohne kompromittierenden Waffenschutz zu arbeiten. In Ost-Timor kommt dem verantwortlichen Projektleiter, Günter Kohl, ein weiterer Vorteil zugute. Sämtliche Mitarbeiter haben sich in den ehemaligen portugiesischen Besitzungen Afrikas oder in Brasilien aufgehalten. Sie beherrschen die singende, leicht näselnde Sprache Lusitaniens, wie die iberische Provinz des Imperium Romanum unter Augustus genannt wurde. Das Portugiesische ist auf Timor-Leste neben der malayo-polynesischen Sprache Tetum als offizielle Amtssprache etabliert worden.
Während wir im klimatisierten Empfangssalon unser Erkundungsprogramm für die kommende Woche besprechen, bietet sich plötzlich ein überraschendes, irgendwie groteskes Schauspiel. Eine Ministerin der Regierung von Ost-Timor – die Kabinettsmitglieder sind zahlreich und wechseln ständig – ist mit einem Sonderjet eingetroffen und wallt im Vollgefühl ihrer Bedeutung an uns vorbei. Eine ganze Rotte von muskulösen Leibwächtern, das Schnellfeuergewehr im Anschlag, umringt die dunkelhäutige, europäisch gekleidete Frau, als lägen die Attentäter schon bereit.
Noch bevor die unerträgliche, schwüle Mittagshitze sich über die Bucht von Dili senkt, unternehmen wir eine erste Besichtigung. Dieser Verwaltungssitz war wohl niemals mit jenen prachtvollen urbanistischen Leistungen zu vergleichen, die die Portugiesen im angolanischen Luanda, im mosambikanischen Lourenço Marques hinterließen. Doch was wir jetzt entdecken, ist ein einziges Trümmerfeld, ein Ort totaler Verwüstung. Mit Ausnahme von ein paar ausländischen Botschaften und UN-Unterkünften, die – zu Festungen ausgebaut – unter dem Schutz australischer Fallschirmjäger stehen, sind sämtliche Behausungen und Amtsgebäude einem Orkan der Vernichtung anheimgefallen. Seit der letzten Woge des kollektiven Amoklaufs im Mai 2006, als sich der schwelende Banden-und Bürgerkrieg zu einem menschlich inszenierten »Tsunami« steigerte, ist es, so weit das Auge reicht, eine trostlose Ansammlung von Ruinen.
Die Menschen leben in armseligen Notverschlägen und können sich glücklich schätzen, wenn sie dort Schutz vor den Wassergüssen der Regenzeit finden. Noch erbärmlicher sind die Ansammlungen von Strohhütten am Stadtrand. Horden von Flüchtlingen haben hier Zuflucht gesucht, als das Töten, die Vergewaltigungen, die Plünderungen sich auch in den Dörfern des Landesinneren austobten.
Die Freunde von der GTZ haben eine Skizze zur Hand, einen Stadtplan, auf dem die UN-Security die unsicheren Viertel eingezeichnet hat. Da schieben sich die schraffierten »hot zones« und die mit roten Sternen markierten »hot spots« – Punkte akuter Gefährdung durch kriminelle Gangs und unkontrollierbare Rebellen – bis an das Diplomatenviertel und die katholische Kathedrale heran, die wie durch ein Wunder der Zerstörung entging. Unversehrt blieben ebenfalls die stattlich gemauerten Gräberreihen des Friedhofs. Dort war der entfesselte Mob davor zurückgeschreckt, die Rachegeister der Toten zu wecken. Immerhin wurde der alte portugiesische Gouverneurspalast, der mit massiven weißen Mauern und einem wuchtigen Säulenportal koloniale Größe vortäuschen sollte, als Unterkunft diverser Behörden wieder restauriert. In diesem Umfeld mutet es tröstlich an, daß die hohe, schneeweiße Statue der Jungfrau Maria, der Immaculata, unangetastet blieb.
Es bewegen sich wenig Menschen in den öden Straßen von Dili. Jede gewerbliche Tätigkeit scheint erloschen. Wir suchen den Marktplatz auf, eine endlose Ansammlung ärmlicher Stände, wo erschlaffte Händler vergeblich nach Kunden Ausschau halten. So verfault das Überangebot prächtiger Tropenfrüchte in der Sonne. Ich verweile vor der Anhäufung halbzerfetzter Textilien, Ausschuß jener mildtätigen Spenden aus Europa, die am hiesigen Bestimmungsort für ein paar Centavos verhökert werden, soweit sie nicht sogar den ausgepowerten Timoresen zu schäbig erscheinen.
In Reiseführern wird die handwerkliche Begabung der eingeborenen Frauen erwähnt, die auf ihren Webstühlen nach überlieferten Mustern buntgestreifte »Tais« – Schals oder Sarongs – herstellen. Ich kann an diesen Produkten keinen Gefallen finden und erfahre zu meiner Verwunderung, daß sie in der Vorstellung der Einheimischen über magische, heidnische Kräfte verfügen sollen. Der katholische Klerus der Kolonialherren hat angeblich noch vor fünfzig Jahren öffentliche Verbrennungen des suspekten Teufelszeugs angeordnet. Der Inquisitionsbegriff »Autodafé« stammt bekanntlich aus dem Portugiesischen.
Die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung gibt manches Rätsel auf. Die Typen sind extrem unterschiedlich. Durch Schönheit und Grazie zeichnen sich die meisten Timoresen nicht aus. Die Frauen, die uns mit freundlicher Trägheit begegnen, entbehren der betörenden Reize der polynesischen Südsee-Insulanerinnen, denen einst die Meuterer von der »Bounty« erlagen. So manches an diesem Sunda-Hafen von Dili erinnert an die morbide, faulige Atmosphäre, die Joseph Conrad in seinem Outcast of the Islands beschreibt. Doch den erotischen Zauber, dem der verkommene, traurige Held des Romans verfällt, würde man auf Timor vergeblich suchen. Dadurch erklärt sich vielleicht, daß diverse UNO-Besoldete und mehr noch die Freibeuter pseudo-humanitärer NGOs in der ersten Phase der Unabhängigkeit Prostituierte aus Bangkok und Manila einfliegen ließen.
Die Völkerkundler verweisen auf den geographischen Urzustand, als eine Landbrücke zwischen Südostasien und Australien den austronesischen Migrationen erlaubte, bis nach Tasmanien vorzudringen. Der melanesische Rasseneinschlag ist auf Timor vorherrschend und verweist bereits auf die Nachbarschaft der Papua-Stämme Neuguineas. Dazu kommen starke malaiische Einflüsse, obwohl die hinduistisch-buddhistische Hochkultur, die im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert an den Höfen von Java erblühte, die östlichen Sunda-Inseln Flores und Timor nicht erreichte.
Auch die rapide Islamisierung, der es die heutige Republik Indonesien verdankt, der zahlenstärkste Staat der Umma mit 220 Millionen Korangläubigen zu sein, hat diese abgelegenen Eilande nicht erfaßt. Nur eine kleine Anzahl arabischer Seefahrer war aus Jemen, aus der bizarren Welt der biblisch wirkenden Hochhäuser von Hadramaut, aufgebrochen, auf den Spuren des legendären Sindbad nach Südosten gesegelt und hatte sich bis nach Timor verirrt. Hingegen lebt hier eine starke chinesische Kolonie von Hakka aus der Provinz Kwantung. Sie wurden seinerzeit von europäischen Plantagenbesitzern als Kulis angeheuert und haben es in Dili wie im übrigen Insulinde binnen weniger Generationen zu Wohlstand und Einfluß gebracht.
Die Portugiesen ihrerseits, die fünfhundert Jahre lang die heutige Republik Timor-Leste dominierten, ließen sich auf diesem Außenposten in geringer Zahl nieder. Aber die lusitanischen Abenteurer, die von den rassebewußten calvinistischen Buren der südafrikanischen Kap-Kolonie als »Seekaffern« geschmäht wurden, vermischten sich intensiv und ohne Vorbehalt mit den Eingeborenen und hinterließen eine zahlreiche Nachkommenschaft. In Afrika hieß es: »Gott schuf den Weißen und den Schwarzen, den Mulatten schuf der Portugiese.« Auf Timor könnte man das Wort »Mulatte« durch »Mestiço« ersetzen.
Heute untersteht die junge Republik Timor-Leste dem De-facto-Protektorat der Vereinten Nationen und mehr noch dem hemdsärmeligen Zugriff Australiens. Auf den ersten Blick fällt die militärische Präsenz der »Aussies«, die auf dem Höhepunkt der Unabhängigkeitswirren mit 6000 Soldaten präsent waren und heute noch über 1500 Mann verfügen, nicht sonderlich auf. Nach den jüngsten dramatischen Ereignissen, die sich drei Wochen vor meiner Ankunft in Dili abspielten, patrouillieren ihre vorzüglich ausgebildeten Commandos nach Einbruch der Dunkelheit im Dschungel. Sie werden bei ihren Einsätzen von Hubschraubern mit Nachtsichtgeräten unterstützt. Bei Tage treten die übrigen Blauhelm-Kontingente recht zurückhaltend in Erscheinung. Diese Muskoten aus Pakistan, Bangladesch, Kenia und anderen Ländern der Dritten Welt, die von ihren Regierungen an die Weltorganisation verpachtet und von ihren Machthabern um den größeren Teil ihres relativ hohen Wehrsoldes betrogen werden, zeichnen sich – wie üblich – durch mangelnde Einsatzbereitschaft und durch Inkompetenz aus.
Die umfangreiche Aktion der UNO, die mit den verwirrenden Anagrammen UNMISET und UNTAET ausgestattet ist – letzteres steht für »Transitional Administration in East-Timor« –, unter steht der Autorität eines Hohen Beauftragten aus Bangladesch. Das wirkt nicht gerade ermutigend. Im westafrikanischen Sierra Leone, wo die Weltorganisation sich durch militärisches Versagen hervortat, ist das Wort »Bangladesch« bei den dortigen Eingeborenen zum Synonym für Chaos und Ratlosigkeit geworden.
Voraussichtlich wird der Einsatz der UNO in Timor-Leste mit einem ähnlichen Fiasko enden wie die massive Intervention im kongolesischen Hexenkessel der frühen sechziger Jahre oder – zwei Dekaden später – im »befreiten« Kambodscha, wo sie in Stärke von 30 000 Bewaffneten nur zusätzliches Unheil, zumal eine massive Verseuchung durch Aids bewirkte. Der Anblick eines bewaffneten Afrikaners in Dili, dessen dunkelblaue Uniform die Aufschrift »Uganda Police« trägt, könnte bittere Heiterkeit auslösen, genießt doch diese vom deutschen Bundespräsidenten gern besuchte und als Demokratie gepriesene ostafrikanische Republik Uganda unter ihrem Staatschef Museveni, die sich der Plünderung der Rohstoffe und des Massakers an Zivilisten in der benachbarten Kongo-Provinz Ituri schuldig machte, einen besonders finsteren Ruf. Daß zudem Filipinos berufen wurden, die timoresische Polizei auszubilden, mutet wie eine böse Farce an, gilt doch Manila als Schwerpunkt ostasiatischer Kriminalität und Korruption.
Die meisten Hilfsdienste, die unter der blauen Flagge operieren, sind in volle Deckung gegangen, als sie feststellten, daß Timor-Leste alles andere als eine Tropenidylle ist. Die UNO ist auch hier mit der üblichen Fahrzeug-Armada extrem teurer, mit allem Komfort ausgestatteter Landrover und Geländewagen zugegen. Die weißen Luxuskarossen – es wurden mehr als tausend gezählt – stehen ungenutzt auf streng bewachten Parkplätzen. Sollte wirklich ein UNO-Beauftragter die Kühnheit aufbringen, irgendein Projekt im Landesinnern persönlich zu inspizieren, läuft er Gefahr, daß seine Windschutzscheibe durch Steinwürfe wütender Einheimischer zerschmettert wird.
Die meisten NGOs, die wie die Heuschrecken über die neu gegründete Republik hergefallen waren, haben sehr schnell den Heimflug angetreten, als sie merkten, daß auf Timor gelegentlich scharf geschossen wird. Eine dubiose deutsche Hilfsorganisation hatte sich dadurch hervorgetan, daß sie die Schulkinder mit Coca-Cola und Chips beglückte. Man hüte sich vor Verallgemeinerungen. Mir ist sehr wohl bewußt, daß eine beachtliche Zahl von internationalen Hilfswerken vorbildliche und selbstlose Arbeit leistet. Man denke nur an Caritas, Brot für die Welt, Ärzte ohne Grenzen, die »Grünhelme« Rupert Neudecks, an die Malteser und manche andere mehr. Doch die Masse der »Non-Governmental Organizations« – im afghanischen Kabul sind sie in Hundertschaften präsent – steht allzu oft im Dienste undurchsichtiger Geschäfte, des exotischen Reiserummels, einer egoistischen Selbstbestätigung und mehr noch der humanitär getarnten Spionage.
Beim Anflug auf Timor war mir das knallrote Ziegeldach eines monumentalen Gebäudes aufgefallen, das aus der allgemeinen Tristesse herausragte. Aus der Nähe betrachtet, erweist sich dieser extravagante Palast als das Außenministerium der Republik Timor-Leste, das von Bautrupps der Volksrepublik China in Rekordzeit aus dem Boden gestampft wurde und das in keinem Verhältnis zu den diplomatischen Bedürfnissen dieses Zwergstaates steht. Schon sind in unmittelbarer Nachbarschaft die rastlosen Arbeiter aus dem Reich der Mitte damit beschäftigt, die Grundmauern des Verteidigungsministeriums und einer pompösen Präsidentenresidenz zu zementieren. Deren Vollendung wird nicht lange auf sich warten lassen und den langfristig planenden roten Mandarinen von Peking Ansehen und – wer weiß – politisches Gewicht verschaffen.
*
Die Unterkunftsmöglichkeiten auf Timor waren mir vor der Abreise in düstersten Farben geschildert worden. Ich gedachte schon bei den Geistlichen der Steyler Mission oder bei den Salesianern um Asyl zu ersuchen. Es ist eine freudige Überraschung, als die Betreuer der GTZ uns im komfortabel renovierten Hotel Timor unterbringen, dessen klimatisierte Zimmer mit Fernsehern samt Empfang von CNN und BBC ausgestattet sind und allen hygie nischen Ansprüchen genügen. In der großen Eingangshalle, wo sich riesige Ventilatoren drehen, plaudert ein gemischtrassiges Publikum überwiegend auf Portugiesisch. Es schafft eine iberisch anmutende Atmosphäre. Plötzlich fühle ich mich in eine längst verflossene Kolonialepoche zurückversetzt, die ich – man mag sich darüber empören – in überwiegend positiver Erinnerung behalten habe. »When the going was good«, zitiere ich den reaktionären britischen Schriftsteller Evelyn Waugh und verspüre einen Hauch von Nostalgie.
Der Eingang des »Timor« wird von schwarz uniformierten Bewaffneten kontrolliert, kräftige Gestalten mediterranen Typs, die Helm und kugelsichere Weste tragen. An den australischen Ordnungshütern gemessen, wirken sie wie Krieger eines anderen Zeitalters. Das alte Lusitanien hat ein paar hundert Angehörige der »Guarda Nacional Republicana« in seine ehemalige Besitzung am Ende der Welt entsandt, nicht um sinnlose postkoloniale Ansprüche anzumelden, sondern in der Hoffnung, durch bescheidene militärische Präsenz zumindest eine Spur des eigenen Kulturerbes zu retten.
Mir imponieren diese resolut auftretenden Schutzengel, die – anders als die Mehrzahl ihrer eher schmächtig gewachsenen Landsleute – über die Muskulatur von Bodybuildern verfügen. Es heißt, daß sie psychologisch sehr viel besser mit den aufsässigen Timoresen zurechtkommen als die Australier, die zwar vorzüglich nach britischem Vorbild gedrillt, aber oft durch die amerikanischen Methoden der Terrorbekämpfung negativ beeinflußt sind. Während die »Aussies« gegen Randalierer und Plünderer sehr schnell zum Schießeisen greifen, gehen die Portugiesen mit Schlagstöcken vor und erzielen weit bessere Pazifizierungsresultate.
Neben der Elitetruppe der »Guarda Nacional« sind vierhundert portugiesische Sprachlehrer in Dili angekommen. Sie haben sich über die östliche Inselhälfte verstreut, um die Sprache des Dichters Camões, die nur noch von zehn Prozent der Bevölkerung benutzt wird, vor der endgültigen Verdrängung durch das Englische, besser gesagt durch das Amerikanische, zu retten. Sie werden dabei von einer aktiven Embajada unterstützt, der sich auch die brasilianische Botschaft von Dili brüderlich zugesellt. Ob die Lusitanier beim linguistischen Überlebenskampf erfolgreicher sein werden als ihre spanischen oder französischen Leidensgenossen auf den Philippinen oder in Indochina, deren kultureller Einfluß durch das er drückende Übergewicht des »American way of life« verdrängt wurde, bleibt dahingestellt. Den Portugiesen kommt zugute, daß ihr Landsmann Manuel Barroso als Vorsitzender der Europäischen Kommission seinen Einfluß in Brüssel zu ihren Gunsten geltend machen kann.
Die obere Etage des zweistöckigen Hotels wird durch timoresische Pistoleros in Zivil und einheimische Polizisten wie ein Banktresor geschützt. In unmittelbarer Nachbarschaft meines Zimmers hat sich der Interims-Staatschef Fernando de Araujo einquartiert, nachdem vor einem knappen Monat Präsident José Ramos-Horta von mehreren Kugeln in den Brustkorb getroffen worden war. Das Hotel Timor mit seinen portugiesischen Bewachern gilt wohl als sicherstes Refugium für die um ihr Leben besorgten Repräsentanten des Staates.
Holland als Großmacht
Während ich mir eine Siesta gönne, die durch den Anflug aus Neuseeland, die kurzen Zwischenstationen in Melbourne und Darwin sowie den krassen Klimawechsel angebracht erscheint, stelle ich mir die Frage, ob man ein deutsches Leserpublikum für das Schicksal dieser fernen exotischen Inselhälfte interessieren kann. Zufällig war ich vor meinem Aufbruch aus Europa auf eine Notiz des Kollegen Rudolph Chimelli gestoßen, der mir stets als vorzüglicher Kenner der konfusen Machtverhältnisse der Islamischen Republik Iran aufgefallen war. Über die Misere des heutigen Journalismus befragt, hatte Chimelli geantwortet: »Die ausführliche Berichterstattung komplizierter Sachverhalte ist dem Nachrichtenkonsumenten meist nicht zuzumuten.«
Den Querkopf Noam Chomsky, der sich (als Sprachforscher) mit Ost-Timor schon lange auseinandergesetzt hatte, bevor es zum Thema internationaler Politik wurde, fragte einst eines der großen US-Fernsehnetze, ob er in einer Minute erklären könne, worin das Problem bestehe. »Nein, das kann ich nicht«, sagte Chomsky, und der Beitrag kam nicht zustande. Der amerikanische Linguist hätte binnen sechzig Sekunden nicht einmal die sechzehn stark unterschiedlichen Dialekte aufzählen können, die auf Timor-Leste gesprochen werden, ganz zu schweigen von der Spaltung der Inselhälfte in einen westlichen und einen östlichen Teil, eine ethnischpolitische Differenzierung, die immer wieder zu Konflikten führt.
Allen Bedenken zum Trotz werde ich zu einer gerafften Chronik ausholen. Auf dieser kleinen Sunda-Insel kann man nämlich wie in einem Mikrokosmos ein abenteuerliches Kapitel der Menschheitsgeschichte untersuchen. Hier läßt sich auf engstem Raum ein grandioses Projekt, die maßlose Hybris und, darauf folgend, der unvermeidliche Niedergang einer europäischen Nation analysieren. An dieser Stelle vollzogen sich auf spektakuläre Weise in dem exakten Zeitraum eines halben Jahrtausends Auftakt und Erlöschen eines imperialen und romantischen Traums.
Man schrieb das Jahr 1512, als der portugiesische Navigator Antonio de Abreu seinen Fuß auf den Strand von Timor setzte und den ersten Kontakt aufnahm zu einer Urbevölkerung, die sich im Zustand endloser Stammeskriege befand, als Kopfjäger berüchtigt war, mit den Schädeln ihrer erschlagenen Feinde ihre Hütten schmückte und sogar im Verdacht des Kannibalismus stand. Die portugiesische Expansion, die auf die grandiose Vision Heinrichs des Seefahrers zurückging, sollte in Timor ihre vorgeschobenste Position am Rande des Pazifischen Ozeans beziehen. Weite Küstenstreifen Afrikas hatten die Lusitanier bereits unterworfen, als Vasco da Gama den Seeweg nach Indien entdeckte, während zum gleichen Zeitpunkt Christoph Kolumbus im Dienste der spanischen Krone noch in der Karibik und an der mittelamerikanischen Landenge nach dem sagenumwobenen Reich der Moguln, der Maharadschas und den unermeßlichen Goldschätzen Cipangos suchte.
Der Gedanke an diese heroische Vergangenheit, die man dem kleinen Küstenvolk Iberiens gar nicht zugetraut hätte, mag wohl auch die heutige Regierung von Lissabon bewogen haben, durch die Entsendung von Gendarmen und Lehrern an dieser Stätte verlorener Größe noch einmal kurzfristig Flagge zu zeigen. Die portugiesischen Entdecker hatten es im sechzehnten Jahrhundert fertiggebracht, mit einem lächerlich kleinen Aufgebot von Menschen und Karavellen die faktische Oberhoheit über den ganzen Indischen Ozean an sich zu reißen. Der Herzog von Albuquerque, der seinen Gouverneurssitz im indischen Goa ausbaute, hielt die verhaßten arabischen Muselmanen in Schach, die kurz zuvor aus seiner Heimat am Tejo auf ihre maghrebinische Ausgangsbasis zurückgeworfen worden waren. Gewaltige portugiesische Festungen überragen heute noch den Hafen von Mombasa und die Straße von Hormuz am Ausgang des Persischen Golfs, die neuerdings im Zeichen der iranisch-arabischen Konfrontation wieder eminente strategische Bedeutung gewonnen hat.
Weit in den Rücken ihrer Gegner – bis auf die Insel Bahrain – hatten die Lusitanier ihre Bollwerke vorgeschoben, bemächtigten sich Ceylons und der Halbinsel von Malacca. Sie waren die ersten Europäer, die sich vom chinesischen Kaiser einen festen Anlegeplatz konzedieren ließen und den kleinen Fischerhafen Macao zur Drehscheibe ihres fernöstlichen Handelsmonopols ausbauten. Von Macao aus stellten sie regelmäßige Kontakte zum abgekapselten Inselreich Cipango her, das wir heute Japan nennen. Die Seefahrer und Freibeuter bahnten sich eine Route bis in die fernsten Ausläufer von Insulinde.
In Ermangelung der ungeheuren Gold- und Silberschätze, die ihre spanischen Rivalen den Azteken und Inkas von Mexiko und Peru entrissen, verlegten sich die Portugiesen auf den Handel mit den vielfältigen, kostbaren Gewürzen Südostasiens. Diese warfen im damaligen Abendland immense Gewinne ab, wurden doch die schwerreichen Kaufleute von Amsterdam »Pfeffersäcke« genannt.
In der atlantischen Hemisphäre kam der portugiesische Navigator Pedro Cabral mit der Entdeckung und ersten Landnahme in Brasilien den spanischen Konkurrenten zuvor. Die Niederlassungen Portugals im Raum von Recife sollten gewaltige Konsequenzen nach sich ziehen. Denn während das Mutterland seine Bedeutung einbüßte und auf den Status eines Kleinstaates an der europäischen Peripherie schrumpfte, entfaltet sich in unseren Tagen das immense Territorium Brasiliens zur amerikanischen Großmacht, die dank ihres wirtschaftlichen, morgen wohl auch politischen Potentials das lusitanische Erbe an die Nachwelt weiterreicht. Brasilien hat die Vasallenrolle, die Washington den lateinischen Staaten Mittel- und Südamerikas im Sinne der Monroe-Doktrin so lange zugewiesen hatte, längst abgeschüttelt. Auf seltsame Weise wirkt hier der Schiedsspruch des Borgia-Papstes Alexander VI. nach, der um das Jahr 1500 die Neuentdeckungen auf dem gesamten Erdball zu einer Hälfte den Spaniern, zur anderen den Portugiesen zugesprochen hatte.
Die Grausamkeit und die Habgier, mit denen die Besitzergreifung der iberischen Conquistadoren und auch ihre christliche Missionierung einhergingen, soll nicht beschönigt werden. Die späteren, überwiegend angelsächsischen Eroberer – denken wir nur an die Ausrottung der Indianer Nordamerikas – standen dem Wüten eines Cortés, der Herrschsucht eines Albuquerque, der Goldgier eines Pizarro übrigens in keiner Weise nach.
Um mich in die begeisterte Aufbruchstimmung von damals zu versetzen, um das Bewußtsein eines zivilisatorischen, ja göttlichen Auftrages zur Unterwerfung und Bekehrung der Heiden nachzuempfinden, hatte ich noch vor der Abreise aus Europa das umfangreiche Epos des größten portugiesischen Dichters Luís de Camões zur Hand genommen. Eine leichte Lektüre ist das nicht. Aus dem Balladenband »Os Lusiados« spricht ein ganz anderer Zeitgeist. Dabei muß man wissen, daß dieser abenteuernde Poet – nachdem er im Kampf gegen die Marokkaner ein Auge verloren hatte – sechzehn Jahre zur See gefahren war auf den Spuren des portugiesischen Nationalhelden Vasco da Gama, den er verherrlichte.
Camões kannte den Indischen Ozean vom Bab-el-Mandeb bis zu den Molukken. Die Lusiaden, so heißt es, hat er an der chinesischen Küste von Macao niedergeschrieben und sich dafür in eine abgelegene Grotte wie in eine Einsiedelei zurückgezogen. Camões fand seine Inspiration nicht nur in der christlich-biblischen Überlieferung, sondern mehr noch bei den griechisch-lateinischen Autoren des heidnischen Altertums. Er huldigte bereits dem Geist der Renaissance, wenn er sich ganz unverblümt bemühte, die Odyssee des Homer, mehr noch die Aeneis des römischen Dichters Vergil auf die eigene Epoche zu übertragen.
Seine Verse mögen für den heutigen Geschmack unerträglich pathetisch klingen, wenn er im »Canto Primeiro« mit folgenden Zeilen anhebt:
»Die kriegerischen kühnen Heldenscharen Vom Westrand Lusitaniens ausgesandt, Die auf den Meeren – nie zuvor befahren – Sogar passierten Taprobanas [Ceylons] Strand, Die mehr erprobt in Kriegen und Gefahren, Als man der Menschen Kraft hat zuerkannt, Und unter fernem Volk errichtet haben Ein neues Reich, dem so viel Glanz sie gaben.« (In der Übersetzung von Hans Joachim Schaeffer)
*
Der französische Aufklärer Voltaire hat sich über diesen »poète aventurier« mokiert, der die Götter des Olymp oder die lästerliche Venus in einem Atemzug mit der jungfräulichen Gottesmutter Maria erwähnte. Der deutsche Übersetzer Friedrich Schlegel hingegen sah in den Lusiaden einen Ansporn für die Aufbruchstimmung, die die deutsche Nation zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts ergriff, ein aufrüttelndes Vorbild der von ihm ersehnten Erweckung Germaniens. Alexander von Humboldt wiederum fand für den schreibenden Navigator Camões den Ausdruck »See maler«.
Die Insel Timor wird im »Canto decimo« kurz erwähnt: »Auch Timor dort, wo man das Holz gewinnt des Sandelbaums, das duftend heilsam wirkt. Das weite Sunda schau! …« Kurz nach der Landung Antonio de Abreus auf der Insel Timor vollbrachte sein Landsmann Fernão de Magalhães, der unter dem Namen Ferdinand de Magellan in die Dienste der zahlungskräftigeren spanischen Monarchie getreten war, die erste Weltumseglung.
Mein Vater hatte mich schon im Knabenalter ermutigt, ja an ge halten, die Biographien der kühnsten Entdecker zu lesen, von Cortés, der Mexiko unterwarf, bis Stanley, der das finstere Herz Afrikas, das Kongobecken, unter unvorstellbaren Strapazen durchquerte. Zu der Lektüre gehörte auch Sven Hedin, der sich in die Ta-klamakan-Wüste Zentralasiens wagte. Am stärksten beeindruckte mich Magellan, der durch die Entdeckung der nach ihm benannten schmalen Meerenge an der äußersten Südspitze der Neuen Welt den Zugang zum Pazifik öffnete. Er hat den endgültigen Beweis erbracht, daß die Erde eine Kugel ist.
Die ersten Portugiesen verhandelten auf Timor mit sogenannten »Königen«, denen sie Gewürze und Sandelholz abkauften, ohne jemals die Küstenebene zu verlassen. Es waren primitive Stammeshäuptlinge, deren Gefolgschaft sich in sinnlosen Fehden erschöpfte. Ein halbes Jahrhundert nach der ersten Erkundung durch Antonio de Abreu drang die lusitanische Präsenz ins Innere von Timor vor. Die Mönche des heiligen Dominikus gründeten ihre Missionen und bemühten sich, die melanesischen Heiden zum Glauben der römischen Kirche zu bekehren. Sie hatten gute Gründe dafür. Die Oberhoheit der Lusitanier über Ceylon, Malacca und den Molukken- Archipel wurde nämlich ganz unerwartet durch die Ankunft anderer Europäer erschüttert und in Frage gestellt.
Holländische Handelsschiffe der »Oostindische Compagnie« tauchten mit überlegener Schiffsartillerie am Horizont auf. Kaum hatten die Niederländer die spanische Unterjochung durch den Herzog von Alba in ihrer Heimat abgeschüttelt, holten ihre Kaufleute und Seefahrer zu einer kolonialen und merkantilen Expansion sondergleichen aus, die man von diesen »Krämern« gar nicht erwartet hatte. Binnen eines Jahrhunderts gelang es dem Volk der »Geusen« – Bettler, wie die Kastilianer sie verächtlich nannten –, die Portugiesen auf ein paar Außenposten abzudrängen, darunter die östliche Sunda-Insel Timor, auf der die ersten holländischen Kaufleute schon im Jahr des Herrn 1568 an Land gingen. Es gehört zu den absurdesten Kapiteln der europäischen Kolonialgeschichte, daß Portugiesen und Niederländer sich dreihundert Jahre lang um den Besitz von ein paar entlegenen und – an Java oder Ceylon gemessen – dürftigen Eilanden bekriegen sollten.
Luís de Camões hatte zusätzlichen Grund, das Vordringen dieser Usurpatoren des Hauses Oranien zu verfluchen. Holland – damals noch nominell Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation – hatte dem Katholizismus der Spanier radikal den Rücken gekehrt. Der protestantische Calvinismus – in den Augen der Portugiesen die schlimmste Form der Ketzerei – wurde offizielle Staatsreligion dieses jungen Staatsgebildes.
Wie »global« schon vor einem halben Jahrtausend die konfessionellen Gegensätze ausgetragen wurden und aufeinanderprallten, entnehmen wir einer Strophe des Siebten Gesangs der Lusiaden. Da heißt es:
»Ihr seht der Deutschen hochmütige Herde, Die sich auf weitflächigem Feld ernährt, Den neuen Hirten wählt der neuen Lehre
[gemeint sind Calvin und Luther]
Und gegen Petri Erben aufbegehrt. Ihr seht beladen sie mit Kriegsbeschwerden, Da sie der blinde Wahn noch nicht belehrt, Nicht um den stolzen Türken zu verjagen, Nein, um das hohe Joch [des Papstes] nicht mehr zu tragen.«
Der greise Camões, der von einer kümmerlichen Rente seines Königs ein trauriges Dasein fristete, wurde noch verzweifelter Zeuge des Niedergangs seines Vaterlandes. Es klingt seltsam modern, wenn er am Ende die Habgier und Verderbtheit seiner Landsleute, die der Sucht nach Ruhm und Reichtum erlegen waren, für das Scheitern des portugiesischen Imperiums verantwortlich macht. Er schließt sich damit der Verdammung der »avaritia« an, der wütenden Kritik an der Habsucht, an der zunehmenden gesellschaftlichen Ausrichtung auf Profit und Geldwirtschaft, die seiner christlichen Grundhaltung zutiefst widersprach und von zahlreichen Moralisten und Literaten seiner Epoche geteilt wurde. Schon damals gab es ideologische Gegner eines weltumspannenden Glücksrittertums, das uns seltsam vertraut vorkommt. Die Tragödie des Dichters Camões gipfelte in der Annexion Portugals durch den spanischen König Philipp II., die im Jahr 1580, im Jahr seines Todes, stattfand und fast ein Jahrhundert andauern sollte.
Ich will die Analogien nicht exzessiv bemühen, aber an dieser Stelle sollte einer der bedeutendsten Exegeten des Camões-Werks, der Deutsche Rafael Arnold, zu Wort kommen:
»Inzwischen sind die Entdeckungen in andere Richtungen gelenkt. Aus dem geographischen Raum in den Weltenraum oder in den Mikrokosmos atomarer Kleinstteile. Daneben entdecken wir heute – den Blick auf den Bildschirm geheftet – am Computer ungeahnte virtuelle Welten. Der Wortschatz der Entdeckungen verdankt dabei bis heute der nautischen Fachsprache sehr viel. Astronauten bereisen ganz selbstverständlich in Raumschiffen das Weltall. ›Explorer‹ helfen bei der Orientierung im elektronischen Informationsspeicher, und unterstützt von einem ›Navigator‹ erkunden wir die ›novos mundos‹ virtueller Wirklichkeit, wenn wir durchs Internet surfen. ›Navegar na internet‹ nennen das die Portugiesen, von denen Camões einst stolz sagen konnte: ›Der Welt werden sie neue Welten bringen.‹ (II, 45)«
*
Im Rückblick erscheint der endlos schwelende Konflikt zwischen Portugiesen und Holländern – letztere hatten vorübergehend, aber ohne bleibenden Erfolg auch in Nordost-Brasilien Fuß gefaßt – als historischer Aberwitz, als extravagantes Vorgeplänkel jener europäischen Selbstzerfleischung, an deren Ende die düstere Vorahnung des »Untergangs des Abendlandes« steht. Die merkantile Hartnäckigkeit der Ostindischen Handelsgesellschaft, die 1799 der staatlichen Autorität der niederländischen Regierung unterstellt wurde, hat es dem Haus Oranien immerhin erlaubt, eine riesige koloniale Domäne zwischen der Nordspitze Sumatras und der Westhälfte Neuguineas extrem gewinnbringend auszubeuten, während Portugal, das sich in Asien lediglich in winzigen Dependancen behauptete, sich bis 1974 ohne großen Profit an seine weitflächigen afrikanischen Besitzungen klammerte.
Das Beispiel dieser europäischen Kleinstaaten, in deren Unterbewußtsein die Erinnerung imperialen Prestiges nicht erloschen ist, illustriert die profunden psychologischen Vorbehalte, die sich der heute angestrebten Einigung des Kontinents entgegenstemmen. Nicht nur Holland und Portugal hatten sich vorübergehend als Großmächte gebärdet. Neben Briten, Spaniern, Franzosen und Deutschen, die unter Berufung auf die zivilisatorische Mission der Europäer die »Bürde des weißen Mannes« schulterten und dem Rausch schrankenloser Dominanz erlagen, könnten ja auch die Polen darauf pochen, daß sie auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte Moskau besetzt und einen Pseudo-Zaren von Krakaus Gnaden im Kreml installierten. Vor den schwedischen Heeren Gustav Adolfs und mehr noch Karls XII. zitterten die Fürstenhäuser des Kontinents. Sogar das Großherzogtum Litauen erstreckte sich zeitweise vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer.
Die Dogen-Republik Venedig konnte sich bis zur Entdeckung Amerikas als unentbehrliche See- und Handelsmacht des Mittelmeers aufführen, und die gefürchteten Kriegshaufen der Schweizer Reisläufer entschieden auf den Schlachtfeldern Norditaliens, Burgunds und Lothringens über den Bestand der rivalisierenden Dynastien des Abendlandes. In der Nachfolge Kaiser Karls V., »über dessen Reich die Sonne nie unterging«, verstieg sich das Haus Habsburg zu der Devise A. E. I. O. U.: »Austriae est imperare orbi universo« (es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen) – oder auch: »Alles Erdreich ist Österreich untertan«.
Wer heute an den zähflüssigen Querelen der Eurokraten von Brüssel, am frustrierenden Hindernislauf der kontinentalen Einigung, an der von Washington geschürten Divergenz zwischen »Old and New Europe« verzweifelt, sollte neben den pompösen Schriften des Barden Camões auch die exaltierten patriotischen Aufrufe, die nationalistischen Haßpredigten des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts zur Hand nehmen, die die machtpolitische Abdankung des Okzidents begleiteten.
»Tristes Tropiques«
Atauro, im März 2008
An Bord der Fähre »Nakroma« versuche ich vergeblich, mich in die kühne Laune der lusitanischen Weltentdecker zu versetzen. Wir unternehmen ja nur einen kurzen, risikolosen Ausflug, und die »Nakroma« ist ein modernes, komfortables Schiff. Unser Ziel ist das Eiland Atauro, das Ost-Timor in dreißig Kilometern Distanz nördlich vorgelagert ist. Die Überfahrt dauert knapp zweieinhalb Stunden. Wir gleiten über die spiegelglatte, tiefblaue Wasserfläche der Wetar Strait. Nur ein Rudel Delphine bietet Abwechslung. Wichtiger als die wöchentliche Verbindung Dilis mit Atauro ist der regelmäßige Pendelverkehr der Fähre mit der Exklave Oecussi, die sich in der Westhälfte Timors befindet und ringsum von indonesischem Staatsgebiet umschlossen ist.
Der Landzugang ist durch miserable Straßen und Zollschikanen erschwert. Diese widersinnige Grenzziehung geht auf einen Vertrag aus dem Jahr 1859 zurück, der dem grotesken Territorialstreit zwischen Lissabon und Den Haag ein Ende setzte. Auf die Beibehaltung der winzigen Außenposition Oecussi hatte Portugal besonderen Wert gelegt, weil dort die Dominikaner ihre erste Niederlassung ausgebaut hatten.
Der Name »Nakroma« bedeutet soviel wie Morgendämmerung oder Aufklärung, wird mir erklärt. Es handelt sich um ein Geschenk der Bundesrepublik. Der Schiffsbau fand in Indonesien unter strikter Überwachung der GTZ statt, die auch weiterhin dieses nützliche Projekt betreut. Der Steuermann und die Besatzung sind ausschließlich Malaien aus Java, die sich von alters her auf Navigation und auch auf Piraterie verstehen, während die überwiegend melanesischen Timoresen für das offene Meer nicht taugen. Man fragt sich, wie die Vorfahren dieser Rasse ihr Siedlungsgebiet bis zu den Fidschi-Inseln und Neukaledonien ausweiten konnten.
Die Wetar Strait liegt harmlos und träge unter der brütenden Mittagssonne. Diese nördlichen Gewässer Timors, die aufgrund ihrer steil abfallenden, ungewöhnlichen Tiefe strategische Bedeutung für die diskrete Passage von Atom-U-Booten der US Navy aus dem Pazifik in den Indischen Ozean besitzen sollen, werden von den Einheimischen das »weibliche Meer« genannt, während die rauhen Fluten der Timor-See, die im Süden mit schäumender Brandung gegen die Ufer schlagen, als »männliches Meer« gelten. Über die emanzipatorische Frage, ob diese auf den Ozean übertragene Unterscheidung zwischen maskulinem Ungestüm und femininer Sanftmut heutzutage noch Sinn macht, haben sich die Timoresen gewiß keine Gedanken gemacht.
Die hochfliegenden Erwartungen, mit denen die iberischen Karavellen einst auf die geheimnisvollen Gestade Insulindes zusegelten, dürften auf Atauro bitter enttäuscht worden sein. Schon ab 1520 wurde das Eiland als eine Art »Teufelsinsel« für die Verbannung von Sträflingen genutzt. Die Indonesier, die mehrere Jahrhunderte später Ost-Timor okkupierten, haben es den Portugiesen gleichgetan. An der Anlegestelle der Fähre tummelt sich ein recht kümmerlicher Haufen von Passagieren und Trödlern.
In einem bequemen Toyota fahren wir durch dichtes Gestrüpp. 8000 Einwohner sind auf unansehnliche Dörfer im Busch verteilt. Der Buchtitel »Tristes Tropiques« hätte für diesen exotischen Landstrich erfunden werden können. Bemerkenswert ist hier allenfalls, daß eine größere Anzahl der Einheimischen im Gegensatz zur Hauptinsel Timor, die fast ausschließlich katholisch ist, zum calvinistischen Christentum bekehrt wurde, was wohl nicht zur Erheiterung der Gemüter beitrug. Heidnische Bräuche sind weiterhin verbreitet.
Unsere enttäuschende Rundfahrt endet mit einem Imbiß in der »Eco Lodge« am Strand von Vila. Das Wort »Eco« steht auch hier für Ökologie und soll den seltenen Touristen und Sonderlingen, die sich hierher verirren, Naturnähe und Ursprünglichkeit vortäuschen. Die einzigen Ausländer, die gemeinsam mit uns in Atauro an Land gingen, hagere, verhärmt wirkende Australierinnen, werden in einer erbärmlichen Pfahlhütte untergebracht und sind auf eine einzige gemeinsame Duschanlage sowie einen stinkenden Abtritt angewiesen. Mühsam ziehen zwei grauhaarige, mißmutige Frauen ihre Koffer durch den Sand, und keiner der träge kauernden Hotelbediensteten käme auf den Gedanken, diesen »Alternativtouristen« behilflich zu sein.
Die »Ökologie-Lodge« ist ein unappetitlicher Platz. Die gerösteten Fische, die uns auf schmuddeligen Tellern serviert werden, starren vor Gräten. Der Geruch des Essens hat drei Hunde angezogen. Beim Anblick der ausgemergelten, räudigen Tiere vergeht einem der letzte Appetit. Offenbar hatte meine Frau Eva, die mich auf dieser Reise begleiten wollte und wegen Erkrankung auf die Expedition nach Timor verzichten mußte, doch nicht so unrecht gehabt, als sie sich vorsorglich gegen Tollwut impfen ließ. Vier schwarze Ziegen haben sich uns zugesellt, die die üppige tropische Vegetation verschmähen, um in einem ekelhaften Abfallhaufen zu wühlen.
Eine bescheidene historische Bedeutung hat Atauro im August 1975 gewonnen, als die Nelkenrevolution der portugiesischen Militärs vom Vorjahr auch in Ost-Timor radikalen politischen Wandel und kolonialen Verzicht erzwang. Der letzte lusitanische Gouverneur flüchtete aus Dili, wo die ersten Gefechte der Unabhängigkeit aufflackerten, mit seinem Gefolge auf diese ehemalige Sträflingsinsel und schiffte sich wenig später auf der Korvette »Alfonso Cerqueira« in Richtung Heimat ein. Es war der unrühmliche Abschluß einer glorreichen Historie.
Auf der Rückfahrt verschwimmt die platte, die weibliche See in einem grauen Trauerflor. Das Trümmerfeld der Hauptstadt taucht als düsterer Schatten auf, aus dem das knallrote Ziegeldach des Außenministeriums wie ein Fanal herausleuchtet. Die Ausgangssperre wurde vor ein paar Tagen um zwei Stunden verkürzt. Im Hotel Timor haben sich die überwiegend portugiesischen Gäste in munter plaudernden Gruppen zusammengetan. Es wird australischer Rotwein und Vinho Verde getrunken. Wären nicht die freundlichen, dunkelhäutigen Bediensteten, man könnte sich am Tejo wähnen.
Plötzlich verstummt das Stimmengewirr. Ein gewichtiger Mestize ist die Treppe heruntergekommen. Er nimmt in der äußersten Ecke der Lounge Platz und läßt sich ein Bier servieren. »Das ist der Parlamentspräsident, der in Abwesenheit des schwerverwundeten Staatschefs Ramos-Horta das höchste Amt der Republik verwaltet«, flüstert mir ein Nachbar zu. Die Wichtigkeit dieses autoritätsbewußten Mannes wird durch die Präsenz von zehn schwerbewaffneten Leibwächtern betont, die nur zur Hälfte uniformiert sind. Über Dili hat sich die Nacht gesenkt, und die australischen Paratroopers nehmen ihre Dschungelpatrouillen vor.
Die Japaner im Dschungelkrieg
Wie erklärt es sich, daß Lissabon mehr als eine Generation nach dem kolonialen Generalverzicht dem entlegensten Fetzen seines ehemaligen Imperiums heute plötzlich eine solche Aufmerksamkeit zuwendet und in Timor-Leste – auch mit militärischem Ausbildungspersonal – Präsenz demonstriert? Fast ein halbes Jahrtausend lang war Ost-Timor von den Lusitaniern sehr stiefmütterlich behandelt worden. Ähnlich wie ihre holländischen Erbfeinde waren die Portugiesen in Insulinde auf eine geringe Zahl von Seeleuten, Abenteurern und Klerikern angewiesen. Sie versuchten ihren Einfluß, der sich auf ein paar Küstenflecken beschränkte, durch Bündnisse mit den eingeborenen Häuptlingen zu konsolidieren, die man in den Chroniken des sechzehnten Jahrhunderts großspurig als »reyes«, als Könige, bezeichnete. Erst in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts raffte sich ein Gouverneur namens Fernandes auf, ins Innere von Timor vorzurücken, um sich Autorität bei den in finsterer Rückständigkeit lebenden Stämmen und ihren argwöhnischen Anführern, den »Liurai«, zu verschaffen.
Dabei stützte er sich – in Ermangelung nennenswerter militärischer Verbände aus dem Mutterland – auf eine abenteuerliche Söldnertruppe, die »Topases«. Es handelte sich dabei um portugiesisch sprechende katholische Mestizen, die anfangs auf der benachbarten Insel Flores rekrutiert, im Laufe der Zeit jedoch durch ein buntes Völkergemisch aus den ehemaligen portugiesischen Besitzungen in Indien verstärkt wurde. Dazu gesellten sich befreite Sklaven aus den Plantagen Ceylons, von den Molukken und sogar aus dem fernen afrikanischen Mosambik. Die Topases wurden von den Niederländern »schwarze Portugiesen« genannt.
Diese mit Musketen bewaffneten Horden erwiesen sich den einheimischen timoresischen Kopfjägern weit überlegen, verjagten oder töteten deren Häuptlinge, unterwarfen die wichtigsten Stämme der Tetum und der Dawan. Ihre Capitãos, die den »Canga ceiros« oder »Bandeirantes« Brasiliens wohl recht ähnlich waren, hielten auf Timor zwar die von Westen vordringenden Holländer der »Oost indische Compagnie« in Schach, richteten ihre Waffen jedoch gelegentlich auf die eigenen portugiesischen Offiziere und Beamten und revoltierten offen gegen den in Goa residierenden Vizekönig.
Warum erwähnen wir überhaupt diese buntgescheckte, verwilderte Rotte der Topases? Ihre Verwendung an den Antipoden des Mutterlandes, dessen geringe Bevölkerung den weltumspannenden Kolonialprojekten nicht gewachsen war, signalisierte bereits den unaufhaltsamen Verfall. Hier bestätigt sich eine historische Kontinuität. Schon das späte römische Imperium – »le bas empire«, wie die Franzosen sagen – hatte in der langen Folge seines Niedergangs die unzureichend bemannten Legionen durch Anwerbung von »Barbaren« ergänzen müssen, wobei den germanischen Stämmen jenseits des Limes, aber auch den Numidiern, Dalmaten oder Nubiern eine besondere Rolle zufiel.
Das britische Empire hatte es seinerseits meisterhaft verstanden, die unterschiedlichsten Rassen in den »Mint«, in den Prägestock seines militärischen Drills, zu pressen und dieser Kolonialtruppe sogar das Gefühl zu vermitteln, einer kriegerischen Elite anzugehören. In der »Grande Armée« Napoleons, die auf Moskau zumarschierte, wurde angeblich mehr Deutsch als Französisch gesprochen. In den mörderischen Vernichtungsschlachten des Ersten Weltkriegs griffen die Franzosen massiv auf Senegalesen und Algerier zurück.
Kurzum, die Verwendung von »Hiwis«, wie es im letzten deutschen Rußlandfeldzug hieß, ist so alt wie die Kriegsgeschichte, symbolisiert jedoch – wie im Falle der Topases – die Perspektive unvermeidlichen Verlustes.
Dem Barden Luís de Camões blieb es erspart, die Schmach des von ihm so blühend gefeierten Vaterlandes mitzuerleben. Nach der Rückgewinnung der eigenen Souveränität und der Loslösung von der spanischen Krone wurde Portugal zum Spielball der Mächte und erstarrte in Lethargie. Wenn die Eigenstaatlichkeit und ein immer noch beachtlicher Überseebesitz erhalten blieben, so war das der engen Anlehnung Lissabons an Großbritannien zu verdanken. Die napoleonische Eroberung der Iberischen Halbinsel sollte die Abspaltung Brasiliens zur Folge haben, das sich ab 1822 zunächst als unabhängiges Kaiserreich konstituierte. Die riesigen afrikanischen Territorien von Angola und Mosambik zumal waren einer solchen Vernachlässigung und Mißwirtschaft anheimgefallen, daß vor dem Ersten Weltkrieg Briten und Deutsche vorübergehend über deren Aufteilung verhandelten.
Wer kümmerte sich da schon um den kümmerlichen Außen posten Ost-Timor, wo die eingewanderten Chinesen zahlreicher waren als die Portugiesen und der Handel mit Sandelholz seine wirtschaftliche Bedeutung verloren hatte? Im Jahr 1915 wurde zwar ein letzter verzweifelter Aufstand der Eingeborenen grausam niedergeschlagen, aber auch die Einführung der Zwangsarbeit auf den Plantagen brachte keinen nennenswerten Gewinn. Außerhalb der dahindämmernden Hauptstadt Dili war in Ost-Timor nicht ein einziger Kilometer Asphaltstraße gebaut worden.
*
Das Erwachen war fürchterlich. Mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 setzte im ostasiatisch-pazifischen Raum eine sensationelle Zeitenwende ein. Der Ferne Osten hatte auf mich schon als Kind eine seltsame Anziehungskraft ausgeübt. So hatte nicht nur die stark romantisierte Legende des baltischen Barons Ungern-Sternberg, die Welt der mongolischen Götter und Dämonen, meine junge Phantasie beflügelt. Ich entwarf in meinen frühen Gymnasialjahren Landkarten von dem erobernden Vordringen der Armeen des Tenno in Richtung Peking, Schanghai und Kanton. Den Kriegsausbruch zwischen den Vereinigten Staaten und Japan verfolgte ich mit intensiver Spannung und ahnte nicht, daß ich wenige Jahre später als aktiver Zeitzeuge in die Wirrnisse des Fernen Ostens einbezogen werden würde.
Beim Geographieunterricht am Kasseler Wilhelms-Gymnasium stellte uns der Geographielehrer, der durchaus kein Nazi war, aber auf den Sieg Deutschlands hoffte, die Allianz mit diesem seltsamen gelben Volk, das so gar nicht in die Vorstellungen der nordischen Herrenrasse hineinpaßte, als ein Geschenk des Schicksals dar. Auf den Schulbänken diskutierten wir ausgiebig den explosionsartigen Zugriff des Kaiserreichs Nippon, das sich blitzartig die Philippinen, ganz Hinterindien, den Salomon-Archipel, die Halbinsel von Malacca und den kolossalen holländischen Kolonialbesitz Indonesien einverleibte.
Als die Sturmtruppen des Tenno auch auf Neuguinea landeten und über den Kokoda-Trail bis in die unmittelbare Nachbarschaft Australiens vorstießen, hatten die Stäbe des Empire – wie ich später erfuhr – für den Extremfall den strategischen Rückzug auf eine Verteidigungslinie geplant, die von Brisbane bis Adelaide gereicht und die endlosen Wüstenflächen des Fünften Kontinents dem Feind überlassen hätte.
Schon im Februar 1942 bemächtigten sich die Japaner der Insel Timor. Sie stießen dort weniger auf den Widerstand der Holländer als auf den perfekt geführten Partisanenkrieg einer kleinen Truppe australischer Dschungelkämpfer, der sogenannten Sparrow Force. Gegen eine Übermacht von 20 000 Gegnern haben sich die »Aussies« bis 1943 in einer vorbildlichen Guerrilla behauptet. Obwohl Portugal im Zweiten Weltkrieg seine Neutralität proklamiert hatte, wurde die Kolonie »Timor-Leste« beinahe zwangsläufig in die Gefechte einbezogen. Anstatt die Japaner als asiatische Brüder und Befreier zu begrüßen, machte die Mehrheit der kriegerischen Eingeborenenstämme