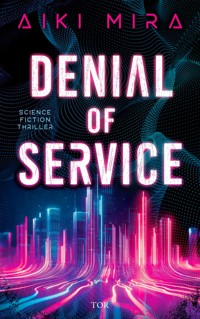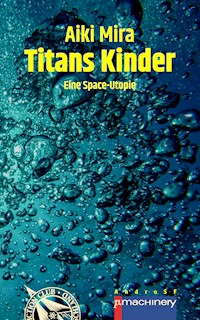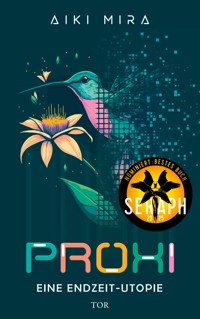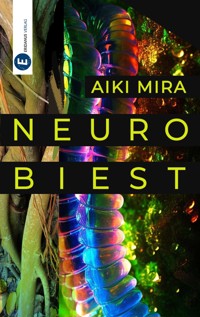Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es knirscht, kracht und dampft im Getriebe. Nebel kriecht durch die Gassen und manchmal enthüllt er Dinge, die besser verborgen bleiben sollten. Eine Schachpartie verändert den Lauf der Geschichte. Der Blick durch die Fotolinse zeigt Dinge, die sein könnten. Ganz leise erklingt eine Melodie, die ihrer Zeit weit voraus ist. Hinsehen oder lieber wegschauen? Fünfzehn Steampunk-Storys über das Leben, den Tod und den Raum dazwischen. Mit Geschichten von Angelika Brox, Lina Tiede, Michael Schmidt, Tessa Maelle, Carolin Gmyrek, Aiki Mira, Galax Acheronian, Janika Rehak, Thorsten Küper, Uwe Post, Frederic Brake, Jol Rosenberg, Yvonne Tunnat, Oliver Bayer, Uwe Hermann Herausgegeben von Janika Rehak und Yvonne Tunnat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2022 Amrûn Verlag
Jürgen Eglseer, Traunstein
Covergestaltung: Christian Günther, Tag Eins – Atelier für digitale Medien
Lektorat: Janika Rehak und Yvonne TunnatKorrektorat: Julian Bodenstein
Printed in the EU
ISBN TB 978-3-95869-500-9ISBN ebook 978-3-95869-501-6
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie unsere Webseite:
amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
v1/22
Vorwort
Liebe Menschen mit einem Herz für Steam,
wir freuen uns, dass unsere Anthologie den Weg zu euch gefunden hat.
Das Genre fasziniert uns schon eine Weile. Und nicht nur uns. Wenn wir davon erzählen, hören wir oft: »Steampunk? Sehr cool! Wollt ihr dazu nicht mal etwas machen?«
Das haben wir beim Wort genommen und eine Reihe Menschen gebeten: »Schreibt uns doch mal etwas über Steampunk.«
Tatsächlich war das die einzige Vorgabe für dieses Projekt. Auf Einschränkungen in Sachen Thema und Länge haben wir bewusst verzichtet und waren gespannt auf die jeweilige Interpretation. Jede neue Geschichte im Postfach erzeugte Vorfreude: Welche dampfige Überraschung würde uns wohl diesmal erwarten? Die Länge variiert entsprechend. Einige Texte sind superkurz, andere sorgen für langes Lesevergnügen.
Dass sich Ideen und Themen dabei überschneiden können, haben wir einkalkuliert. Gleichzeitig hat uns die Bandbreite an Ideen begeistert. So dachten wir oft beim Lesen einer neuen Story-Überraschungstüte: Wow, diesen Ansatz hatten wir noch nicht! Einmal gibt es tatsächlich eine auffällige Ähnlichkeit. Die Umsetzung und der Blickwinkel sind jedoch so unterschiedlich, dass wir kurzerhand beschlossen haben: Ist so. Bleibt so.
Das Fazit überrascht – und auch wieder nicht: Bei allem technischen Fortschritt, bei allem, was Technik und Wissenschaft können, geht es am Ende doch wieder um die ganz elementaren Dinge des Menschseins. So kam es auch zu dem Titel: Der Tod kommt auf Zahnrädern. Die meisten Geschichten berühren, umkreisen, behandeln das Thema, mal handfest, mal subtil und mal auf eine Weise, die wie der genretypische Dampf in die Gehirnwindungen kriecht und dort eine Weile nachwirken kann.
Sämtliche Geschichten sind mit Content Notes versehen. Diese findet ihr am Ende des Buches.
Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die Geschichten und die Zusammenarbeit, oft auch über die Texte hinaus, bei Jürgen Eglseer vom Amrȗn-Verlag, der unser Projekt spontan unterstützt hat, bei Christian Günther, der unsere großen und kleinen Sonderwünsche bei der Covergestaltung wunderbar umgesetzt hat, und auch bei unserem Korrektor Julian Bodenstein: Danke, dass Buchstaben und Zeichen dort sitzen, wo sie hingehören.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Erkunden retrofuturistischer Welten.
Yvonne Tunnat und Janika Rehak, August 2022
My Happiness
von Angelika Brox
Beim dritten Klingeln nahm er den Anruf entgegen.
»In fünf Minuten vor Ihrem Haus!«, sagte die Frau, die sich Mrs. Smith nannte. »Zu niemandem ein Wort. Keine Bodyguards.«
»Okay.« Als er den Hörer wieder auflegte, merkte er, dass seine Hand zitterte. Jetzt, da es ernst wurde, spürte er ein nervöses Flattern im Magen. Aber seine Entscheidung war gefallen. Er würde die Sache durchziehen. Entweder brachte es ihn um oder es wurde seine zweite Chance.
Exakt vier Minuten später stand er auf der Zufahrt vor seiner Villa. Fünf Minuten später näherte sich knatternd ein Hubschrauber und landete auf der Rasenfläche. Sieben Minuten später hoben sie wieder ab.
Er sah sein Anwesen kleiner werden und nahm innerlich Abschied. Es war eine schöne Zeit gewesen, doch in den letzten Jahren war ihm alles zu viel geworden. Der Erfolgsdruck. Die Termine. Die Erwartungen der Menschen. Keine unabhängigen Entscheidungen mehr treffen zu dürfen. Er konnte kaum noch schlafen, brauchte immer mehr Tabletten, zur Beruhigung, zum Schlafen, zum Munterwerden, gegen Verdauungsbeschwerden, gegen alles Mögliche, und er spürte, dass sein Körper bald nicht mehr mitspielen würde. Er atmete tief durch, schloss die Augen und betrachtete Bilder aus seinem inneren Fotoalbum.
Als sie eine Schleife flogen, schreckte er hoch. Unter sich sah er ein eingezäuntes Areal mit mehreren flachen Gebäuden, ringsherum Steppe, Kiefern und ein paar Hügel.
Sie landeten vor einer Halle, die aussah wie ein Flugzeug-Hangar, und stiegen aus.
Smith entriegelte das Schloss an einer schmalen Tür neben dem Rolltor und sie traten ein.
Mitten in der Halle stand ein riesiges Ei aus Metall, ungefähr so groß wie ein Kleinwagen.
»Ziehen Sie sich aus!«, befahl Smith.
»Wie bitte?«
Sie stellte ihm eine Reisetasche vor die Füße. »Dort brauchen Sie Kleidung, mit der Sie nicht auffallen.«
»Okay.« Er zog sich aus bis auf die Unterwäsche und begutachtete den Inhalt der Tasche. Als Erstes zog er einen Zylinderhut heraus, über dessen Krempe eine Fliegerbrille saß. Als Nächstes kam ein weites weißes Rüschenhemd zum Vorschein, anschließend eine dunkelbraune Weste mit unzähligen Taschen, Knöpfen und Riegeln, eine locker geschnittene Hose aus schwarz-beige gestreifter Seide und zum Schluss ein Paar kniehohe Stulpenstiefel. Trotz der angespannten Situation musste er schmunzeln. Die Sachen sahen aus, als wollte er zu einem Kostümfest gehen.
Während er sich anzog, deutete Smith auf seinen ledernen Gitarrenbeutel und fragte: »Was ist da drin?«
»Meine Gitarre. Ein Gegenstand ist erlaubt, sagten Sie.«
Smith zog den Reißverschluss auf, warf einen kurzen Blick in den Beutel und nickte. Dann holte sie eine Fernbedienung aus ihrer Jackentasche und richtete sie auf das Metall-Objekt. Langsam klappte die obere Hälfte auf wie bei einem Fabergé-Ei. Das Innere war komplett verspiegelt. Ringsum verliefen durchsichtige Röhren, in denen Flüssigkristalle schimmerten. Ein unwirkliches Funkeln ging von ihnen aus. Es gab zwei Sitzplätze mit Gurten.
»Steigen Sie ein!«, sagte Smith.
»Ich reise doch allein, oder?«
»Ja, sicher. Auf dem zweiten Platz können Sie Ihre Gitarre festschnallen.«
Er zögerte einen Moment. Noch könnte er es sich anders überlegen. – Nein! Er atmete tief durch, nahm den Lederbeutel und kletterte in das Ei.
Smith drückte ein paar Köpfe auf der Fernbedienung. »Die Maschine ist so programmiert, dass Sie nach Erreichen des Zielortes genau drei Minuten zum Aussteigen haben. Dann kommt sie zurück. So sind die Sicherheitsvorschriften. – Noch irgendwelche Fragen? – Okay, dann gute Reise!«
Das Ei schloss sich. Die Röhren leuchteten auf, die Maschine begann sich zu drehen. Zunächst fühlte es sich an wie in einem Jahrmarktskarussell, aber die Geschwindigkeit nahm rasch zu. Das Ei rotierte schneller und schneller, wie durch einen Strudel geschleudert, wie durch einen Tornado gewirbelt. Aus den Röhren drang leises Summen, die Kristalle flackerten und blitzten. In seinen Ohren knackte es, unter der Schädeldecke baute sich Druck auf, der stetig schmerzhafter wurde. Fast hätte er das Bewusstsein verloren.
Endlich ließ das Tempo nach und das Ei trudelte aus. Er massierte seine Schläfen und machte Grimassen, um die Spannung in den Ohren loszuwerden. Als sich der Ausgang öffnete, beeilte er sich, die Gurte zu lösen, schnappte sich die Gitarre und kletterte hinaus.
Zuerst sah er nur Nebel. Allmählich zeichneten sich die Umrisse einer mächtigen Lokomotive ab, die auf den Gleisen hielt und ihre Umgebung in dichte Dampfwolken hüllte. Nach und nach erkannte er Waggons, Gebäude, Gaslaternen und Menschen.
Zischend und rumpelnd setzte sich der Zug in Bewegung. Einige Reisende, die ausgestiegen waren, gingen den Bahnsteig entlang. Er folgte ihnen. Die Frauen trugen Rüschenkleider, geraffte Röcke, einige auch Hosen, Spitzenblusen und enge Korsagen. Die allgemein bevorzugten Farben schienen Braun, Schwarz und Dunkelrot zu sein. Einige der Damen hatten verspielte Hütchen mit Federn oder Zahnrädern auf dem Kopf, andere zünftige Hüte mit Schweißerbrillen. Die Herren waren alle so ähnlich gekleidet wie er selbst. Manche schwangen beim Gehen elegante Spazierstöcke mit silbernen Griffen. Die Luft war erfüllt von Kohlengeruch, Parfümduft und heiterem Geplauder.
Rings um den Bahnhofsvorplatz wuchsen Platanen, in deren Schatten Bänke zum Verweilen einluden. Links und rechts zweigte jeweils eine mit Kopfsteinen gepflasterte Straße ab, gesäumt von Häusern wie aus einer Charles-Dickens-Verfilmung mit Erkern, Türmchen, Stuckfassaden und Butzenscheiben.
Unter einer Platane wartete eine Kutsche. Allerdings war kein Pferd eingespannt. Sie sah eher aus wie ein richtig alter Oldtimer. Statt eines Motors befand sich vorne ein kupferner Wasserkessel, unter dem in einem flachen Ofen ein Feuer brannte. Ein Mann in einem braunen Gehrock und mit Ballonmütze legte Holz nach und überprüfte den Druck auf einer Messingarmatur. In dem Moment schritt eine Dame von hinten an den Automobilisten heran und tippte ihm auf die Schulter. Sie trug einen bauschigen schwarzen Rock, darüber eine taillierte weinrote Jacke mit gekräuseltem Schößchen und schwarzen Zierborten. Der Mann wandte sich um und die beiden fielen sich lachend in die Arme. Fürsorglich half ihr der Gentleman die Stufe hinauf und auf die Sitzbank, dann nahm er neben ihr Platz und legte einen Hebel am Wasserkessel um. Der Dampf schoss durch ein Rohr in die Zylinder seitlich am Fahrzeug. Qualmend ratterten sie auf und nieder, Zahnräder drehten sich und setzten über Metallketten die Räder in Bewegung. Fröhlich winkend rollte das Paar über den Platz davon.
Schmunzelnd blickte er ihnen nach. Anscheinend waren sie frisch verliebt. Wohin sie wohl fuhren?
Wohin sollte er selbst sich als Nächstes wenden?
Am besten konnte er nachdenken, wenn er Musik hörte. Also setzte er sich auf eine Bank, legte den Hut neben sich, holte die Gitarre aus dem Lederbeutel und stimmte die Saiten. Anschließend spielte er ein Intro und begann zu singen: My Happiness, jenes Lied, das er vor langer Zeit für seine Mutter gesungen hatte.
Schon während der ersten Strophe näherte sich eine junge Dame mit kunstvoll hochgesteckter Lockenpracht. Sie sah entzückend aus in ihrem schwarzen Spitzenkleid, den schwarzen Netzstrümpfen und den geknöpften Stiefeletten. Lächelnd blieb sie stehen, um zuzuhören. Nach und nach gesellten sich immer mehr Menschen zu ihr. Alle lächelten, wiegten sich im Takt, wirkten entspannt und schienen jede Menge Zeit zu haben.
Ja, hier würde er sich wohlfühlen. Zur Ruhe kommen und sich selbst wiederfinden. Frei über sein Leben entscheiden. Wieder gesund werden.
Als das Lied zu Ende war, applaudierte das Publikum und hoffte anscheinend auf eine Zugabe. Was sollte er als Nächstes spielen? Mit einem Song über blaue Wildlederschuhe konnte man in dieser Welt vermutlich wenig anfangen. Jailhouse Rock fand er ebenfalls unpassend. Nachdenklich strich er mit den Fingern durch seine Haartolle und schaute nach oben. Über ihm schwebte ein Luftschiff vorbei wie eine dicke bunte Zigarre mit Schwimmflossen und Propellern. Darunter hing eine Fahrgastkabine, die aussah wie eine kleine Arche.
Schauen wir mal, ob sie hier auch Gospels mögen, dachte er und stimmte So High an. Schon nach wenigen Takten wippten seine Zuhörer mit den Füßen und klatschten zu dem flotten Rhythmus. Er strahlte in die Runde. Vielleicht könnte er es hier schaffen, von seiner Musik zu leben und gleichzeitig alles ein paar Nummern kleiner zu halten.
Wieder erntete er viel Applaus. Die junge Dame im Spitzenkleid setzte sich neben ihn und sagte: »Sie haben eine sehr schöne Stimme. Darf ich fragen, wie Sie heißen?«
»Elvis …« Er überlegte. Zu einem Neubeginn gehörte auch ein neuer Name. »Elvis Aaron«, antwortete er. – Ja, das fühlte sich gut an.
»Wären Sie so freundlich, noch ein Lied für uns zu spielen, Mr. Aaron?«
»Mit Vergnügen. Darf ich auch um Ihren Namen bitten?«
»Lisa. Lisa Lovelace.«
»Sehr erfreut, Miss Lovelace. Das nächste Lied ist für Sie.«
Während er It’s Now or Never sang, spürte er, wie der alte Ballast von ihm abfiel.
In der Vergangenheit eine neue Zukunft finden – das soll mir mal einer nachmachen, dachte er. Schade nur, dass zu Hause keiner weiß, dass ich noch lebe.
Damenopfer
von Lina Thiede
London, Oktober 1840
44. Zug
Die Weiße Dame schlägt zurück
Nach einer Explosion gewaltigen Ausmaßes in der Nähe von King’s Cross bekennt sich das Weiße Haus für den Anschlag schuldig. Drei Schwarze Bauern kamen dabei ums Leben, ein Schwarzer Turm wurde schwer verwundet ins nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert …
Als ich aus dem Haus trete, grölt der Zeitungsjunge die Schlagzeile den vorbeieilenden Londonern zu. Immer wieder lese ich halb verborgen von Unterarmen oder Fingern: Die Weiße Dame schlägt zurück. In der Bahn schließlich kann ich die Hälfte des Artikels lesen, während wir über London dahingleiten. Laut Zeitung handelte es sich um eine Rochade in letzter Minute. Und während die Dame evakuiert wurde, sprengte man einen Waggon in die Luft. Ich lasse die Zeitung sinken und sehe aus dem Fenster. Es ist nicht auszumachen, wo der Morgennebel anfängt und der Dampf der Schwebebahn aufhört.
Ich fahre drei Stationen bis zu den Büros des Londoner Guardian. Von den Rolltreppen aus, die die Pendler nach unten zurück ins Stadtleben befördern, betrachte ich die verschlafene Stadt. Rauchende Kamine, der Dampf der Schwebebahn und in der Ferne die Fabriken. Meine Freundin Maud arbeitet dort.
Ich laufe an den Büros vorbei, drei Straßen weiter, bis ich vor einem schmiedeeisernen Tor stehe, das in einen kleinen Privatpark führt. Mehrere Minuten bleibe ich stehen und beobachte. Nichts bewegt sich. Die Information, dass sich hier ein Großteil des Schwarzen Hauses befinden soll, ist frisch. Wahrscheinlich falsch. Meine Informanten nutzen Gerüchte und Phantome als Quellen ihres Vertrauens. Da sehe ich eine Bewegung hinter einer Eiche. Ein Hut, der abgenommen wird. Ein schwarzer Zylinder. Der Schwarze Turm? Ich kneife die Augen zusammen. Könnte ehrlich gesagt jeder und keiner sein dort hinter dem Baum. Trotzdem hole ich mein Notizbuch aus der Handtasche und notiere:
Der Schwarze Turm wurde in einem Park nahe Piccadilly gesichtet. Ich hebe den Kopf und lasse meinen Blick über den restlichen Park schweifen. Außer einem eifrigen Eichhörnchen ist nichts zu sehen. Ein Schulterzucken reicht mir als Berechtigung für die folgende Notiz: Er befand sich in fragwürdiger Gesellschaft. Droht der nächste Schlag gegen das Haus der Weißen? Das muss reichen. Ich streue ein paar Fakten über den Anschlag in King’s Cross ein und tue so, als hätte ich verstanden, wo das Ganze hinführen soll. Das ist Gesprächsstoff für eine Woche. Das Spiel der Damen versetzt London seit Monaten in Aufruhr. Es begann mit einem Mord auf offener Straße. Ein Säureangriff. Ein Weißer Bauer besiegte einen Schwarzen Bauern. Der Mörder stürzte aus einer Seitengasse auf den Spieler des Schwarzen Hauses zu und drückte den Abzug seiner Säurepistole. Durch den Schwall starben außer dem Bauern auch drei Zivilisten. Zunächst versuchte die Polizei zu agieren, doch wie schnappt man jemanden, der im Auftrag einer Königin handelte, wenn man selbst im Auftrag der Königin handelt? Die Frage ist nur, für welche Königin arbeiten wir? Weiß oder Schwarz?
Die Menschen glauben alles, wenn man es richtig verpackt. Und sie verzehren sich nach guten Geschichten. Der Kampf um den Thron ist Gesprächsthema Nummer eins. Eine vergessene Nachfahrin der Tudors nennt sich die Schwarze Königin und tritt gegen Victoria an. Victoria, die den Thron nach ihrem Onkel Wilhelm IV. erklimmen sollte, musste fliehen, als sich der Schwarzen Königin immer mehr Briten anschlossen. Voller Skepsis wird Victoria nur noch die Weiße Königin genannt. Zu schwach, um zu regieren. Zu unschuldig, um zu kämpfen. Statt eines Krieges, der Zivilisten leiden ließe, tragen die Damen ihren Streit um die Thronfolge mittels Spielern aus. Sie spielen das Spiel der Könige. Und in England herrscht Schach.
Das Volk ist überzeugt: Wer das Spiel gewinnt, wird rechtmäßig herrschen und den Menschen Frieden bringen.
Doch das Spiel ist noch lange nicht entschieden. Die Verluste waren auf beiden Seiten hoch. Fünf Weiße Bauern, ein Weißer Läufer, beinahe ein Weißer Turm. Für das Schwarze Haus starben vier Bauern und ein Springer. Und es gingen Gerüchte um, die Dame habe um ein Haar den Kopf verloren, als sie den Turm beschützt hat.
Meine Arbeit für den Londoner Guardian besteht zwar zum Großteil daraus, mir auszudenken, was die Spieler getan haben sollen, doch der Lohn ist es wert. Wenn ich das mit Maud vergleiche, dann geht es mir besser. Ich muss mich nur mit der Tinte herumschlagen, die meine Finger nicht loslässt.
Eine Weile streife ich durch die Straßen, halte die Augen offen, frage ab und an Verkäufer nach Vorkommnissen in der Gegend. Die Menschen sind dazu übergegangen, sich mit halben Rüstungen auszustatten, manche Menschen tragen verstärkte Brillen, die an ihren Hinterköpfen mit einer Schnalle befestigt sind. Wir haben Angst vor Explosionen, vor Pistolenschüssen, vor Säureangriffen, vor Entführungen. Wer weiß, wie weit dieses Spiel noch geht. Mein Korsett ist verstärkt mit Kupfer, dementsprechend schwer ist es. Im Sommer ist das kaum auszuhalten. Ich frage eine Traube Jugendlicher, die vor einem Café auf Einlass wartet, ob sie in letzter Zeit etwas Verdächtiges bemerkt hätten. Niemand will mit mir reden. Also habe ich nichts. Die Lüge über den Schwarzen Turm muss reichen.
Nachdem ich meinen Artikel im Büro abgegeben habe, ist es spät genug, um nach Hause zu fahren. In der Schwebebahn sehe ich hinaus auf die vorbeirauschenden Häuser. Die Sonne geht bereits unter. Ich schleppe mich in die Bedford Street, winke Mr Oldman zu, der eben seinen Laden abschließt, und erklimme die Treppe in den ersten Stock. Mein Rücken ist ein einziger Krampf, als ich die Wohnung betrete, die ich mir mit Maud teile. Ich schleudere meine Schuhe in eine Ecke, zerre die Schnüre meines Korsetts auf und nehme den ersten tiefen Atemzug des Tages.
»Mein Gott«, seufze ich, werfe mir eine Strickjacke über, entfache ein Feuer im Ofen und setze mich dann mit einem Schluck Sherry in den Ohrensessel, den ich von meinem Vater geerbt habe. Ich könnte etwas lesen, aber meine Augen sind müde. Ich überlege, einfach hier sitzen zu bleiben, bis Maud heimkommt. Da ertönt hinter mir ein Räuspern, und ich verschütte vor Schreck ein wenig Sherry auf mein Kleid. »Himmel!«, rufe ich. Ein Mann tritt aus dem Schatten des Schlafzimmers heraus. Er trägt einen pechschwarzen Anzug, hält eine schwarze Melone in der Hand. Sein Haar hat er mit reichlich Pomade zurückgelegt. Stechend grüne Augen bohren sich in meine.
»Du hast die Nachricht erhalten, Madame?«
»Ja«, erwidere ich. »Das sind mitunter die schlechtesten Neuigkeiten seit langem.«
»Ja, Madame.«
»Wir können unmöglich zulassen, dass Victoria den Thron für sich beansprucht. Es läuft so gut für London und die Welt.«
»Eventuell ist dieses Treffen, das sie mit mir verlangt, nicht so bedeutend, wie wir denken.«
»Mein lieber Timothy«, sage ich und gieße mir Sherry nach. »Die Weiße Königin will mich treffen. Diejenige, die sie anscheinend herausgefordert hat. Wenn herauskommt, wer ich bin – dass ich nichts weiter als eine kleine Reporterin bin –, dann sind wir alle geliefert.«
»Wir wussten, welches Risiko wir eingehen, Madame.«
Ich stürze den Sherry hinunter und huste. »Ich werde mich verkriechen.«
»Das kannst du nicht, Patty«, sagt der Turm da sanft. Ich schüttele den Kopf und verberge das Gesicht in den Händen. »Du musst dich ja nicht zeigen.«
»Was soll ich stattdessen tun?«
»Das, was du mit dieser ganzen Sache bezwecken wolltest. Gewinne das Volk für deine Seite. Dann gewinnst du auch diesen Krieg.«
Ich nicke in Gedanken versunken. »Berufe alle für ein Treffen ein. Ich bin in einer Stunde da.«
Der Schwarze Turm steht schwungvoll auf, setzt den Hut auf und geht zur Tür. »Wir sehen uns später.« Als er die Tür öffnet, offenbart er Maud, die mit gezücktem Schlüssel dasteht, im Begriff, aufzuschließen. »Miss«, sagt er und nickt ihr zu. Dann geht er an ihr vorbei.
Maud starrt ihm nach. »Wer war’n das?«, will sie wissen und legt langsam ihren Mantel ab. Ich rieche den Qualm und den Rauch, der ihr nach zehn Stunden Arbeit in der Fabrik anhaftet. Sie hustet und krümmt sich dabei angestrengt. Seit einigen Wochen geht das schon so. Heute wirkt sie besonders erschöpft. Ich kann das nicht mit ansehen, springe auf und helfe ihr dabei, Schuhe und verrauchtes Kleid auszuziehen. »Tee?«, frage ich.
»Sherry«, sagt sie. Ich nehme ein Glas aus der Vitrine neben dem Bücherregal und schenke ihr einen Schluck ein.
»Harter Tag?«
Sie nickt.
»Und wer war das nun, Patty?« Sie grunzt, als sie ihre Füße auf den Futon legt, in Richtung des Ofens.
Ich sehe sie an. Wie viel kann ich ihr erzählen? So lange schon lasse ich sie im Dunkeln, tische ihr Lüge um Lüge auf. Wenn ich jetzt enthülle, wer ich in den letzten Monaten war, dann nimmt das kein gutes Ende, da bin ich mir sicher. Ich räuspere mich und sage dann: »Das war einer vom Schwarzen Haus.«
Maud verschluckt sich. »Bitte?«
»Der Turm.«
»Du verulkst mich doch?«
Ich schüttele den Kopf und beschließe dann, mit dem Schürhaken im Ofen herumzustochern, um meine Hände zu beschäftigen. »Sie planen eine offene Revolution gegen Victoria.«
»Patty! Lass dich da nicht mit reinziehen!«
»Ich kann schlecht einen königlichen Befehl ignorieren, oder?«
»Bisher ist noch niemand zur neuen Königin gekrönt worden, also lass es. Stell dir vor, das Haus der Weißen findet heraus, dass du mit den Schwarzen verkehrst. Meinst du nicht, du gerätst dann zwischen die Fronten?«
Mein Blick verschwimmt in den Flammen, erst als einer der Scheite laut knackt, sage ich leise: »Ich kann nicht vergessen, was Victorias Vorgänger meiner Familie angetan haben. Ich kann einfach nicht.« Ich sehe hinüber zu Maud, doch die ist längst eingeschlafen. Sie schnarcht leise. Erst will ich mich über sie ärgern, doch dann breite ich vorsichtig eine Decke über sie, verbanne die Gedanken an meinen Vater und meinen Bruder am Galgen aus meinem Kopf und kleide mich an. Auf Zehenspitzen verlasse ich die Wohnung.
Die Schwebebahn fährt nachts nicht mehr. Stattdessen nehme ich eine Droschke. Die Gaslaternen tauchen die Straßen in ungesund grünes Licht. Man könnte meinen, Mary Shelley hätte diese Nacht geschrieben. Gänsehaut überzieht meine Unterarme. Kalter Schweiß rinnt mir den Rücken hinab. Das schwere Korsett verwandelt jeden Atemzug in eine Kostbarkeit. »Verflucht«, keuche ich. »Reiß dich zusammen, Pontifax.« Bevor die Droschke vor dem unscheinbaren Pub, dem Golddigger, zum Stehen kommt, schlage ich meine Kapuze hoch und greife nach dem schwarzen Gehstock. Hastig bezahle ich den Fahrer und klettere dann aus der Kutsche.
Joseph poliert Gläser, als ich den Pub betrete. Er nickt mir zu. »Sie warten«, raunt er, als ich an ihm vorbeirausche. Ich neige den Kopf zum Dank und bahne mir den Weg in den hintersten Teil des Pubs. Er ist selten gut besucht. Joseph ist einer meiner Bauern. Mit klammen Fingern schiebe ich den Wandbehang beiseite und steige die unebenen Steinstufen hinab in den Keller.
»Madame«, begrüßt mich der Läufer, die Bauern erheben sich, stellen ihre Gläser ab, glätten ihre Uniformen.
»Guten Abend«, sage ich außer Atem. Mir war nicht bewusst, dass ich die Luft angehalten habe. Alle Herren verbeugen sich. »Wie geht es dem Turm?«
»Er wird es überleben, Madame, jedoch um ein Bein leichter.«
»Grausame Verluste diese Woche«, seufze ich. Nicken, der ein oder andere tritt unangenehm von einem Fuß auf den anderen. »Sagt frei heraus, was ihr denkt, meine Herren.«
»Es hätte nicht sein müssen«, sagt ein Springer. Er steht auf, fährt sich wütend durchs Haar und sieht allen in die Augen, nur mir nicht. Wut verdrängt meine Nervosität, ganz langsam. »Wir hätten schon längst einen Großangriff wagen sollen.«
»Und riskieren zu verlieren und das Königreich wieder in eine brutale Monarchie zu stürzen?« Mein Turm, Timothy, steht ebenfalls auf und legt mir eine Hand auf die Schulter. »Madame gibt ihr Bestes.«
»Ja?« Der Springer stemmt die Hände in die Hüften und richtet seinen erbosten Blick nun auf mich. Auch ich erhebe mich. »Madame wird um ein Treffen gebeten. Sie soll Victoria treffen. Die Weiße Dame will verhandeln.«
»Es sind leere Worte. Man will die Schwarze Dame in einen Hinterhalt locken.«
»Die Dame sollte mit Bedacht eingesetzt werden«, stimmt ein älterer Bauer zu. Dockery pafft eine Zigarette. »Sich kopfüber ins Risiko zu stürzen hat bisher den wenigsten etwas gebracht. Außer den Tod.«
Gelächter ertönt.
»Einen Springer kann ich leicht ersetzen, Higgins«, warne ich den wütenden Mann. Er sieht sich um, sucht nach Unterstützung, findet jedoch keine. »Setz dich oder meine Drohung wird Wahrheit.« Ich neige den Kopf. Er schluckt, setzt sich hastig hin und schweigt. »Gut.« Ich wende mich an Timothy. »Wir werden deine Idee verfolgen. Der Turm sieht es als angemessene Lösung, das Volk schnellstmöglich auf unsere Seite zu bringen, … das Volk mit uns kämpfen zu lassen.«
»Dann sind wir nicht besser als die anderen.«
»Wie war das?«
Der alte Mann drückt seine Zigarette aus. »Ihr wolltet keinen Krieg für die normalen Leute, deswegen haben wir uns gemeldet. Wenn Ihr dieses Versprechen brecht, verliert Ihr Spieler. Das wollt Ihr nicht, Schwarze Königin.«
»Nein«, flüstere ich und sehe zu Timothy hoch. Die Angst, alles falsch zu machen, hat so plötzlich Besitz von mir ergriffen, dass ich vergesse, wen ich spiele. »Was sollen wir tun?«
»Wir verhalten uns ruhig und planen unseren Angriff«, sagt er. »Aber er hat Recht. Wenn wir jetzt das tun, was wir versprochen haben, nicht zu tun, dann sind wir nicht besser als Victoria.«
»In Ordnung«, sage ich und sehe in die Runde. »Ihr habt den Turm gehört, wir bleiben unauffällig, wir finden einen besseren Weg zum Sieg.«
Timothy entlässt die Spieler und wir bleiben allein zurück. Joseph bringt uns zwei Whiskey. Schweigend verfolgen wir unsere eigenen Gedanken. Als die Gläser leer sind, gibt Timothy mir einen Kuss und zieht mich auf die Beine. »Ich bringe dich nach Hause«, sagt er. Wir steigen die Treppe hinauf, wünschen Joseph eine gute Nacht und stehen dann in Erwartung einer Droschke vor dem Golddigger. »Lass dich nicht entmutigen, Patty. Du machst das gut. Nur wenn die anderen ihr Mitspracherecht behalten, können wir für unsere Zukunftsidee kämpfen.«
»Jeder soll mitreden dürfen«, bestätige ich. Erschöpft lehne ich mich gegen ihn. »Trotzdem wünsche ich mir manchmal, ich hätte diese Sache nicht ins Rollen gebracht.«
Timothy drückt mich an sich, ich spüre nur seine Arme an meinen Oberarmen, durch den Schild, der meinen Brustkorb umschließt, dringt keine Wärme, keine Umarmung.
Das Scharren von Metall auf Stein reißt uns auseinander und schließlich ein Schuss.
45. Zug
Timothy fängt Pattys erschlafften Körper auf. Er schreit dem Schützen hinterher, dann erst sieht er die Schusswunde an ihrer Schläfe. Ein weißer Schatten eilt davon und verschwindet in einer Seitengasse. Timothy senkt den Blick, und ein Zittern packt ihn, lässt ihn nicht los. Er starrt auf Pattys offene Augen und das Blut, auf die erstaunt geöffneten Lippen.
»Nein«, flüstert er immer wieder. Erst als Joseph ihm die tote Dame aus den Armen nimmt und in den Pub trägt, rührt sich Timothy wieder. Mit den Händen fährt er sich übers Gesicht, versucht die Tränen fortzureiben, den Schmerz fortzuwischen. Schließlich steht er auf und geht zurück in den Pub. Er greift sich eine Flasche Whiskey und verschwindet im Keller, wo er darauf wartet, dass die anderen eintreffen. Joseph lässt nach ihnen schicken und als er inmitten der Männer sitzt, die entmutigt dreinschauen, hebt er das Glas: »Auf die Schwarze Dame.« Leise echot der Klageruf durch den Keller. »Sie dachten, sie würden uns damit bewegungsunfähig machen.« Er schüttelt den Kopf. »Nein. Sie lagen falsch. Wer weiß, was es mit einer Bauernumwandlung auf sich hat?«
»Dafür müssten wir ins Hauptquartier der anderen kommen, Turm. Wir wissen nicht, wo sie sich verstecken.« Nicken folgt seinen Worten.
»Oh, ich werde es herausfinden. Doch zuerst brauche ich einen geeigneten Freiwilligen.« Timothy steht auf, schwankt, stützt sich in letzter Sekunde auf seinem Stuhl ab und deutet auf Dockery. »Wie wäre es, wenn du Victoria die letzte Ehre erweist?« Dockery steht ebenfalls auf. »Falls du einzig aus Rache für Patty dazu aufrufst, lehne ich –«
»Nein!«, brüllt Timothy. »Ich will ihren Kopf rollen sehen, weil es reicht mit der Monarchie.« Er schmettert die leere Flasche auf den Boden. Das Geräusch des splitternden Glases durchflutet den Raum. »Ich will, dass es aufhört, dass die Menschen wieder wissen, in was für einer Gesellschaft sie leben, und ich will für uns alle Genugtuung, wenn Victoria nicht weiß, wie ihr geschieht, wenn sich ein Bauer in eine Dame verwandelt und sie in die Knie zwingt.«
Dockery legt Timothy die Hände auf die Schultern. Scherben knirschen, als er nähertritt. »Ich tue es«, sagt er. Jubel hüllt den Keller in Nebel.
Es folgt ein Monat, in dem Zeitungsjungen Meldeketten errichten. Manche enden schwarz, manche weiß. Die Zeitungen drucken wirre Gerüchte, weil nichts geschieht. Die Menschen munkeln, die Schwarze Dame sei verschwunden, vermuten, das Spiel sei vorbei. Straßenkämpfe zwischen Weißen und Schwarzen Anhängern füllen die Abende.
Königin Victoria sitzt derweil zufrieden in ihrem Versteck und plant die nächsten Züge. Wenn Ruhe herrscht, kann sie die Schwebebahn über sich rattern hören. Sie schickt die Hälfte ihrer verbleibenden Spieler aus, um einen Großangriff durchzuführen. Siegessicher verlangt sie nach Champagner. Und Champagner wird gebracht. Der alte Herr hat eine Zigarette im Mundwinkel. »Du bist neu, ich habe dich hier noch nie gesehen«, sagt sie, als sie das Glas entgegennimmt.
»Und das werdet ihr auch nicht mehr«, erwidert er freundlich. Er löst die weiße Robe von seinen Schultern und entblößt ein schwarzes Gewand, auf dem das Zeichen der Dame prangt.
»Was soll das werden?«
»Das, liebe Frau, nennt sich Bauernumwandlung. Ich werde zur Dame und werde euch töten.« Dockery zieht an seiner Zigarette und die Pistole aus seinem Beinhalfter.
»Schachmatt«, sagt er und drückt ab.
Braunkreuz
von Michael Schmidt
Deutschland, 1924
Die Gummihaut umschloss ihren rasierten Kopf passgenau, so wie auch den restlichen Körper. Sie holte tief Luft, dann brachte ihre Gefährtin Uli das Luftventil an, schloss den oberen Teil der Apparatur, und es wurde dunkel um Alice.
Sie bekämpfte den Anflug an Panik, der sie in solch einem Moment immer heimsuchte. Alice kontrollierte ihren Atem. Ein, aus, ein, aus, immer im gleichen Rhythmus. So konzentriert wurde sie sich nach und nach ihres gesamten Körpers bewusst. Die Füße, die Beine, das Becken, der Magen, die Lunge, das Herz, weiter nach oben. Die Schultern, die Arme, die Finger, wie weggewischt war ihre Unruhe.
Eins mit sich lag sie bereit, während der Fluttank mit einer selbst entwickelten Sauerstoffmischung befüllt wurde und sich das Luftventil, das ihr im Mund steckte, auflud.
Die Prozedur würde eine halbe Stunde dauern, und danach war sie in der Lage, sich selbst für zwei Stunden autark mit Luft zu versorgen.
Erneut spürte sie ihren Körper. Ein leichtes Stechen im Knie, ein Zwicken im Rücken und eine latente Entzündung im linken Ellenbogen. Alice musste sich eingestehen, dass sie langsam alt wurde. Nicht mehr lange, und sie würde ihren runden Geburtstag feiern. Sie war immer noch fit, hatte kaum ein Gramm zu viel an ihrem Körper. Ihr Arzt bei Volt war der Meinung, dass sie ihren Körper zu sehr forderte, dass sie schon fast zu mager war, um dauerhaft gesund zu bleiben. Alice hatte ihren eigenen Kopf, und ihr jetziger Zustand war schon ein Kompromiss, sie selbst würde es noch weiter treiben, aber Uli war strikt dagegen, und zusammen mit Dr. Neimann hatten sie sich auf diesen Mittelweg geeinigt.
Im Kopf beschäftigte sie sich mit dem Plan, in die Anlage einzudringen, um die Welt vor dieser furchtbaren Gefahr zu bewahren. Schritt für Schritt ging sie den skizzierten Weg durch, den sie auswendig aufsagen konnte. In der Beziehung war sie unglaublich pedantisch, und es hatte ihr ein ums andere Mal das Leben gerettet.
Sie war die einzelnen Schritte kaum zu Ende durchgegangen, hatte hier und da die Situation nochmal von allen Seiten kritisch betrachtet, da zischte es, und der Fluttank öffnete sich. Blondschopf Uli sah sie verliebt an, und Alice spürte ein warmes Gefühl im Bauch. Eine trügerische Zuversicht machte sich in ihr breit. Sie riss sich zusammen, konzentrierte sich und machte sich bewusst, welche Risiken bestanden. Sie war bereit. Ihre Handballen waren feucht vor Aufregung. Alice war bereit für den Einsatz.
Alice nahm das Luftventil in den Mund, zog die Gummihaut über den Kopf und stürzte sich in die dreckigen Fluten des Rheins. Das Wasser war grünbraun, eine Mischung aus Schlamm, verseuchtem Abwasser und diversen Trübstoffen. Trotz der schützenden Gummihaut fühlte sie sich dreckig, während sie durch die trübe Brühe tauchte. Aber Sauberkeit war noch das geringste der Probleme, die auf sie zukommen würden.
Eine Viertelstunde tauchte sie durch die Fluten, immer dem östlichen Ufer zugewandt. Endlich passierte sie das erste Abwasserohr, dann das zweite, und wenig später hatte sie ihr Ziel erreicht. Das besonders große dritte Abwasserrohr gehörte der Bayer AG und leitete den vielfältigen Schmutz aus der Industrieanlage in Wiesdorf in den Rhein – und das waren nicht nur Rückstände aus den Farbenproduktionen. Diese verdächtige Brühe war der Grund für ihren Einsatz. Volt bekämpfte jegliche Missstände der Industrie, und Kampfgase hatten da oberste Priorität. Alles sah danach aus, dass die I.G. Farben aus der Taufe gehoben wurde, und es sprach vieles dafür, dass das neue Chemiekonglomerat nicht nur friedliche Zwecke erfüllte.
Alice schwamm durch das breite Rohr, zählte erneut die Abzweigungen. Nach kurzem Zögern wählte sie ein schmales, unscheinbares Rohr linker Hand. Sie tauchte noch gut zehn Minuten durch ein sich verzweigendes Gewirr, bevor sie ihr Ziel erreicht hatte. Eine unbedeutende Anlage zur Herstellung von Aspirin, die nicht überwacht wurde. Sie stieg an Gittern vorbei, Treppen hinauf und öffnete Türen, die ihrem Dietrich nicht widerstehen konnten.
Als sie die Straßen des Chemieparks erreichte, holte sie tief Luft.
Das Werksgelände war ein düsteres Grau-in-grau, selbst bei Tageslicht konnte es hier kaum besser aussehen. Wer hier zur Arbeit abgestellt war, kam sich bestimmt vor wie ans Ende der Welt verbannt.
Alice sondierte die Lage. Nirgends rührte sich eine Menschenseele. Die Luft schien rein, und so überquerte sie vorsichtig die Straße und näherte sich dem Produktionsgebäude für Chlorgas. Unweit davon war ein hohes, kegelförmiges Gebäude, das sich noch im Bau befand. Dort sollte das neuartige Kampfgas Braunkreuz entwickelt werden, das den Krieg revolutionieren sollte. Weißkreuz (Augenkampfstoff), Blaukreuz (Nasen und Rachen), Grünkreuz (Lunge) und Gelbkreuz (Haut) sowie Rotkreuz (Nesselstoffe) gab es schon, und das Braunkreuz sollte all diese chemischen Kampfstoffe weit übertreffen. Die genaue Funktionsweise war Volt unbekannt, aber es war sicher, dass es dem Deutschen Reich einen unglaublichen Vorteil im nächsten Krieg gewähren konnte. Ein Krieg, den Volt verhindern wollte. Die Spannungen zwischen dem Deutschen Reich und dem Franzosenreich hatten sich intensiviert und glichen mittlerweile einem Pulverfass. Noch hielt sich das Deutsche Reich zurück, aber ein Durchbruch in der Kampfmittelforschung wäre ein gutes Argument für all die Kriegstreiber, deren Stimmen sich gerade erhoben und die in den völkischen Propagandamedien gezielt verbreitet wurden.
Doch so weit durfte es nicht kommen, deshalb musste Alice auf jeden Fall erfolgreich sein. Unsichtbar für fremde Blicke huschte Alice durch die Straßen, verharrte immer wieder regungslos in Nischen, das Gehör auf das Äußerste gespannt, bevor sie tiefer in den Park drang.
Unwillkürlich tastete ihre Hand nach der Patrone, die sie im Rucksack trug. U3+ in einem Wassermantel, und sobald sie das Siegel brechen würde, dauerte es nur wenige Minuten, bis die Reaktion begann und das Fabrikgebäude unwideruflich zerstört wäre.
Dieses Ereignis würde sie allerdings verpassen, da sie dann schon auf dem Rückweg sein wollte und sich das Spektakel aus der Ferne ansehen würde.
Gerade wollte sie um die Ecke biegen, da warnten sie alle Sinne. Sie erstarrte zu Stein, presste sich an die raue Wand und schärfte ihre Sinne.
Da! Ein kratzendes Geräusch!
Alice hielt ihre pneumatische Armbrust bereit und zückte ihr Messer, spannte die Muskeln, trotzdem wurde sie überrascht.
Sie spürte den Einschlag im rechten Oberschenkel, noch bevor sie den Schuss hörte. Sofort ließ sie sich fallen, schoss selbst auf gut Glück, rollte sich zur Seite und begann den Rückzug. Holzpfeile und -geschosse schwirrten um sie herum, streiften ihre Arme, ihre Beine, ihren Bauch, während sie selbst mit der Armbrust die Reihen der Angreifer dezimierte. Sie rannte, so schnell es ihr verletztes Bein möglich machte. Alice drängte den Schmerz in den Hintergrund, warf die wasserstoffgefüllten Handgranaten, eine nach der anderen, um ihren Rückzug zu decken. Die Todesschreie der Angreifer waren Musik in ihren Ohren, und mit aller Energie, die sie aufzubringen in der Lage war, erreichte sie die Unterwelt, stieg in das nächstbeste Abwassersystem, ohne genau zu wissen, wohin es sie treiben würde.
Der Schmerz war allgegenwärtig in ihr. Sie schwamm um ihr Leben, einzig der Überlebenswille trieb sie an, und als sie plötzlich in das Gesicht ihres geliebten Blondschopfs blickte, flossen die Tränen wie ein nie versiegender Strom aus ihren Augen, bevor es für lange Zeit dunkel um sie wurde.
Feuer waberte um sie herum, brannte in ihren Beinen, fraß sich zu den Füßen und den Zehen vor. Ihre einzige Empfindung war der Schmerz, ein infernalischer, alles beherrschender Schmerz. Schweiß rann in Bächen ihre Stirn herunter. Sie spürte die Hitze des Feuers, aber keinen Rauch. Ihre Nase schien völlig gefühllos, ihr Geruchssinn neutralisiert. Alice nahm die Welt wie durch einen Schleier war. Als ob sie durch Rauchschwaden sah, aber da war kein Rauch. Verschwommene Gesichter tauchten auf, verschwanden. Tauchten auf und verschwanden. Sie wollte brüllen, ihren Schmerz herausschreien, aber kein Ton verließ ihre Kehle. Ihre Kehle, die trocken war wie Erde, die der prallen Sonne ausgeliefert war. Sie fühlte sich wie Erde, bröselig, zerfallen und allem ausgeliefert. Sie sah, wie das Tageslicht schwand, und schon nahm sie die Nacht gefangen.
Erneut spürte sie die Pein in sich. Doch diesmal war es anders. Kein Feuer malträtierte sie, keine Schwaden ohne Rauch nahmen ihr die Sicht. Ermattet lag sie da, fast gefühllos, wenn nicht der vermaledeite Schmerz in den Beinen wäre. Mit letzter Kraft wollte sie sich aufrichten, da stellte sie erstaunt fest, dass ihre Arme angebunden waren, fixiert mit einem breiten Riemen, der verhinderte, dass sie sich aufsetzte. Entsetzt sah sie auf ihre linke Hand beziehungsweise das, was stattdessen da war. Ein Armstumpf, der in einem blutdurchtränkten Verband endete. Ein Zittern ergriff sie, durchfuhr ihren ganzen Körper. Ihr Herz wurde von einer eisernen Faust umklammert, und mit letzter Mühe schnappte sie nach Luft. Schreiend verlor sie das Bewusstsein.
Uli schaute mit Verbitterung auf ihre Gefährtin. Alices Wangen waren eingefallen, und tief hatte sich der Schmerz in ihr Gesicht eingegraben. Uli glaubte, noch immer Zuversicht in Alice’ Zügen zu lesen, die Kraft, die in ihrer Freundin steckte und die sie niemals aufgeben ließ.
Einbildung. Du willst sie so sehen!
Alice hatte den Kampf nur schwer verwundet überlebt. Uli sah zu Dr. Emmi Neimann, der großen, fülligen Ärztin, die gar nicht danach aussah, so feinfühlig an ihrer Freundin operiert zu haben. Aber sie hatte alles Menschenmögliche getan und mit Sorgfalt und Ruhe versucht, die Krise ihrer Patientin vorübergehen zu lassen.
»Ob Alice das überstehen wird?«
»Körperlich definitiv«, antwortete Dr. Neimann. »Sie ist gut in Schuss, trotz ihres fortgeschrittenen Alters. Alice hat gutes Heilfleisch und vor allem den absoluten Willen, wieder gesund zu werden. Aber wird der Wille auch da sein, wenn sie realisiert, was geschehen ist?« Dr. Neiman schaute Uli ernst an. »Widmen Sie ihr all die Liebe, die in Ihnen steckt.«
»Ach, Dr. Neimann, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich danke Ihnen von Herzen. Sie haben Alice das Leben gerettet. Die Amputation war ihre einzige Chance, und sie haben Gottseidank keine Sekunde gezögert. Ich hätte das nicht gekonnt!«
Ein liebevoller Blick traf Uli. Dr. Neimann hatte graublaue Augen, und darin lag viel Zuneigung.
»Sie wird dank Ihrer Hilfe, Uli, wieder so werden wie vor den Verletzungen. Ach was, sie wird stärker zurückkehren, auch dank meiner Erfindungen. Helfen Sie ihr über die erste Zeit hinweg, und ihre Gefährtin wird zu nie gekannter Stärke finden. Soll ich anfangen?«
Dr. Neimann fing einen zustimmenden Blick auf, gab sich einen Ruck und begann mit den Vorbereitungen. Sie würde alles daransetzen, dass Alice sich würde rächen können. Und das würde schneller möglich sein, als alle sich das vorstellen konnten.
Einige Tage später
Die verfallene Fabrik im Niemandsland des aufgegebenen Industrieparks Carlsberg in Mühlheim war schon monatelang das Versteck der Organisation Volt. In der Vergangenheit mussten sie mehrmals das Quartier wechseln, da ihnen die Polizeibehörde auf die Schliche gekommen war, und einige Male war ihre Flucht denkbar knapp gewesen. In Carlsberg dagegen schien sie niemand zu vermuten. Oder hatten sie einen Spion in den eigenen Reihen, der auf die große Chance wartete, ihrer Organisation den vernichtenden Schlag beizubringen?
Uli war sich dessen sicher, und es gab Gerüchte, eine Art Trojanisches Pferd namens Tesla würde noch wichtige Informationen sammeln, bevor es losging. Im Sterben hatte Paula ihr gegenüber Andeutungen gemacht. Dass es eine Organisation in der Organisation gab und diese für die Gegenseite arbeitete. Eine Gruppe, vielleicht auch nur eine einzelne Person, die versuchte, Volt von innen zu sabotieren, und Informationen an die Mächtigen weitergab. Paula, die Sonderbare, bei der man nie wusste, woran man war, und der Uli es durchaus zugetraut hatte, für mehrere Seiten zu arbeiten.
Doch niemand wusste, wer hinter Tesla steckte, und so blieb Uli nichts anderes übrig, als auf der Hut zu bleiben. Und außer Uli und Dr. Neimann wusste niemand von Tesla. Und so hatte Uli auch geheim gehalten, dass Alice überlebt hatte. Offiziell berichtete sie, dass ihre Gefährtin nicht wieder zurückgekehrt war.
Sie sah in die Runde. Vierzig Frauen und Männer, das war die schlagkräftige Truppe, die Volt bildete, und vier Frauen und vier Männer waren stellvertretend hier, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Lizzy, die schlanke und hochgewachsene Amazone, stand auf und ergriff das Wort. »Wir gehen erneut nach Wiesdorf, aber diesmal mit allen Mitteln. Greifen wir aus verschiedenen Richtungen an und vernichten die Kampfmittelanlage ein für alle Mal, bevor das Deutsche Reich dem Franzosenreich den Krieg erklärt. Und wir können gleichzeitig Alice rächen. Worauf warten wir noch?«
Mit Feuer in den Augen sah sich Lizzy um, blickte reihum Friedrich, Richard, Bernhard und Michael auffordernd an, ihr Blick glitt weiter zu Uli, Levi und Erika.
»Worauf warten wir?«, stellte Lizzy die rhetorische Frage. »Die rechnen so schnell nicht mit einem erneuten Angriff. Noch haben wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Machen wir diese teuflische Anlage dem Erdboden gleich!«
»Gemach«, warf Uli ein. »Das stimmt schon. Die rechnen nicht so schnell mit uns. Aber die nächsten Tage erwarte ich kaltes und klares Wetter, und das zu Vollmond. Am 2. Juni ist Neumond und das Wetter soll schlechter werden. Schlagen wir doch genau an Neumond zu.«
Ein zustimmendes Murmeln erhob sich.
In Lizzys eiskalten blauen Augen blitzte es. »So soll es sein!«
Alice lief, was das Zeug hielt. Schweiß rann ihre Stirn herunter, während sie sich weiter verausgabte, schwer pumpend noch einen letzten Spurt anzog. Ihre neuen Beine funktionierten tadellos, besser noch als die alten.
Ein schmerzhafter Stich in der Brust durchfuhr sie, als sie an den Kampf und die Folgen dachte. Noch verbissener zog sie ihren Spurt durch, holte das Letzte aus ihrem Körper raus und stellte mit Befriedigung fest, dass sie körperlich völlig auf der Höhe war. Sie brach den Spurt ab, trudelte noch ein paar Meter vorwärts und ging pumpend zurück zu Dr. Neimann.
Ihr melancholischer Anfall war vergangen. Sie kam mit den neuen Beinen tadellos zurecht, und auch die »Optimierung«, für die Dr. Neimanns Erfindung sorgte, funktionierte einwandfrei.
Sie fühlte sich wie Jane Carter in Eva Rice Burroughs Marsgeschichten. Mutig, in einem starken Team und mit dem moralischen Auftrag, die Welt zu retten.
Alice war bereit. Tesla würde zur Rechenschaft gezogen. Wenn sie doch nur wüsste, wer es war. Aber Alice war sich sicher, an Neumond würde Tesla büßen. Und wenn es ihr eigener Untergang war.
Zwanzig Frauen und zwanzig Männer zogen in den Kampf gegen die Bayer AG und ihren neuartigen Kampfstoff Braunkreuz. Sie würden die Produktionsanlage heute Nacht vernichten. U3+-Granaten, Dampfpatronen, pneumatische Armbrüste und Messer für den Nahkampf, die Ausrüstung stimmte und ein Blick in die Kämpfer zeigte Uli: Alle waren bis aufs Äußerste bereit. Ein Alles-oder-nichts-Einsatz, die Hälfte von Volt würde entweder den großen Ruhm einheimsen oder untergehen.
Hinter der Zuversicht verspürte Uli auch ein wenig Angst, räumte dem Gefühl aber keinen Platz ein.
Wir schaffen das!
Lizzy, die den Einsatz leitete, gab letzte Instruktionen, wiederholte Einzelheiten, die jeder auswendig kannte, aber jeder sog es ein letztes Mal gierig auf.
Kurz danach kam das Startsignal, und die vierzig Menschen gingen in die Schlacht gegen einen übermächtigen Chemiekonzern. Der heute Nacht eine krachende Niederlage erleiden würde.
Der Chemiepark lag scheinbar still und verlassen da. Eine flache Ebene, im Süden und Osten begrenzten lichte Waldstücke die kasernenhofartig angelegte Fabrik. Die Gebäude waren rechteckig angeordnet. Der Bereich, der das Zielobjekt von Volt war, lag im Südosten, direkt am Rhein. Vier Blöcke und etwas abseits ein quadratischer Block mit sechs ineinander übergehenden Häusern. In dem vierten der Rechteckblocks thronte mittendrin die Anlage zur Herstellung des Kampfgases, die sich noch im Bau befand, der man aber schon von außen ansehen konnte, dass ihre Vollendung in naher Zukunft lag. Eine Inbetriebnahme wollten die Eindringlinge verhindern, die aus verschiedenen Richtungen in den Industriepark einströmten. Aus den zwei Waldgebieten im Süden und Osten schlich jeweils eine Zehnergruppe heran, eine weitere Zehnergruppe hatte den Weg durch den Fluss genommen. Die letzte Gruppe näherte sich von Norden, jede der spärlichen Deckungen nutzend, und durchquerte den kompletten Industriepark. Lizzy hatte eine Route ausgearbeitet, auf der man nur wenig Wachpersonal begegnete. Dieses wollten sie nach einem genau abgestimmten Zeitplan ausschalten.
Alice saß auf einem hohen Turm und hatte direkten Blick auf die fast fertige Produktionsanlage des Braunkreuzes.
Die ersten Angreifer huschten unten auf den breiten Straßen entlang, jede Nische, jeden Schatten ausnutzend. Sie kamen aus vier Richtungen, schwärmten um die Anlage herum, und fast glaubte Alice an einen Erfolg, zweifelte daran, dass Tesla erfolgreich sein und ihr Unternehmen sabotieren könnte.
Plötzlich aber brachen aus allen Ecken die Feinde hervor und eröffneten das Feuer.
Der ersten Angriffswelle fielen zahlreiche Voltaner zum Opfer. Gegenfeuer kam auf, aus Verzweiflung wurden Granaten gezündet und dem Gegner entgegengeworfen. Dampfpatronen wurden aktiviert, um die Sicht der Angreifer zu behindern und sich für den Moment zu schützen.
Fast schien es, als könnte Volt das Blatt wenden, aber die Übermacht der Verteidiger war zu groß.
Alice schwang sich den Turm herunter, sprang mit ihren neuen Beinen die zwanzig Meter herunter und aktivierte die Dampfeinheit, die dafür sorgte, dass sie sanft auf dem Boden aufkam. Sie würde genau viermal funktionieren, jeweils zum Sprung und zur Landung.
Kaum am Boden schoss Alice mit ihrer pneumatischen Armbrust, meuchelte einen der Angreifer mit dem Messer, während sie verzweifelt nach Uli fahndete. Sie blickte in gehetzte Gesichter, schmerzverzerrte Grimassen, die vom nahen Tod kündeten, und von Mordlust gezeichnete Augen, die Gleiches mit Gleichem vergolten.
Statt Uli sah sie Lizzy und erkannte erstaunt, dass die Einsatzleiterin sich absetzte. Spontan folgte ihr Alice, hielt sich aus dem Kampfgeschehen heraus und blieb der hochgewachsenen Frau auf den Fersen. Plötzlich sah sie, wie Lizzy mitten in einen Kampf geriet, und eilte schnell dorthin, um ihr zu helfen.
Doch mit Entsetzen erkannte sie die Wahrheit. Lizzys Gegnerin war Uli. Ihre Freundin lag am Boden und Lizzy stand gebückt darüber, um ihr brutal das Messer ins Herz zu rammen.
»Nein!«, schrie Alice, und tatsächlich, Lizzy hielt inne und schaute ihr überrascht entgegen. Als Lizzy erkannte, wer geschrien hatte, verzog sich ihr Gesicht zu einer hassverzerrten Grimasse, aber da war Alice schon heran. Sie sprang mit den neuen Dampfbeinen, überbrückte so die zehn Meter in Sekundenschnelle, landete und sprang die Verräterin an. Gerade noch rechtzeitig verhinderte sie so, dass das Messer in Ulis Brust eindrang.
Die beiden Kontrahentinnen wälzten sich verbissen über den Boden. Mit aller Kraft umschloss Alice mit der Rechten Lizzys Messerhand. Trotz allem näherte sich die Messerspitze immer mehr ihrem ungeschützten Hals.
Ein Aufblitzen in Lizzys Augen, die Schwung nahm und die Muskeln anspannte, um den finalen Stich auszuführen, warnte sie.
Alice, das Ende vor Augen, aktivierte per Muskelanspannung die Prothese am linken Arm und hielt sie in Lizzys Richtung.
Ein heißer Strahl aus Dampf trat aus, verbrühte Lizzys Gesicht, die schwer gezeichnet nach hinten fiel.
Alice sprang auf, zog ihr Messer, bereit, der Verräterin das Leben zu nehmen. Wie in Trance stand sie da, verharrte keuchend, mit sich kämpfend, ob sie zustoßen sollte oder nicht. Lizzy, die treue Kampfgefährtin, die sich als Verräterin entpuppt hatte. Alice hörte Schritte hinter sich und drehte sich leicht apathisch herum, bereit, den nächsten Angreifer zu empfangen und zu bekämpfen.
Doch es war Uli, die zu ihr eilte und ihr in die Arme fiel.
»Lass sie, sie ist keine Gefahr mehr. Wir kümmern uns später um sie.«
Und tatsächlich. Als Alice sich ihrer Gegnerin zuwandte, sah sie eine gebrochene Frau. Das Gesicht verbrüht, die Haut aufgeplatzt, und die Augen starrten blicklos, während kurze keuchende Schreie ihren verzerrten Mund verließen.
Der heiße Dampf hatte nicht nur ihr Gesicht verunstaltet sondern ihr auch das Augenlicht genommen.
»Du hast Recht, Uli. Aber geh jetzt! Flieh mit den anderen! Ich habe noch eine letzte Aufgabe zu erfüllen«, rief Alice ihrer Gefährtin zu, dann tauchte sie, ohne sich ein letztes Mal umzudrehen, in den Schatten der Industrieanlage.
Von den beteiligten Frauen und Männern kehrte nur ein Viertel zurück. Uli sah in die zerschundenen Gesichter. Trotz Verletzungen und Enttäuschungen sah sie, der Kampfeswille der Gruppe war ungebrochen.
»Wir werden uns von dem Schlag erholen. Wir geben niemals auf«, sprach sie in die Runde, und es folgte Zustimmung aus allen Kehlen.
»Ob Alice es geschafft hat?«
Die Antwort fand sich weit hinten am Horizont, da, wo der Chemiepark Wiesdorf lag. Ein Feuerball erhellte die Nacht, und wenig später hörte man auch den Donner der gewaltigen Explosion.
Uli lächelte. Ihr Ziel war erreicht. Braunkreuz würde eine Substanz bleiben, die auf dem Papier gefährlich war, aber so schnell nicht in Produktion gehen würde. Ihr nächster Auftrag würde diffiziler werden. Volt musste die Konstruktions- und Forschungsunterlagen an sich bringen und vernichten.
Heute hatten sie trotz aller Verluste nur eine Schlacht gewonnen. Der Kampf ging weiter. Der Kampf, der Kriege verhindern und die Welt zu einem besseren Ort machen sollte. Auch wenn dazu drastische Mittel nötig waren.
Tempus Fugit
von Tessa Maelle
Lady Pandora Pankhurst schwang sich gänzlich undamenhaft aus einem Dachfenster auf das Sims neben einem furchterregenden Gargoyle, begrüßte ihn mit einem Stups auf die verwitterte Fratze, zog sich hoch und setzte sich rittlings auf den Dachfirst. In dieser Stunde kurz vor Sonnenaufgang, in der vom Ufer der Themse die Stille wie klebriger Nebel zu den Türen und Fenstern der Häuser emporwaberte und in den menschenleeren Straßen Londons jegliches Geräusch erstickte, hielt die zierliche Frau ihre einsame Wacht.
Die Frische des Morgenwinds wehte ihr ins Gesicht und vertrieb den letzten Rest Schläfrigkeit. Schnell schlang Pandora ihren Seidenschal enger um den Hals, fasste an die Brille, klappte ein Okular herunter und stellte es scharf. Die winzigen Zahnräder und die feingeschliffenen Linsen darin verstärkten ihre Sehkraft auf geradezu unerhörte Weise. Aufmerksam musterte sie die Fassaden der Häuser, barg doch die Ruhe des Morgengrauens mehr Geheimnisse, als man schlechthin vermutete. Auf der rechten Häuserseite erschien alles friedlich. Auf der gegenüberliegenden blieb ihr Blick an einem halboffenen Fenster hängen. Zwei Silhouetten warfen ihre Schatten. Die eines Mannes, groß und mit breiten Schultern, und die einer schmächtigeren Frau. Dann eine erhobene Hand. Ein Schlag ins Gesicht der Frau.
Pandora hatte genug gesehen. Sie zog ihren linken Handschuh aus und klappte die metallene Kuppe ihres kleinen Fingers auf. Heraus schoss eine pfeilförmige Libelle mit einer Nadelspitze und einem winzigen Glaskolben am hinteren Ende. Pandora drehte an ihrem Metallfinger einige schmale Ringe in verschiedene Positionen, und die Libelle nahm Kurs auf den Schatten hinter dem Fenster. Zufrieden bog Pandora die Spitze ihres Fingers wieder nach oben und verbarg die Prothese erneut unter dem Handschuh aus feinstem Leder. Kurze Zeit später kehrte das Fluggerät zurück, hielt an und schwebte direkt vor ihrem Gesicht. Pandora pflückte es aus der Luft und verstaute es in einer Büchse, die an ihrem Gürtel befestigt war. Zufrieden kletterte sie vom Dach herunter. Der wichtigste Teil war geschafft.
***
Den nächsten Teil erledigte Pandora am Nachmittag. Sie warf sich einen grauen Umhang über und unternahm einen Spaziergang, der sie direkt zu jenem am Morgen beobachteten Haus führte. Sie musste ganz sicher gehen.
Schließlich ist das hier kein Spiel.