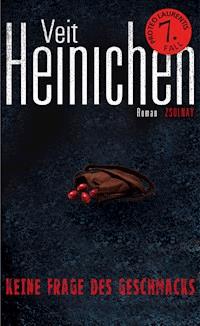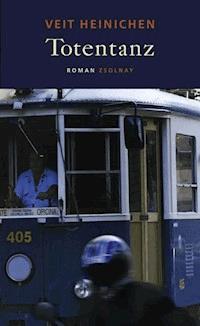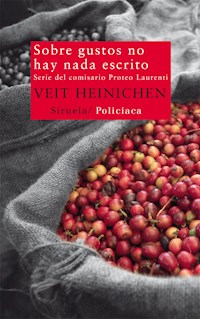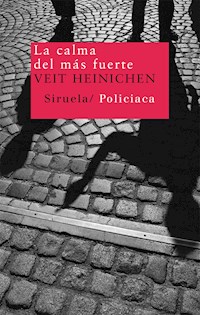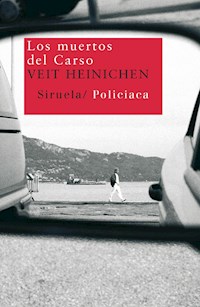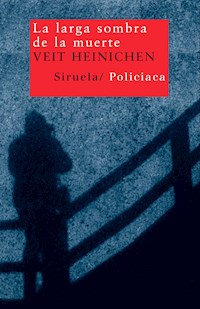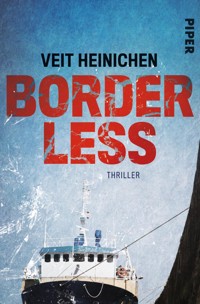Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem abgelegenen Tal auf dem Karst wird eine unbekleidete Männerleiche gefunden. Der Obduktionsbefund: Erstickungstod. Als der Tote identifiziert ist, weiß man rasch, dass er sich des öfteren mit Mia, einer jungen Australierin, getroffen hat. Mia regelt für ihre Familie eine Erbschaft, zu der eine Lagerhalle gehört, die nicht nur zu Mias Überraschung bis zur Decke mit alten Waffen gefüllt ist. Auch in Kommissar Laurentis 4. Fall führen wieder Spuren in die unruhige politische Vergangenheit Triests. Und nicht nur einfache Kleinkriminelle, sondern die Hochfinanz jenseits der Grenze und die Kollegen vom italienischen Geheimdienst stören Laurentis Kreise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zsolnay eBook
Veit Heinichen
Der Todwirft lange Schatten
Roman
Paul Zsolnay Verlag
ISBN 978-3-552-05623-7
Alle Rechte vorbehalten
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2005/2012
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
»Gib mir dein Schwert, Freund, damit iches für dich aufbewahre. Kämpfe nicht. Nur mitLiebe können wir den Frieden erobern.«
Inschrift auf dem Grabvon Diego de Henriquez, 1974
»Ich habe viele Städte gesehen,aber nach Triest komme ich zum ersten Mal.«»Eine interessante Stadt. Das, was währenddes Krieges Lissabon und Istanbul waren,ist heute Triest. Spionage und Gegenspionage,Spitzel, Titoanhänger und Titogegner, Stalinistenund Antistalinisten, dazu zehntausend englischeund amerikanische Soldaten, eine sympathischeund enthusiastische Bevölkerung, undSeeleute aus aller Herren Länder.Die ganze Welt in einer einzigen Stadt.«
»Diplomatic Courier« – Ein Film vonHenry Hathaway mit Karl Maldenund Hildegard Knef, 1952
Ende – dabei hätte alles so schön sein können
Früh im Mai war es schon unerträglich heiß. Vor drei Monaten hatte es zuletzt geregnet, und für die Landwirtschaft wurde das Schlimmste befürchtet. Das Bett der Rosandra führte nur wenig Wasser, obwohl ihr Ursprung in den sonst niederschlagsreichen Bergfalten des Monte Carso lag und der Fluß einst die unzähligen Ölmühlen im Tal betrieben hatte. Sie waren nach einem Bad im Meer mit seinem verbeulten Lieferwagen losgefahren. Er hatte von einem großartigen Naturereignis geschwärmt, das er ihr zeigen wollte. Ein tief in das Karstgebirge eingeschnittenes Tal! Und erst nach halbstündiger Fahrt zu erreichen. Dann noch ein längerer Spaziergang. Das war nichts für sie. Es war schon spät am Nachmittag gewesen und sie wollte lieber den Sonnenuntergang am Meer genießen. Aber schließlich hatte er sie doch überredet. Ein römischer Aquädukt, ein Bad im Fluß, danach eine kleine Gastwirtschaft an der Grenze, wo es handfeste Bauerngerichte gab und kräftigen Wein, und selbstverständlich würde er sie einladen.
Sie waren langsam durch Bagnoli gefahren, am Büro der Partisanenvereinigung vorbei bis nach Bagnoli superiore, das auf slowenisch Konec hieß: Ende. Er hatte ihr vom Weinanbau in der Gegend erzählt, der seit einiger Zeit wieder mit Sinn für Qualität betrieben wurde, und von der Olivenölproduktion, die seit Tausenden von Jahren an den Ausläufern des Monte Carso und um den Castelliere San Michele ansässig war. Die Nähe von Berg und Meer, die starken Temperaturschwankungen seien wichtig für die Qualität. Er erzählte von Starec, Ota und Sancin, deren Öle zu den besten des ganzen Landes gehörten, aber sehr teuer waren – wenn man sie überhaupt bekam. Er wußte viel, und es war angenehm, neben ihm in dem rumpelnden Auto zu sitzen und zuzuhören. Die kleinen Steinhäuser standen dicht aneinandergeduckt, wegen der Bora, die von den kargen, geröllüberzogenen Abhängen aus hellgrauem Kalkstein durch das Tal herunterpfiff und an ungeschützten Stellen alle Vegetation mit sich forttrug. Nachdem er den Motor ausgeschaltet hatte, hörte sie durch das ohrenbetäubende Gezirpe der Zikaden das Gemurmel der Rosandra. Akazien, Pappeln, Weiden und Ahornbäume säumten das Ufer des kleinen Flusses. Nach wenigen Metern führte ein steiniger Pfad entlang der römischen Wasserleitung ins Tal hinein. Rot- und blauweiße Markierungen an den Bäumen wiesen die Richtung. Sie bewunderten den Wasserfall, den sie nach einer halben Stunde erreichten.
»Da unten schwimmt jemand«, sagte sie und deutete auf Kleidungsstücke, die in einen Busch geworfen worden waren.
Er schüttelte den Kopf. »Das wirst du noch öfter sehen. Das sind die Sachen von Illegalen, die hier über die Grenze gekommen sind. Der Übergang ist unbewacht. Das Val Rosandra«, erklärte er stolz, »steht wegen seines Artenreichtums unter dem Schutz der Unesco. Jede einzelne Pflanze, und hier gibt es eine Menge seltener Pflanzen.«
»Und wo ist die versprochene Trattoria?« fragte sie, als er sie an der Taille faßte und stützte, während sie über ein Geröllfeld den steilen Anstieg hinauf zu einer kleinen Kirche erklommen.
»Wart ab, gleich siehst du die Dächer der Häuser von Botazzo. Dort auf der anderen Seite des Tals gab es früher eine kleine Eisenbahn, die die abgelegenen Ortschaften mit der Stadt verbunden hat.«
»Schade, daß es sie nicht mehr gibt«, sagte sie.
»Du könntest nachher nicht in der Rosandra baden.«
»Man müßte doch nur an der richtigen Stelle aussteigen. Kommt man wirklich nicht mit dem Auto hierher?«
»Nur die Forstbehörde und die Anwohner. Sie fahren Geländewagen.«
Beim Abstieg sahen sie endlich die drei Häuser. Bald hörten sie Stimmengewirr, und dann kam ihnen eine Gruppe Wanderer entgegen. Als sie schließlich den Gastraum der Trattoria betraten, war die Sonne bereits hinter dem Bergrücken versunken. Die Wirtin, verwundert über die späten Gäste, brachte einen Liter offenen Rotwein und empfahl Bratwürste mit Stampfkartoffeln und Kraut. Neugierig erkundigte sie sich, woher die beiden kamen und rief es laut zu den anderen Tischen hinüber. Beifälliges Gemurmel. Wer das Tal besuchte, gehörte zu einem Kreis Eingeweihter, die den Karst dem Meer vorzogen.
Er machte ihr Komplimente und brachte sie zum Lachen. Einmal legte er den Arm um ihre Schulter und küßte sie auf die Wange. Sie erzählte von einem Canyon in ihrer fernen Heimat, in dem es vor Giftschlangen wimmelte. Irgendwann brachte die Wirtin das Gästebuch und bat um einen Eintrag. Jeder, der hier vorbeikam, schreibe etwas hinein. Sie lachten, als sie es durchblätterten und rückten enger aneinander. Es war ihr nicht unangenehm, die Wärme seines Körpers zu fühlen. Er war glücklich, daß ihr der Ort gefiel. In den nächsten Tagen wollte er ihr noch andere schöne Plätze zeigen, die kaum jemand in der Stadt kannte. Sie nahm seine Hand von ihrem Oberschenkel und legte sie zurück auf den Tisch. Ihr Lob auf Wein und Wurst im Gästebuch unterschrieb er nur mit einem Initial. Es sei besser, keine Spuren zu hinterlassen, sagte er. Sie lachte und malte ein Strichmännchen dazu.
Es hätte alles so schön sein können. Ein Flirt, ein Gang durch die Nacht, ein Kuß. Aber es endete furchtbar. Ihr Rücken schmerzte von den spitzen Steinen, gegen die er sie gedrückt hatte. Sie mußte sich übergeben. Immer wieder. Ihr war hundeelend zumute.
Sie waren die letzten Gäste gewesen, als sie endlich aufbrachen. Die Wirtin hatte geduldig gewartet und noch einen Liter Wein gebracht. Irgendwann aber konnte oder wollte sie ihr Gähnen nicht mehr unterdrücken. Die scharf geschnittene Sichel des Neumonds warf ein spärliches Licht ins Tal, der Weg war nur zu erahnen, doch das Geplätscher der Rosandra war ein guter Führer.
Einmal stolperte sie und sagte kichernd, daß sie nicht wisse, ob es an der Dunkelheit liege oder am Wein. Er legte einen Arm um sie. Sie spürte, wie er mit der Hand ihre Brust berührte. Dann zeigte er auf eine Stelle am Ufer der Rosandra und schlug vor, ein Bad zu nehmen. Bevor sie antworten konnte, hatte er sich schon ausgezogen. Seine Haut schimmerte hell im Mondlicht, dann tauchte er ins Wasser. Sie zögerte einen Augenblick, bis auch sie sich entkleidete. Sie hatte den Abend genossen. Sie hatten viel gelacht und sich gut unterhalten. Er war ein wirklich netter Kerl, doch eine Affäre wollte sie auf gar keinen Fall. Er war nicht ihr Typ.
Und dann sprang auch sie in den Fluß.
Warum war sie davongelaufen wie eine Mörderin? Warum hatte sie keine Hilfe geholt, als er tot war? Jeder hätte ihr geglaubt. Ihre Wunden waren so deutlich, daß ein Blinder die Spuren der Gewalt hätte identifizieren können. Als sie ihn bat, sich zurückzuhalten, hatte er sie grob auf den Boden geworfen und niedergedrückt. Ihre Schreie verklangen ungehört in der Nacht, und die Spuren, die ihre Fingernägel in seine Haut rissen, schienen ihn noch mehr aufzureizen. Als er mit heftigen Stößen in sie drang, hörte sie sein Keuchen an ihrem Ohr.
Doch plötzlich hatte er sich aufgerichtet und sich mit beiden Händen theatralisch an die Kehle gefaßt, gewürgt und gekeucht. Er war aufgesprungen und wie ein Irrer herumgetanzt. Und dann der Fall. Röchelnd sackte er zu Boden. Er krümmte und wand sich und bäumte sich ein letztes Mal auf, bevor er schließlich bewegungslos in sich zusammenfiel.
Sie hatte sich auf ihn gesetzt und ihn geschüttelt, doch seine Augen waren starr und schienen aus dem Kopf zu quellen. Er atmete nicht mehr. Sie stand auf und blickte sich panisch um. Wo war sie hier? Sie sah keine Lichter, an denen sie sich hätte orientieren können. Sie wühlte in den Taschen seiner Hose nach dem Feuerzeug und steckte sich mit zitternden Händen eine Zigarette an. Dann ging sie in den Fluß und wusch sich lange. Er hatte keine Zeit gehabt, sich in sie zu ergießen, doch jetzt wünschte sie, daß er lebte und seine Gewalt zu Ende führte. Es wäre alles leichter. Sie schmeckte Salz auf der Zunge, das von ihren Tränen stammte. Dabei weinte sie doch gar nicht. Sie stieg aus dem Wasser und beugte sich über ihn, doch wieder starrten sie nur diese toten Augen an. Sie stieß ihn mit dem Fuß, trat ihn in die Rippen, doch er bewegte sich nicht. Hastig zog sie ihren Rock und das Hemdchen an, raffte seine Kleidungsstücke zusammen und schlüpfte in ihre Schuhe. Sie rannte blind drauflos, flußabwärts in die Dunkelheit hinein. Einmal stürzte sie und rappelte sich hastig wieder auf. Irgendwo warf sie seine Kleider in die Büsche. In Bagnoli erwischte sie gerade noch den letzten Bus, der sie in langer Fahrt in die Stadt brachte. Die letzten Meter ging sie zu Fuß. Zu Hause suchte sie hastig nach der Grappaflasche und stürzte ein Glas nach dem anderen hinunter, bis sie irgendwann fast besinnungslos ins Bett fiel.
Als sie gegen sechs Uhr erwachte, schlief die Erinnerung noch und schlug erst unter der Dusche mit erbarmungslosem Schrecken zu. Wieder übergab sie sich. Immer wieder.
Es hätte alles so schön sein können. Die Zeit in Triest sollte Befreiung sein und war zum Alptraum geworden. Sie war zu ihren Wurzeln zurückgekehrt, um sich selbst zu finden, und war dem Tod begegnet.
Marinadi Aurisina
Mit Schnorchel und Flossen kam er schnell voran. Das Wasser in diesem Mai war dank der brütenden Hitze, die sich seit Wochen übers Land gelegt hatte, deutlich wärmer als im Vorjahr. Dennoch hatte er den schwarzen Neoprenanzug angelegt, dann wie üblich das Halteband der kleinen Harpune übergestreift und ein Messer an der Wade festgemacht, mit dem er Muscheln losbrach oder Seeigel aufschnitt, die er für sein Leben gern roh verzehrte. Im Osten über der Stadt hatte der anbrechende Tag bereits über die Finsternis gesiegt, als er die Treppe zum Meer hinunterstieg und kurz darauf am kleinen Anleger ins Wasser glitt. Seit er an der Küste lebte und regelmäßig schwimmen ging, während alle anderen noch schliefen, war er endlich wieder in Form. Selbst Laura hatte plötzlich nichts mehr an seinem Bauchumfang auszusetzen, lobte manchmal sogar seine muskulösen Schultern – und auch mit dem Sex lief es wieder besser.
Srečko, der letzte Fischer von Santa Croce, hatte am Abend zuvor am Tresen des »Pettirosso« beiläufig zu ihm gesagt, daß in der letzten Zeit eigenartige Typen unten am kleinen Hafen beim Meeresbiologischen Forschungslabor aufgetaucht seien. Aber man wolle ja nicht gleich die Polizei rufen. Manchmal seien sie zu zweit, dann wieder zu viert, aber natürlich niemand von denen, die dort ein Boot liegen hatten und erst recht keine Badegäste, die ein Stück weiter oben den Nacktbadestrand Liburnia am Fuß der Steilküste aufsuchten. Dazu seien die Herren einfach nicht richtig gekleidet. Der Fischer, trotz seiner 74 Jahre ein Berg fester Muskeln mit Händen, kräftig wie Baggerschaufeln, fuhr jeden Morgen raus. Nicht weil er es finanziell nötig gehabt hätte, vielmehr aus Leidenschaft und weil er das idyllische Restaurant »Bellariva«, das seine Frau gleich neben dem kleinen Hafen betrieb, mit dem frischen Fang versorgte. Srečko hatte feste Zeiten, und das wußten diese Männer wohl, die immer gerade dann die Mole verließen, wenn er bei Tagesanbruch zu seinem Kutter ging. Und jedesmal habe dann eines dieser hochmotorisierten Schlauchboote abgelegt, die bis zu 40 Knoten machen. »Irgend etwas stimmt nicht«, sagte er. »Das sollte sich einmal jemand genauer ansehen.«
Die kleinen Häfen an der Steilküste vor Triest waren nur zu Fuß über Hunderte von Treppenstufen zu erreichen, bis auf die Marina di Aurisina, zu der eine enge Straße mit starkem Gefälle hinabführte. Sie endete vor der Einfahrt zum Gelände des Laboratoriums, zu dem nur die Mitarbeiter und die Eigner der kaum zwanzig Boote, die an der Mole lagen, Zugang hatten. Alle anderen mußten eine steile Treppe zum Meer hinunter und dann auf einem steinigen Strand weiter zum Hafen gehen. Dafür war die Wahrscheinlichkeit, daß hier Kontrollen durchgeführt wurden, gering. Kein Streifenwagen fuhr je dort hinab, wo nur ein paar mit hohen Mauern umgebene Villen standen, deren Alarmanlagen direkt mit den Behörden verbunden waren. Und der Nacktbadestrand am Fuß der Küste war ohnehin nicht kontrollierbar. Kein Polizist würde auf die Idee kommen, die steilen Pfade hinunter- und danach wieder hinaufzuklettern. Manchmal fuhr ein Boot der Küstenwache oder der Polizia Marittima nahe am Ufer vorbei, aber die Beamten mit den guten Ferngläsern schienen vor allem am Anblick nackter Haut interessiert. Es gab Badegäste, die dort im Sommer Jahr für Jahr dieselben Plätze beanspruchten und sie eisern verteidigten, und andere, die sogar so etwas wie einen Zweitwohnsitz samt Kochgelegenheit und Bretterverschlag dort aufgestellt hatten.
Im Hafen war keine Menschenseele zu sehen. Proteo Laurenti hielt sich hinter den Anlagen der Miesmuschelzuchten, die in riesigen geometrischen Mustern hundert Meter vor der Küste in der sanften Dünung schaukelten. Auf dem offenen Meer bewegten sich lediglich die Positionslichter einiger heimkehrender Fischkutter, sonst war es ruhig. Die Sonne hob sich langsam über den Karst, ihr Licht war noch stumpf, als würde sie selbst erst mit dem Tag erwachen. Laurenti wartete an einer Boje und beobachtete die Einfahrt zu dem kleinen Hafen. Er verschnaufte kurz, denn er wollte die Strecke ohne aufzutauchen hinter sich bringen. Keine einfache Sache. Aber wenn man ihn entdeckte, wäre seine Mühe umsonst gewesen und er hätte im Bett bleiben können und die verschlafene Frage seiner Frau, weshalb er so früh auf den Beinen sei, nicht mit einer Lüge beantworten müssen.
Seine Atemluft reichte knapp aus, um direkt vor dem Wellenbrecher aufzutauchen. Wenn die Angaben des Fischers stimmten und die Männer tatsächlich jeden Morgen zur gleichen Zeit kamen, dann war er zu früh. Er mußte sich einen Platz zwischen den Felsen suchen und warten: Außerhalb des Wassers, um sich nicht zu unterkühlen. Er zog Maske und Schnorchel vom Kopf und verschanzte sich, so gut er konnte, zwischen den mächtigen Steinquadern des Wellenbrechers. Laurenti spürte die Müdigkeit wieder, gegen die er sich beim Aufstehen gewehrt hatte, doch bevor er ihr nachgeben konnte, hörte er Stimmen und, keine zehn Sekunden später, das gedämpfte Geräusch moderner großvolumiger Schiffsturbinen, kaum lauter als ein Summen, das schnell näher kam. Auf dem Schlauchboot, das jetzt sichtbar wurde und kurz darauf den Motor drosselte, standen zwei Frauen. Doch Laurentis Aufmerksamkeit galt vier athletischen Männern mit militärischem Haarschnitt, Jeans und bunten kurzärmligen Hemden, die trotz der Uhrzeit Sonnenbrillen trugen. Sie kamen die Treppe neben der »Bellariva« herunter und schleppten zwei große wasserdichte Plastikbehälter. Der Kies knirschte unter ihren Sohlen. Die zwei Frauen auf dem einfahrenden Schlauchboot mit dem Fiberglasrumpf, das ohne Kennung und Nationenflagge war, trugen Bikini und über den Schultern Windjacken.
Laurenti duckte sich hinter die Felsen. Er sah, wie wenige Meter entfernt die zweite der Kisten an Bord gehievt wurde. Die Harpune auf seinem Rücken schlug, als er sich ein Stück aufrichtete, gegen den Fels, und gab ein metallisches Geräusch von sich, das in der Stille zu zerplatzen schien. Zwei der Männer drehten sich blitzartig um. Er hatte keine Zeit, um mit einem zweiten Blick zu überprüfen, ob es wirklich Pistolen waren, die sie in den Händen hielten. Hastig stülpte er sich die Tauchermaske über den Kopf und glitt ins Wasser. Er mußte rasch zur Muschelzucht zurück, zwischen deren Fässern er sich gut verstecken konnte. Dabei war er sich nicht einmal sicher, ob sie ihn überhaupt gesehen hatten.
Die Hektik kostete ihn wertvolle Atemluft. Zwanzig Meter vor der ersten Reihe mußte er hoch. Instinktiv drehte er sich um und sah gerade noch den hellgrauen Schiffskörper an sich vorbeischießen, der kurz darauf die Maschinen drosselte. Mit einem Blick erkannte er, daß die Mole inzwischen verlassen war. Laurenti tauchte wieder unter und suchte sich einen Platz inmitten der Muschelzucht, wo er sicher war. Eine Möwe flatterte erschreckt davon, als er auftauchte. Er nahm die Harpune vom Rücken und schaute sich vorsichtig um. Den schwarzen Kopf eines Tauchers im Gewirr von Fässern und Tauen von einem Schiff aus zu entdecken, war unmöglich. Laurenti sah das Motorboot hundert Meter weiter in der Dünung schaukeln. Kurz darauf war vom kleinen Hafen her das stampfende Geräusch eines beschleunigenden Schiffsdiesels zu vernehmen und der Bug eines Fischkutters schob sich hinter dem Wellenbrecher hervor. Das Schlauchboot nahm Kurs aufs offene Meer und verschwand bald als kleiner Punkt am Horizont.
Er hatte gesehen, was er gesehen hatte – und wußte nicht, was es bedeutete. Die meisten der Personen hätte er zwar beschreiben und in der Kartei wiederfinden können, wenn sie registriert waren. Bis auf einen der Männer und das Allerweltsgesicht einer der Blondinen, die sich von Hamburg bis Split glichen wie ein Ei dem anderen. Sechs Personen im Mai in einer mysteriösen Aktion am idyllischen Hafen bei den Filtri, und das schon seit etlichen Tagen. Zwei davon gutgebaute junge Damen im Bikini. Zu einer Uhrzeit, zu der jeder andere auf See sich noch einen leichten Pullover überzog. Als Tarnung nicht sehr glaubwürdig. Das würde dem dümmsten Kollegen auffallen, der auf einem Schiff der Küstenwache oder der Polizia Marittima Dienst tat. Sie kontrollierten gerne diese attraktiven Damen, die sich irgendwo auf ihren Booten vor der Küste nahtlos bräunten und dabei ihre Erfahrungen mit der Schönheitschirurgie austauschten. Aber niemals so früh am Tag.
»Wie lange warst du im Wasser?« fragte der alte Fischer besorgt, der ihn an Bord seines Schiffes gezogen hatte. »Hier, trink!« Er schenkte Weißwein in einen Plastikbecher.
»Hast du jemand gesehen?« fragte Laurenti.
Der Mann nickte. »Sie waren etwas später dran als sonst. Als ich zum Meer runterkam, standen sie oben auf der Mole und schauten hinaus. Sie waren bewaffnet, das konnte ich genau erkennen, obgleich ich so getan habe, als hätte ich sie nicht bemerkt. Der Kutter liegt weit genug weg. Kurz darauf gingen sie eilig davon.«
Laurenti zwängte sich aus dem Neoprenanzug und trocknete sich mit dem Handtuch ab, das Srečko ihm reichte. Sie tuckerten geradeaus aufs Meer hinaus.
»Könntest du die Leute beschreiben?« fragte Laurenti, obwohl er wußte, daß es eine unnötige Quälerei wäre, ihm stundenlang die Kartei vorzublättern. Er winkte rasch ab und lachte. Die Leute auf dem Karst waren geprägt. In den letzten hundert Jahren hatten sie mehr Sicherheitskräfte gesehen, als alle anderen in Europa. Österreichische Gendarmen und Soldaten, Italiener, Faschisten, Gestapo, SS und Wehrmachtsoldaten, Tito-Truppen, Engländer, Neuseeländer, Amerikaner, wieder die Italiener – und weiß der Teufel wie viele Spione. Wen wunderte es da, daß sie sich gegenüber offiziellen Anfragen reserviert verhielten? »Dumme Frage. Vergiß es. Ich hab sie selbst gesehen.«
»Einheimische sind das jedenfalls nicht«, sagte der Fischer. »Trink noch einen Schluck. Es erinnert mich an früher, als viele vom Schmuggel lebten. Übers Meer war es am einfachsten. Aber wehe, sie erwischten dich. Man zögerte nicht lange mit dem Schießen. Nicht so wie heute.«
»Wie spät ist es?« Laurenti spürte den Alkohol bereits.
»Kurz nach sechs. Ich fahr dich rüber. Die letzten Meter mußt du allerdings schwimmen, das Boot hat zuviel Tiefgang.« Er prostete Laurenti zu und packte Brot, ein Stück Salami und Käse aus. »Iß etwas. Wie lange warst du im Wasser?«
»Knapp zwei Stunden.«
»Das ist zu lang für diese Jahreszeit. Auch in deinem Anzug. Greif zu.«
»Danke.« Laurenti ließ es sich nicht zweimal sagen.
»Haben sie auf dich geschossen? Ich meine etwas gehört zu haben.«
Laurenti schüttelte den Kopf. »Ich glaube, sie haben mich überhaupt nicht gesehen.«
»Irgendwann hätten sie dich gefunden, wenn ich nicht gekommen wäre«, sagte der Fischer ohne falschen Stolz. »Ich oder ein anderer. Irgendwann wäre es dir zu kalt geworden und du hättest versucht, an Land zu kommen. Dann hätten sie dich erwischt.«
»Ich habe weder ein Kennzeichen des Boots, noch weiß ich, wer die Leute sind. Sie sind nervös, das ist eindeutig.«
»Trink«, sagte der Fischer. »Willst du ihre Autonummer?«
Laurenti stieß den Becher um, als er sich hektisch aufrichtete. Der Wein floß über seine nackten Schenkel. Srečko schenkte nach, zwinkerte mit den Augen und nannte ohne Aufregung die siebenstellige Zahlen-Buchstabenkombination. Sie war einfach zu merken. Dann drosselte der Fischer die Maschine und ging für einen Augenblick ins Steuerhaus. Aus einer Plastiktüte zog er einen Branzino von fast vierzig Zentimeter Länge.
»Ein Kilo achthundert Gramm. Frisch von gestern abend. Ich hab immer einen dabei. Wenn deine Kollegen die Papiere sehen wollen, macht sich ein kleines Geschenk meist ganz gut. Ich will ja nicht behaupten, daß sie es direkt erwarten. Aber eine freundliche Geste wird gerne gesehen. Hier, nimm ihn, mach deiner Familie eine Freude. Aber sag nicht, woher du ihn hast. Sag, daß du ihn selbst gefangen hast. Jag ihm die Harpune durch die Kiemen, bevor du aus dem Wasser steigst. Ich muß mich jetzt um meine Canoce kümmern.« Die Meeresheuschrecken, die hier so hießen, waren ein beliebtes Gericht: gegrillt, gratiniert, gekocht. »Ich hab die Reusen draußen, es wird Zeit.«
Es wäre unhöflich gewesen, ein solches Geschenk abzulehnen. Dieser wunderbare alte Mann hatte sich längst als warmherziger und großzügiger Freund erwiesen. Laurenti fühlte sich trotz seiner fünfzig Jahre wie ein kleiner Junge, als er sich bedankte. Dann ließ er sich ins Wasser hinabgleiten und schwamm mit seinem Fisch die letzten Meter zurück.
Bagnoli della Rosandra/Boljunec, bei Triest
Der Hauptplatz von Bagnoli wirkte wie ausgestorben, nur ein paar wenige Fahrzeuge standen am Straßenrand. Eine vermummte Gestalt im Sattel eines Geländemotorrads, das im Standgas tuckerte, wartete in einer Einfahrt. Trotz der Hitze hielt sie das Visier des schwarzen Helms geschlossen. Zwei Hunde mit staubgrauem Fell lagen im Schatten auf der Straße, und man hörte die Stimmen alter Männer, die unter der Pergola vor der Bar der Partisanenvereinigung schon vor dem Mittagessen dem Wein zusprachen und Karten spielten.
Irina hörte all dies nicht. Einige der Veteranen hatten der jungen Frau mit dem rosafarbenen Rucksack ein paar Cent zugesteckt, wie immer, wenn sie zweimal die Woche hier Kärtchen mit billigen Schlüsselanhängern oder einem Feuerzeug auf den Tischen verteilte und sie meist erfolglos wieder einsammelte, um dann stoisch im nächsten Lokal ihr Glück zu versuchen. Niemand achtete auf das zurückhaltende Handzeichen, mit dem sie sich bedankte. Irina war gehörlos und stumm. Hier draußen war die Ablehnung nicht so hart zu spüren wie in der Stadt, auch wenn die Ausbeute lächerlich war. Ihre Tour war so eisern festgelegt wie der Bezirk, den man ihr in Triest zugeteilt hatte. Sie teilten sich Stadt und Umland zu viert, und einmal in der Woche hatten sie ihren Verdienst abzuliefern. Bei einem von der Gruppe, der mehr zu sagen hatte, aber selbst kontrolliert wurde, vom nächsten Chef, der es ihn büßen ließ, wenn die Einnahmen zu gering waren. So wie Irina es zu spüren bekam, brachte sie einmal auch nur einen Euro zu wenig oder zu spät. Sie kannte die Konsequenzen genau, schließlich war sie bereits vor einem Jahr in dieses gnadenlose Geschäft geraten und hatte die Hölle durchgemacht. Durch wie viele Länder Westeuropas war sie geschickt worden? Die Gesichter ihrer Bosse hatten von Ort zu Ort gewechselt, doch die Methode war stets die gleiche geblieben. Man hatte sie geschlagen, als sie sich auflehnte, mit Zigarettenstummeln verbrannt und mit heißem Wasser verbrüht als Strafe für Verspätungen, sie vergewaltigt, wenn es der Laune des Bosses entsprach, ihr das Haar abgeschnitten und den Eltern nach Rußland geschickt, als sie versucht hatte abzuhauen. Die Drohung war unmißverständlich. Irgendwann hatte Irina sich mit ihrem Schicksal arrangiert und wurde dafür belohnt, indem sie länger in einer Stadt bleiben durfte und weniger Druck bekam. Dennoch stand sie unablässig unter Kontrolle. Man hatte ihr verboten, Freundschaften mit Einheimischen zu schließen, und sie mußte täglich damit rechnen, weitergeschickt zu werden. In manchen Städten war es härter gewesen als in Triest, vor allem wenn die Konkurrenz aus Rosenverkäufern, Schwarzen mit billigem Schmuck oder CDs und den Taubstummen, zu denen sie gehörte, so groß war, daß die Gäste in den Lokalen sich belästigt fühlten. Sie war illegal in Westeuropa und konnte sich nicht verständigen. Sie kannte niemanden, dem sie sich hätte anvertrauen können, und wer hätte ihr schon geglaubt. Sechzehn Stunden war Irina fast täglich unterwegs und trotzdem blieb ihr von dem Geld kaum etwas zum Leben übrig.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!