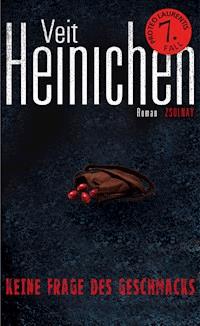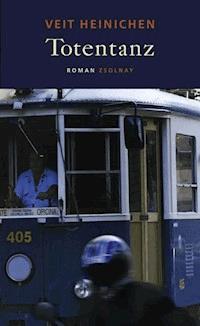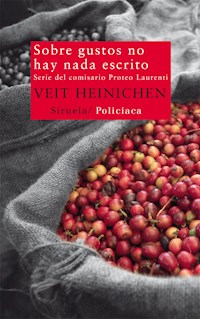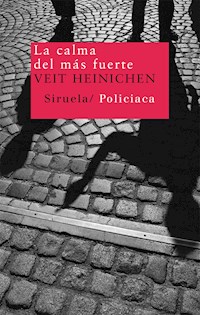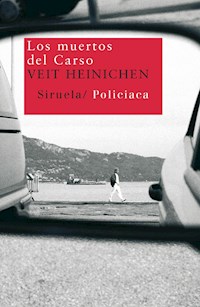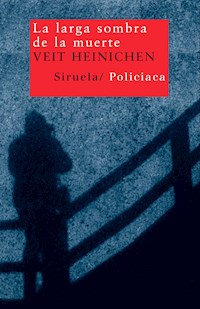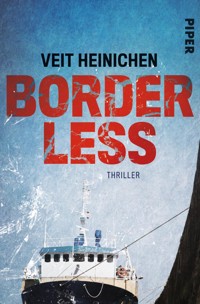Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Commissario Proteo Laurenti nachts von einer EU-Sicherheitskonferenz nach Triest zurückkehrt, wird im selben Zug der Tierpräparator Marzio Manfredi ermordet. Die Ermittlungen belasten Laurenti zusätzlich, denn die Zeremonie zur Erweiterung der Schengen-Zone erfordert seine ganze Konzentration. Eine vermutlich rechtsradikale Gruppe, die gegen Grundstücksspekulation im großen Stil entlang der Adriaküste protestiert, hat gegen einen Teilnehmer des Festakts Morddrohungen ausgesprochen. Es handelt sich um den am internationalen Geldmarkt tätigen Spekulanten Goran Newman, dessen Sohn Sedem wiederum sich ausgerechnet in Laurentis Assistentin Pina Cardareto verliebt, die auf diese Weise ungeplant Einblick in ein Zentrum der modernen Wirtschaftskriminalität erhält. Im sechsten Kriminalroman von Veit Heinichen über die dunklen Machenschaften in der Grenzregion um die Hafenstadt Triest geht es um viel Geld und die politisch-wirtschaftlichen Veränderungen in Europa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Veit Heinichen
Die Ruhe des Stärkeren
Roman
Paul Zsolnay Verlag
eBook ISBN 978-3-552-05469-1
Alle Rechte vorbehalten
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2009
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
www.veit-heinichen.de
www.hanser-literaturverlage.de
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
»Stetes Seufzen wendet keine Not.«
Petrarca
Hoch schon über Europa und Asias Lande getragen,
Fuhr der Jüngling einher, und Szythiens Küsten erreicht’ er.
König allhier war Lynkos. Er geht in des Königes Wohnung.
Wie er komm’, um des Wegs Ursach’, um Namen und Heimat,
Ward er gefragt, und: Die edle Athen ist, sagt’ er, mir Heimat,
Und Triptolemus heiß ich; mich trug kein Kiel durch die Wogen,
Noch durch die Lande der Fuß, mir öffnete Bahnen der Äther.
Gaben bring’ ich von Ceres, die, weit durch Äcker gestreuet,
Fruchtbare Ernten des Korns und mildere Nahrungen tragen.
Neidisch sah der Barbar, und um selbst Urheber so großer
Milde zu sein, empfängt er den Gast; und dem Schlummerbetäubten
Naht er mit würgendem Stahl. Da die Brust zu durchstoßen er trachtet,
Wandelt ihn Ceres zum Luchs, und heißt von neuem die Luft durch
Lenken sein heiliges Drachengespann den mopsopischen Jüngling.
Jetzo beschloß den Gesang die erhabenste unseres Reigens.
Aber die Nymphen erkannten den helikonischen Jungfrau’n
Mit einträchtigem Spruche den Sieg. Als drauf die Besiegten
Schmäheten: Weil euch demnach, durch den Wettkampf Strafe verdienen,
Sprach sie, zu wenig noch ist, und Lästerung ihr der Verschuldung
Zufügt, und nicht einmal die freie Geduld uns gegönnt ist;
Wohl! so verlangen wir Buß’, und folgen dem rächenden Zorne!
Ovid, Metamorphosen 5,3t
Pina in Panik
Das Keuchen kam rasch näher. Zuerst hatte sie dem Geräusch keine Beachtung geschenkt, doch jetzt warf sie erschrocken einen Blick über die Schulter. Mit wild gefletschten Zähnen näherte sich ein kraftstrotzender, braunweiß-gescheckter Köter und würde sie in Kürze einholen. Freundlich sah das Tier nicht aus mit seinen hochgezogenen Lefzen, unter denen das rote Zahnfleisch und ein kräftiges weißes Gebiß leuchteten. Noch hundert Meter, und es würde zum Sprung ansetzen. Panisch trat sie in die Pedale und versuchte, Abstand zu gewinnen, die Straße war kurvig, und wo sie dem Asphalt folgen und dagegen ankämpfen mußte, mit dem Fahrrad im Graben zu landen, hielt das Tier schnurstracks auf sie zu. Weit unten im Tal sah sie die roten Ziegeldächer einer kleinen Ortschaft unter der Dezembersonne glänzen, bis dorthin würde sie es kaum schaffen. Der Hund jagte ihr nach wie einem Kaninchen, als hätte ihn jemand auf sie angesetzt, um sie auf Teufel komm raus zu Fall zu bringen und zu zerfleischen. Endlich erblickte sie auf einer Wiese eine Miete mit Heuballen, für die der Bauer wohl keinen Platz mehr in der Scheune gefunden hatte und sie deshalb unter einer weißen Plastikplane im Freien lagerte. Pina hielt direkt darauf zu, sprang vom Rad und versuchte auf dem glitschigen Kunststoff hinaufzuklettern. Für den Bruchteil einer Sekunde verklang das Keuchen hinter ihr, dann war auf einen Schlag ihr linker Fuß blockiert, stechender Schmerz durchfuhr sie und ein schweres Gewicht hing an ihr, das sie zu Boden zu ziehen versuchte. Mit wütendem Knurren hatte sich der Hund in ihren Schuh verbissen und hing einen Meter über dem Boden, seine Pfoten kratzten auf der Plane. Sie trat mit dem freien Bein nach ihm, doch in dieser Position erwischte sie das Vieh nicht. Unter Einsatz ihrer letzten Kraft konnte sie sich noch ein Stück emporziehen und festen Halt finden an einem Seil, das die Plane fixierte. Wieder trat sie vergeblich nach dem Hund. Eine aussichtslose Situation. Wo kam das Tier her, und wie lange würde es durchhalten? Was war das für eine Rasse? Ein Pitbull, eine argentinische Dogge, ein Mastino Napolitano? Pina konnte Hunde nicht ausstehen und hatte sich stets verweigert, sie auseinanderzuhalten. Dieser hing an ihr wie ein Zappelsack, knurrte wütend und hatte einen Biß wie ein Schraubstock. Seine Reißzähne waren durch das Leder des Sportschuhs gedrungen, Pinas Ferse glühte vor Schmerz. Wenn sie wenigstens den Schuh abstreifen könnte, um dieses blindwütige Tier loszuwerden, das von ihrem Blut, das aus dem Leder tropfte, offensichtlich noch wilder wurde.
Sie hatte keine Wahl, nichts half ihr, außer aus Leibeskräften zu schreien. Während ihrer Ausbildung hatte sie gelernt, daß man in solchen Situationen mit der Stimme am meisten erreichte, doch die aus voller Kehle gebrüllte Haßtirade, mit der sie ihren vierbeinigen Feind bedachte, schien den nicht weiter zu beeindrucken. Nie hätte sie sich träumen lassen, einmal in eine Lage zu geraten, in der ihr all ihre Kenntnisse der härtesten Kampfsportarten so wenig nützten wie ihr durchtrainierter Körper und ihr blitzschnelles Reaktionsvermögen. Sie brüllte wie am Spieß und hoffte, daß schnell jemand auf sie aufmerksam würde. Der Hund ließ keine Sekunde nach. Endlich gelang es ihr, sich mit einem Ruck herumzuwerfen und auf den Rücken zu drehen, um mehr Bewegungsfreiheit zu bekommen und das Bein anzuwinkeln. Und endlich konnte sie mit dem rechten Fuß einen gezielten Tritt ausführen, der in seiner ganzen Härte die Schnauze des Tiers traf, dessen Oberkieferknochen krachte. Es fiel, ohne den geringsten Laut von sich zu geben, auf die Wiese, taumelte einen Augenblick um die eigene Achse, setzte dann aber sofort wieder zum Sprung an, als fühlte es keinen Schmerz. Doch Pina war fürs erste in Sicherheit. Mit laut klopfendem Herzen sah sie den Hund an, der nur darauf zu warten schien, daß sie von ihrem erhöhten Sitz heruntersteigen würde.
Von der Ortschaft im Tal drang vor dem Neun-Uhr-Schlag der Klang der Kirchenglocken herauf, der die Gemeinde zum Sonntagsgottesdienst rief. Pina riß den Reißverschluß ihrer Gürteltasche auf und kramte nach ihrem Mobiltelefon. Aus der Ferne vernahm sie einen Pfiff, der sie für einen Moment ablenkte. Und als sie ihrem Peiniger wieder ins Auge blicken wollte, war sein Platz plötzlich leer. Der Hund war wie vom Erdboden verschluckt.
*
Wie jeden Sonntagmorgen, an dem es nicht regnete und sie keinen Dienst hatte, war Giuseppina Cardareto zu einer Fahrradtour aufgebrochen. Und wie immer sonntags, war sie früher als unter der Woche aufgestanden, obgleich es erst zaghaft zu dämmern begann. Wenn sie um sieben Uhr im Sattel saß, dann könnte sie bis Mittag an die einhundertfünfzig Kilometer schaffen, hunderttausendmal ihre Körpergröße. Den Anstieg von ihrer Wohnung im Stadtzentrum Triests, also von Meereshöhe auf den Karst hinauf, wählte sie stets neu. Je nachdem, ob sie sich mehr oder minder in Form fühlte, fielen die Anfangsstrapazen aus. Die Küstenstraße – entlang der jäh ins Meer abfallenden Felsen –, auf der alle unterwegs waren, forderte sie nicht genug. An diesem Morgen im Dezember wähnte Pina sich stärker als Popeye. Den steilen Anstieg der Via Commerciale machte ihr ohnehin kaum einer nach, erst danach, weiter hinauf nach Conconello, an den rot-weiß lackierten Antennenmasten der Mobilfunksender vorbei, begann die Tortur. Ohne abzusteigen, mit hechelndem Atem und schweißüberströmt, kam sie Meter für Meter voran. Mehrfach haderte sie mit sich, doch ihr eiserner Wille obsiegte, und nachdem sie schließlich die vierhundertfünfzig Höhenmeter geschafft hatte, strich der Fahrtwind beim Hinabgleiten nach Banne und weiter Richtung Basovizza ihr angenehm übers Gesicht. Den Grenzübergang nach Lipizza durchfuhr sie ohne anzuhalten. Vor Sportlern hatten die Zöllner auf beiden Seiten Respekt – oder Mitleid.
Drei Jahre war die kleinwüchsige Inspektorin kalabresischer Herkunft inzwischen in Triest und konnte kaum mehr einen Ausflug unternehmen, ohne an Orten vorbeizukommen, an die sie meist mit dem Dienstwagen gefahren war, begleitet vom Geheul der Sirene. Und das, obwohl in der Stadt für ehrgeizige Kriminalisten mit Karriereabsichten meist wenig zu tun war. Gewiß, eine kühl inszenierte Einbruchserie in die Villen der Oberschicht dominierte seit geraumer Zeit die Titelseiten der Tageszeitungen, und der erneute, besorgniserregende Anstieg illegaler Einwanderung bereitete Kopfzerbrechen, doch Ermittlungen in Mordsachen ließen nach Pinas Geschmack zu wünschen übrig. Hier geschahen große Dinge hinter den Kulissen, die kaum einer zu durchdringen vermochte: Die Finanzströme, die durch Triest flossen, hielten die Kollegen von der Guardia di Finanza in Atem, die auch mit illegalen Einfuhren im Hafen oder entlang der Grenzübergänge beschäftig waren. Wenn jemand ins Jenseits befördert werden mußte, dann vermieden es die Drahtzieher, dies hier in der Stadt erledigen zu lassen. Damit hatten dann die Kollegen an anderen Orten ihre Last. Pina konnte in den letzten eineinhalb Jahren nur einen Mordfall selbständig bearbeiten, den der Kommissar ihr ohne Zögern überlassen hatte und der ihres Erachtens symptomatisch war für die ganze Gegend. Ein Vierundachtzigjähriger erdolchte seine einundneunzigjährige Nachbarin und verständigte anschließend selbst die Behörden. Von Ermittlung keine Spur, Pina hatte sich nur Papierkram aufgehalst, das Vernehmungsprotokoll des Geständigen sowie die Zeugenaussagen in den Computer getippt und an den Staatsanwalt weitergeleitet. Das war’s. Der rüstige Greis kam nicht einmal in den Knast, sondern wurde unter Hausarrest und psychiatrische Betreuung gestellt, da kaum damit zu rechnen war, daß er zum Serienkiller würde. Er lachte sogar über das Urteil, denn in der Nachbarwohnung herrschte nun das, was ihm fehlte, als er zum Messer gegriffen hatte: Ruhe. Da blieb man doch gerne zu Hause in den eigenen vier Wänden.
Während ihres letzten, wirklich spektakulären Falls war sie knapp einem Disziplinarverfahren entkommen, nur die Absprache mit dem Kommissar, ihrem Vorgesetzten, rettete sie. Keine Widersprüche, in die sie sich vor dem Untersuchungsausschuß verwickelten. Am Ende blieb es bei einer Ermahnung, die nicht in ihre Personalakte eingetragen wurde. Und obwohl der Fall, der die Triestiner Sicherheitskräfte über Jahre beschäftigt hatte, nun ein für alle Mal erledigt war, erhielt sie trotzdem keine Punkte, die ihre Karriere beschleunigten. Pinas Hochmut allerdings hatte einen schweren Dämpfer erfahren, ihre Absicht, so schnell wie möglich zurück in den Süden versetzt zu werden, behielt sie inzwischen für sich. Es war höchst angeraten, eine Zeitlang Demut zu zeigen. Selbst ihre schwarzen Haare trug sie nicht mehr als widerborstige Igelfrisur, sondern inzwischen in einer Länge, die ihre Weiblichkeit wenigstens eine Spur deutlicher werden ließ. Und eigenartigerweise erreichte sie sogar einen Grad an Freundlichkeit, vor allem den Kolleginnen gegenüber, den ihr niemand zugetraut hatte. Ihren Dienst schob sie perfekt, und in ihrer Freizeit verfeinerte sie dreimal die Woche im Polizeisportverein ihre Technik als Kickboxerin sowie an zwei Tagen mit einem privaten Lehrer Wing Tsun Kung-Fu – sofern keine Verbrecher ihr einen Strich durch die Zeitplanung machten. Inspektorin Giuseppina Cardareto hatte den Ehrgeiz, ihre Intelligenz mit exzellenter Kampftechnik zu vereinen, damit würde sie unschlagbar werden, auch für den Fall, daß sie irgendwann aus irgendeinem Grund, den sie nicht anstrebte, den Polizeidienst verlassen müßte. Das konnte schneller gehen, als man sich versah, denn die sensationsgeilen Medien einer gelangweilten Massengesellschaft kannten wenig Pardon mit Verstößen der Sicherheitskräfte gegen die Vorschriften und Gesetze. Genauso wie die Verbrecher und ihre Anwälte. Alle lauerten nur darauf, einem ruckzuck die größten Schweinereien, grobes Fehlverhalten und Übergriffe anzudichten, die einem nicht einmal in hartnäckigsten Situationen durch den Kopf gegangen waren. Und wie schnell konnte es passieren, daß man Dingen auf die Spur kam, an deren Aufdeckung einflußreiche Kräfte nicht das geringste Interesse hatten? Das Leben – ein Vabanquespiel. Inspektorin Giuseppina Cardareto zwang sich zur Ruhe, selbst wenn ihre Umgebung am Überschäumen war. Sie mußte die Stärkere bleiben.
Freundlicher Sonnenschein erwärmte den Wintermorgen, als sie am Fuß des Nanos das Wippach-Tal hinabfuhr. Seit zwei Stunden trat sie wie der Teufel in die Pedale, hatte bereits siebzig Kilometer hinter sich, Abhänge, Steigungen, Kurven bewältigt und fühlte sich ganz in ihrem Element. Doch diese Straße war in einem elenden Zustand und keine Traumstrecke für Radsportler. Jede Unebenheit schlug auf den Lenker, und Pina hatte alle Mühe, ihr angestrebtes Durchschnittstempo zu halten, ohne zu stürzen. Der Schwerlastverkehr, der wochentags die Strecke befuhr, hatte tiefe Spurrillen hinterlassen, der Asphalt sah aus wie ein Flickenteppich, und am Sonntag herrschte starker Ausflugsverkehr. Autos mit Ljubljaneser Kennzeichen oder aus Italien hupten sie immer wieder zur Seite. Pina beschloß, ihren Kurs bei der ersten Möglichkeit zu ändern, und traf bei Hrašče endlich auf eine Kreuzung, an der ein Schild die »Vinska Cesta« anzeigte, die enge, kaum befahrene Weinstraße durch den slowenischen Karst, unterhalb des kahlen Berges Nanos, der sich weit über die Gegend erhob und die natürliche Wasserscheide zwischen Adria und Donau bildete. Sein Gipfel trug schon seit Wochen eine Schneehaube, im Tal hingegen war die Temperatur angenehm. Pina hatte keine Straßenkarte dabei, obwohl es das erste Mal war, daß sie die Strecke nahm. Irgendwann würde sie schon in der kleinen Stadt Vipava herauskommen, wo sie auf dem Friedhof zwei viereinhalbtausend Jahre alte ägyptische Sarkophage anschauen wollte, um anschließend über Nova Gorica zurück nach Italien zu radeln.
Statt dessen saß sie mit einer blutenden Ferse inmitten einer weitläufigen winterwelken Wiese auf einem vier Meter hohen Heuhaufen und hatte Schiß vor einem Kampfhund, der plötzlich spurlos verschwunden war. Ratlos schaute sie auf das graue Display ihres Mobiltelefons und blätterte den Speicher durch. Wen konnte sie anrufen? Drüben, auf der anderen Seite der Grenze, hätte sie die Kollegen verständigt, doch hier kannte sie nicht einmal die Notrufnummer der slowenischen Polizei.
*
Den teuren Sportschuh, den der Ladeninhaber extra für sie hatte bestellen müssen, weil er Größe35 nicht am Lager führte, konnte sie vergessen. Das Gebiß des Hundes hatte tiefe Narben ins Leder geprägt, wobei die Verstärkung an der Ferse wenigstens das Schlimmste verhindert hatte. Nur die Reißzähne waren wie Butter durch den Schuh in ihren Fuß gedrungen und hatten vermutlich sogar das Fersenbein erwischt. Der Schmerz pochte mit jedem Pulsschlag, und ganz sicher müßte sie sich auf Tollwutverdacht behandeln lassen. Behelfsmäßig verband Pina die Wunde mit einem Taschentuch und versuchte aufzustehen. Noch einmal suchte sie mit zusammengekniffenen Augen die ganze Umgebung ab und faßte schließlich den Mut, sich vorsichtig auf die Wiese gleiten zu lassen. Sie stieß einen Zischlaut durch die Zähne, als sie den Boden unter den Füßen spürte. Wenn sie mit dem Ballen auftrat, hatte sie weniger Schmerzen. Pina humpelte zu ihrem Fahrrad und hob es auf, doch ganz gegen ihre Hoffnung konnte sie die Pedale nicht treten. Sie stützte sich am Lenker ab und hinkte neben dem Drahtesel Richtung Straße, als sie Hufschlag und ein regelmäßiges Schnauben vernahm. Die Panik stieg wieder in ihr auf, ein Reiter hatte oft genug einen Hund dabei. Sie ließ das Fahrrad los und versuchte, trotz der Schmerzen eine Kampfstellung einzunehmen. Wenn der Drecksköter noch einen Angriff wagte, dann hätte sein letztes Stündlein geschlagen, denn diesmal stand sie in einer vorteilhafteren Ausgangsposition. Noch im Sprung würde sie ihn erwischen, so, wie sie es ein paar tausendmal trainiert hatte. Schnell genug wäre sie und der Schmerz in ihrem Fuß erst nach der erfolgten Abwehr unerträglich. Dann sah sie den Reiter, der im Damensattel und in versammeltem Galopp auf einer Lipizzaner-Stute auf sie zuhielt.
»Dobro jutro!« Mit einem leichten Ruck am Zügel kam das Pferd fünf Meter vor ihr zu stehen, und Pina wunderte sich über die Männerstimme, die sie von einer Person im Damensitz nicht erwartet hatte. Die nächsten Worte auf slowenisch verstand sie nicht. Gewiß würde sie, wenn sie noch lange in Triest bleiben müßte, im Gegensatz zur Mehrheit der italienischsprachigen Städter diese Sprache lernen, doch noch hatte sie die Hoffnung auf den Süden nicht verloren. Sie zuckte hilflos mit den Achseln und ließ endlich ihre gereckten Fäuste sinken.
Der Reiter lächelte mitleidig. »Ist alles in Ordnung?« fragte er dann auf italienisch.
Pina wunderte sich, worüber er lächelte. Weil sie ziemlich dämlich dagestanden hatte in ihrer Kampfposition auf der Wiese? Weil ihre Ferse mit einem völlig durchbluteten Taschentuch nur lausig verbunden war? Oder einfach aus Überlegenheit, weil sie die Sprache der Menschen diesseits der Grenze nicht beherrschte, diese aber sehr wohl das Idiom ihrer Nachbarn?
»Ich habe Sie aus der Ferne auf dem Heuhaufen gesehen. Sie brüllten wie am Spieß. Ich dachte, ich sehe einmal nach.«
»Der Hund?« fragte Pina und sah sich lauernd um. »Gehört der Ihnen?«
»Ich habe keinen Hund gesehen. Sind Sie verletzt? Brauchen Sie Hilfe?« Der Mann war etwas jünger als sie, hatte einen auffallend blassen Teint und trug sein blondes Haar, als würde er den gleichen Friseur wie sie aufsuchen. Zweimal mit den Händen über den Kopf gestrichen, und man war perfekt. Sein Italienisch war akzentfrei, und die Art, wie er sich ausdrückte, machte klar, daß er aus gutem Hause kam.
Pina winkelte das Bein an. »Ich kann mit dieser Wunde nicht Fahrrad fahren. Wenn ich es wenigstens bis zum nächsten Dorf schaffen könnte.«
»Ich kann nicht absteigen«, sagte der junge Mann. »Aber vielleicht können Sie sich hochziehen.« Er gab dem Pferd ein Kommando, damit es sich der kleinen Frau näherte. »Ich bringe Sie zu uns nach Hause und rufe einen Arzt aus der Nachbarschaft, damit er sich ihren Fuß ansieht. Schaffen Sie es hoch? Das Pferd ist die Ruhe selbst, keine Angst.«
Mit einem wenig eleganten Sprung gelang es Pina aufzusitzen. »Und was ist mit meinem Fahrrad?« fragte sie, als sie auf der Kruppe saß. Jetzt erst sah sie, daß der Mann im Damensitz am Sattel festgebunden war. Seine Beine waren dünner als ihre Arme und hingen kraftlos über das Seitenblatt aus sorgfältig gepflegtem schwarzem Leder.
»Ich laß es gleich holen«, sagte der junge Mann, der ihren Blick bemerkt hatte, und gab dem Pferd einen Befehl, worauf es sich im Schritt in Bewegung setzte. Er zog ein Mobiltelefon aus der Jackentasche und erteilte einige Anweisungen, die sie nicht verstand. »Ich bin ab dem dritten Lendenwirbel gelähmt«, sagte er schließlich. »Aber mit diesem Pferd bin ich aufgewachsen, und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, daß eines Tages doch noch ein Wunder passiert. Man kann auf alles verzichten, nur nicht auf die Hoffnung. Vielleicht kann ich irgendwann einmal wieder richtig reiten und muß mich nicht mehr von nichtsahnenden Leuten auslachen lassen, weil ich auf einem Damensattel sitze. Können Sie reiten?«
Pina verneinte. Als Kind hatte sie in ihrem Heimatort Africó über der kalabresischen Costa dei Gelsomini manchmal auf einem Esel gesessen, dort unten waren die meisten Familien zu arm, als daß Mädchen von Pferden träumen konnten. Man aß das Pferdefleisch, ohne es vorher weichzureiten. »Wie heißen Sie?« fragte sie und versuchte den alltäglichen Polizistentonfall zu unterdrücken.
»Meine Freunde rufen mich Sedem«, sagte er ohne weitere Erklärungen. »Und Sie?«
»Nennen Sie mich Pina, das ist die Abkürzung von Giuseppina. Wo bringen Sie mich hin?« Sie hatten die Straße überquert und ritten auf der anderen Seite des Tals ein so steiles Waldstück hinauf, daß sie fast von der Kruppe rutschte. »Wäre es nicht näher zum Dorf, wo Sie mich absetzen könnten?«
»Bei uns sind Sie besser aufgehoben. Dort oben liegt die Villa meines Vaters. Ein Arzt ist auch verständigt. Er wird bereits warten, wenn wir ankommen. Und ein Fahrer wird nachher Ihr Rad mit dem Pickup auflesen.«
»Ich hätte auf sie warten können«, setzte Pina an und vollendete, nachdem sie den unwilligen Blick dieses Sedem gesehen hatte, den Satz nur aus Höflichkeit, »anstatt Ihnen zur Last zu fallen.« Und nach einer Weile fragte sie: »Haben Sie wirklich keinen Hund gesehen?«
Sedem schüttelte den Kopf.
»Einen braun-weiß gefleckten Kampfhund?« Sie hob ihren linken Fuß an. Das Taschentuch war inzwischen ein einziger roter Fleck. »Das Vieh wollte mich zerreißen. Um ein Haar hätte es das geschafft, dann hätten Sie mich begraben können. Seltsam, daß Sie den Hund nicht gesehen haben.«
»Aus der Ferne sieht manches anders aus«, sagte Sedem. »Wir sind fast da.«
Auf einem sanften Hügel, von dem sich eine großartige Aussicht nach Süden öffnete, lag ein altes Gehöft, das sehr aufwendig restauriert worden war. Zwei Seitenflügel, die im rechten Winkel zum Hauptgebäude standen, verhinderten den Blick in den Hof. Ein runder Torbogen aus Karstmarmor bildete den Eingang, war jedoch durch schwere, stählerne Türflügel verschlossen, die sich automatisch öffneten, nachdem Sedem eine Nummer in sein Mobiltelefon eingegeben hatte. »Wundern Sie sich bitte nicht«, sagte er zu Pina. »Das ist kein Bauernhof mehr. Die alten Stallungen sind Büros, darüber die Gästewohnungen. Es gibt nur noch einen Stall für die Stute hier, die mich geduldig erträgt.«
Ein Bediensteter wartete an einer Rampe, vor der das Pferd hielt und auf der ein Rollstuhl stand.
»Ich befürchte«, sagte Sedem zu dem Mann, »wir brauchen heute zwei. Holen Sie bitte den Ersatzstuhl. Unser Gast ist verletzt. Ist der Doktor schon da?«
»Nach Ihnen«, sagte er schließlich zu Pina. »Ich komme alleine zurecht.«
Behutsam rutschte sie von der Kruppe der Schimmelstute und ließ sich von dem Diener in den Rollstuhl helfen. Ihre Ferse schien vom heftigen Pulsen zu platzen, doch vermied sie, sich den Schmerz anmerken zu lassen, als sie sah, wie ihr Retter die Riemen um Oberschenkel und Hüfte, die ihn im Sattel gehalten hatten, löste und sich ganz alleine in seinen Rollstuhl gleiten ließ. Wie elegant er mit seinem Gebrechen umging!
Ein Diener führte das Pferd aus dem Hof, und als der Hufschlag verklang, vermeinte Pina ein Bellen hinter dem Gebäude zu vernehmen.
Dukes Wunsch
»›Istria libera‹ nennen die sich?« Goran Newman lachte schallend. »Und sie wollen mich umbringen? Das ist ja wunderbar.« Dann wurde er schlagartig ernst und blickte seine Mitarbeiterin mit wasserklaren Augen an. »Gut gemacht, Vera.«
Er blätterte trotz seiner grauen Seidenhandschuhe flink Seite für Seite des Dossiers um, das sie ihm auf den Tisch gelegt hatte. An der Wand seines Büros zeigten vier Flachbildschirme Tag und Nacht die Börsenkurse der wichtigsten Finanzplätze an. Singapur hatte soeben eröffnet, ein Pfeil neben den sich ständig verändernden Werten zeigte steil nach oben. Er legte die Fernbedienung auf den Schreibtisch zurück.
»Es ist kein Scherz, Duke.« Im Sessel neben der blonden schlanken Frau saß Edvard, ein Mann Anfang Dreißig, der auffallend groß und muskulös und kaum weniger elegant gekleidet war als sein Chef. »Die Drahtzieher sind Schladerer, Mervec und Lebeni. Sie sind frustriert, weil du sie zum wiederholten Mal ausgebootet hast. Der Kauf der Grundstücke nördlich von Trogir hat das Faß für sie zum Überlaufen gebracht. Nach der Niederlage, die sie auf der Insel Hvar erlitten haben. Und jetzt bedienen sie sich dieser Gruppe ›militanter Idealisten‹, wie sie sich selbst nennen. Da sieht man, wohin der Hase läuft.«
»Keine Sorge, nicht die Ruhe verlieren. Ich kenne die Herrschaften schon länger als dich. Sie können mit Niederlagen schlecht umgehen. Aber sie werden es lernen, sonst …« Er beendete den Satz durch eine unmißverständliche Geste, indem er sich mit zwei ausgestreckten Fingern über die Kehle strich.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!