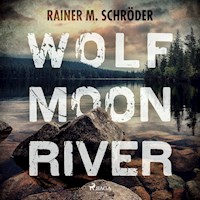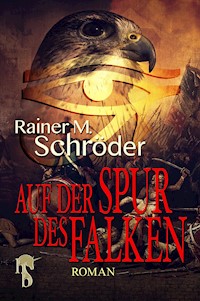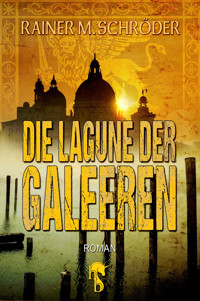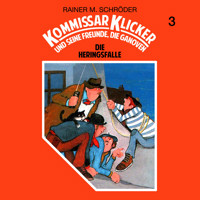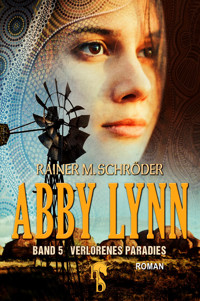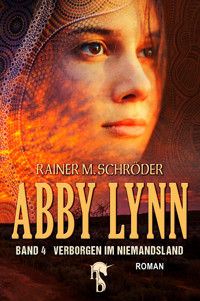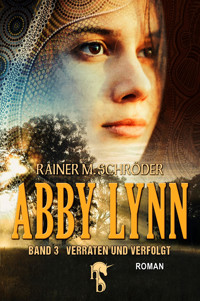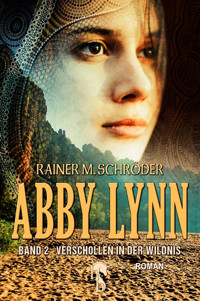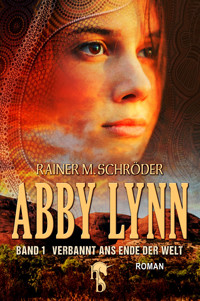6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Tauchen Sie ein in die prachtvolle Welt der Renaissance-Stadt Florenz, in der drei grausame Morde innerhalb kürzester Zeit die Bewohner in Angst und Schrecken versetzen. Das erste Opfer: ein angesehener Priester aus dem ehrwürdigen Kloster San Marco. Sein entsetzlich verstümmelter Leichnam ist mit Tarotkarten versehen, die auf seine angeblichen gottlosen Neigungen hinweisen. Ein makabres Rätsel. Prior Vincenzo Bandelli, der das Kloster leitet, drängt Pater Angelico dazu, diesen ungeheuerlichen Verdacht so rasch wie möglich aus der Welt zu schaffen, um den Ruf des Klosters zu schützen. Die Tarotkarten und die blutigen Hinweise an den Tatorten deuten auf die sieben Todsünden hin. Ist der Mörder ein „Todesengel“, der Menschen hinrichtet, die sich einer dieser Sünden schuldig gemacht haben? Die mysteriösen Morde halten nicht nur ganz Florenz in Atem, auch Pater Angelico selbst gerät ins Visier des Mörders, als er in enger Zusammenarbeit mit der berüchtigten Geheimpolizei Fortschritte bei den Ermittlungen macht. Wird er selbst zum Opfer eines teuflischen Plans?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Der Todesengel von Florenz
Pater Angelicos zweiter Fall
Roman
Den Mönchen der Zisterzienserabtei Himmerod in der Eifel in großer Verbundenheit gewidmet
1
Es gab kein Entkommen. Die ersten Gehöfte entlang der Landstraße standen bereits in Flammen, als die stradiotti von zwei Seiten in das Dorf am Fuße des Monte Rotondo galoppierten. Die leichte Kavallerie des condottiere Bastiano Torentino fiel über die Dorfbewohner her wie ein Rudel Wölfe über eine Herde ahnungsloser Schafe.
Der Stahl der blankgezogenen Schwerter, der Streitäxte und Lanzen blitzte im grellen Mittagslicht des drückend heißen Augusttages. Nicht weniger unheilvoll funkelten Brustharnische, Stechhelme und Kettenhemden. Es war ein kaltes Glitzern, das den Tod ankündigte.
»Macht sie nieder!«, brüllte Bastiano Torentino, der als Söldnerhauptmann eine corazza von mehr als fünfhundert Mann befehligte und an der Spitze seiner Hauptstreitmacht ins Dorf preschte. »Alle! Ohne Ausnahme! Ihr Blut für das unserer Kameraden!«
Mit wilder Mordlust nahmen die vorderen Stradiotti den Befehl auf und gaben ihn brüllend nach hinten weiter. Sie wollten Vergeltung für ihre fünf Toten. Aber mehr noch tobte in ihnen – Landsknechte, die sie waren – die Wut darüber, dass eine Bande von Briganten es nicht nur gewagt hatte, die Wagen ihres weit zurückgefallenen Trosses zu überfallen, sondern auch noch mit den geraubten Pferden, Waffen und Vorräten in die nahen Berge hatte entkommen können. Diese Schmach zu tilgen, das vermochte nur Blut, und viel Blut musste es sein!
In seiner blindwütigen Rachsucht kannte Bastiano Torentino keine Gnade. Dass die Bauern und Dorfbewohner dieses Landstrichs mit der Räuberbande vermutlich nichts zu schaffen hatten und dass keiner von ihnen wusste, wo in den zerklüfteten Bergketten der Abruzzen die Räuber sich versteckten, kümmerte ihn nicht. Das Dorf lag im Feindesland, und damit gab es für ihn keinen Grund, auch nur einen Hauch von Milde walten zu lassen. Zumal der Feldzug nicht verlief wie erhofft. Unter solchen Umständen war die Strategie der verbrannten Erde schon immer ein probates Mittel gewesen; man schwächte die feindlichen Truppen, indem man ihre Versorgung gefährdete.
Und so begann die Blutorgie. Ein erbarmungsloses Hauen und Stechen und Abschlachten, begleitet von infernalischem Geschrei, vom Gebrüll der wütenden Landsknechte, das die gellenden Klagen der wehrlosen Opfer noch übertönte.
Dichter Blutregen flog von den Klingen, die aus niedergestreckten Leibern gerissen wurden und vor dem nächsten tödlichen Hieb durch die Luft schnitten. Blut spritzte den Waffenknechten durch das hochgeklappte Visier ins Gesicht, lief in dreckigen Strömen über Brustpanzer und Kettenhemd. Es troff auf das Fell der Pferde, die unruhig die Nüstern blähten und so manchen Dorfbewohner, der gefällt und in den Dreck geworfen worden war, zu Tode trampelten.
Johlend machten die Landsknechte, bewaffnet mit Bogen oder Armbrust, Jagd auf jene, die aus dem Dorf zu fliehen suchten, lieferten sich einen Wettstreit, wer von ihnen aus dem Lauf heraus den besseren Schuss zu setzen vermochte.
Pfeile und Bolzen bohrten sich in magere Kinderrücken und rissen alte, faltige Kehlen auf. Und die Lanzenträger sprangen nach dem ersten Niederstechen vom Pferd, rammten Männern, Frauen und Kindern ihren Spieß in den Leib und nagelten so manches Opfer an ein Scheunentor, eine Schuppenwand oder Haustür.
Hier und da flog auch ein Seil über einen kräftigen Ast und brachte einem Dörfler den Tod durch den Strang. Und bald schon loderten die ersten Brandfackeln auf und flogen in Stallungen, Scheunen und Wohnhäuser.
Es hatte keine Bedeutung, wie jung oder wie alt oder welchen Geschlechts ein Dorfbewohner war – keiner kam mit dem Leben davon. Auch nicht der blinde Junge, der, seine Flöte in der Hand, am Dorfeingang direkt an der Landstraße auf einer Viehtränke saß. Bastiano Torentino selbst schlug ihm im Vorbeireiten den Kopf vom Rumpf – so gleichgültig, wie man ein Blatt von einem Strauch reißt und fallen lässt, ohne im Gespräch mit seinem Begleiter auch nur kurz zu stocken.
Als Angelico Crivelli wenige Minuten nach Beginn des Gemetzels mit der Nachhut und den leichten Geschützen im Dorf eintraf, bot sich ihm ein grauenhafter Anblick. Ihm war, als sei das, was in der Bibel als Apokalypse geschildert wurde und was schon mancher Maler in Bilder zu fassen versucht hatte, an diesem Ort Wirklichkeit geworden.
Wo er auch hinschaute, sein Blick fiel auf abgetrennte Gliedmaßen, zertrümmerte Schädel, gespaltene Brustkörbe, aufgeschlitzte Leiber und ein Meer von Blut, das den Boden tränkte und dunkle Lachen bildete. Schwärme erregter Schmeißfliegen umschwirrten die Leichen und saugten das Blut gierig auf. Die Luft war erfüllt vom beißenden Qualm der in Flammen stehenden Gebäude und dem Gestank von Urin, Fäkalien und aufgefetzten Eingeweiden.
Angelico Crivelli war mit den Schrecken des Kriegshandwerks vertraut, seit er denken konnte. Von Kindesbeinen an war er mit seinem Vater, der sein Leben lang als Wundarzt im Dienst von Condottieri gestanden hatte, im Tross von Söldnertruppen durch das in viele Herrschaftsgebiete zersplitterte Italien gezogen, von einem sommerlichen Feldzug und einem öden, endlos langen Winterlager zum anderen.
Er hatte das blutige Handwerk des Waffenknechts erlernt, weil es ihm weniger grausam erschienen war, als mit der Knochensäge Gliedmaßen zu amputieren oder unter schauderhaften Bedingungen – auf einem dreckigen Tisch, unter einer stockfleckigen Zeltplane – Verwundete zusammenzuflicken, was meistens doch nicht gelang.
Und so, wie er von klein auf den Umgang mit Waffen erlernt hatte wie andere das Färben von Stoffen oder das Backen von Brot, war ihm auch das Brandschatzen im Feindesland zur Gewohnheit geworden. Solches Vorgehen war ihm als ganz natürlicher, fester Bestandteil eines Feldzugs erschienen; selbst Krieg führende Kirchenfürsten und Päpste wendeten es an. Er hatte es als so selbstverständlich hingenommen wie die sprichwörtliche und allseits akzeptierte Käuflichkeit der Condottieri, die heute für den Herzog von Mailand in den Krieg zogen, morgen Verbündete des Dogen von Venedig waren, übermorgen unter dem Banner der Republik Florenz ritten und sich nächste Woche vielleicht schon vom Papst oder vom König von Neapel die Taschen mit Gold füllen ließen.
Dennoch hatte er sich nicht bewusst und selbstständig dafür entschieden, sein Brot mit der Waffe zu verdienen, sondern war in das Leben eines Landsknechts unmerklich hineingewachsen. Und dann, vor nicht ganz drei Jahren – wenige Wochen nach dem plötzlichen Tod seines Vaters –, hatte er seinen Namen in das Soldbuch eines Truppenführers geschrieben, ohne groß darüber nachzudenken, was er damit tat.
Sechzehn war er damals gewesen, stolz auf den Sold und das Wehrgehänge, das er seither trug. Die nagenden Zweifel, ob er sein Leben wirklich mit der Waffe in der Hand zubringen und damit sein Seelenheil verwirken wollte, hatten sich erst später eingestellt. Nach seinem ersten Gefecht nämlich, nachdem der erste Blutstrom unter seiner Klinge geflossen war.
Beim Anblick des Massakers jedoch, das Bastiano Torentino und seine Stradiotti wie die Reiter der Apokalypse unter den Dorfbewohnern angerichtet hatten, gefror Angelico Crivelli das Blut in den Adern. Diese Gräueltat hatte mit den gewöhnlichen Härten eines Feldzugs nichts mehr zu tun. Hier hatten Männer hundertfach unschuldiges Leben niedergemetzelt, um eine persönliche, ohnmächtige Wut blutig zu stillen.
Abscheu stieg in ihm auf und zugleich der saure Geschmack von Übelkeit. Einer Übelkeit, die zu einem Gutteil ihm selbst galt. Die Erkenntnis, dass er als Landsknecht von Bastiano Torentinos Truppe an dieser Blutorgie mitschuldig war und dass dieses gottlose Handwerk nicht sein Leben sein konnte … nicht sein durfte, traf ihn wie ein Keulenschlag in den Unterleib.
»Angelico! Verdammt noch mal, hörst du nicht?«, brüllte plötzlich jemand an seiner Seite. »Los, an die Arbeit! Die Sache hier wird zu Ende gebracht!«
Angelico fuhr aus seiner Schockstarre auf und sah Bastiano Torentino an, der blutbespritzt neben ihm im Sattel saß. Blut tropfte auch von der Klinge seines Schwertes.
»Warum um alles in der Welt habt Ihr dieses sinnlose Blutbad angerichtet?«, stieß er erschüttert hervor. »Die Leute dieses Dorfes haben uns doch nichts getan. All die unschuldigen Kinder und Frauen …«
»Zum Teufel, jemand musste für das Blut unserer Kameraden bezahlen, und da hat es eben dieses dumpfe Bauernpack getroffen!«, schnitt der Condottiere ihm das Wort ab und herrschte ihn an: »Was soll das überhaupt? Du bist Landsknecht und nicht Samariter. Also behalt dein rührseliges Geschwätz für dich und tu, was ich dir befohlen habe, verdammt!«
»Und das wäre?«
»Hast du es jetzt auch noch auf den Ohren?«, blaffte Bastiano Torentino. »Du sollst ein paar Brandfackeln aus dem Wagen holen und gefälligst dabei helfen, diese elende Dorfkirche anzuzünden. Da haben sich einige verbarrikadiert. Aber das wird dem dreckigen Gesindel nicht viel helfen. So, und nun beweg deinen Arsch! Ich will in diesem Drecknest keine Wurzeln schlagen!«
Erst jetzt nahm Angelico die schrillen Schreie wahr, das Weinen und Flehen um Gnade, die aus dem armseligen kleinen Gotteshaus nach draußen drangen auf den mit Leichen übersäten Platz. Es waren Frauen und Kinder, die da schrien.
»Ihr müsst von Sinnen sein!«, entfuhr es Angelico, und er starrte den Condottiere mit einem Ausdruck fassungslosen Entsetzens an. »Habt Ihr denn kein Gewissen? Habt Ihr keinen Funken Anstand mehr im Leib, dass Ihr, ohne mit der Wimper zu zucken, wehrlose Kinder und Frauen abschlachtet und dort im Feuer elendig umkommen lassen wollt? Der Teufel muss in Euch gefahren sein!«
Bastiano Torentinos Zornesader schwoll an. »Du flaumbärtiges Bürschchen verweigerst mir, deinem Condottiere, den gebotenen Gehorsam?«, fauchte er und hob drohend das bluttriefende Schwert.
»Ein Condottiere, der ein Massaker an unschuldigen und wehrlosen Bauersleuten für rechtens und wohl auch noch für mannhaft hält, hat sein Recht auf Respekt verwirkt, von Gehorsam ganz zu schweigen!«, schleuderte Angelico ihm voller Verachtung entgegen. »Streicht mich aus eurem Soldbuch und vergesst auch den Lohn, den Ihr mir für die letzten drei Monate noch schuldig seid. Ich will Euer Blutgeld nicht! Mit Euch bin ich fertig, Torentino!«
»Aber ich nicht mit dir, du Bastard!«, schrie der Condottiere und schlug zu.
Instinktiv riss Angelico den rechten Arm hoch, und die dicke Lederstulpe seines Handschuhs nahm dem Schwerthieb einen Großteil seiner Wucht, doch sie bewahrte ihn nicht davor, dass die Klinge ihm quer über das Gesicht fuhr.
In dem Hieb lag noch genug Kraft, um ihn aus dem Sattel zu stoßen. Ein blutiger Schleier legte sich über seine Augen. Und noch während er fiel, verwandelte sich das Blutrot in ein abgrundtiefes Schwarz, das ihn verschlang und jeden Gedanken in ihm ertränkte.
2
Er versank in einem Meer von Blut und drohte zu ertrinken.
Was ihn rettete, war seltsamerweise eine Stimme. Sie kam von weit her und zog ihn nach oben, doch was sie sagte, blieb undeutlich. Dem Klang nach musste es sich um etwas Dringliches handeln. Diesen Eindruck verstärkte noch die Hand, die ihn sanft, aber beharrlich an der Schulter rüttelte, bis das Meer aus klebrigem Blut ihn endlich freigab und er die Augen aufschlug.
»Pater Angelico, es wird Zeit!«
Die grässlichen Bilder seines Albtraums verflüchtigten sich wie Rauch im Wind. Stöhnend drehte er sich auf der gepolsterten Ruheliege zu der Stimme um. Im schwachen Schein eines Öllichts nahm er über sich das zart geschnittene Gesicht einer Frau wahr, die mit seltsam mildem und zugleich mitleidigem Blick auf ihn herabsah.
In seiner Benommenheit hätte er beinahe Lucrezias Namen gemurmelt, doch er konnte den Impuls gerade noch unterdrücken, als ihm bewusst wurde, dass er in das Gesicht von Rebecca blickte, der sanftmütigen Frau des Hebräers und Pfandleihers Gershom Jezek. Und damit wusste er augenblicklich auch, wo er sich befand, nämlich im prèstito seines jüdischen Freundes. Das heißt, genau genommen hielt er sich nicht in Gershoms Pfandleihe auf, sondern im hinteren, verschwiegenen Teil des Hauses. Dort, wo am Fuß einer kurzen Treppe in dämmrigen Kellergewölben der Ort sanfter Träume und seliger Weltvergessenheit auf jenen wartete, der sich in einer der Nischen auf ein weiches Ruhelager sinken ließ und sich dem Rausch des Opiums hingab.
Die Griechen hatten dem Saft des Schlafmohns diesen Namen gegeben, und Homer hatte ihn in der Ilias als die »Blume der Demeter« besungen. Doch vermutlich hatten schon Tausende Jahre vor ihm andere den Tränen des Mohns gehuldigt, die ebenso Segen sein konnten wie Fluch.
»Es wird Zeit, Pater Angelico«, sagte Rebecca Jezek erneut mit gedämpfter Stimme und drehte den Docht der Öllampe, die am Kopfende des Ruhelagers auf einem kleinen Wandbord stand, etwas höher. Nun reichte der gelbliche Schein über das kissenreiche Lager in der halbrunden Nische hinaus und hob auch den Beistelltisch mit der Wasserschüssel aus buntem Majolika-Steingut und dem ordentlich gefalteten, sauberen Handtuch aus der Dunkelheit. Licht fiel auch auf einen gefüllten Zinnbecher und ließ die bunten Glasperlen an den Schnüren leuchten, die als Vorhang vor der Gewölbenische dienten. Bis zu dem gusseisernen Dreifuß im Gang, auf dem in einem Becken Kohlen glühten und in dem Gewölbe für Wärme sorgten, reichte das Licht allerdings nicht.
Pater Angelico blinzelte.
»Wenn Ihr Euch jetzt nicht auf den Weg zum Kloster macht, kommt Ihr zu spät zu Euren Nachtgebeten«, sagte Rebecca. »Gern hätte ich Euch schlafen lassen. Aber Ihr habt darum gebeten, dass ich Euch zur rechten Zeit wecke.«
Pater Angelico machte ein erstauntes Gesicht und richtete sich schwerfällig auf. »Es ist schon Zeit für die Vigilien?« Seine Stimme war rau, fast kratzig, und machte ihm bewusst, wie ausgetrocknet seine Kehle war.
Rebecca Jezek nickte.
»Gütiger Gott!« Pater Angelico schwang die Beine über die Kante der Liege und rieb sich die Augen. Er konnte kaum glauben, dass die Nacht schon halb verstrichen war und die Vigilien ihn zurück nach San Marco riefen, in die Gemeinschaft seiner Klosterbrüder.
Er war müde, fühlte sich völlig zerschlagen. Aber wann hatte er sich in den vergangenen Wochen einmal nicht so gefühlt? Die Fertigstellung des Gemäldes für Lorenzo de’ Medici, den Stadtherrn von Florenz, und das Ausmalen der Hauskapelle im Palazzo der Petrucci lagen ihm auf der Seele und waren doch die geringsten seiner Probleme. Was ihn viel mehr beunruhigte und bis ins Innerste aufwühlte, war die Tatsache, dass sein Klosterleben bedrohlich aus den Fugen geraten war. Und dabei spielte Lucrezia, die ebenso eigensinnige wie verstörend anmutige Tochter des steinreichen Wollfabrikanten und Medici-Günstlings Marsilio Petrucci, keine unbedeutende Rolle.
»Ich habe Euch einen Schluck Weißwein gebracht.« Rebecca Jezek wies auf den Zinnbecher neben der Waschschüssel. »Der Vernaccia ist herrlich kalt, und ich habe ihn leicht verdünnt, so wie Ihr es mögt. Er wird Euch erfrischen.«
»Daran habt Ihr gut getan«, murmelte Pater Angelico, griff nach dem Becher und nahm einen kräftigen Schluck. Kühl und belebend rann der Wein durch seine ausgedörrte Kehle. »Was ich von Eurem Mann leider nicht sagen kann! Hintergangen hat er mich, dieser Schuft! Und zwar aufs Übelste!«
Schuldbewusst sah sie ihn an. »Nun ja, er macht sich Sorgen um Euch«, sagte sie zur Verteidigung ihres Mannes und zuckte hilflos die Achseln. »Also grollt ihm nicht allzu sehr. Er hat es gut gemeint mit Euch.«
Pater Angelico schnaubte. »Weiß der Teufel, was Gershom da zusammengebraut und mir als Opium verkauft hat«, sagte er grimmig, »von der Blume der Demeter hat sich jedenfalls nicht ein lausiger Tropfen in seine Mixtur verirrt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche!«
Sie seufzte. »Gewiss, und ich hätte auch nicht das Gegenteil behauptet.«
»Also was in Gottes heiligem Namen hat er da zusammengerührt?« Tatsächlich fühlte er sich um den versprochenen Rausch und die köstlichen Stunden seliger Weltentrückung und völligen Vergessens schändlich betrogen. Dabei hatte seine gequälte Seele doch so sehr danach verlangt!
»Ein starkes Schlafmittel mit einer winzigen Prise Engelstrompete und Bilsenkraut, soviel ich weiß. Es sollte Euch nur schnell einen tiefen Schlaf bringen. Ihr wart erschöpft und zugleich so aufgewühlt.« Sie machte eine entschuldigende Geste.
»Und warum hat er mir vorgegaukelt, es sei sein bestes Opium?«, fragte er verdrossen und rieb sich die Narbe, die sich vom Wangenknochen unter dem linken Auge als feine weißliche Linie bis zum Kinn zog. Bis an sein Lebensende würde sie ihn an Bastiano Torentinos Schwerthieb erinnern – und an die entsetzliche Blutorgie am Fuße des Monte Rotondo. Wenngleich es dieser Narbe als mahnendes Zeichen nicht bedurfte. Dass er nicht vergaß, wer er einmal gewesen war und welche Schuld er in seiner Zeit als Landsknecht – wie kurz sie auch gewesen sein mochte – auf seine Seele geladen hatte, dafür sorgten schon die Albträume. Zwar waren sie in den mehr als sechzehn Jahren, die er nun schon den Habit eines Dominikanermönchs trug, seltener geworden und suchten ihn barmherzigerweise längst nicht mehr jede Nacht heim. Aber sie quälten ihn doch noch regelmäßig genug, um die Erinnerung beklemmend wachzuhalten. Und gänzlich freigeben würden sie ihn wohl nie. Auf die Treue der Dämonen, die man selbst erschaffen hatte, war Verlass.
Rebecca Jezek bedachte ihn mit einem fast demütigen Blick. »Habt die Güte und seht es ihm nach. Er macht sich, wie ich schon sagte, Sorgen um Euch. Ihr wisst, wie sehr er Euch schätzt. Gerade deshalb wollte er nicht zulassen, dass Ihr in einem Moment der Schwäche und Erschöpfung wieder … nun ja, der Verlockung des Opiums erliegt«, sagte sie verlegen. »Wo Ihr doch so lange und so hart darum gekämpft habt, Euch von der Sucht zu befreien.«
Damit rührte sie an einen wunden Punkt. Nun war es an ihm, betreten dreinzuschauen. Er wich ihrem Blick aus, machte sich an seiner weißen Tunika zu schaffen und zupfte das gleichfalls weiße Skapulier unter dem schlichten Gürtel zurecht. Die Bemerkung rief ihm den heiligen Schwur ins Gedächtnis, den er erst wenige Monate zuvor, am Hochfest von Mariä Geburt, vor dem Altar der seligen Jungfrau abgelegt hatte, nämlich, der Versuchung dieser süchtig machenden Weltentrückung fortan viel entschiedener zu widerstehen. Und Gershom wusste von seinem Schwur, hatte er ihm doch selbst davon erzählt, als sie bei Brot und einem Krug Wein im Giardino die Sonne eines der letzten warmen Oktobertage genossen hatten.
»Seine Sorge ehrt ihn, verleiht ihm aber nicht das Recht, darüber zu entscheiden, ob oder wie ich meine Dämonen im Zaum halte!«, knurrte er, leerte den Becher und knallte ihn auf den Tisch.
Rebecca nahm ihn an sich. »Übrigens werdet Ihr das Geld, das Ihr meinem Mann für das Opium gezahlt habt, in der Tasche Eurer Kutte wiederfinden.«
»Teufel auch, das sieht ihm ähnlich! Aber wenn ich in Windeln gewickelt zu werden wünsche, steige ich wohl kaum in ein Opiumgewölbe hinab, sondern suche mir eine Amme!«, gab Pater Angelico zurück, trat an die Waschschüssel und schaufelte sich mit beiden Händen Wasser ins Gesicht. »Sagt ihm das, Rebecca! Aber nein, das soll Eure Sache nicht sein! Ich werde Gershom selbst sagen, was es zu seinem Gebaren als selbst ernannte Amme zu sagen gibt!«
Rebecca Jezek reichte ihm das Handtuch und nickte mit jener verständnisvollen Miene, die Frauen aufsetzten, wollten sie einem Mann zu verstehen geben, dass er sich ihrer Nachsicht sicher sein konnte, auch wenn er nichts begriffen hatte und zweifellos im Unrecht war.
»Tut das. Ihr wisst, dass er ein offenes Wort schätzt und Euch keine Antwort schuldig bleiben wird«, sagte sie hintersinnig. »Aber jetzt solltet Ihr Euch erst einmal sputen, damit Euer Seelenheil keinen Schaden nimmt.«
Das sagte sie mit solchem Ernst, dass der darin verborgene gutmütige Spott umso deutlicher wurde. Trotz seiner finsteren Stimmung konnte Pater Angelico nicht anders als lächeln. »Wenn sich die Frau eines Hebräers um das Seelenheil eines Klosterbruders sorgt, dann wird es wirklich höchste Zeit, das Weite zu suchen und in den barmherzigen Schoß der Mutter Kirche zurückzukehren«, entgegnete er und trocknete sich flüchtig Gesicht und Hände ab. Dann griff er zu seiner schwarzen, grobwollenen cappa und legte sich den Umhang um die Schultern.
Rebecca trat hinaus in den Gang und hielt ihm den Vorhang aus bunten Perlenschnüren auf. »Schalom, Pater Angelico.«
Er nickte ihr mit einem freudlosen Lächeln zu. »Pax vobiscum, Rebecca«, murmelte er. Augenblicke später trat er durch die Hintertür hinaus in den Hof und die kalte, regnerische Februarnacht.
3
Der Mann, der in Santa Croce im tintenschwarzen Schatten eines Torbogens stand und mit einer Mischung aus nervöser Anspannung und freudiger Ungeduld die von heftigen Regenschauern gepeitschte Kreuzung des Borgo Pinti mit der Via dei Pilastri im Auge behielt, lächelte zufrieden. Für sein Vorhaben hätte er sich kein besseres Wetter wünschen können.
Zweifellos war es ein gutes Omen, dass zur rechten Zeit solche Regenmassen vom Himmel stürzten. Die böigen Schauer spülten nicht nur den Dreck in die Abflussrinnen und Abwasserkanäle, sondern trieben auch jeden in den Schutz seiner Behausung, der dem hässlichen Wetter nicht um jeden Preis trotzen musste. Keiner der streunenden Straßenköter, die man gewöhnlich zu allen Tages- und Nachtstunden überall in der Stadt antraf, zeigte sich. Nicht einmal das dreiste Rattenpack, das so leicht durch nichts zu verscheuchen war, wagte sich aus seinen Löchern und Spalten.
Was dem Mann jedoch noch weitaus mehr zupasskam, war der Umstand, dass er bei diesem Wetter vor den Wächtern der Nacht, die üblicherweise nach Mitternacht zu zweit durch die Stadt patrouillierten, nicht auf der Hut zu sein brauchte. Von diesen Bütteln der Kommune, die jeden anhielten, einem mit ihrer Laterne ins Gesicht leuchteten und barsch über Kommen und Gehen Auskunft verlangten, hatte er in dieser Nacht nichts zu befürchten. Die selbstgerechten Kerle hatten sich mit Sicherheit längst in die nächste Wachstube geflüchtet, um dort das Ende des Unwetters abzuwarten.
Während er die Kreuzung hinter den wehenden Regenschleiern nicht aus den Augen ließ, kreisten seine Gedanken wieder einmal um sein jüngstes Lieblingsthema – nämlich die Schlechtigkeit des Menschen.
Mit seiner Überzeugung – dass der Mensch an sich unweigerlich schlecht sei – befand er sich in allerbester Gesellschaft, hatte er doch den Allmächtigen auf seiner Seite. Dass es Gott reute, den Menschen erschaffen zu haben, war schon auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift belegt.
Der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war.
Ja, so stand es in Genesis 6, Vers 5 geschrieben, klar und deutlich. Und selbst der alte Noah war der Sintflut mit seiner Familie nur deshalb entkommen, weil er vor den Augen des Herrn Gnade gefunden hatte! Was ja wohl den logischen Rückschluss zuließ, dass auch er keinen Anspruch auf Rettung gehabt hatte, sondern einfach nur ein bisschen weniger schlecht gewesen war als der Rest der Menschen.
Und Noah war ein mieser Kerl und obendrein ein maßloser Säufer gewesen, daran gab es nichts zu rütteln! Wie verdorben sein Charakter war, konnte man schließlich in Genesis 9 nachlesen. Kaum hatte der alte Knacker wieder trockenen Boden unter den Füßen und die Ernte seines ersten Weinbergs eingefahren, da betrank er sich auch schon sinnlos und lag in seinem Rausch schamlos nackt in seinem Zelt. Wusste der Teufel, wieso er nichts am Leib hatte, aber man konnte sich schon denken, was er außer Saufen in seinem Zelt noch trieb. Jedenfalls bot er am Morgen so splitternackt gewiss keinen schönen Anblick. Was auch sein Sohn Ham fand, als er das Zelt des Vaters betrat. Er erzählte seinen beiden Brüdern davon, und sie schnappten sich einen Überwurf und bedeckten damit die Blöße ihres Vaters.
Und was tat dieser Saufbold, als er davon erfuhr, dass Ham ihn in all seiner widerlichen nackten Pracht gesehen und seinen Brüdern davon erzählt hatte? Dieser lotterhafte Tyrann geriet dermaßen in Wut, dass er eine lästerliche Verwünschung ausstieß. Aber er verfluchte nicht seinen Sohn Ham, sondern dessen Sohn Kanaan! Was immer der alte Kerl meinte, seinem Sohn vorwerfen zu können, er bestrafte nicht ihn, sondern seinen ahnungslosen und vollkommen unschuldigen Enkel! Was für ein widerlicher Hund! Aber wenn schon Noah von so üblem Charakter gewesen war, dann konnte es kein Zufall sein, dass in der Bibel über Noahs Frau, seine Söhne und deren Frauen, die mit ihm auf der Arche entkommen waren, bis auf diese kurze Passage nichts weiter geschrieben stand. Keiner von ihnen konnte wirklich vor Gott bestehen. Wie sonst war die bezeichnende Stelle im Buch Genesis zu erklären, in der es hieß, dass alle Wesen aus Fleisch auf der Erde verdorben lebten?
Und genauso war es. Ob nun vor oder nach der Sintflut, die Welt war von Grund auf schlecht und der Mensch böse, ein durch die Erbsünde vom ersten Tag an verdorbenes Geschöpf, das sich durch eigenes Tun niemals von seiner Schuld reinwaschen konnte. Deshalb war der Mensch verloren, wie sehr er auch versuchen mochte, ein rechtschaffenes und gottgefälliges Leben zu führen. Was immer er an frommen Werken vollbrachte und an ruchlosen Taten unterließ – nichts davon konnte ihm das Tor zum Himmelreich öffnen. Selbst wenn er danach trachtete, wie ein Heiliger zu leben, auch das vermochte die ihm innewohnende Schlechtigkeit nicht zu tilgen. Allein die Gnade Gottes, dessen Barmherzigkeit grenzenlos war, konnte den sündigen Menschen vor der ewigen Verdammnis retten.
Eine ausgesprochen befreiende Erkenntnis, wie er fand. Befreiend insbesondere für jemanden wie ihn, der beschlossen hatte, zum Mörder zu werden.
4
In den frühen Nachtstunden war ein unfreundlicher, böiger Wind aufgekommen und hatte dunkle Regenwolken über der Arno-Ebene zusammengetrieben. Jetzt schlug er Pater Angelico Regenschauer ins Gesicht wie schallende Ohrfeigen, als wolle er ihn für seinen nächtlichen Besuch bei Jezek züchtigen.
»Santiddio – gütiger Gott, das hat mir zu meinem Glück heute wahrlich noch gefehlt«, murmelte er, als er sich mit hochgezogener Kapuze und dicht vor der Brust zusammengerafftem Umhang aus dem Schutz der dunklen Hofdurchfahrt wagte und über die ausgestorbene Via Mensano in Richtung des Mercato Vecchio eilte.
Doch er mied den Alten Markt. Auf dem großen freien Platz hatten Wind und Regen freies Spiel. Dort war er dem üblen Wetter schutzlos ausgeliefert, und ebenso verhielt es sich auf den breiten Durchgangsstraßen, die Florenz von den wehrhaften Stadttoren aus in alle Himmelsrichtungen durchschnitten. Lieber wählte er für seine Heimkehr in das Kloster im Norden der Stadt den Umweg durch das verwinkelte Labyrinth der chiassi, das sich durch alle Bezirke zog. Von diesen krummen, engen Gassen, in denen man vielerorts die Arme ausbreiten und so die Wände der einander gegenüberstehenden Häuser berühren konnte, hatte die stolze Republik am Arno etliche zu bieten. Aber es ging wohl in keinem anderen borgo gedrängter, krummer und enger zu als hier im jüdischen Getto, einem Stadtviertel, das noch Cosimo de’ Medici in seiner Regierungszeit gut ein halbes Jahrhundert zuvor den Juden hinter dem Mercato Vecchio mitsamt einer wohlklingenden Schutzerklärung zugeteilt hatte.
Zwar wurde seit eh und je von den Kanzeln der Pfarr- und Klosterkirchen, die sich in jedem Stadtteil zu Dutzenden fanden, geifernd und selbstgerecht gegen das in alle Welt verstreute Volk der Thora und des Heiligen Landes zu Felde gezogen. Die jüdischen Geldwechsler aber, die Juwelenschmiede, Pfandleiher, Gelehrten und Heilkundigen wollte man in der Stadt ebenso wenig missen wie die kollektive Strafgebühr in Höhe von zweitausend Goldstücken, die sie jährlich an die Kommune zu entrichten hatten, weil sie gottlose Zinsgeschäfte betrieben und damit aufs Schändlichste gegen die Heilige Schrift verstießen, die doch jede Art von Zinsgeschäften ausdrücklich untersagte.
Dass die christlichen Bankherren, allesamt geachtete grandi und nobili und regelmäßig mit hohen Staatsämtern geehrt, ihre Zinsen für Geldeinlagen als Geschenke und die Zinsen für Kredite als Risikoaufschläge deklarierten, diese Heuchelei war bislang noch keinem übel aufgestoßen, schon gar keinem Kirchenfürsten oder Papst. Zu teuer war das verschwenderische Leben, das sie führten, als dass sie es gewagt hätten, sich mit Männern aus dem Hause Medici, Strozzi, Bardi, Peruzzi, Pitti oder Tornabuoni anzulegen, die als Bankherren ihren Hofstaat, ihre Mätressen und ihre ständigen Kriegszüge finanzierten.
Wie verlogen die Welt doch ist, sinnierte Pater Angelico, während er mit gesenktem Kopf den Regenschauern trotzte, und nahm sich selbst davon nicht aus. Verlogen waren sie alle, die sie sich Christen nannten und doch so wenig christliches Verhalten an den Tag legten. Das war für ihn das eigentliche Kreuz mit dem Kreuz. Und dass es mit seiner eigenen Demut, Uneigennützigkeit und Selbstzucht auch nach fast siebzehn Jahren Klosterleben noch nicht weit her war, bedrückte ihn dabei mehr als die Verfehlungen kirchlicher Würdenträger.
Seine innere Zerrissenheit stand in einem beängstigenden Widerspruch zu seiner monastischen Berufung. Dass selbst Heilige vor diesem inneren Widerspruch nicht gefeit gewesen waren und zeitlebens gegen ihre inneren Dämonen gekämpft hatten, tröstete ihn zwar gelegentlich, brachte ihm jedoch nicht die ersehnte innere Ruhe.
Die fand er in letzter Zeit nur noch, wenn er in seiner Werkstatt mit Pinsel und Palette an der Staffelei stand oder irgendwo an einem Fresko arbeitete. Dann war er ganz eins mit sich und vergaß alles, was seine Seele sonst in Unruhe versetzte. Den Lobpreis Gottes in Bildern zu feiern, war eine Berufung, derer er sich absolut sicher sein durfte. Und für dieses himmlische Geschenk war er in einem Maße dankbar, das er nicht in Worte hätte fassen können.
Kurz nachdem er den offenen Domplatz von Santa Maria del Fiori umgangen hatte, verloren die Regenschauer ihre wütende Kraft und verebbten zu einem harmlosen Nieselregen, so als sei dem Wind nach all dem grimmigen Toben die Puste ausgegangen, als hätten die dunklen Wolken kein Wasser mehr. Vielleicht legte das Unwetter aber auch nur eine Atempause ein, um sein sturzbachartiges Wüten bald wieder aufzunehmen.
Pater Angelico schickte einen stummen Dank gen Himmel, dass er vorerst nicht mehr durch stockfinstere Gassen hasten und dabei fast blind durch allerlei Unrat stapfen musste. Endlich konnte er den direkten Weg nach San Marco einschlagen und auch breitere Straßen entlanggehen. Dort war es leichter, dem allgegenwärtigen Dreck und Abfall auszuweichen, den die Florentiner noch immer rücksichtslos aus den Fenstern auf die Straßen und Gassen kippten, den Inhalt ihrer Nachttöpfe eingeschlossen. Auf den gepflasterten Verkehrsadern der Stadt fiel schon hier und da der hilfreiche Lichtschein einer Torlaterne oder einer Öllampe, die in einer Wandnische ein Madonnenbildnis beleuchtete, auf den Gehweg. Und wer einen Palazzo sein Eigen nannte, ließ es sich meist nicht nehmen, die prächtige Fassade seines Hauses bei Nacht in den flackernden Schein mehrerer Pechfackeln zu tauchen.
Pater Angelico kam aus der Via del Cocomoro, die im Norden in die Piazza di San Marco mündete. Majestätisch ragte die gewaltige Fassade der Klosterkirche in den dunklen Nachthimmel und warf ihren pechschwarzen Schatten auf die weiträumige Piazza, auf der der Mercato Vecchio gut dreimal Platz gefunden hätte.
Gerade wollte er sich nach links wenden und den Vorplatz überqueren, als er die Gestalt bemerkte. Sie trat auf der Ostseite des Klosterkomplexes aus der Seitenpforte und hielt eiligen Schrittes auf die Via della Sapienza zu, die von der Piazza in die südöstlichen Stadtviertel führte.
Er erkannte den hageren Klosterbruder sofort an dem dichten Ring schlohweißer Haare, der seine Tonsur wie ein Silberkranz umschloss. Aber auch wenn der Mönch sich die Kapuze tief in die Stirn gezogen hätte, wäre Pater Angelico klar gewesen, dass es Pater Nicodemo war, den es da zu nächtlicher Stunde aus dem Kloster trieb. Denn der zog seit einem bösen Treppensturz fünf Jahre zuvor das rechte, steif gebliebene Bein unübersehbar nach. Rätselnd, was einen derart frommen und dem gemeinschaftlichen Chorgebet treu ergebenen Mann wie Pater Nicodemo dazu treiben mochte, die Vigilien zu versäumen und mitten in der Nacht San Marco zu verlassen, änderte er seine Richtung und ging dem Bruder entgegen. Der musste für sein Handeln einen schwerwiegenden Grund haben, einen, der ihm keine Wahl gelassen hatte.
Und das konnte bei einem Priester nur eines bedeuten, nämlich dass für eine der ihm anvertrauten Seelen der schwarze Schleier des Todes nahte.
5
Die beiden padres erreichten die Ecke zur Via della Sapienza nahezu gleichzeitig. Der ergraute Dominikaner zeigte sich nicht im Mindesten überrascht, zu dieser nächtlichen Stunde außerhalb der Mauern von San Marco auf seinen fast dreißig Jahre jüngeren Klosterbruder zu treffen.
Jeder im Konvent wusste, dass Pater Angelico als Malermönch oft außer Haus war und manchmal sogar die ganze Nacht fernblieb, wenn die Umstände es verlangten – etwa weil er das Teilstück eines Freskos fertigstellen musste, bevor der intonaco, der Feinputz, trocknete. Weshalb ihm der Prior ja auch einen umfassenden Dispens erteilt und ihn damit von der strikten Einhaltung vieler monastischer Pflichten entbunden hatte, sofern diese mit den Notwendigkeiten seiner Malerei kollidierten.
»Kein gutes Zeichen, Euch um diese Uhrzeit bei einem Gang in die Stadt anzutreffen, werter Bruder«, sagte Pater Angelico, der sich mit dem Älteren nicht nur gut verstand, sondern ihn als einen belesenen und gebildeten Mann auch überaus schätzte. »Zumal bei diesem elenden Wetter, das Eurem Bein sicherlich alles andere als Freude bereitet.«
Pater Nicodemo lachte freudlos. »Grave senectus est hominibus pondus«, seufzte er und rieb sich das Knie. Eine schwere Bürde ist dem Menschen das Alter.
Pater Angelico nickte und antwortete ihm auf Latein, das der Bruder so liebte: »Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.«Indem wir geboren werden, sterben wir, und das Ende beruht auf dem Anfang.
Der weißhaarige Mönch lächelte müde. »Ja, das hat Marcus Manilius trefflich gesagt. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, seine Astronomica noch einmal zu lesen, allein schon wegen seines perfekten Versmaßes. Aber in meinem Alter heißt es mehr denn je: Tempori parce!« Geh sparsam mit deiner Zeit um!
»Infinita est velocitas temporis, quae magis apparet respicientibus«, pflichtete Pater Angelico ihm bei. Unermesslich ist die Eile der Zeit, was denen mehr auffällt, die zurückblicken. »Aber was bringt Euch denn heute um die Vigilien, werter Bruder?«
Pater Nicodemo machte ein bekümmertes Gesicht. »Ser Aurelio. Seine Frau hat nach mir geschickt. Mit ihrem Mann hat es sich offenbar zum Bösen gewendet. Und als sein langjähriger Beichtvater …«
Pater Angelico runzelte die Stirn und fiel ihm ins Wort.
»Sprecht Ihr von Aurelio Rovantini, dem Gelehrten aus der Via di Mezzo in Santa Croce?«, vergewisserte er sich.
Pater Nicodemo nickte.
»Aber ich dachte, er hätte sich von seinem Reitunfall erholt und sei wieder bester Dinge«, sagte Pater Angelico verwundert. »Hieß es nicht sogar, er wolle bei der nächsten Regierungswahl als Prior in die signoria einziehen?« In Florenz wurde die Regierung Signoria genannt. Sie bestand aus acht Prioren und dem gonfaloniere, dem Bannerträger der Justiz, die alle zwei Monate neu gewählt wurden. Was unablässigen Wahlkampf zwischen den konkurrierenden Parteien bedeutete und einen ständigen Wechsel in den höchsten Staatsämtern mit sich brachte.
»Das habe ich auch geglaubt, zumal ich ihn vor zwei Tagen im Zustand bester Genesung und ausgesprochen fröhlicher Verfassung angetroffen habe«, sagte Pater Nicodemo. »Aber nun kann davon nicht mehr die Rede sein. Es sollen starke innere Blutungen aufgetreten sein. Jedenfalls steht es schlimm um ihn, wie man mir hat ausrichten lassen.«
»Wie schlimm?«
»Er befindet sich zwar noch nicht in agone, aber der Todeskampf wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ser Aurelio soll unter fürchterlichen Krämpfen leiden und sogar Blut gespuckt haben.«
»Heiliger Lazarus!«, entfuhr es Pater Angelico. »Was für eine böse Wendung. Und ich dachte, der gute Aurelio Rovantini sei längst über den Berg!«
»Nemo ante mortem beatus«, sagte Pater Nicodemo mit kummervoller Miene. Niemand ist vor seinem Tode glücklich zu schätzen.
»Weiß Gott nicht!«
Pater Angelico wollte den Bruder nicht länger aufhalten. Tief betrübt begab er sich ins Kloster. In dem Raum, von dem aus es in den Kreuzgang des heiligen Antonius ging, zerrte er sich hastig den klatschnassen Wollumhang von den Schultern, hängte die Cappa an einen Kleiderhaken und fuhr in sein fersenlanges weißes Chorgewand. Aus der Basilika war bereits der feierliche Gesang seiner Klosterbrüder zu hören. Der Eröffnungsvers, »Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund Dein Lob verkünde«, war längst im hohen Kirchenschiff verklungen. Der Konvent hatte schon den Hymnus angestimmt.
Zügigen Schrittes, aber ohne unziemliche Hast betrat er die Kirche und begab sich im Altarraum an seinen Platz in den Stallen des Chors.
Man schenkte seinem Zuspätkommen keine sonderliche Beachtung. Die meisten hatten genug damit zu tun, die Schläfrigkeit zu überwinden, die ihnen noch in den Knochen steckte, und sich im Wechselgesang auf ihren nächsten Einsatz zu konzentrieren. Selbst der schlaksige Novize Bartolo Lorentino, der mit seinen weichen, knabenhaften Zügen weitaus jünger aussah als zwanzig, schenkte ihm allenfalls flüchtige Aufmerksamkeit und gähnte herzhaft. Mittlerweile hatte der junge Bruder sich an die seltsamen Eigenmächtigkeiten Pater Angelicos gewöhnt, der ihm nicht nur als Novizenmeister zugeteilt worden war, sondern ihn auch als Malerlehrling unter seine Fittiche genommen hatte – wenn zunächst auch nur widerwillig und voller Groll gegen den Prior, der das über seinen Kopf hinweg einfach so verfügt hatte.
Vincenzo Bandelli war denn auch der Einzige, der nicht mit nachtmüder Gleichgültigkeit über das verspätete Eintreffen des Malermönchs hinwegging. Der missmutige, ja misstrauische Blick des Priors traf Pater Angelico von der gegenüberliegenden Seite des Chorgestühls. Die Augen zusammengekniffen, eine steile Furche auf der hohen Stirn und die Habichtsnase wie den Finger eines Anklägers auf ihn gerichtet, starrte der Klosterobere zu ihm herüber. Ganz offensichtlich bezweifelte der Prior, dass es für sein spätes Erscheinen einen triftigen Grund gab.
Natürlich war ihm nicht entgangen, dass Pater Angelico nicht aus seiner Zelle oder der Werkstatt gekommen war, sondern von draußen. Die Wasserlachen, die seine durchnässten Sandalen und der triefende Saum seiner Kutte auf dem Weg durch den Altarraum auf den Steinplatten hinterließen und in denen sich das warme Licht der Kerzen spiegelte, waren verräterisch genug. Natürlich fragte der Obere sich, was ein Mönch – mochte er auch noch so eigensinnig sein – zu dieser von Regenschauern gegeißelten Nachtstunde in der Stadt zu schaffen gehabt hatte.
Ohne mit der Wimper zu zucken, geradezu herausfordernd unbeugsam, hielt Pater Angelico dem prüfenden Blick seines Priors stand. Es war, als warte der Obere darauf, dass er zum Zeichen des gebotenen Gehorsams und der Unterwerfung als Erster den Blick senkte.
Pater Angelico dachte gar nicht daran, klein beizugeben und ihm den Sieg zu gönnen. Zwischen ihnen beiden war nicht viel Liebe verloren, bei Gott nicht! Klösterliche Brüderlichkeit kannte auch in San Marco ihre Grenzen, und die waren, was Vincenzo Bandelli und ihn anging, besonders eng gezogen.
Es war der Prior, der dem stummen Ringen schließlich ein Ende setzte und sich geschlagen gab. Er wäre jedoch nicht Vincenzo Bandelli gewesen, hätte er die Niederlage nicht geschickt zu kaschieren gewusst. Als zwei Stallen neben ihm dem eulengesichtigen Bibliothekar Bruder Manetto die Augen zufielen und der Kopf auf die Brust sank, nutzte er die Gelegenheit, fuhr zu dem vom Schlaf übermannten armarius herum und holte ihn mit einem scharfen Zischlaut zurück ins Chorgebet.
Pater Angelico empfand keine Genugtuung, geschweige denn Freude darüber, dass er seinem Oberen einmal mehr erfolgreich die Stirn geboten hatte. Vielmehr verstärkte es seine Niedergeschlagenheit und litt er umso mehr daran, dass er sich den drei evangelischen Räten Armut, Keuschheit und Gehorsam nicht vorbehaltlos unterwerfen konnte und damit den Ansprüchen eines wahrlich gottgeweihten Lebens immer weniger gerecht wurde. Trost suchte er, indem er den Blick auf das Kruzifix des Altars richtete.
Irgendwann in dieser Zeitspanne, während derer er sich stumm mit Vincenzo Bandelli maß und dann seiner störrischen Unbeugsamkeit schämte, traf Pater Nicodemo in Santa Croce auf seinen Mörder.
6
Der Mann im Torweg lockerte den Dolch unter seinem Umhang. Jeden Moment musste sein Opfer drüben auf der Kreuzung auftauchen und in die Via dei Pilastri einbiegen. Dann galt es, seine erste Bluttat schnell und beherzt auszuführen.
Er hoffte, der Aufgabe gewachsen zu sein. Denn bei dem einen Toten würde, nein, durfte es nicht bleiben. Keine halben Sachen, hatte er sich geschworen. Er musste verantwortlich und methodisch vorgehen.
Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte er aus erheblich geringfügigeren Gründen gefürchtet, sein Seelenheil zu verwirken. Aber diese Ängste bedrängten ihn nicht länger. Es hatte nur eines Anstoßes und einigen logischen Denkens bedurft, um ihn ein für alle Mal von diesem Joch zu befreien. Der Mensch war schon von der Schöpfung her so angelegt, dass er einfach nicht umhinkam, Böses zu tun und sich durch Gewalt Vorteile zu verschaffen.
Nur die körperlich wie geistig Schwachen duckten sich ein Leben lang und wagten nicht, von ihrem natürlichen Recht auf Gewalt Gebrauch zu machen. Ganz wie Vergil es einmal so treffend formuliert hatte: »Niedere Seelen verrät die Furcht.«
Dabei hatte es im Laufe der Menschengeschichte immer der Gewalt in unterschiedlichster Form bedurft, um das Schwache, Verdorbene und Unwerte auszumerzen – so, wie es immer wieder einmal eines Feuers bedurfte, um den Wald von totem Unterholz zu reinigen und der Erde neue Lebenskraft zu verleihen. Einen Menschen zu töten konnte daher nicht mehr Bedeutung haben als das Ausrupfen von Unkraut.
Würden denn sonst all die hohen kirchlichen Würdenträger, selbst der vicarius Christi in Rom, hartnäckige Feinde hinterrücks umbringen lassen und einen blutigen Eroberungskrieg nach dem anderen führen?
Natürlich nicht!
Die Kirchenfürsten und Päpste, die doch überwiegend eine hohe Bildung genossen hatten, wussten seit jeher, dass man um sein Seelenheil nicht zu fürchten brauchte, nur weil man Blut vergoss.
Man musste das nicht unbedingt öffentlich schönreden und schon gar nicht dem gemeinen Volk klarmachen, das nicht von ungefähr popolo minuto hieß. Nur ausgemachte Dummköpfe sägten an dem Ast, auf dem sie saßen. Deshalb wurden von den Kanzeln ja auch ständig Höllenszenarien verkündet, wurde beschwörungsreich zu Gehorsam, Friedfertigkeit und Nächstenliebe aufgerufen. Solches Gefasel war für den, der wachen Geistes war und hinter die Kulissen zu blicken vermochte, leicht als raffinierter Schwindel und Mittel zum Zweck der Herrschaftssicherung zu durchschauen.
Außerdem musste auch die Absolution zu ihrem Recht kommen. Zuweilen gab es sie – auch für Auftragsmorde – sogar schon im Voraus, selbst vom Stuhl Petri. Man brauchte in der Geschichte gar nicht weit zurückzugehen, um solch einen Fall zu finden, der öffentlich geworden war – von den unzähligen geheim gebliebenen ganz zu schweigen. Gerade einmal elf Jahre zuvor hatte Papst Sixtus IV. während der blutigen Pazzi-Verschwörung gegen das Haus Medici dem Meuchelmörder Giovan Battista Montesecco und seinen Komplizen – unter denen sogar zwei geweihte Priester gewesen waren – schon im Vorhinein Absolution für alle Morde erteilt, die sie in Florenz an den Medici und deren Verbündeten begehen würden.
Dass der blutige Umsturz in Florenz kläglich gescheitert und nur der jüngere Bruder Giuliano, nicht aber der mächtige Stadtherr Lorenzo de’ Medici während der Ostermesse im Dom den Messerstichen der Attentäter zum Opfer gefallen war, hatte Sixtus bis zu seinem Tod nicht verwinden können, und es hieß, er habe es den stümperhaften bravi, den Meuchelmördern, mit den lästerlichsten Verwünschungen und Flüchen vergolten.
Und was den Patron von Florenz anging, Lorenzo de’ Medici, den das tumbe Volk als Il Magnifico verehrte und der als ungekrönter Fürst über die Toskana herrschte, so hatte auch er zweifellos mehr Blut an den Händen als …
Der Mann in der Tordurchfahrt stockte. Raues Gelächter holte ihn aus seinen Betrachtungen und machte ihm bewusst, dass kein Regen mehr wie aus Eimern vom Himmel stürzte und die Nacht mit Tosen erfüllte.
Zwei Männer, einander den Arm um die Schulter gelegt, kamen wankend die Straße herunter. Betrunkene, die das plötzliche Ende des Gusses, das vielleicht auch nur eine Atempause war, nutzten, um nach Hause zu stolpern. Oder aber sie wollten ihre Zecherei in einer der verruchten Hinterhof- und Kellertavernen im Färberviertel unten am Fluss fortsetzen, wo die ganze Nacht hindurch scharfer Fusel ausgeschenkt wurde.
Er zog sich weiter in den dunklen Torweg zurück. Die beiden Zecher torkelten kichernd an ihm vorbei und verschwanden kurz darauf nach rechts in die Via Fiesolana.
Als er sich wieder vorwagte und zur Kreuzung hinüberspähte, sah er ihn im Nieselregen aus der Via di Cafaggiolo und über den Borgo Pinti kommen – einen schwarzen, wehenden Schatten. In der Mitte des Schattens, der sich seltsam ruckartig bewegte, blitzte etwas Weißes auf. Die Tunika eines Dominikaners, der sich seine schwarze Cappa mit hochgeschlagener Kapuze eng um die Schultern zog und es sehr eilig hatte.
Pater Nicodemo, der Dominikaner mit dem steifen rechten Bein!
Der Mann im Torbogen lächelte selbstzufrieden. Er hatte nicht nur die Zeit gut berechnet, die der Priester für seinen nächtlichen Weg von San Marco nach Santa Croce benötigen würde, sondern auch den richtigen Ort für seinen Hinterhalt gewählt. Er brauchte also auf keine der Alternativen zurückzugreifen, die er sich für den Fall zurechtgelegt hatte, dass sich eine seiner Annahmen als falsch erwies. Plan Alpha kam also zur Umsetzung, und das erfüllte ihn mit Stolz, hatte er doch gewissenhafte Vorarbeit geleistet. Nicht nur dem Tapferen half das Glück, wie es bei Terenz hieß, sondern auch dem Vorausschauenden!
Er zog den Dolch aus der silbernen Scheide und hielt ihn unter dem Umhang verborgen, während er auf die eiligen Schritte lauschte, die durch Pfützen klatschten und immer näher kamen. Er konnte nicht verhindern, dass sein Herz nun doch höherschlug und sein Mund plötzlich wie ausgetrocknet war.
Er ließ Pater Nicodemo ein paar Schritte am Tordurchgang vorbeihasten, dann trat er hinaus auf die Via dei Pilastri, setzte ihm nach und rief scheinbar erstaunt: »Pater Nicodemo? Täusche ich mich oder seid Ihr es wirklich? Bei Gott, Ihr seid es! Natürlich, der erste Bote galt selbstredend Euch! Wie hätte es auch anders sein können?«
Der Dominikaner fuhr zusammen, hielt inne, drehte sich um – und machte nun seinerseits ein verblüfftes Gesicht.
»Bei meiner Seele, Euch zu dieser Stunde hier anzutreffen ist wohl das Letzte, womit ich gerechnet hätte!«, stieß er, überrascht und erleichtert zugleich, hervor.
»Ich nehme an, auch Ihr seid auf dem Weg zu Ser Aurelio, werter Pater.«
»In der Tat, aber was habt Ihr …«
Der Mann mit dem Dolch im Gewand fiel ihm ins Wort.
»Ich weiß, wie schlecht es um ihn steht und wie viel es ihm zweifellos bedeutet, Euch an seinem Sterbebett zu haben. Mich dagegen ehrt es über Gebühr, dass er darum gebeten hat, auch mich noch einmal zu sehen.«
»Man hat auch Euch zu ihm gerufen?« Pater Nicodemos Verwunderung hätte kaum größer sein können.
Bekümmertes Nicken.
»Mir war nicht klar, dass Ihr so eng mit Ser Aurelio befreundet seid«, gestand der Dominikaner. »Und schon gar nicht hätte ich eine so innige Verbindung zwischen Euch erwartet, dass er Euch in dieser Stunde zu sich rufen lässt.«
»Nicht alles liegt so offen zutage wie die Frömmigkeit Eures Herzens und die guten Werke, die Euer Orden vollbringt«, antwortete der Mann mit dem Dolch in der Hand scheinheilig und legte dem Pater scheinbar freundschaftlich den anderen Arm um die Schulter. »Aber kommt, lasst uns hier die Abkürzung nehmen. Wir sollten eilen und nicht eine Sekunde verschenken.« Damit zog er den Dominikaner nach rechts in die Seitengasse.
»Seit wann ist der Weg durch die Via Sant’Anna eine Abkürzung, wenn man zum Haus von Ser Aurelio will?«, wandte Pater Nicodemo verwirrt ein, gab dem sanften Druck aber dennoch nach. »Das Haus der Rovantini liegt doch genau an der Ecke zur Piazza di San Ambrogio.«
»Es mag Euch nicht so erscheinen«, sagte der Mann mit dem Dolch, als sie sich dem großen Gebäude zu ihrer Linken näherten, einer Brandruine, halb eingestürzt und von den Flammen gezeichnet, »aber vertraut mir, wenn ich Euch versichere, dass dies der schnellste Weg zum Tod ist!«
Noch während er das sagte, glitt seine linke Hand von der Schulter des Priesters und presste sich auf dessen Mund. Gleichzeitig flog die Hand mit dem Dolch unter dem Umhang hervor. Und ehe Pater Nicodemo wusste, wie ihm geschah, durchtrennte die rasiermesserscharfe Klinge ihm schon die Kehle.
Der Todesschrei, der in ihm aufstieg, drang nicht mehr in die Nacht hinaus. Wie eine dunkle Fontäne schoss – ein paar Augenblicke noch geleitet vom Rhythmus des Herzschlags – Blut aus der klaffenden Wunde und ertränkte, was ein Schrei hätte werden sollen. An seiner Stelle kam nur ein blubberndes Röcheln aus dem blutüberspülten Spalt, der bis an den Halswirbel reichte.
Der Mörder stellte sich hinter den erschlaffenden Körper, fing ihn auf, zog ihn vom Straßenrand weg und schleppte ihn in die Brandruine. Dabei achtete er darauf, dass das Blut, das noch immer aus der riesigen Wunde sickerte, möglichst nicht seine Kleidung beschmutzte. Doch ganz vermochte er es nicht zu verhindern.
Er wusste genau, wo in der Ruine er die Leiche ablegen wollte, und zwar in dem ummauerten Raum, der einst die Küche gewesen war und dessen Decke das Feuer weitgehend unbeschadet überstanden hatte. Dort schleifte er den Toten hin und ließ ihn vor einer geschwärzten Wand zu Boden gleiten.
So etwas wie Euphorie erfasste ihn, als er auf den Leichnam starrte und darauf wartete, dass seine Augen sich an die Dunkelheit in der Ruine gewöhnten.
Ein berauschendes Gefühl voll Allmacht durchströmte ihn.
Ich habe es wahrhaftig getan!
Ich habe getötet, und es war so leicht!
Und sogleich schmeichelte er sich selbst, indem er sich sagte, dass es nur deshalb leicht gewesen sei, weil er die Tat so sorgfältig geplant und dann auch ohne Zögern und weiche Knie ausgeführt hatte. Selbst ein berufsmäßiger Bravo hätte es nicht besser machen können!
Für ihn tat es nichts zur Sache, dass der Dominikaner ein vertrauensvoller, ahnungsloser alter Mann gewesen war, den zu überwältigen es weder großer Körperkraft noch sonderlicher Raffinesse bedurft hatte. Ahnungslos und vertrauensvoll würden sie alle sein; alle, die auf seiner Liste standen und damit dem Tod geweiht waren.
Nein, dass Pater Nicodemo als Erster sterben musste, hatte von Anfang an festgestanden. Das gebot die Logik seines ehrgeizigen Vorhabens. Erst musste das Haupt fallen, bevor er sich den Gliedern widmen und beherzt ausmerzen konnte, was faulig war und nicht wert, am Leben zu bleiben.
Unwillkürlich wanderten seine Gedanken zu den anderen, deren Tod im Dienste seiner höheren Zielsetzung unumgänglich war, und er wünschte, er könnte noch in dieser Nacht den zweiten Mord ausführen und einen weiteren Namen von seiner inneren Liste streichen. Was natürlich ein Unding war, selbst wenn sich eine Gelegenheit geboten hätte.
Er musste seinen Taten Zeit lassen, jene Wirkung zu entfalten, von der das Gelingen seines Vorhabens im Ganzen abhing. Am Ende hatte sich alles zu einem bestimmten, unzweideutigen Bild zusammenzufügen. In der Umsetzung des Plans musste jeder einzelne Mosaikstein am richtigen Ort sitzen, damit es später keine Leerstelle gab, damit nichts das Bild störte, das er mit Blut zu zeichnen gedachte.
Der Anfang war nach der langen Zeit des Grübelns und gewissenhaften Planens endlich gemacht, und es war viel einfacher gewesen, als er erwartet hatte. Das nahm er als gutes Omen und als Hinweis darauf, dass er den richtigen Weg gewählt hatte.
Hatte er andererseits nicht schon immer gewusst, dass Töten und Blutvergießen ihm leicht von der Hand gingen, einfach weil sie ihm im Blut lagen?
Er seufzte.
Nun ja, dieser Teil – das Töten und Blutvergießen – war leicht gewesen. Was jetzt kam, war etwas ganz anderes und würde ihm zweifellos weit weniger gefallen.
Aber was getan werden musste, musste getan werden – und wenn es noch so widerlich war. Keine halben Sachen und nie das Ziel aus dem Blick verlieren! Die Botschaft musste unmissverständlich sein. Das galt auch für die anderen, die auf seiner Liste standen und dem Mönch folgen würden. Bei keinem durften hinterher Zweifel aufkommen, warum er den Tod gefunden hatte.
»Also bringen wir auch das hinter uns!«, raunte er sich selbst zu, stellte sich breitbeinig über den Leichnam und schlug mithilfe des Dolchs den schwarzen Umhang nach beiden Seiten zurück. Dann schob er dem Mönch die Tunika auf dieselbe Weise bis über den Nabel hoch und entblößte damit seinen Unterleib. Er zögerte kurz, dann beugte er sich hinunter, schlitzte das fadenscheinige Untergewand auf und setzte die Klinge an.
Wie gut, dass er daran gedacht hatte, alte Lederhandschuhe anzuziehen!
7
Keuchend und schwitzend wankte Bruder Bartolo Lorentino durch die hohe Bogentür und in die bottega seines Novizenmeisters, von dem er auch das Handwerk des Malens, insbesondere der Freskenmalerei, zu erlernen trachtete.
Sowie er die lang gestreckte und mit großen Steinplatten ausgelegte Werkstatt betrat, umgab ihn das stets aufs Neue berauschende Aroma. Es setzte sich aus den vielfältigen Gerüchen zusammen, die den Farbpigmenten, dem abgelagerten Holz der Tafeln, den Staffeleien, den grundierten Leinwänden, den steifen cartone fürs Vorzeichnen von Fresken sowie den Gefäßen mit Kalk und Zinkblende, Antimon und Harz, Leim und gebleichtem Öl, Beize aus Alaun und Pulver aus zerriebenen Weinstöcken und noch so vielen anderen Utensilien entströmten. Und über allem lag der intensive Geruch von Leinöl, der die Aromenvielfalt einer jeden Malwerkstatt dominierte.
Verglich man die Bottega mit den Werkstätten anderer Maler in Florenz, von denen nicht wenige eine ganze Reihe von Gesellen und Lehrlingen in Lohn und Brot hielten, machte sie nicht viel her. Aber das tat der Zuneigung, die Pater Angelico für sein Atelier empfand, nicht den geringsten Abbruch. Er liebte diesen Ort der Stille und der verheißungsvollen Düfte.
Auch Bruder Bartolo liebte die Stunden, die er hier mit seinem Meister verbrachte. Nur wünschte er, die kalten Tage wären gezählt und die belebende Wärme des Frühlings möge endlich einkehren, aber bis die Sonne wieder kräftiger auf die Toskana herabschien und ihm das Leben buchstäblich leichter machte, würden – dem Herrn sei’s geklagt! – noch Wochen vergehen. Lange Wochen, in deren Verlauf er sich noch etliche Male so würde abschleppen müssen wie jetzt!
Die schmalen Hände des Novizen mit den knabenhaften Zügen und dem gelockten nussbraunen Haar steckten nicht von ungefähr in dicken, ausgepolsterten Lederhandschuhen, deren Stulpen ihm fast bis zu den Ellbogen reichten. Er plagte sich mit zwei großen, schweren Metalleimern ab. Über den Deckeln, die mit einem halben Dutzend goldstückgroßer Löcher versehen waren, flirrte die Luft.
Die Eimer waren mit glühenden Kohlen gefüllt, und es schien, als wollten sie dem Novizen die Arme aus dem schlaksigen Körper reißen. Zumindest verstand Bruder Bartolo sich darauf, diesen Eindruck zu erwecken, indem er gequält das Gesicht verzog und sich steif und scheinbar unter Aufbietung letzter Kraftreserven bewegte.
Kurz nach ihm trug auch Laienbruder Gregorio zwei Eimer glühende Kohlen in die Werkstatt. Doch der konverse, ein einfacher, breitschultriger Mann von Anfang dreißig, mit pechschwarzem Vollbart, platt gedrückter Nase und muskelbepackten Armen, machte im Vergleich zu dem Novizen einen geradezu leichtfüßigen Eindruck.
»Bei den Leiden des Erlösers, was für eine Plackerei!«, stieß Bruder Bartolo hervor und steuerte das ihm am nächsten stehende Kohlenbecken an, das auf einem Dreibein ruhte. »Dass zur Malerei auch Schwerstarbeit gehört, habe ich nicht gewusst!«
Pater Angelico stand am hinteren der drei hohen Bogenfenster, die in die Längswand des Raums eingelassen waren und zum Klostergarten hinausgingen. Frühes Morgenlicht fiel auf mehrere unterschiedlich große Staffeleien sowie auf Regale und Tische, auf denen ein dem Uneingeweihten wüst erscheinendes Durcheinander aus Malutensilien, Gerätschaften und Gefäßen aller Art und Größe herrschte.
Wohin der Blick auch schweifte, er fiel auf Steintöpfe, aus denen Pinsel und Federn ragten, auf Spachtel, Feilen, Messstäbe und Stichel, auf Mischpaletten, Zinnschalen, Eisentöpfe, Brennlöffel, Mörser und Bronzepfannen, auf schwere Reibsteine aus Porphyr, auf deren Marmorplatte grobkörnige Erdbrocken zu feinsten Farbpigmenten zerrieben wurden, auf glatt geschliffene Tafeln aus Eiche oder Pappelholz, auf Leinwandballen, abgegriffene Skizzenbücher und Stapel großer Bogen Cartone, auf mit Wasser gefüllte Glaskugeln und Spiegel aus Silberblech, die bei nächtlicher Arbeit das Licht von Kerzen und Ölleuchten bündelten und verstärkten – und auf vieles andere mehr.
An einem dieser vollgestellten Werktische war Pater Angelico damit beschäftigt, in einem großen Bronzemörser eine Handvoll Gesteinsbrocken zu Mineralpulver zu zermahlen, um am Ende ein kostbares Farbpigment zu gewinnen. Nun ließ er den schweren Stößel kurz ruhen und blickte zu den beiden Männern hinüber, die Glut für die drei schmiedeeisernen Kohlenbecken in seiner Bottega brachten.
Dass der Konverse, der als Fuhrknecht und Handlanger des cellerarius – des für die gesamte Vorratshaltung zuständigen Kellermeisters – körperlich hart zu arbeiten gewöhnt war, bei Bruder Bartolos Klage die Augen verdrehte, bekam er gerade noch mit. Eigentlich hätte er den Laienbruder dafür rügen müssen, doch er verzichtete darauf.
Respekt hatte man sich zu verdienen; nur weil man einen höheren gesellschaftlichen Rang einnahm, hatte man noch keinen Anspruch darauf. Jedenfalls war das seine Überzeugung, von der er auch nicht abrückte, selbst wenn er damit aneckte. Und gerade seinem Prior stieß diese Haltung immer wieder sauer auf.
Bartolo war von freundlichem, einnehmendem Wesen; er hatte gute Anlagen und einen willigen Geist, musste aber noch einiges lernen, das über Theologie und das Malhandwerk hinausging.
»Wenn es dir lieber ist, frierend und mit steifen Fingern Pinsel oder Zeichenstift zu führen, wie ich das bei meinem Meister noch gelernt habe, so können wir das gern versuchen«, schlug Pater Angelico vor. »Nur sollst du nicht glauben, dann könntest du dir mehr Fehler erlauben.«
Bruder Bartolo machte ein bestürztes Gesicht und versicherte hastig: »Bei Gott, es besteht wirklich kein Grund, dass Ihr Eure Unterrichtsmethoden ändert, Meister! Es sieht schlimmer aus, als es ist, glaubt mir!«
»Komisch, irgendwie überrascht mich das nicht«, erwiderte Pater Angelico trocken.
»Was sind schon ein bisschen Schlepperei, Schwitzen und Muskelschmerz, wenn es zum Ruhme Gottes geschieht!« Und noch während Bruder Bartolo das beteuerte, nahm er eilfertig den Deckel von einem der Eimer, wuchtete den schweren Behälter mit stoischer Miene hoch und ließ die halb durchgeglühten Kohlen vorsichtig in das gusseiserne Becken rutschen.
»So, du meinst also, du plagst dich zum Ruhme Gottes.« Ein spöttisches Lächeln huschte über Pater Angelicos Gesicht. »Du solltest aber das Füllen der Kohlenbecken mit Glut nicht mit einem divinum officium verwechseln. Es ist weder Gottesdienst noch ein Lobpreis des Herrn, sondern geschieht einzig und allein zu unserer persönlichen Annehmlichkeit«, sagte er und hielt damit dem Novizen das Unsinnige seiner Bemerkung vor Augen.
»Das … äh … das war wohl etwas ungeschickt ausgedrückt, Meister«, erwiderte Bruder Bartolo verlegen und klapperte mit den Eimerdeckeln.
Pater Angelico nickte. »Danke für die Bestätigung des Offensichtlichen. Das wenigste von dem, was wir tun, gereicht uns zur Ehre oder geschieht gar zum Ruhme Gottes. Irgendwie liegt das nicht in der Natur des Menschen. Aber es ist doch immer wieder Balsam für die Seele, wenn wir uns zumindest einreden können, dass unser Tun einem höheren Zweck dient«, fügte er bissig hinzu und rammte den Stößel in den Mörser.
Dem Novizen schoss das Blut ins Gesicht. »Wie recht Ihr habt, Meister.«
Auch diesen Allgemeinplatz ließ Pater Angelico ihm nicht ungestraft durchgehen. »Natürlich habe ich recht – selbst wenn ich unrecht habe, das bringt das Amt des Novizenmeisters mit sich«, sagte er und verkniff sich ein Schmunzeln. »Weißt du, warum Gott dafür gesorgt hat, dass die Gurgel geringelt ist?«
Verwirrt über diese Frage, die mit nichts von dem eben Gesagten in Zusammenhang zu stehen schien, blickte Bruder Bartolo seinen Meister an und schüttelte den Lockenkopf.
»Damit das Wort nicht zu schnell aus ihr herauskommt!«, beschied ihn Pater Angelico.
Der Novize seufzte und blickte beschämt zu Boden. Nun hatte seine gequälte Miene ganz und gar nichts Erzwungenes mehr an sich.
Der Konverse Gregorio grinste, während er seine Eimer geräuschvoll leerte, schadenfroh in sich hinein. Gleich darauf verließ er mit einem Nicken in Pater Angelicos Richtung die Werkstatt und trug die leeren Bottiche hinaus. Die Eimer des Novizen nahm er auch mit.
Pater Angelico wusste, dass er zuweilen Bruder Bartolo das Leben nicht gerade leicht machte. Aber wo, beim heiligen Blute Christi, stand denn geschrieben, dass ein Novize es leicht haben sollte? Eher traf doch wohl das Gegenteil zu.
Wer es in der Zeit seines Noviziats nicht schaffte, die ihm vorgesetzten Kröten ohne Aufbegehren zu schlucken, würde nie zu jenem Gehorsam imstande sein, den das Mönchsleben verlangte – nicht einmal zu jener abgespeckten Version von Gehorsam, die er, Pater Angelico, trotz seiner Widerborstigkeit Vincenzo Bandelli gegenüber immerhin noch zustande brachte.
Und wer zudem nicht lernte, sich bei allzu schludrigen Gedankengängen zu ertappen, bevor er sie unbedacht hervorplapperte, wer nicht die Kraft aufbrachte, sich rechtzeitig zu korrigieren oder im Zweifel lieber zu schweigen, der hatte hinter Klostermauern ebenso wenig zu suchen. Ein Mönch musste nicht unbedingt einen scharfen und gebildeten Geist haben. Den hatten viele nicht, ohne dass das gegen sie gesprochen hätte. Aber klar und rein sollte er sein. Zumindest in der Theorie. Die Wirklichkeit in Sachen Selbsterkenntnis, geistige Beweglichkeit und Redlichkeit sah in vielen Ordenshäusern freilich anders aus. Das hatten ihn annähernd siebzehn Jahre Klosterleben gelehrt.
Mit einem nachsichtigen Lächeln, das seinen bissigen Bemerkungen die Spitze nahm, winkte Pater Angelico den Novizen heran.
Bruder Bartolo trat zu ihm an den Werktisch und sah ihm einen Moment aufmerksam zu. Die Mineralien im Mörser sahen aus wie kleine grüne Froschrücken, die von einem dichten Geflecht aus Warzen übersät waren.
»Was siehst du, Bruder Bartolo?«