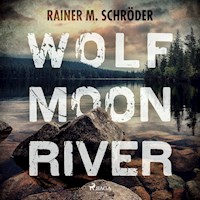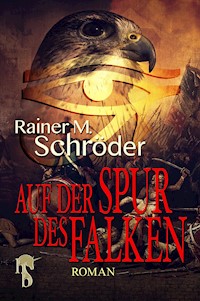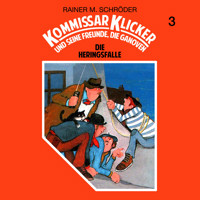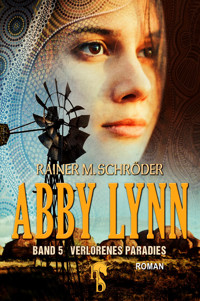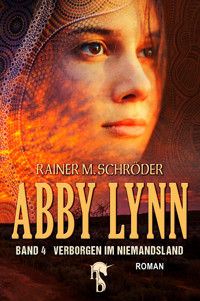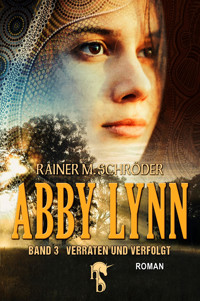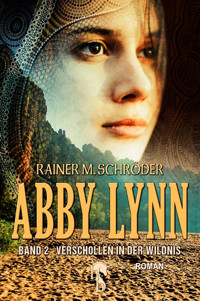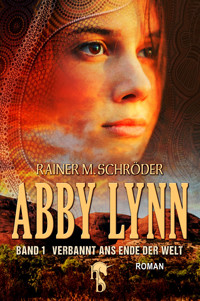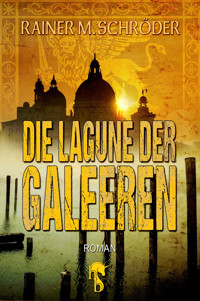
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1570: Ganz Norditalien leidet unter der Pest. Als die Seuche seine Familie auslöscht, flieht der 16-jährige Matteo mit der jungen Fiona aus seiner Heimatstadt San Bernardo. Bei Fionas Familie finden sie Zuflucht, doch Matteo sieht als Lohnknecht auf dem Land keine Zukunft für sich – und Fiona. Sein Weg führt ihn nach Venedig zu seinem Onkel Tomaso, einem angesehenen Schiffbaumeister. Dieser verschafft ihm Arbeit im geheimnisvollen Arsenal, wo mächtige Kriegsgaleeren für den Kampf gegen das Osmanische Reich gebaut werden. Doch die größte Bedrohung lauert in den dunklen Gassen und prunkvollen Palazzi der Lagunenstadt. Matteo wird Zeuge von Intrigen, Verrat und Mord. Die Schlinge um ihn zieht sich immer enger. Wie entkommt er den Schatten, die ihn verfolgen und wird er den wahren Feind enttarnen, bevor es zu spät ist? Wird er jemals seine geliebte Fiona wiedersehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Die Lagune der Galeeren
Roman
»Maßstab für die Forderungdes Lebens ist nur deine eigene Kraft.Und deine mögliche Tat besteht darin,nicht fahnenflüchtig geworden zu sein.«Aus: Zeichen am Wegvon Dag Hammerskjöld
In Liebemeiner Frau Helga,meinem Licht auch in dunkelster Nacht
Erster Teil
San BernardoMärz bis April 1570
1
Es war jene kurze Zeitspanne fahler Dämmerung, in der sich die dunklen Schatten der Nacht noch überall in den Gassen und Straßen behaupteten und in der man dem Eindruck erliegen konnte, dass dem zögerlichen Vordringen des im Osten hervorbrechenden Lichts ein klägliches Scheitern an den Bastionen der Dunkelheit drohte. Es war die Stunde der Toten von San Bernardo.
Fröstelnd stand Matteo Lombardi im Erdgeschoss des Elternhauses am Fenster, das nach vorn zur Straße hinausging. Seine Hand zitterte leicht, als er den Schlagladen ganz langsam eine Handbreite aufschob. Er schluckte mehrmals heftig, weil der Kloß in seiner Kehle einfach nicht weichen wollte, und zwang sich, seinen Blick nicht an den Türen der gegenüberliegenden Wohnhäuser entlangwandern zu lassen. Was für ein grauenvoller Anblick sich seinen Augen dort darbieten würde, wusste er auch so.
Matteo starrte durch den Spalt schräg hinüber auf die Straßenecke, wo sich die Via San Fermo mit der Via del Carmine kreuzte, und lauschte angestrengt in den kühlen, frühen Morgen. Mit wild schlagendem Herzen wartete er auf die schauerlichen Rufe, die jeden Augenblick durch die Straßen ihres Viertels dringen mussten. Und dann würden sie dort drüben um die Ecke kommen, diese entsetzlichen, schwarz gewandeten Gestalten, die ihm wie Ausgeburten der Hölle vorkamen, wie zu Fleisch und Leder gewordene Gespenster aus einem grässlichen Albtraum. Für ihn waren sie die Verkörperung des unsäglichen Leides, das über seine Familie und so viele andere Menschen gekommen war!
Eine unnatürliche, totenähnliche Stille lag über der norditalienischen Kleinstadt San Bernardo, die in der oberen scharfen Biegung einer s-förmigen Schleife der Brenta lag. Der breite Arm des Flusses umschloss sie im Norden, Westen und Süden, sodass die Stadt auf dem Landweg nur von Osten her zugänglich war.
Nirgendwo regten sich an diesem Morgen auch nur Ansätze der vertrauten frühmorgendlichen Geschäftigkeit, zu der San Bernardo sonst immer beim ersten Licht eines neuen Tages erwachte. Nicht eine Menschenseele zeigte sich auf der Straße. Nirgendwo schlugen Türen, wurden Fensterläden aufgestoßen, klapperte Kochgeschirr, grüßten sich Nachbarn. Kein erhabenes, weit klingendes Morgengeläut rief zu häuslichem Gebet oder heiliger Messe. Von den Türmen der Kirchen, von denen seit Wochen die schwarzen Fahnen wehten, fiel nicht ein Glockenton herab. Auch die Totenglocke, die in der ersten Woche der Katastrophe fast Tag und Nacht geläutet und die Todesangst unablässig in jedes Haus getragen hatte, war längst verstummt.
Aber jeden Augenblick würden sie diese unwirkliche, düstere Stille brechen! Gleich würden die Schnabelmänner durch die Straßen ziehen und mit ihrem grausigen Tagewerk beginnen!
Ja, da waren sie schon! Er hörte sie kommen, die Pestknechte, deren Gier nach Geld größer war als ihre Angst vor dem Tod!
Die Kälte, die Matteo plötzlich in Wellen überfiel und ihn bis ins Mark erschauern ließ, hatte nichts mit der frischen Morgenluft zu tun. Sie kam von den Rufen der Schnabelmänner, die ihm der böige Märzwind schwach von drüben aus der Seitenstraße ans Ohr wehte und die beständig lauter wurden und sich der Kreuzung näherten.
Manchmal verstummten die Rufe für einige Augenblicke und diese Pausen waren nicht weniger unheimlich, wusste Matteo doch nur zu gut, womit die Schnabelmänner in diesen Momenten des Aussetzens beschäftigt waren.
»Corpi morti! … Corpi morti!1«
Dumpf, teilnahmslos und wie aus halb erstickten Kehlen steigend, drangen die Rufe der Totengräber im nasskalten Morgengrauen durch die ausgestorbenen Straßen von San Bernardo. Sie zogen mit ihrem Fuhrwerk durch die Viertel, um die Leichname derjenigen einzusammeln, die der schwarze Tod in der Nacht dahingerafft hatte – und die ihre Angehörigen einfach in Tücher gewickelt auf die Straße vor die Tür gelegt hatten. Auf die Toten wartete irgendein Massengrab in ungeweihter Erde vor der Stadt. Denn würdige Begräbnisse mit Glockengeläut, heiliger Messe und einer Trauerfeier, an der Verwandte, Freunde und Nachbarn der Verstorbenen teilnahmen, gab es längst nicht mehr – ebenso wenig wie die kirchlichen Sakramente der Buße, der Kommunion und der letzten Ölung. Die Geistlichen von San Bernardo waren entweder tot oder aus der Stadt geflohen. Dasselbe galt für die meisten Pfarrhelfer und Kirchendiener. Und von den wenigen Mönchen des kleinen Minoritenklosters, deren Barmherzigkeit und selbstlose Aufopferung bei der Pflege der zahllosen Kranken auch im Angesicht des Todes unerschütterlich geblieben war, lebte keiner mehr.
»Corpi morti! … Corpi morti!«
Augenblicke später sah Matteo drei maskierte Männer aus dem Halbdunkel der gegenüberliegenden Straße treten. Jeder von ihnen trug ein eng anliegendes, schwarz gefärbtes Ledergewand, das bis zu den Knöcheln herabfiel und im Rücken mit Lederbändern fest zugeschnürt wurde. Zudem waren sie bewehrt mit langen, ledernen Stulpenhandschuhen, einer monströsen Glasbrille, deren Ledereinfassung die Augen auch an den Seiten eng umschloss, und mit einer schauerlichen Ledermaske, aus der sich vor Mund und Nase ein grotesk großer schnabelartiger Fortsatz nach vorn wölbte. Im Innern dieses breiten und weit vorstrebenden Schnabelfortsatzes befanden sich mit Essig getränkte Schwämme und geruchsstarke Kräuter in eingenähten Stoffbeuteln, von denen man sich erhoffte, dass sie die Erreger der Pest fernhielten und für reine Atemluft sorgten.
Mit steifen, fast hölzernen Bewegungen kamen sie wie Wesen aus den feurigen Höhlen der Unterwelt die Straße hoch. Einer der drei Schnabelmänner ging vorweg. Die anderen beiden folgten ihm mit dem Leichenkarren.
Der Mann an der Spitze der Pestknechte hielt rote Kreide in der Hand, mit der er jedes Haus markierte, in dem der schwarze Tod Einzug gehalten hatte. Jetzt, am Ende der dritten Woche seit Ausbruch der Pest, fand sich das gefürchtete Todeszeichen schon fast an jeder zweiten Haustür.
Niemand, den der Fluch traf, konnte sich länger als ein paar Tage vor dem Pestzeichen schützen, das jeden im Haus zu einem Ausgestoßenen machte. Zwischen dem Ausbruch der Krankheit und dem Tod lagen meist nicht mehr als drei, vier Tage. Manchmal verstrichen zwischen dem ersten hohen Fieber und dem letzten Atemzug sogar nicht einmal drei Tage. Und spätestens, wenn der erste Tote vor der Türschwelle lag, malte der Schnabelmann sein Kreuz an die Tür. In San Bernardo war das mittlerweile wie ein wortloses Todesurteil für die restlichen Hausbewohner – und für jeden, der mit ihnen in Berührung kam. Ja, es hieß sogar, dass es schon reichte, vom Blick eines Erkrankten getroffen zu werden, um selbst vom schwarzen Tod befallen zu werden.
Die Haustür der Lombardis trug schon seit der zweiten Woche das rote Pestkreuz, seit Matteos Vater, Schmied von Beruf und ein breitschultriger Mann mit der gewaltigen Kraft eines Zugochsens, innerhalb von drei Tagen von der mörderischen Krankheit dahingerafft worden war. Vom Tod so mühelos niedergemäht wie dünnes Gras von der scharfen Schneide einer Sichel.
»Corpi morti! … Corpi morti!«
Matteo wollte sich abwenden, aber sein Blick folgte fast zwanghaft den drei Schnabelmännern und im nächsten Moment bemerkte er das in graue Leinentücher gewickelte Bündel vor der Haustür der Familie Crivelli. Das Bündel war so klein, dass er gar keine langen Vermutungen anzustellen brauchte, wen es im Haus ihrer Nachbarn als Nächsten getroffen hatte. Es konnte sich nur um das Jüngste der Crivellis handeln, das nicht einmal zweijährige Mädchen Mariana.
»Komm vom Fenster weg, Junge! Und zieh den Schlagladen wieder zu! Der kalte Luftzug tut deinen Geschwistern nicht gut. Auch wird es Zeit, dass wir beten.« Die leise, kraftlose Stimme der Mutter in seinem Rücken zitterte und verlor sich im Raum wie das schwache Flattern eines völlig erschöpften Vogels.
Matteo sah, wie die ledergewandeten Schnabelmänner das winzige Bündel aus dem Dreck der Straße hoben und es zu den anderen auf den Schinderkarren legten. Eine Gänsehaut überfiel ihn, sie begann in seinem Nacken und lief bis zu den Beinen hinunter. Er spürte das unbändige Verlangen, davonzulaufen und dem Grauen zu entfliehen.
Aber es gab keine Flucht vor der entsetzlichen Geißel, mit der die Pest den Tod über die Bewohner von San Bernardo brachte. Und wenn er sich jetzt vom Fenster abwandte und damit dem schauerlichen Anblick der Schnabelmänner entfloh, dann wartete auf ihn das Leiden seines neunzehnjährigen Bruders Riccardo und seiner vierzehnjährigen Schwester Pia. Beide lagen sie mit hohem Fieber auf einem Notlager vor dem Kamin der Wohnstube. Und beide trugen sie seit der späten Nachtstunde die unverkennbaren Zeichen der Pest, die Blutknoten und Anschwellungen in der Leiste und in den Achselhöhlen, die sich bald zu eitrigen, apfelgroßen Beulen auswachsen würden.
»Komm und lass uns beten!«, forderte ihn die Mutter leise, aber mit beschwörender Eindringlichkeit auf. »Beten wir, dass die blinde Seherin Wort hält und sich trotz allem noch zu uns ins Haus wagt!«
»Ja, Mutter«, antwortete Matteo gehorsam, zog den Schlagladen zu und folgte seiner Mutter hinüber in die schlichte Wohnstube, wo im Kamin ein kräftiges Feuer prasselte. Denn nachdem herrlich sonnige und warme Tage die ersten beiden Märzwochen bestimmt hatten, war das Wetter in der zweiten Monatshälfte, kurz nach Ausbruch der Pest, umgeschlagen und hatte eine empfindliche Abkühlung und ungewöhnlich viel Regen gebracht.
Jeder Schritt, der ihn seinen todkranken Geschwistern näher brachte, kostete Matteo Überwindung. Er schämte sich für seine Angst und für seinen fast übermächtigen Drang, seine Mutter und seine Geschwister im Stich zu lassen, einfach aus dem Haus zu laufen und sich irgendwo zu verstecken, wo es weit und breit keinen gab, den der Fluch des schwarzen Todes getroffen hatte.
Vor der Feuerstelle lagen seine Geschwister Riccardo und Pia auf Strohsäcke und Decken gebettet. Ihre schweißbedeckten Gesichter glühten im hohen Fieber, das ihre Kräfte mit einer so wilden Vernichtungswut verzehrte wie die unruhig lodernden Flammen die Holzscheite im Kamin. Die Mutter sank vor dem Krankenlager auf die harten Dielenbretter, wischte Riccardo und Pia den Schweiß vom Gesicht, legte ihnen feuchte Tücher auf die Stirn und begann dann mit bebender Stimme zu beten, dass Gott wenigstens ihre Kinder verschonen möge und dass er ihnen die Seherin Rosa Silvera ins Haus schickte. Denn wenn jemand etwas für ihren Erstgeborenen und ihre Tochter tun konnte, dann war sie es.
Matteo kniete sich an ihre Seite und fiel in das Gebet ein. Doch während seine Lippen einmal mehr göttlichen Beistand und Barmherzigkeit für seine erkrankten Geschwister erbaten, schnürte ihm die Angst fast die Kehle zu – die Angst und die qualvolle Frage, wann es wohl ihn treffen würde.
2
Keine halbe Stunde nachdem die Pestknechte durch die Straßen gezogen waren und die vor den Türen niedergelegten Leichen aufgesammelt hatten, klopfte es energisch an die Tür. Es war Rosa Silvera.
Man nannte die untersetzte, korpulente Frau in San Bernardo gemeinhin die »blinde Seherin«, weil ihr linkes Auge schon von Kindheit an den milchigen Schleier der Blindheit trug. Rosa Silvera warf wie ihre längst verstorbene Mutter die Astragale, die würfelförmigen Fersenknöchel der Ziege, und verstand sich darauf, die Zahlen dieser seltsamen Würfel zu deuten und in ein Orakel zu fassen.
Aber wohl mehr noch als für ihre Kunst der Befragung der Astragale war sie für die Heilwirkung ihrer Salben, Tinkturen, Pulver und Kräutergetränke bekannt. Einen Großteil der Kräuter zog sie in ihrem Garten, der ihr Haus, eine alte, halb verfallene Kate am östlichen Stadtrand, mit einem Dickicht aus Büschen und Gewächsen aller Art umgab. Andere Zutaten wie seltene Wurzeln, getrocknete Blütenblätter, Samen und Kräuter ließ sie sich aus fernen Orten kommen.
»Der Allmächtige segne Euch für Euren Mut und Eure Güte!«, rief Matteos Mutter mit großer Dankbarkeit, als sie Rosa Silvera die Tür öffnete. »Jetzt können wir wieder Hoffnung haben!«
Ein müdes Lächeln huschte über das füllige Gesicht der Seherin und Kräuterfrau, das durch die kräftige Nase, die hohen Wangenknochen und das vorspringende Kinn trotz aller Fleischesfülle eine herbe Note besaß.
»Man verliert die Hoffnung erst gar nicht, Signora Lombardi. Nicht einmal der Tod kann uns die Hoffnung nehmen. Und wenn doch, haben wir falsch gelebt«, erwiderte sie und strich sich eine fingerdicke Strähne aus dem Gesicht. Rosa Silvera trug ihr dichtes tintenschwarzes Haar, durch das sich schon viele graue Strähnen zogen, entgegen der Mode und Schicklichkeit von keiner Haube, ja nicht einmal von einem Haarband oder einer Spange gebändigt offen wie ein Mann.
»In dieser entsetzlichen Zeit ist es so unsäglich schwer, nicht alle Hoffnung … und gleich auch noch allen Glauben zu verlieren«, gestand Matteos Mutter mit kraftloser Stimme und nahm der Seherin den schweren Wollumhang ab. »Gott allein weiß, warum er uns diese fürchterliche Geißel geschickt hat und uns mit so unmäßigem Zorn straft. Gewiss, die Welt ist voller Sünde und Schlechtigkeit, undankbar gegen Gott und stürzt sich in alle Schandtaten. Nichts brauchen wir mehr als Läuterung und Umkehr. Aber musste Gott uns denn gleich mit dem schwarzen Tod schlagen?«
»Ich glaube nicht, dass Gott uns die Pest geschickt hat, um uns für unsere Sündhaftigkeit zu strafen«, widersprach Rosa Silvera. »Macht nicht Gott für all das Elend und Leiden verantwortlich, Signora Lombardi.«
»Ja, aber …«
»Gott ist kein blindwütiger Schlächter und Racheengel, der wie eine Bestie über eine Herde wehrloser Lämmer herfällt«, fiel ihr die Kräuterfrau ins Wort. »Seht mir meine Heftigkeit nach, aber ich kann das mit der Gottesstrafe nicht mehr hören! Wohin ich auch komme, jeder klagt den Allmächtigen an, dass der Fluch der Pest unsere Stadt getroffen hat. Hier ist nicht der Allmächtige am Werk! Auch nicht im nahen Padua und Brescia, wo die Pest nicht weniger schlimm wütet, wie es heißt.«
»Woher wollt Ihr das wissen, Seherin?«, fragte die Mutter voller Zweifel.
»Weil Jesu Leiden für uns am Kreuz dann ohne Sinn gewesen wäre!«, erwiderte Rosa Silvera. »Was wäre das für ein fürchterlicher Gott, wenn wir wirklich annehmen müssten, er würde in rasender Mordlust einerseits unschuldige Kinder und gottgefällige barmherzige Menschen ungerührt in den Tod reißen und andererseits so viele schlechte Menschen mit dem Leben davonkommen lassen. Denn genau das geschieht. Nein, Gott hat durch Jesus den neuen, ewigen Bund mit uns Sündern geschlossen, und er ist die Barmherzigkeit und Liebe – nicht ein satanischer Blutsäufer im Gewand entsetzlicher Seuchen.«
Matteo sah sie ebenso verblüfft an wie seine Mutter, die nun erneut zaghaft zu einem Widerspruch ansetzte: »Aber die Pest …«
Auch diesmal kam sie nicht dazu, ihren Einspruch ganz auszusprechen.
»… ist eine fürchterliche Krankheit, die alle anderen Plagen um ein Vielfaches an Elend und Tödlichkeit übertrifft«, führte Rosa Silvera den Satz für sie zu Ende. »Aber sie ist genauso wenig eine von Gott gesandte Strafe wie die Gicht, die Schwerhörigkeit, ein vereiterter Zahn, ein Armbruch, ein verrenkter Magen oder schmerzhafte Blähungen!«
Matteo bemerkte, wie es im blassen, verhärmten Gesicht seiner Mutter um die Mundwinkel herum zuckte, als wollte sich ein zaghaftes Lächeln einstellen, das sich jedoch aus Mangel an Kraft nicht durchzusetzen vermochte.
»Es ist schön, wenn man daran glauben kann«, sagte sie mit einem schweren Seufzer. »Nur von der Kanzel hat man noch nie dergleichen zu hören bekommen, immer nur von Gottes Zorn über unsere Sündhaftigkeit und von seinem Strafgericht.«
»Pfaffen!«, sagte Rosa Silvera geringschätzig. »Da kommt doch auf hundert Männer im Rock der heiligen Mutter Kirche meist nur eine wirklich fromme, barmherzige Seele, die es wert ist, am Altar unter dem Kreuz unseres Heilands zu stehen und Hirte genannt zu werden!«
Bei dieser scharfen, bissigen Kritik an den Kirchenmännern sog die Mutter die Luft scharf ein und schlug hastig das Kreuz.
»So, und jetzt lasst mich sehen, was ich für Eure Kinder tun kann, Signora Lombardi«, sagte Rosa Silvera und trat an das Krankenlager vor dem Kaminfeuer.
Die Untersuchung, die Matteos Bruder und Schwester offensichtlich nicht bewusst wahrnahmen, dauerte nicht lange. Das hohe Fieber, der Schüttelfrost und die verräterischen Schwellungen, die sich inzwischen auch an anderen Körperstellen als nur in der Leistengegend und in den Achselhöhlen zeigten, die rot-schwarzen Blattflecken der Pestrose, sprachen eine deutliche Sprache.
»Ja, die Zeichen sind auf sie gekommen!«, stellte Rosa Silvera nüchtern fest. »Aber um das zu erfahren, habt Ihr mich nicht gebraucht. Das habt Ihr auch vorher schon gewusst.«
»Ja«, hauchte die Mutter.
»Ihr wisst, dass ich keine Wunder vollbringen kann. Gegen die Pest ist meines Wissens kein Kraut gewachsen. Wie auch keiner weiß, warum der eine verschont bleibt und der andere durch sie zum Tode kommt. Meine Mittel vermögen die Schmerzen zu lindern und in manchen Fällen die Kräfte im Körper bei ihrem Kampf gegen den unbarmherzigen Feind, der in ihnen tobt, zu stärken. Aber alles andere liegt nicht in meinen Kräften.«
Die Mutter nickte tapfer. »Was immer Ihr für meine Kinder tun könnt, ich bin Euch dankbar dafür.«
Matteo dankte dem Herrgott im Stillen, dass Rosa Silvera keine jener drastischen Eingriffe und Behandlungen vorschlug, mit denen so viele andere angebliche Heiler so schnell bei der Hand waren. Mit Schaudern dachte er an den Bader Bitone, den die Mutter zuerst zurate gezogen hatte, als der Vater mit hohem Fieber darniederlag. Der kahlköpfige Mann hatte den Vater zur Ader gelassen. Aber nicht, indem er erhitzte Schröpfgläser aufgesetzt oder ihm die Venen angeschnitten hätte. Nein, er hatte dem Vater zuckende Blutegel auf den Armen und im Nacken angesetzt und der Mutter zum Schluss noch geraten, tote Kröten auf die schlimmsten der Schwellungen zu legen. Genützt hatte nichts, weder der Aderlass noch das Auflegen von toten Kröten. Der Vater war in der nächsten Nacht gestorben, aber auch der Bader hatte die zweite Pestwoche nicht überlebt.
»Leider sind meine Vorräte mittlerweile so gut wie aufgebraucht. Aber ein wenig von einem meiner besten Mittel habe ich gottlob noch. Ihr sollt es gerne haben«, sagte die Kräuterkundige und schlug das Tuch von ihrem Weidenkorb zurück. Sie holte eine kleine Holzdose hervor, die eine grünliche Salbe zum Auftragen auf die Pestflecken und -beulen enthielt. »Das ist alles, was ich für Eure Kinder zur Linderung zu tun vermag.«
Die Mutter murmelte ihren Dank.
»Versucht beim Apotheker Valverde ein Beutelchen mit schwarzem Nieswurz sowie ein wenig Gratula und Tausendgüldenkraut zu bekommen«, fuhr Rosa Silvera fort und ein bissiger Ton schlich sich kurz in ihre Stimme. »Sein Kollege, der tapfere Signor Russo, verfügte in seinem Laden in der Nähe vom Rathaus zwar über die weitaus größeren Vorräte. Aber der edle Herr hat mit seiner Familie ja schon in der ersten Woche das Weite gesucht. Bleibt also leider nur noch das Geschäft von Signor Valverde. Aber vielleicht habt Ihr Glück und Ihr bekommt bei ihm, was ich Euch angeraten habe. Ist das der Fall, so macht von den Kräutern einen heißen Aufguss, lasst ihn in einem Krug eine gute Stunde ziehen, versetzt ihn dann mit einem Löffel Honigsaft und zwei Löffeln voll Zwiebelsud und gebt den Kranken den Tee zu trinken, wann immer sie nach Wasser verlangen.« Sie machte eine kurze Pause, bevor sie hinzufügte: »Alles andere liegt in Gottes Hand. Der Mensch gleicht einem Hauch, seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. So steht es schon in den Psalmen. Und dessen sollten wir uns immer gewahr sein.«
»Der Allmächtige segne Euch und vergelte es Euch!« Matteos Mutter drückte ihr mehrere Münzen in die Hand.
Energisch wehrte die Kräuterfrau ab. »Nicht in dieser Zeit … und nicht im Angesicht so einer schrecklichen Krankheit, die auch die erfahrenste Kräuterfrau und den gelehrtesten Medikus zu einem hilflosen Nichtskönner stempelt!«
Doch Matteos Mutter bestand darauf, dass sie das Geld annahm. »Vielleicht habt Ihr ja zufällig Eure Würfel dabei und wagt einen Wurf!« Sie sagte es zu hastig und zu angestrengt, als dass ihr der Gedanke, sie um diesen Gefallen zu bitten, erst vor wenigen Augenblicken spontan gekommen sein konnte.
Rosa Silvera zögerte kurz und eine steile Falte bildete sich auf ihrer Stirn. Aber dann nickte sie. »Gewiss, ich habe meine Astragale immer bei mir.«
»Hättet Ihr dann auch die Güte, sie zu befragen?« Inständiges Flehen lag in Stimme und Blick der Mutter.
Matteo fiel in diesem Moment auf, dass sie ihren Rosenkranz in der rechten Hand hielt. Seine Mutter betete zur seligen Jungfrau und Muttergottes, wollte aber gleichzeitig ein Zeichen von der blinden Seherin!
»Also gut, wagen wir einen Wurf, wenn Euch so sehr daran gelegen ist«, sagte Rosa Silvera und trat an den Tisch. »Aber vergesst nicht, dass die Würfel nicht das Schicksal voraussagen, sondern dass es sich dabei immer um ein Orakel handelt, wie es die Menschen in der Antike schon gekannt und zu ihrem Nutzen eingesetzt haben.«
»Werft die Knochen!«, forderte die Mutter sie nach kurzem, hastigem Nicken auf.
Auch Matteo kam nun näher, mied jedoch den Blick der Seherin. Das milchige Weiß in ihrem linken Auge flößte ihm Unbehagen ein, wann immer er ihren Blick auf sich gerichtet sah. Es war dumm, denn Rosa Silvera war eine Frau von großer Güte, das wusste er, und zwar nicht erst seit heute. Aber es umgab sie doch auch etwas Dunkles und Geheimnisvolles und … ja, irgendwie Wildes, das er nicht genau zu benennen vermochte und vor dem er sich fürchtete.
Rosa Silvera griff in die tiefe Tasche ihres bauschigen Wollkleides und brachte fünf hellbraune, blank geriebene Würfelknochen mit runden Kanten hervor, die aus den Fersenknochen von Ziegen kamen. Sie besaßen in etwa die Größe einer Walnuss und hatten im Gegensatz zu richtigen Spielwürfeln nicht sechs, sondern aufgrund ihrer merkwürdigen Rundungen nur vier Flächen, auf denen sie liegen konnten. Auch gab es bei den Astragalen nur die Werte eins, drei, vier und sechs. Die Zwei und die Fünf existierten nicht.
»Asche!«, verlangte Rosa Silvera leise. »Ich brauche ein Bett aus Asche für die Astragale!«
»Natürlich! Entschuldigt, dass ich das vergessen habe!« Die Mutter lief schnell zur Feuerstelle und holte den Ascheneimer.
Rosa Silvera schöpfte mit der hohlen Hand ein wenig Asche aus dem Eimer und streute sie wie ein Sämann aus dem Handgelenk über die Tischplatte. Dann griff sie zu den Würfeln und umschloss sie mit beiden Händen.
Sie murmelte unverständliche Worte, während sie die fünf Würfelknochen in der Höhlung zwischen den Händen hielt und sie kreisförmig über das kleine Feld aus Asche führte. Schließlich verharrten ihre Hände, die flach wie zum Gebet zusammengepresst waren, über dem grauen Aschebett.
Matteo schaute zu seiner Mutter hinüber. Sie hatte die Augen geschlossen und die gefalteten Hände vor ihren Mund gepresst. Er sah, wie sich ihre Lippen bewegten. Sie betete inständig, vermutlich zur Muttergottes.
»Möge das Orakel der Astragale zu uns sprechen!«, sagte die Seherin feierlich, öffnete ihre Hände und ließ die Würfelknochen in das Bett aus Asche fallen.
Die Mutter hielt weiterhin die Augen geschlossen und betete, zweifellos um ein hoffnungsvolles Orakel.
Matteos Blick folgte dem Fall und dem Rollen der Würfel, die Spuren in der dünnen Schicht aus Asche hinterließen. Als sie liegen blieben und Rosa Silvera die fünf Astragale mit geschmeidigen, schnellen Handbewegungen zu einer Reihe zusammenschob, las er von den nach oben zeigenden Knochenflächen die Zahlenfolge ab. Sie lautete: Sechs, sechs, sechs, eins, eins.
Als er den Blick hob und ihn auf das zerfurchte Gesicht der Kräuterfrau richtete, sah er dort einen Ausdruck des Erschreckens.
»Was sagen die Würfel, Seherin?«, stieß die Mutter hervor, die die Anspannung nicht länger ertrug, und schlug nun wieder die Augen auf. »Wie sind sie gefallen? Welche Zahlen zeigen sie?«
Rosa Silvera griff augenblicklich nach ihren Würfelknochen, bedeckte sie mit ihrer Hand, schob sie zusammen und nahm sie auf.
»Eins, eins, eins, sechs, vier«, antwortete sie und räusperte sich umständlich.
»Du lügst, Seherin!«, sagte Matteo in Gedanken und ließ sie nicht aus den Augen. Aber die Frau mied seinen Blick und säuberte die Würfel mit einem Zipfel ihres Kleides.
»Und welches Orakel gehört zu dieser Zahlenfolge?«, fragte die Mutter bang.
»Zu dieser Zahlenreihe gehört der Spruch: ›Geh, wohin du wünschst. Denn fröhlich wirst du nach Hause kommen. Finden wirst du und tun, was du in deinen Sinnen überlegst‹«, rasselte Rosa Silvera das Astragal-Orakel herunter, um dann mit einer merkwürdigen Mischung aus Verärgerung und Entschuldigung hinzuzufügen: »Ich weiß, es sind Worte, die in dieser Situation wenig Sinn machen und Euch keine Hilfe sind, Signora Lombardi. Aber ich hätte wissen müssen, dass die Würfel sich mir verweigern und mir nicht die gewünschte Botschaft offenbaren würden. Es war eben nicht richtig, die Würfel so in aller Eile zwischen Tür und Angel zu befragen. Alle Dinge haben ihre rechte Zeit und ihren rechten Ort. Und dies war weder die richtige Zeit und schon gar nicht der rechte Ort, um die Würfel zu uns sprechen zu lassen.«
Die Mutter machte ein zerknirschtes Gesicht. »Ihr habt recht, Seherin. Ich hätte Euch nicht dazu drängen dürfen. Es tut mir leid.«
»Schon gut. Allein mich trifft hier die Schuld, denn ich hätte es besser wissen müssen. Und nun muss ich gehen«, sagte Rosa Silvera schnell, nahm ihren Korb auf und ließ sich ihren Umhang geben. Ein kurzer Abschiedsgruß an der Tür und Matteo war wieder mit seiner Mutter und seinen beiden todkranken Geschwistern allein.
3
»Wenn du mir Geld gibst, laufe ich sofort zum Apotheker und besorge die Kräuter!«, bot Matteo sich an, kaum dass die Tür hinter Rosa Silvera zugefallen war. Er hatte Mühe, sich seine innere Hast nicht anmerken zu lassen.
»Ja, lauf zu Signor Valverde und besorg alles!« Die Mutter griff zu ihrem Geldbeutel, zählte mit zitternder Hand einige Münzen ab und reichte sie ihm.
Matteo steckte das Geld ein, riss seinen Umhang vom Haken neben der Tür und stürzte hinaus auf die Straße. Er rannte zur Kreuzung und blickte sich nach Rosa Silvera um. Gerade sah er sie noch die Gasse zu seiner Rechten hocheilen und nach links um die Ecke verschwinden. Er lief ihr nach und hatte sie schnell eingeholt.
»Signora Silvera!«, rief er noch im Laufen. »Wartet bitte! Ich habe mit Euch zu reden!«
Auf seinen Zuruf hin drehte sich die Seherin um. Überrascht blieb sie stehen, als sie sah, wer ihr da nachgeeilt kam.
»Was gibt es?«, fragte sie, als er Augenblicke später vor ihr stand. »Hast du vielleicht vergessen, was du beim Apotheker für Kräuter holen sollst?«
»Nein.«
»Was gibt es dann noch zu reden, Matteo? Du heißt doch Matteo, nicht wahr?«
Er nickte knapp. »Ihr habt gelogen!«, bezichtigte er sie ohne Umschweife.
Ein ungehaltener Ausdruck erschien auf ihrem Gesicht, und nicht nur ihr gesundes Auge schien ihn zu fixieren, als wollte es ihn durchbohren. »Du bist gut beraten, dir deine respektlosen Worte reiflich zu überlegen, Matteo Lombardi! Denn mich der Lüge zu bezichtigen …«
»… entspricht der Wahrheit!«, fiel er ihr unbeirrt ins Wort, obwohl ihn ein flaues Gefühl im Magen befiel, als er das milchig verschleierte Auge der Seherin so starr auf sich gerichtet sah. »Ihr habt meiner Mutter nicht die richtige Zahlenfolge genannt! Ihr habt sie angelogen! Die Würfel zeigten nicht eins, eins, eins, sechs und vier, sondern die Zahlenfolge lautete dreimal die Sechs und zweimal die Eins! Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Also werft mir nicht vor, Euch der Lüge zu bezichtigen! Habt besser den Anstand, mir zu sagen, welche Botschaft die Würfel wirklich offenbart haben!«
Rosa Silvera sah ihn einen langen Moment schweigend an. Zwei Gestalten, ein Mann und eine Frau, kamen eiligen Schrittes die Straße herunter. Sie hatten sich verhüllt, sich mehrfach Tücher um Mund und Nase geschlungen. Mit nach vorn zusammengezogenen Schultern, die Arme vor der Brust gekreuzt und in leicht gebückter Haltung, als rechneten sie jeden Augenblick mit dem Niedersausen einer Peitsche auf ihren Rücken, hasteten sie über das Pflaster – vorbei an den vielen Haustüren mit dem roten Pestkreuz.
»Wie alt bist du?«, fragte Rosa Silvera, als die beiden von Furcht Gebeugten an ihnen vorbeigeschlichen waren.
»Siebzehn … im Sommer.«
»Du bist ein mutiger junger Mann, dass du mir nachgelaufen kommst und die Wahrheit wissen willst«, sagte sie und ihr Gesicht nahm einen sanften Zug an. »Denn du ahnst, dass ich einen guten Grund gehabt habe, warum ich deiner Mutter die wahre Zahlenfolge und das dazugehörige Orakel verschwiegen habe, nicht wahr?«
»Ja«, sagte Matteo. »Aber Mut ist etwas ganz anderes als das, was ich hier tue.«
Sie hob leicht die Augenbrauen. »So? Was ist dann Mut?«
»Das, was Ihr tut … und was meine Mutter auf sich nimmt«, sagte Matteo. »Ich habe Angst und fürchte mich so sehr, dass ich mich nicht traue, in die Nähe meiner Geschwister zu gehen. Ich kann es einfach nicht, sosehr ich auch an ihnen hänge. Aber diese entsetzlichen Beulen …« Er sprach nicht weiter, sondern schluckte. Und dann gestand er leise: »Wenn ich wüsste, wie ich es anstellen soll, würde ich auf und davon laufen.«
»Aber du tust es nicht.«
Er ließ den Kopf sinken. »Nein«, murmelte er. »Selbst dazu bin ich zu feige. Wohin sollte ich denn auch fliehen?«
Sie legte ihre Hand kurz auf seine Schulter. »Ich glaube nicht, dass du feige bist, Matteo Lombardi. Die Pest ist grausamer als jeder Krieg, schlimmer als ein Dutzend blutiger Schlachten auf freiem Feld. Und du stehst im Haus deiner Familie noch immer deinen Mann. Niemand könnte mehr von dir verlangen. Also geh nicht zu hart mit dir selbst ins Gericht.«
Matteo hob den Kopf. Er war nicht gekommen, um über sich zu reden. »Wie lautet das richtige Orakel, das Ihr meiner Mutter verschwiegen habt?«
Die Seherin atmete tief durch, doch sie wich seinem Blick nicht aus, als sie ihm antwortete: »›Nicht ist es möglich, etwas zu tun: Mühe dich nicht vergebens! Und bewege nicht jeden Stein, damit du nicht auf einen Skorpion triffst. Unglücklich ist das Geschäft: Nimm dich vor aller Mühsal in Acht.‹ So lautet das Orakel.«
Matteo nickte und das Herz wurde ihm so schwer, als wäre es von einem bleiernen Panzer umschlossen. »Bei wem sich die Pestbeulen zeigen, der ist verloren. Ist es nicht so? Oder habt Ihr davon gehört, dass jemand wieder gesund geworden wäre?«
»Es mag solche Fälle geben, aber gehört habe ich von einer solchen Heilung noch nicht.«
»Dann … werden meine Geschwister wie mein Vater an der Pest sterben, nicht wahr?«
»Ja, das werden sie wohl«, sagte sie ehrlich und ihr Gesicht sah mit einem Mal so müde und erschlafft wie das einer kraftlosen Greisin aus. »So, und jetzt gehst du zu Signor Valverde und besorgst die Kräuter. Was wir für die Kranken tun können, müssen wir tun, Matteo. Und bei ihnen zu sein und ihr Leid zu lindern ist der größte Dienst, den wir in dieser Zeit leisten können. Vertrau auf deine Kraft und auf deinen Mut, Matteo Lombardi. Entdecke, was in dir steckt.« Damit wandte sie sich um und eilte davon.
Mit einem Gefühl fast körperlicher Übelkeit sah er ihr nach. »Da ist nichts, Seherin …«, flüsterte er mit belegter Stimme. In ihm steckte nichts, was der Rede wert gewesen wäre, geschweige denn etwas, worauf er hätte stolz sein können. Er wagte sich nicht an das Krankenlager seiner Geschwister und dachte nur daran, vor dem Grauen zu flüchten und sich zu verstecken. Auch konnte er nicht einmal um den Tod seines Vaters trauern, obwohl er ihm doch so nahegestanden und ihn bewundert hatte. Nicht eine Träne hatte er am Grab weinen können. Nichts hatte er gespürt. Nichts als Unwirklichkeit und Kälte. Und er spürte noch immer nichts. Keinen Schmerz, keine Trauer. Jeder Vater und jede Mutter mussten sich eines solchen Sohnes schämen! Nein, in ihm steckte nichts als Feigheit und Schande!
4
Auf dem Weg zum Geschäft des Apothekers Antonio Valverde kam Matteo an zahlreichen Häusern vorbei, deren Bewohner in ihrer Angst vor Ansteckung die Fenster ihrer Läden und Wohnungen mit Brettern vernagelt oder sie gar mit Ziegelsteinen zugemauert hatten. Wo zu einem Anwesen ein Innenhof mit einem eigenen Brunnen gehörte, der von einer genügend hohen Mauer umschlossen wurde, war auf diese Weise oft sowohl die Vordertür als auch der Durchgang in der Hofmauer unzugänglich gemacht worden.
Diese Bürger von San Bernardo, die offenbar ausreichend gefüllte Vorratskammern besaßen, hatten sich selbst zu Gefangenen gemacht. Sie hofften, die Pestseuche von sich fernhalten zu können, indem sie jeden Kontakt mit anderen Menschen mieden. Und da sie in ihrem Hof über eine eigene Wasserstelle verfügten, kannten sie auch nicht den Zwang, ihr Haus aller Angst zum Trotz verlassen zu müssen, um einen der öffentlichen Brunnen aufzusuchen. Nicht selten schwelte in ihrem Innenhof auch ein Feuer, das ganz bewusst mit nassen Holzscheiten und feuchtem Stroh genährt wurde, damit es möglichst viel Rauch entwickelte. Der Rauch sollte den Pesthauch fernhalten, wie es hieß. Gerüchte und Mutmaßungen dieser Art gab es beinahe so viele wie Tote.
Aber mit einem eigenen Brunnen waren nur wenige gesegnet. Denn San Bernardo war alles andere als eine reiche Stadt. Dafür lag Padua, das mit dem Flussschiff, dem Fuhrwerk oder zu Pferd in einer halben Tagesreise zu erreichen war, einfach zu nahe. In dieser Region zog Padua den Handel an wie ein Magnetstein Eisenspäne, sodass nicht mehr viel für die Bewohner von San Bernardo blieb. Welcher Händler wollte sich auch damit aufhalten, hier Station zu machen und sich um ein Geschäft zu bemühen, wo er doch nur wenige Stunden weiterziehen musste, um die Zinnen von Padua zu erblicken? Die bescheidene Blütezeit dieser Kleinstadt in der engen, sinnfälligen Umklammerung der Brenta lag schon so weit zurück, dass sie längst zur Legende verblasst war. Aus jener fern zurückliegenden Zeit stammten auch die Befestigungsmauern, die inzwischen aus Mangel an den notwendigen Geldern für ihre Instandhaltung brüchig geworden und an zahlreichen Stellen sogar eingestürzt waren.
In den Gassen, wo die einfachen Leute in ärmlicher Enge lebten, fand man keine privaten Brunnen und daher auch keine zugemauerten Türen und Fenster. Dort hatte man bestenfalls billiges Sackleinen in Essig getränkt und über die geschlossenen Schlagläden gehängt.
Was die Gassen der Armen mit den Straßen der bessergestellten Bürger jedoch gemein hatten, war der vielstimmige und schauerliche Chor, der aus den Häusern kam. Dieser Chor der Kranken und der Trauernden war nicht übermäßig laut. Aber dennoch musste man sich nicht sonderlich anstrengen, um ihn wahrzunehmen. Man brauchte nur einmal kurz stehen zu bleiben und auf das zu lauschen, was aus den Häusern um einen herum auf die Straße drang. Dann hörte man ihn, diesen Chor des Leidens und des Schmerzes. Er setzte sich zusammen aus dem Stöhnen, Schreien und Wimmern der Pestkranken, den flehentlichen Gebeten der Angehörigen und dem Klagen, Weinen und Schluchzen der Hinterbliebenen.
Auf seinem Weg zum Geschäft des Apothekers stieß Matteo aber auch mehrfach auf Gruppen von betrunkenen Männern und nicht weniger berauschten und halb entblößten Frauen, die unter schrillem Gelächter, Grölen und Lallen durch die Straßen zogen und sich dabei in aller Öffentlichkeit schamloser Handlungen erdreisteten.
Das war das andere Bild, das San Bernardo unter dem Fluch der Pest bot. Denn während die meisten Bürger von lähmender Angst erfüllt waren, mit ihrem Gott und ihrem Glauben rangen und sich kaum noch auf die Straße wagten, entfesselte der schwarze Tod bei diesem anderen Teil der Bevölkerung die niedersten Instinkte, insbesondere die unstillbare Gier nach Sinnestaumel. Wenn der Tod schon unabwendbar schien, dann wollte man die kurze Lebensfrist, die einem noch blieb, auch bis zum letzten Augenblick auskosten, wollte sie ohne jede Reue in einem endlosen Rausch genießen und sich hemmungslos allen sinnlichen Leidenschaften hingeben. Kein Tabu sollte mehr gelten, keine Moral ihnen Zurückhaltung auferlegen! Und so herrschte in einigen Tavernen und auch in so manchen privaten Häusern eine geradezu hysterische Vergnügungssucht, die keine sittlichen Grenzen kannte. Da gab es Trunkenheit bis zur Besinnungslosigkeit, Unzucht ohne jede Scham und Hemmung.
Das Eckhaus des Apothekers Valverde lag zwei Seitenstraßen vom Kirchplatz entfernt am Beginn einer breiten Gasse, die von ansehnlichen Bürgerhäusern gesäumt war und hoch zur großen Piazza von San Bernardo mit seiner trutzigen Pfarrkirche und dem Rathaus führte.
Matteo hatte kein gutes Gefühl, als er auf das Geschäft zuging, über dem sich die Privaträume der Familie Valverde und die Kammern ihrer Bediensteten auf zweieinhalb schmalbrüstigen Stockwerken verteilten. Die mit roten Pestkreuzen markierten Schlagläden vor dem Schaufenster waren weder ganz geöffnet und gegen die Hauswand geklappt, noch befanden sie sich in einer deutlich geschlossenen Stellung. Sie verharrten irgendwo in der Mitte, als wüssten sie nicht, was von ihnen erwartet wurde. Nur wenn der wechselhafte Wind sie erfasste, dann bewegten sie sich mal ein wenig in die eine Richtung, um sich im nächsten Moment in den Scharnieren wieder in die andere Richtung zu drehen.
Ähnlich verhielt es sich mit der Ladentür. Sie stand halb offen. Ihr dunkles Holz trug die Spuren eines verwischten Pestkreuzes. Jemand schien versucht zu haben, das Zeichen mit der Hand oder mit einem Lappen hastig zu entfernen, hatte sein Vorhaben aber nicht erfolgreich ausführen können. Möglicherweise weil er dabei gestört worden war oder aber die Sinnlosigkeit seines Vorhabens erkannt hatte.
»Vielleicht hat man den Valverdes deshalb diese dicken Kreuze noch zusätzlich auf die Schlagläden gemalt!«, ging es Matteo durch den Kopf. Und er bezweifelte, dass er noch jemanden im Laden oder in den Privaträumen vorfinden würde – zumindest keinen, der nicht von der Pest befallen war. Wahrscheinlich hielt sich gar keiner mehr in dem Haus auf. Irgendwie machte es auf ihn schon von außen einen verlassenen Eindruck.
Matteo überlegte kurz, ob er sich überhaupt noch in das Haus wagen sollte, über das der schwarze Tod schon hergefallen war und das damit für jeden, der die Krankheit noch nicht in sich trug, eine unberechenbare Lebensgefahr darstellte. Die Kräuter, die er hatte kaufen sollen, würde er hier nicht bekommen. Also wozu das Risiko eingehen, wo es doch ganz danach aussah, als hätten die Valverdes die Flucht ergriffen?
Matteo fand, dass er gute Gründe anführen konnte, um später sein Gewissen zu beruhigen, warum er das Geschäft des Apothekers nicht betreten hatte und unverrichteter Dinge nach Hause zurückgekehrt war. Und die Mutter würde es verstehen und ihm auch nicht mit unangenehmen Fragen zusetzen.
Aber dann musste er an Rosa Silvera denken, die trotz der roten Markierung auf ihrer Tür nicht davor zurückgeschreckt war, ihr Haus zu betreten. Es wurmte ihn, dass eine unbequeme innere Stimme ihn darüber nachzudenken zwang, ob er wohl ein Feigling sei und weniger Mut als ein Kräuterweib und seine Mutter habe. Es machte ihn wütend, aber es brachte ihn auch dazu, es sich noch einmal anders zu überlegen.
Mit verkniffener Miene und sehr zögerlich stieg er die drei Stufen zur Ladentür hoch und stieß sie mit dem Fuß auf. »Signor Valverde?«, rief er in das Halbdunkel des Geschäftes. Augenblicklich umfing ihn der eigenartige Geruch, der in einem solchen Ladenlokal gemeinhin den vielfältigen Heilpulvern, Salben, Tinkturen, Essenzen und Kräutern entströmte. Aber dieser so typische Apothekengeruch kam hier gar nicht von den zahllosen mit Heilmitteln aller Art gefüllten Tiegeln, Glasbehältern, Tongefäßen, Holzkästen, Schütten und Beuteln, die gewöhnlich die Regale hinter der Ladentheke füllten. Denn von dort blickten Matteo leer geräumte Bretter entgegen. Ton- und Glasscherben, aufgerissene Beutel, zertretene Kräuter, verstreute Pulver und die zersplitterten Bretter von kleinen Schubladen bedeckten den Boden.
Jemand musste die Regale und die Schubladen in allergrößter Eile ausgeräumt und dabei wenig Rücksicht auf den Schaden genommen haben, den er verursachte.
Zurückgeblieben war allein der vertraute Geruch, der im Laufe vieler Jahre in das Holz der Ladentheke, Regale, Dielenbretter, Deckenbalken sowie in das Mauerwerk eingedrungen war und sich dort wie eine unsichtbare Patina festgesetzt hatte.
Mehrmals rief Matteo mit lauter Stimme nach dem Apotheker und wollte wissen, ob sich sonst irgendjemand im Haus aufhielt, der ihm Auskunft geben konnte. Aber er erhielt keine Antwort. Es blieb still im Haus.
»Ich wusste es doch! Hier ist niemand mehr!«, murmelte er vor sich hin und versetzte einer handflächengroßen Steingutscherbe mit der Schuhspitze einen kräftigen Stoß, sodass sie über die Dielenbohlen schlitterte und die Splitter eines kleinen Glasgefäßes zu allen Seiten wegspritzen ließ.
Schon wollte er sich umdrehen und den ausgeplünderten Apothekerladen wieder verlassen, als er ein Geräusch hörte und erschrocken zusammenfuhr. Etwas polterte dumpf und dann war ein seltsam schleifender Ton zu hören. Ihm folgte ein lang gezogener, klagender Laut. Er kam von jenseits des offen stehenden Durchgangs, der in die hinteren Räume und zur Treppe in die oberen Stockwerke führte.
Matteo stellten sich bei dem klagenden, wimmernden Laut die Haare auf. Er war also doch nicht allein im Haus der Valverdes!
5
Sein erster Impuls war es, wegzulaufen – wer immer dort auch so stöhnen mochte. Aber bevor er sich noch vom ersten Schreck erholen und aus dem Ladenlokal flüchten konnte, hörte er die Stimme erneut. Diesmal war es kein leises Gewimmer, was ihn erschauern ließ, sondern der gequält verzweifelte Klang eines einzigen Wortes, den die kraftlose Stimme, die nur ganz schwach wie ein sanfter Windhauch an sein Ohr drang, immer wieder hervorstieß.
»Wasser! … Wasser! … Wasser!«
Matteo stand im Halbdunkel des Apothekerladens wie erstarrt zwischen all den verschütteten und zertretenen Arzneien, Scherben und Trümmern, und sein Herz fing wild an zu klopfen. Er wollte nichts wie fort von diesem Ort, wollte sich die Hände auf die Ohren pressen, um dieses schreckliche, fast geflüsterte Flehen nach Wasser nicht länger hören und nicht darüber nachdenken zu müssen, wer dort irgendwo hinter dem Durchgang von entsetzlichem Durst gequält wurde – und wie grauenvoll die Pest diese Gestalt wohl schon entstellt haben mochte.
»Verschwinde! Was geht es dich an? Du hast in deiner eigenen Familie schon genug Elend zu ertragen! Und wenn die Pest einen der Valverdes in ihren Klauen hat, ist ihm sowieso nicht mehr zu helfen! Je schneller ihn der Tod erlöst, desto besser ist es für ihn!«, wehrte sich in Matteo die kalte Vernunft gegen die Zumutung seines Herzens, auf die flehentliche Bitte zu reagieren.
Wie sollte er auch helfen? Nicht einmal einen Priester oder einen Ordensmann konnte er rufen, damit er dem Sterbenden geistlichen Trost und Beistand leistete. Innerhalb weniger Wochen waren in San Bernardo die vertraute Ordnung und das gesellschaftliche Gefüge, das man für unerschütterlich gehalten hatte, wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen.
»Wasser! … Wasser! … Wasser!«
Das Flehen ging in ein Schluchzen und leises Weinen über. Dann trat wieder Stille ein.
Es war eine entsetzliche, bedrückende Stille. Matteo konnte nicht anders, als angestrengt nach der Stimme zu lauschen, die so schnell wieder verstummt war. Hatte sie nicht nach der eines Mädchens geklungen?
Diese Mutmaßung bohrte sich wie ein Dorn in seine Gedanken und ließ sich nicht wieder verdrängen. Sie zwang ihn gegen seinen Willen, sich das Bild eines halb verdursteten Kindes vor seinem inneren Auge vorzustellen und sich mit der Frage zu quälen, ob er genug kaltherzige Gleichgültigkeit aufzubringen vermochte, um auch einem Kind seine Hilfe zu verweigern.
»Warum nicht? Kind oder Erwachsener, wo liegt denn da der Unterschied?«, schrie es in ihm mit verzweifeltem Aufbegehren. Die Pest hielt sich auch nicht mit derartigen Unterscheidungen auf. Sie fraß jeden, den Greis wie das Neugeborene. War die nicht mal zweijährige Mariana, das Jüngste der Crivellis, die von den Schnabelmännern in der Dämmerstunde vor der Tür der Nachbarn aufgelesen worden war, dafür nicht das beste Beispiel?
Er rang mit sich selbst, was er jetzt bloß tun sollte. Und es war ein Kampf, der nicht nur in seinem Innern stattfand. Er krümmte sich, schloss die Augen, biss sich schmerzhaft auf die Lippen, als könne er nur so einen tief in sich aufsteigenden Schrei unterdrücken.
»Verdammt! Verdammt! Verdammt!«, fluchte er leise und gepresst. Warum nur war er nicht seiner ersten Eingebung gefolgt und hatte den Laden gar nicht erst betreten? Dann wäre ihm das jetzt erspart geblieben! »Das hast du jetzt davon, du Tölpel!«
Also gut, er würde nachsehen, wem die Stimme gehörte. Aber nur auf einen Blick! Zum Samariter fehlten ihm mehr als nur die Hingabe, die seine Mutter auszeichnete, und die Todesverachtung, mit der Rosa Silvera der Pest begegnete!
Matteo schlug die Augen wieder auf und gab sich einen Ruck. Mit einem an Übelkeit grenzenden Gefühl ging er um die Ladentheke herum, trat durch den Durchgang und wagte sich dann vorsichtig auf die Treppe zu, die nach oben führte.
Er hörte schweren Atem, der in kurzen, abgehackten Stößen kam. Als er im schmalen Stiegenhaus nach oben blickte, sah er auf dem Treppenabsatz der ersten Etage eine schmächtige Gestalt. Sie lag bäuchlings auf dem Boden. Ein linker Arm baumelte über die ersten Stufen herab, während sich der andere Arm zusammen mit dem Kopf zwischen den Stäben des Geländers verfangen hatte. Helles Tageslicht fiel durch eines der oberen Fenster auf die zierliche Gestalt, bei der es sich tatsächlich um ein Mädchen handelte. Dem einfachen Stoff ihres Kleides nach zu urteilen, konnte das Mädchen nicht zur Familie von Antonio Valverde gehören, der seines Wissens nach auch gar keine Tochter hatte, sondern nur zwei Söhne. Er musste es wohl mit einer der Hausbediensteten zu tun haben.
Aber ob nun feine Bürgertochter oder einfaches Hausmädchen, die eine konnte ihm die Pest genauso leicht an den Hals hängen wie die andere!
Außerdem fragte er sich, wieso sie sich als Einzige im Haus befand? Wo steckten der Apotheker, seine Frau und die beiden schon erwachsenen Söhne? Waren sie schon dem schwarzen Tod zum Opfer gefallen? Aber wer hatte dann unten im Laden in so großer Hast die Regale und Schubladen ausgeräumt? Sicherlich war das keiner der Anwohner gewesen. Die Pestkreuze auf Tür und Schlagläden waren ein besserer Schutz vor Plünderern als eine bewaffnete Wache vor dem Haus.
Langsam stieg er die Treppe hoch. Von dem Gesicht des Mädchens konnte er nichts sehen. Nur ihr Hinterkopf wies zwischen zwei der gedrechselten Geländerstäbe in seine Richtung. Als er schließlich den Treppenabsatz erreicht hatte, über ihr stand und auf sie hinunterschaute, verbarg goldbraunes, von Schweiß durchnässtes Haar ihre rechte Gesichtshälfte vor seinen Blicken.
»Wasser! … Wasser!«, wimmerte sie wieder.
Nervös leckte sich Matteo über die Lippen. Worauf hatte er sich da bloß eingelassen! Aber jetzt konnte er schlecht zurück, wenn er nicht seinen Rest Selbstachtung verlieren wollte. Er machte schon Anstalten, um sich zu ihr hinunterzubeugen, hielt dann aber in der Bewegung inne und richtete sich schnell wieder auf. Bevor er sie anfasste, sollte er sich doch besser erst einmal vergewissern, in welchem Peststadium sie sich befand!
Er setzte ihr seinen Schuh an die linke Schulter und schob sie ein Stück vom Geländer weg, sodass ihr Kopf freikam. Dann zwängte er seinen Fuß zwischen Hüfte und Rippenbogen, hob ihren schmächtigen Körper an, ohne dabei allzu viel Kraft aufwenden zu müssen, und rollte sie mit einem recht derben Stoß auf den Rücken.
Wie leblos flogen die Arme des Mädchens herum und schlugen auf die Dielenbohlen. Das feuchte Haar fiel nach hinten, als ihr Kopf mit herumrollte, und gab nun ein ovales, anmutiges Gesicht mit vollem Mund, einer hübsch geschwungenen Nase und langen Augenwimpern frei. Ihr Gesicht glänzte vor Schweiß.
Aus dem Ausschnitt ihres Kleides war eine merkwürdige Halskette gerutscht und hing ihr nun halb über dem Kinn. Sie bestand aus vielen kirschkernkleinen Holzperlen, die mit feinen Rosenblättern verziert waren. Wie Rosenknospen, die von Zauberhand in Holz verwandelt worden waren, reihten sich diese dunklen und glatt polierten Perlen aneinander. Winzige Knoten der Lederschnur füllten die Abstände zwischen den einzelnen Holzperlen. Im nächsten Moment entdeckte er dann das kleine, ungemein fein geschnitzte Kruzifix als Anhänger und begriff, dass es sich bei der Halskette um einen Rosenkranz handelte.
Die Augenlider des fremden Mädchens hoben sich flatternd. Mit glasigem, unstetem Blick sah sie zu ihm hoch. »Wasser! … Bitte, gib mir … Wasser! … Ich verbrenne! … Wasser!«, flehte sie kurzatmig.
»Wie heißt du?«, fragte er.
»Fiona …«, keuchte sie und verdrehte die Augen. »Aber warum … warum fragt Ihr, Herr …? Ihr … Ihr kennt mich doch, … Signor Guido.«
»Nein, ich bin nicht Guido. Ich bin Matteo«, antwortete er. Sie verwechselte ihn offenbar mit einem der Valverde-Söhne. »Matteo Lombardi, der Sohn des Schmieds in der Via San Fermo. Sag, bist du denn ganz allein im Haus?«
Das Mädchen namens Fiona reagierte nicht. Die Augen fielen ihr wieder zu und er bezweifelte, dass seine Worte überhaupt bis in ihr Bewusstsein vorgedrungen waren. Sie befand sich eindeutig im Fieberdelirium.
Als er sich nun vorsichtig zu ihr hinunterbeugte und ihren Hals und ihre Arme einer sorgfältigen Prüfung unterzog, konnte er nirgends Anzeichen dafür feststellen, dass sie von der Pest befallen war. Aber die konnten natürlich noch kommen. Wenn sie doch nur klar genug gewesen wäre, um ihm ein paar einfache Fragen zu beantworten!
Für einen langen Moment blickte er unschlüssig auf sie hinunter. Sollte er sie einfach im Flur liegen lassen und verschwinden? Sie war ihm völlig fremd und er hatte nichts mit ihr zu schaffen, war ihr also in keiner Weise verpflichtet! Oder sollte er es wagen, sie zu berühren, sie in eine der Kammern zu tragen und ihr zu trinken zu geben? Er kämpfte mit dem Zwiespalt seiner Gefühle. Aber eine Überlegung drängte sich immer wieder in den Vordergrund, nämlich dass Fiona nicht viel älter als seine Schwester Pia sein konnte.
Wenn die Mutter die Krankenpflege nicht übernommen hätte, würde er Pia dann einfach im Stich gelassen haben?
Matteo atmete tief durch, überwand seine Angst, bückte sich dann mit einem Ruck und hob Fiona auf. Sie erschien ihm leicht wie ein Federbett. Mit ihr auf den Armen ging er den Flur auf der Suche nach der nächsten Bettstelle hinunter.
Schon die nächste offen stehende Tür führte in ein geräumiges Schlafzimmer, wo er sie auf das Bett legte.
»Bleib ganz ruhig! Ich hole dir Wasser und bin gleich zurück!«, versicherte er und begab sich hinunter in die Küche. Doch er fand dort nicht einen Tropfen Wasser. Sowohl der Krug auf der Anrichte war leer als auch der große Wasserbehälter aus moosgrünem Steingut, der auf einem passenden Holzgestell gleich neben der Feuerstelle stand und über einen Zapfhahn in Bodennähe verfügte. Ein Innenhof mit einem eigenen Brunnen gehörte nicht zum Eckhaus der Valverdes. Deshalb blieb ihm nichts anderes übrig, als einen Holzeimer zu nehmen und sich zum nächsten öffentlichen Brunnen zu begeben. Dieser befand sich auf dem kleinen Vorplatz der Kirche Santa Maria Assunta.
Die Männer und Frauen, die wie er Wasser holen kamen, hielten Abstand voneinander. Manche gingen barfuß und trugen nichts weiter als ein kratziges weißes Büßergewand. Sie hofften, durch Gebete und das offenkundige Zeichen ihrer Reue dem Bannstrahl des göttlichen Zorns zu entgehen, der ihrer Überzeugung nach dem Ausbruch der Pest zugrunde lag. Ihre Gesichter waren von Angst, Gram und Verzweiflung gezeichnet.
Matteo beeilte sich, seinen Eimer zu füllen und zu Fiona zurückzukehren. Als er ihr den ersten Becher Wasser an die Lippen setzte, gab sie einen Aufschrei der Erlösung von sich und trank so hastig, dass sie sich verschluckte und das Wasser gleich wieder ausspuckte.
»Verdammt noch mal, trink langsam!«, herrschte er sie an, weil ein Teil des Ausgespuckten über seinen Unterarm gespritzt war. »Es ist genug Wasser da! Ein ganzer Eimer voll! Und ich kann jederzeit mehr holen!« Er achtete darauf, dass sie fortan nur noch kleine Schlucke machen konnte.
»Ich danke Euch! … Danke, Signor Guido«, flüsterte sie, als ihr Durst endlich gestillt war und ihr Kopf mit einem langen Aufseufzen ins Kissen zurückfiel.
Matteo verzog das Gesicht. »Matteo, nicht Guido!«, korrigierte er sie, obwohl er wusste, wie sinnlos das in ihrem Zustand war.
Er rückte den Eimer mit dem Wasser ans Kopfende des Bettes und wollte sich nun davonstehlen. Mehr konnte er ja wohl nicht für sie tun, oder?
Dann jedoch musste er daran denken, dass seine Mutter das Fieber beim Vater mit feuchten Umschlägen bekämpft hatte und dasselbe jetzt auch bei seinen Geschwistern versuchte.
»Also gut, das mache ich noch!«, murmelte er verdrossen vor sich hin. »Damit hat es sich dann aber auch!«
In der Truhe am Bettende fand er mehrere frische Laken und Bezüge. Er holte aus der Küche ein Messer und zerschnitt eines der großen Laken in ein halbes Dutzend breite Streifen. Dann schlug er ihr weites Kleid zurück, tunkte die Streifen in den Eimer und wickelte ihr die nassen Lappen um die Waden, wie er es bei seiner Mutter gesehen hatte. Er tränkte auch noch einen kürzeren Streifen mit Wasser, faltete ihn dreimal und legte ihn dem Mädchen auf die glutheiße Stirn.
»So, das ist alles, was ich für dich tun kann«, sagte Matteo, trat vom Bett zurück und fügte noch ganz leise hinzu: »Stirb in Frieden, Fiona.«
Als er wieder auf der Straße stand und den Heimweg einschlug, kam ihm das Erlebnis im Haus des Apothekers plötzlich ganz unwirklich vor und er wunderte sich über sich selbst. Warum hatte er das getan? Und woher hatte er die Überwindung genommen, dieses fremde Mädchen überhaupt anzurühren?
»Vermutlich ist sie schon tot, wenn ich das nächste Mal nach ihr sehe!«, ging es Matteo durch den Kopf, um gleich im nächsten Moment verblüfft über seinen eigenen Gedanken stehen zu bleiben.
Das nächste Mal?
Nein, ein nächstes Mal würde es nicht geben! Wieso, in Gottes Namen, konnte sich in ihm überhaupt die absurde Idee formen, er würde sich noch einmal in das Haus der Valverdes begeben und nachsehen, wie es dem Mädchen Fiona erging? Nichts da! Den Teufel würde er tun!
6
Am frühen Nachmittag verloren Riccardo und Pia die Kontrolle über ihre Gliedmaßen. Die rasch angeschwollenen Pestbeulen waren aufgeplatzt und der ekelhafte Geruch nach Fäulnis erfüllte auch noch den letzten Winkel des Hauses. Der Schmerz wühlte unbarmherzig in den vom Tod gezeichneten Leibern der Geschwister. Ihr Mund füllte sich mit Blasen, sie tobten und wimmerten im Delirium.
Matteo hielt es in der Wohnstube nicht aus. Stundenlang kauerte er vorn im dunklen, zugigen Winkel bei der Tür, die Ellbogen auf die bis zur Brust angezogenen Beine gestützt und die Hände auf die Ohren gepresst. Aber je länger er dagegen ankämpfte, desto schwerer wurde der unsichtbare Block aus Eis, der auf seiner Brust lastete und ihm immer mehr die Luft zum Atmen nahm. Schließlich ertrug er es nicht länger und stahl sich ohne ein Wort aus dem Haus.
Scheinbar ziellos und von einer seltsam kalten Benommenheit umfangen, irrte er durch die Straßen und Gassen von San Bernardo, das ihm wie ein einziges riesiges Totenhaus vorkam. Ihm war, als triebe er durch ein Meer von roten Kreuzen.
Plötzlich fand er sich vor dem Haus der Valverdes wieder. Zuerst wusste er gar nicht, warum er stehen geblieben war und nun ausgerechnet an dieser Fassade hochblickte. Dann erst erkannte er verblüfft, dass er vor dem Haus des Apothekers stand.
Ein Zufall?
Unwillkürlich hatten ihn seine Schritte wieder an diesen Ort gelenkt, obwohl er doch fest entschlossen gewesen war, nicht wieder zu kommen!
Matteo ertappte sich dabei, dass sein Blick im ersten Stockwerk das Fenster suchte, das zu der Schlafkammer gehörte, in der er das Mädchen Fiona zurückgelassen hatte. Aber er erinnerte sich nicht mehr, ob dieses Zimmer zur Straße oder nach hinten hinausging.
Sollte er vielleicht doch noch einmal nach ihr sehen?
Eine ganze Weile vermochte er zu keinem Entschluss zu kommen. Dann zuckte er mit den Achseln. Wo er nun schon einmal hier war, konnte er auch ins Haus gehen, einen Blick in die Kammer werfen und nachsehen, ob sie überhaupt noch lebte. Er glaubte es ja nicht. Viel wahrscheinlicher war es, dass die Schnabelmänner sie am Morgen unten am Fuß der Stufen vor der Ladentür finden würden. Was jedoch voraussetzte, dass jemand es auf sich nahm, ihren Leichnam in ein Laken zu wickeln und vor die Tür zu tragen …
Fiona lebte, glühte jedoch im Fieber und nahm ihn überhaupt nicht wahr. Sie nannte ihn nicht einmal Guido. Unruhig wälzte sie sich von einer Seite auf die andere.
Matteo war dankbar, dass sich ihr schmächtiger Körper noch immer so tapfer gegen das Fieber zur Wehr setzte und er sich damit nicht vor die Frage gestellt sah, ob er zu ihrem Totenträger werden oder sich besser rasch wieder aus dem Haus stehlen sollte.
Was ihn zusätzlich mit Erleichterung erfüllte, war die Feststellung, dass sich bei ihr noch immer keine Pestzeichen eingestellt hatten. Nirgendwo zeichneten sich die typischen rosenförmigen Flecken unter der Haut ab. Auch entdeckte er an keiner Stelle Anschwellungen, mit denen sich gewöhnlich Pestbeulen ankündigten. Ihr Körper schien ausschließlich von schwerem Fieber befallen zu sein.
Aus einem ihm selbst unerklärlichen Grund empfand er darüber eine so große Dankbarkeit und Erleichterung, dass er sich recht lange bei ihr aufhielt. Er erneuerte die feuchten Wadenwickel, wischte ihr den Schweiß von Gesicht, Hals und Armen, flößte ihr immer wieder zu trinken ein und begab sich zum zweiten Mal an diesem Tag mit dem Eimer zum Brunnen, damit auch für die Nacht genug Wasser im Haus war.
Als die Dunkelheit einsetzte, suchte er im Haus nach Kerzen. Unten in der Vorratskammer, die ein ähnliches Bild hastiger Räumung bot wie der Ladenraum, wurde er fündig. Er stieß in einer Ecke auf eine umgekippte Kiste mit dicken Talglichtern. Eine dieser dicken Kerzen trug er zusammen mit einem flachen Zinnteller nach oben in Fionas Zimmer. Dort stellte er sie in die halbrunde Mauernische, die in die Wand gegenüber vom Bett eingelassen war und wo eine geschnitzte Madonna stand. Der Docht brannte mit ruhiger Flamme und gab einen schönen hellen Schein von sich.
»Du sollst dich nicht vor der Dunkelheit fürchten, Fiona«, sagte Matteo, setzte ihr noch einmal den Wasserbecher an die Lippen und ging wenig später. Er zog unten die Schlagläden zu, schob von innen die Holzriegel vor und schloss auch die Ladentür hinter sich.
Der Heimweg wurde ihm entsetzlich schwer. Jeder Schritt zurück kostete ihn Überwindung, wusste er doch, was ihn in der niedrigen elterlichen Stube erwartete.
7
Seine Geschwister starben im Laufe der Nacht. Zuerst erlöste der Tod seinen Bruder von den Qualen der Pest. In der Stunde nach Mitternacht hauchte er sein Leben aus. Pia folgte ihm kurz vor Anbruch des neuen Tages, als wüsste sie, dass es Zeit für sie wurde, um noch an diesem Morgen auf den Wagen der Schnabelmänner zu kommen.
Die Mutter besaß keine Kraft mehr für lautes Wehklagen. Stumm liefen ihr die Tränen über das Gesicht, während sie die von der Krankheit entstellten und ausgezehrten Körper von Riccardo und Pia in saubere Laken wickelte, sie vor die Haustür trug und dort sanft niederlegte. Sie sackte gegen die Hauswand und blieb bei ihnen sitzen, bis die Schnabelmänner mit ihrem Wagen um die Ecke kamen.
Matteo stand in der Tür und sah mit erstarrter Miene und versteinertem Herzen zu, wie die Pestknechte seinen Bruder und seine Schwester zu den anderen Toten auf ihren Karren legten und so gleichgültig weiterzogen, wie sie kurz bei ihnen Halt gemacht hatten.
»Komm!«, sagte er und berührte seine Mutter zaghaft an der Schulter. Leichter Regen fiel aus dem tristen grauen Morgenhimmel. »Komm bitte wieder ins Haus. Du wirst dir sonst noch den Tod holen.« Und kaum hatte er den letzten Satz ausgesprochen, als ihm auch bewusst wurde, wie lächerlich dieser Satz angesichts der Katastrophe klang, die ihre Familie getroffen hatte. Aber nicht nur der Vater, der Bruder und die Schwester waren tot, sondern ganz San Bernardo war zu einem steinernen Grab geworden. Was machte da schon ein wenig Nieselregen aus!
Die Mutter erhob sich. Mühsam kam sie auf die Beine. Als er seinen Arm um ihre Schulter legte und sie ins Haus führte, schwankte sie plötzlich und knickte in den Beinen ein. Rasch streckte sie ihren linken Arm nach der Wand aus, um nicht zu stürzen.
»Mutter!«, rief Matteo erschrocken und packte fester zu.
»Es ist nichts! … Nur ein leichter Schwindel!«, murmelte sie hastig und sank auf den nächsten Stuhl. »Mir … mir ist gleich wieder gut.«
Mit Entsetzen bemerkte Matteo die Hitzewallung, die seine Mutter überfiel und die ihr den Schweiß aus den Poren trieb, als stände sie in der Schmiede vor der glühenden Esse. Er streckte die Hand nach ihr aus, und als seine Fingerspitzen ihre heiße Stirn berührten, erschauderte er bis ins Mark unter der entsetzlichen Erkenntnis, dass die grauenvolle Saat der Pest jetzt auch im Körper seiner Mutter steckte und dort ihr Werk der Vernichtung begonnen hatte.
Zur Mittagsstunde, als Matteo von einem kurzen Krankenbesuch bei Fiona zurückkehrte, deren Zustand unverändert kritisch war, und der Schüttelfrost wie eine Horde Dämonen über die Mutter herfiel, folgte sie dem Vater und den Geschwistern auf das Notlager vor dem Feuer.
In seiner Not und Verzweiflung stürzte er aus dem Haus und machte sich im Laufschritt auf den Weg zu Rosa Silvera. Er wusste nicht, welche Hilfe er von ihr erwartete, nachdem er doch erst am Tag zuvor selbst mit angehört hatte, dass sie kaum noch über Kräuterarzneien verfügte und dass es zudem überhaupt keine Heilmittel gegen den Fluch der Pest gab. Aber dennoch musste er zu ihr, war es doch das Einzige, was ihm zu tun einfiel. Denn irgendetwas musste er doch tun!
Die Seherin und Kräuterkundige lebte am östlichen Rand von San Bernardo in unmittelbarer Nähe der alten Stadtmauer, wo die Häuser sich nicht dicht an dicht aneinanderreihten und die Straßen auf beiden Seiten noch keine durchgehende, lange Front aus Stein, Mörtel und Fachwerk bildeten. In diesem Teil standen zwischen neueren Häusern einige sehr alte Katen. Auch gehörten zu den Anwesen unterschiedlich große Gärten, von denen manche sogar einen alten Baumbestand aufwiesen.