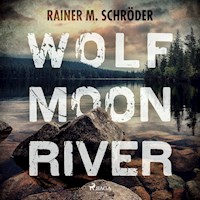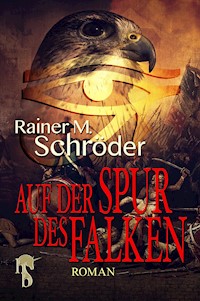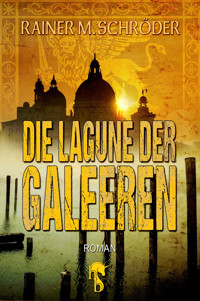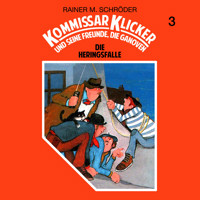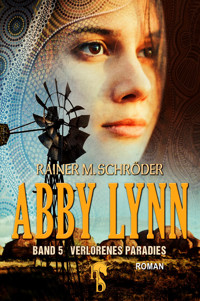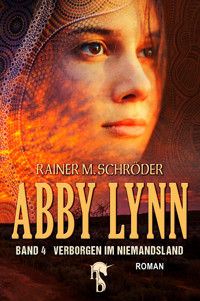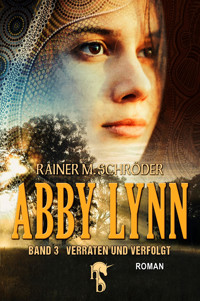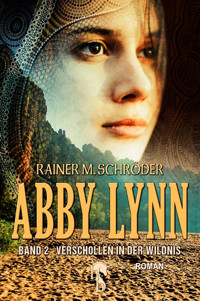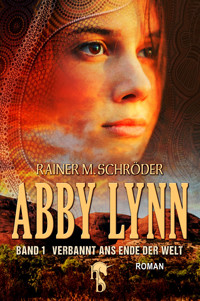6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Paris, 1307. Es sind 16 Jahre vergangen, seit vier junge Tempelritter den Heiligen Gral aus der brennenden Stadt Akkon nach Paris in die Templerburg brachten und alle Versuche der Iskaris vereitelten, ihn zu entwenden. Doch die Judasjünger geben nicht auf. Ihre Machenschaften und Intrigen sind schließlich erfolgreich, als König Philipp IV. den reichen und mächtigen Templerorden, bei dem er hoch verschuldet ist, der Ketzerei beschuldigt. Er verfügt die Gefangennahme aller Templer, ihre Anklage bei der Inquisition und eignet sich die Ordensbesitztümer an. Der Heilige Gral ist erneut in Gefahr und ein sicherer Ort muss für ihn gefunden werden. Auf der abenteuerlichen Reise der Gralsritter nach Spanien gelingt es einem Spion der Iskaris, den Gral zu stehlen und in die schwarze Abtei des Fürsten der Finsternis zu bringen. Die vier Freunde Gerolt, Maurice, Tarik und McIvor verfolgen die Spur bis zur Teufelsburg in den Bergen und rüsten sich zum Kampf gegen die satanischen Mächte. Gelingt es ihnen, den Heiligen Gral rechtzeitig zu retten? Der dritte und letzte Band der Roman-Trilogie von Erfolgsautor Rainer M. Schröder, packend erzählt in seiner Roman-Trilogie „Die Bruderschaft vom Heiligen Gral“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 684
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Die Bruderschaft vom Heiligen Gral
Das Labyrinth der schwarzen Abtei
Roman
In Liebemeiner Frau Helga,dem heiligen Gralmeines Herzens
»Was kein Auge gesehenund kein Ohr gehört hatund was in keines Menschen Herzgedrungen ist:All das hat Gott denen bereitet,die ihn lieben.«(Anselm Grün, nach dem 1. Korintherbrief 2,9) »Die göttliche Vorsehung hat es so geordnet,dass einem jeden geschenkt wird,nach seiner Art und Weise zu dem Ziel zu gelangen,das in seinem Wesen angelegt ist.« (Thomas von Aquin) »Der Wählende trägt die Schuld,Gott ist schuldlos.«(Platon)
Prolog
Die Saat des BösenAugust 1306
1
Kein noch so kläglicher Strahl Tageslicht drang in den Kerker, der zum verzweigten System unterirdischer Gewölbe auf der Île de la Cité1 gehörte. Und ob Winter oder Sommer, das dicke Mauerwerk der Königsburg, das tief in den Inselgrund reichte, blieb stets unverändert kalt und feucht. Auch der stechende Geruch von Moder, heißem Pech, Fäkalien, Ruß und Schweiß hielt sich zu allen Zeiten an diesem düsteren Ort, als hätte sich das Gestein bis ans Ende aller Tage damit vollgesogen. Denn die Reihe der Unglücklichen, die in diesen Kerker zur Tortur verschleppt und von erfahrenen Folterknechten gequält wurden, riss nie ab, egal wer in den Jahrhunderten seit der Errichtung der Inselfestung in Paris regierte. Rupin Turville, der in dieser Spätsommernacht des Jahres 1306 der Tortur unterzogen wurde, war nur einer in jener schier endlosen Kette von Opfern vor ihm und nach ihm.
Das schauerliche Verlies war ein lang gestrecktes Kellergewölbe mit mehreren tiefen Mauernischen und lag halb in Dunkelheit getaucht. Die hohen Wände aus dicken, roh behauenen Steinquadern warfen ihre schwarzen Schatten gnädig über einen Großteil der entsetzlichen Folterinstrumente, mit denen die Kammer reichlich ausgestattet war. Denn von den acht Pechfackeln, die in den Ecken und Nischen der Folterkammer aus schweren, spiralförmigen Eisenbändern ragten, brannte nur eine einzige. Es war die Fackel schräg oberhalb der Streckbank und ihre gelbliche, blakende Flamme tanzte unruhig hin und her. Mal wich sie wie entsetzt zurück und leckte über das rußgeschwärzte Gestein der Kerkerwand, mal bog sie sich mit breit lodernder Feuersbrunst nach vorn, als bäumte sie sich auf, um sich dann im nächsten Moment zu ducken wie unter unsichtbaren Schlägen.
Es war ein wirrer Flammentanz und er schien den qualvollen Zuckungen des ausgemergelten schwarzbärtigen Mannes namens Rupin Turville zu folgen, der mit zerfetzten Kleidern und zum Reißen gespannten Gliedern auf das Gitter der Streckbank gebunden lag. Doch die Flamme hatte so wenig Mitgefühl mit den Leiden des Gefolterten wie der hohlwangige Folterknecht, der zu einer Eisenzange gegriffen hatte und sich nun damit am Becken mit den glühenden Kohlen zu schaffen machte. Und den beiden vornehm gekleideten Männern, die mit einigen Schritten Abstand der unbarmherzigen Tortur mit unbewegter Miene beiwohnten, war Mitleid schon von Natur aus so fremd wie einem Herz aus Stein. Nichts weiter als die Zugluft des nahen Luftschachtes war für den unruhig flackernden Feuerschein verantwortlich, der über den fast nackten, schweißüberströmten Körper des Gequälten fiel.
Der von exzessiver Trunksucht schwer gezeichnete Mann auf der Streckbank erwies sich jedoch als überraschend zäh, wie Sjadú insgeheim zugeben musste. Viel zäher, als er für möglich gehalten hatte. Obwohl der Bursche längst dem billigsten Fusel haltlos verfallen war und den Dreck der Gosse sein Zuhause nannte, so steckte in diesem Rupin Turville offenbar noch immer ein Rest jenes überragenden Templerstolzes und jener unerschütterlichen Todesverachtung, die man den Kriegermönchen dieses mächtigen Ritterordens bekanntlich nachsagte. Kein vornehmes Geschlecht, das sich nicht der Ehre rühmte, wenn einer der ihrigen die begehrte Clamys trug, den weißen Mantel mit dem blutroten, achtspitzigen Tatzenkreuz der Templer. Und auch Rupin Turville hatte vor vielen Jahren einmal jenen weißen Mantel der Tempelritter getragen.
Doch seine glanzvolle Ritterzeit lag mehr als ein Jahrzehnt zurück. Sie hatte mit seinem Ausstoß aus dem Orden geendet, weil er bei einem wüsten Zechgelage von hinten über einen jungen Sergeanten2 hergefallen war und diesen wegen einer spöttischen Bemerkung mit einem Steinkrug totgeschlagen hatte.
Ja, Rupin Turville hatte trotz seines langen Abstiegs in die Gosse wahrhaftig noch einen Rest Templerstolz in sich bewahrt und bäumte sich mit aller Willenskraft gegen das Unabänderliche auf! Aber an dem Schicksal, das er, Sjadú, der erhabene Erste Knecht des Schwarzen Fürsten, seinem Opfer vorbestimmt hatte, würde das nicht das Geringste ändern.
Im Gegenteil, sagte Sjadú sich im Stillen, ein wenig Widerstand machte das Ganze am Ende nur noch glaubwürdiger, und allein darauf kam es letztlich an. Wilhelm von Nogaret, die hagere Gestalt an seiner Seite, musste diesen Köder schlucken. Zu viel hing davon ab, nicht zuletzt sein eigenes Schicksal, als dass sein Plan scheitern durfte! Nogaret musste anbeißen!
Wilhelm von Nogaret war zurzeit der wohl einflussreichste Berater des französischen Königs. Ein von allen gefürchteter Mann, der nicht die geringsten Skrupel kannte und den es nach noch mehr Macht gelüstete. Er schreckte vor keinem noch so abscheulichen Komplott zurück, wenn es nur seinem König und ihm Nutzen brachte. Sein fanatischer Eifer für Philipp IV. kannte keine Grenzen.
Zudem brannte in diesem königlichen Rat ein abgrundtiefer Kirchenhass, wie Sjadú ihn sich stärker gar nicht hätte wünschen können. Es hielt sich das Gerücht, er sei der Sohn von Katharer3-Eltern. Das würde einiges erklären, zumindest weshalb er einen solch flammenden Hass auf die Kirchenoberen hegte und für seinen nicht weniger berechnenden König zu jeder Schandtat bereit war. Denn beides hatte er hinreichend unter Beweis gestellt!
Als König Philipp, auch »Philipp der Schöne« genannt, vor Jahren mit dem damaligen Papst Bonifazius VIII. in erbittertem Streit lag, hatte Nogaret die Fehde höchstpersönlich und sehr direkt für seinen gekrönten Herrn geregelt – indem er nämlich kurzerhand in das Schlafgemach des vierundachtzigjährigen Papstes eingedrungen war und dem alten Mann derart übel mit Fausthieben zugesetzt hatte, dass dieser wenig später an den Folgen dieses Attentates gestorben war. Und dass dessen Nachfolger ihm schon nach nur sieben Monaten auf dem Heiligen Stuhl ins Grab gefolgt war, sollte auch auf Nogarets Konto gehen. Es hieß, er habe dem neuen Papst, der dem König von Frankreich so ungelegen gewesen war wie zuvor Papst Bonifazius, vergiftete Feigen servieren lassen.
Und diese Skrupellosigkeit, die Wilhelm von Nogaret auszeichnete und die ihn nicht einmal vor dem Stellvertreter Christi auf Erden zurückschrecken ließ, machte ihn zu genau dem richtigen Mann, den er, Sjadú, brauchte, um endlich über die geheime Bruderschaft der Gralsritter zu triumphieren und in den Besitz des heiligen Kelches zu gelangen. Denn das Große Werk, die Zerstörung des Heiligen Grals, wartete darauf, in der schwarzen Abtei der Judasjünger vollzogen zu werden, auf dass der Fürst der Finsternis seine Alleinherrschaft auf Erden antreten und von Nacht zu ewiger Nacht über die Menschheit reagieren konnte!
Wenn erst der Heilige Gral, der Kelch des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern, der Bruderschaft entrissen war, dann könnte das Große Werk vollbracht werden. Dann würde es niemand mehr wagen, ihm seine ranghöchste Stellung unter den Judasjüngern streitig zu machen. Und als erhabener Erster Knecht, der als Einziger vom Atem des Schwarzen Fürsten der Finsternis getrunken hatte, auf dass sein Leben sich nun nicht mehr in Jahrzehnten, sondern in Jahrhunderten bemaß, würde seine Macht größer sein als die von einem Dutzend Königen!
Noch war das ehrgeizige Ziel nicht erreicht, aber es war endlich zum Greifen nahe gerückt! Nach der schändlichen Niederlage, die ihm die Gralsritter im Herbst 1291 nach dem Fall von Akkon4 zugefügt hatten und die fast sein Schicksal besiegelt hätte, hatte er sich für viele bitterlange Jahre zu eiserner Geduld und Selbstbeherrschung gezwungen, damit sein teuflischer Plan zur Vernichtung der Gralsritter reifen und sich entwickeln konnte. Mit großer Raffinesse hatte er sich unter dem Namen Jean-Mathieu von Carsonnac eine falsche Identität zugelegt und ein altes, reiches Adelsgeschlecht erfunden, dessen Stammbaum angeblich im fernen Zypern wurzelte und auch einer kritischen Nachprüfung standhielt. In dieser Zeit hatte er nicht nur ein wahres Vermögen für ein standesgemäßes Anwesen und ein herrschaftliches Leben vor den Toren von Paris ausgegeben, sondern fast noch einmal so viel Gold verschwendet, um zum Hofe König Philipp des Schönen Zugang zu erlangen und sich allmählich das Vertrauen des königlichen Rats Wilhelm von Nogaret zu erschleichen. Und nun, anderthalb Jahrzehnte nachdem er sich angstschlotternd vor dem Thron des Schwarzen Fürsten zu Boden geworfen, sein Versagen eingestanden und nur dank seines genial perfiden Einfalls noch einmal Gnade vor seinem Gebieter gefunden hatte, nun rückte sein heimtückischer Plan in die entscheidende Phase!
Sjadú nickte dem Folterknecht knapp zu, als dieser die Eisenzange aus der Glut des Kohlenbeckens zog und ihm einen fragenden Blick über die Streckbank hinweg zuwarf.
»Fang unten mit den Fußsohlen an!«, befahl er ihm. »Er soll einen Vorgeschmack von dem bekommen, was ihn erwartet, wenn er sich weiterhin uneinsichtig und störrisch zeigt.«
Wilhelm von Nogaret verzog keine Miene. Der schmale, dünnlippige Mund in dem wie gemeißelt wirkenden, scharfkantigen Gesicht verlor ebenso wenig seinen mitleidlosen, harten Ausdruck wie seine kalten Augen. Er zupfte jetzt jedoch das parfümierte Spitzentuch, das er in weiser Voraussicht in den Kerker mitgebracht hatte, aus dem weiten Ärmel seiner Brokatjacke und führte es unter die scharf gekrümmte Nase. Er war nur zu gut mit den Abläufen der Folter vertraut und wusste, was jetzt kam.
Der gellende Schrei des einstigen Templers ging in ein abgehacktes Wimmern über, als der Folterknecht schließlich von ihm abließ und die Eisenzange mit der gezackten Greifklaue am vorderen Ende wieder zurück in die Glut des Kohlenbeckens stieß.
»Allmächtiger, stehe mir bei!«, flehte Rupin Turville mit erstickter Stimme und verdrehte den Kopf, um Sjadú und Wilhelm von Nogaret in sein Blickfeld zu bekommen. »Warum lasst … Ihr … mich foltern, Ihr vornehmen Herren? … Wer seid Ihr, dass Ihr mich in den Kerker … des Königs verschleppt habt? … Was habe ich … ein armseliges Nichts der Straße … Euch bloß getan? … In Christi Namen … was wollt Ihr nur von mir?«
»Die Wahrheit!«, gab Sjadú kalt zur Antwort.
Wilhelm von Nogaret gab einen Seufzer von sich, der eine Spur von Enttäuschung und auch Langeweile in sich trug. »Mir scheint, der Bursche wird die Erwartungen nicht erfüllen, die Ihr in mir geweckt habt, Jean-Mathieu.« Er seufzte erneut. »Bedauerlich! In der Tat, sehr bedauerlich, mein Bester. Ich hegte schon die Hoffnung, Ihr könntet die Lösung für so manch drückendes Problem liefern, das mich und Seine Majestät seit Langem umtreibt.«
»Wartet!«, rief Sjadú, innerlich aufs Höchste alarmiert. Er fürchtete, das Interesse jenes Mannes zu verlieren, auf den der König hörte wie auf keinen anderen. Wenn das geschah, wurde nicht nur sein Plan zunichtegemacht, sondern dann war auch er verloren. Der Fürst der Finsternis würde ihm keine weitere Chance zubilligen und einen anderen zu seinem erhabenen Ersten Knecht ernennen. Nicht einmal auf das Labyrinth der Sühne, diese grausame Strafe, durfte er dann noch hoffen. Nein, erbarmungslos vernichten würde ihn sein Gebieter, mit einem feurigen Atemstoß von der schwindelerregenden Plattform seines Thrones fegen und ihn hinab in den fürchterlichen Gebeineschlund der Verfemten schleudern! »Habt noch einen Moment Geduld. Ich versichere, dass Ihr es nicht bereuen werdet! Lasst es mich mit guter Zurede versuchen, damit diese sündige Seele zur nötigen Einsicht gelangt und auf den Weg der Läuterung zurückfindet.«
Wilhelm von Nogaret zögerte kurz, nickte aber dann großmütig und ein wenig herablassend, als gewährte er ihm eine übergroße Gunst. »Nur zu, versucht Euer Glück. Einige Minuten länger werden meine anderen Staatsgeschäfte wohl noch warten können.«
Ein falsches Lächeln trat auf das Gesicht des ranghöchsten Judasjüngers, das sich durch makellose Ebenmäßigkeit und Schönheit auszeichnete und damit die perfekte Maske für das abgrundtief Böse war, das sich dahinter verbarg.
»Ich weiß Eure Großzügigkeit zu schätzen. Seid einmal mehr versichert, dass nicht nur Seine Majestät weiß, was er an Euch hat«, sagte Sjadú schmeichelnd und trat dann zu dem Unglücklichen auf dem Gitter der Streckbank. »Und nun zu dir, Rupin Turville!«
Der einstige Ordensritter sah mit blutunterlaufenen Augen und flehendem Blick zu ihm auf. »Bei der Jungfrau Maria, allen Heiligen und der Heil bringenden Auferstehung unseres …«, begann er mit brechender Stimme.
»Schweig!«, fuhr ihm Sjadú sofort ins Wort, gab seiner Stimme jedoch schon im nächsten Moment einen sanften, scheinbar besorgten Klang, als er fortfuhr: »Mein Sohn, wir sind in Sorge um dein ewiges Seelenheil. Schrecken dich nicht die vielfältigen Qualen der Hölle, die einen reuelosen Sünder ob seiner abscheulichen Verfehlungen mit Sicherheit erwarten? Willst du nicht endlich dein Gewissen reinigen? Hier und jetzt tätige Reue durch das gottgefällige Geständnis der Wahrheit üben, so schrecklich sie auch sein mag, und damit deine Seele vor den endlosen Torturen des Fegefeuers bewahren? Du musst es einfach wollen, wenn du deine unsterbliche Seele retten und das ewige Leben im Himmel gewinnen willst! Ich weiß, dass du es willst. Es fehlt dir nur noch der letzte innere Anstoß, um dich von den sklavischen Ketten des Bösen zu befreien und ins reinigende Licht aufrichtiger Reue und Läuterung zu treten! Lass uns deshalb gemeinsam beten, dass sich dein verstocktes Herz dem gnadenreichen Zuruf Gottes öffnet und du reuevoll zurückkehrst auf den Pfad der Redlichen und Wahrhaftigen!«
Sjadú griff nach der gefesselten Rechten des Gefolterten und beugte sich ganz nah über ihn, als wollte er tatsächlich leise mit ihm um Kraft und göttlichen Beistand beten. Doch was er ihm sogleich leise in Ohr zischte, war alles andere als ein frommes Gebet um göttlichen Beistand.
»Rede, Kerl!«, fauchte er ihn so leise an, dass weder der Folterknecht noch Wilhelm von Nogaret etwas davon mitbekam. »Mach endlich dein Maul auf! Wen willst du mit deinem lächerlichen Schweigen beeindrucken? Glaubst du Einfaltspinsel vielleicht, du könntest es mit dem Folterknecht des Königs aufnehmen? Nicht eine Nacht wirst du durchhalten! Früher oder später wirst du reden, das schwöre ich dir! Der Mann dort drüben am Becken versteht sein Handwerk, darauf kannst du Gift nehmen. Er hat noch gar nicht richtig angefangen, dir seine hohe Kunstfertigkeit in der Handhabung der Tortur zu beweisen. Also gestehe endlich und spucke aus, was ich von dir hören will! Aber nicht das übliche Gerede will ich hören, sondern dass du Zeuge dieser schändlichen Zeremonien gewesen bist und selbst daran teilgenommen hast! Du weißt genau, wovon ich spreche. Ich habe dir in der Taverne lang und breit davon erzählt, und sage nicht, du warst da schon zu betrunken, um dich noch darauf besinnen zu können. Und nenne gefälligst Namen, verstanden? Du wirst dich doch an einige deiner einstigen Gefährten und Ordensoberen erinnern können. Wenn du deine Sache gut machst, lasse ich dich laufen! Ich gebe dir das Wort eines Ehrenmannes und schwöre es dir auch beim Kreuz Jesu!« Er lachte bei dieser Beteuerung innerlich höhnisch auf, hatte er für das eine doch so viel Verachtung übrig, wie er das andere aus tiefster Seele hasste und verabscheute. »Du bist zu unbedeutend, um uns nach deinem Geständnis noch länger von Nutzen sein zu können.«
Er machte nach dieser Lüge eine kleine Pause, um dann mit eisiger Stimme die Drohung hinzuzufügen: »Aber wenn du dich weigerst, werde ich dafür sorgen, dass du die Hölle schon hier auf Erden erlebst! Und deine Qual in diesem Kerker wird sich nicht in einigen wenigen Stunden höllischer Schmerzen bemessen, sondern in schier endlosen Tagen und Wochen der Folter, darauf gebe ich dir mein Wort! Man wird dir die Haut bei lebendigem Leib abziehen, dich mit kochendem Pech traktieren, dir Daumenschrauben und den spanischen Stiefel anlegen und dir noch vieles andere mehr antun, wovon du jetzt noch nicht einmal den Schimmer einer Ahnung hast, glaube es mir! Also, wofür entscheidest du dich?«
Damit ließ Sjadú die Hand des Mannes los, richtete sich wieder auf und fragte mit nun wieder lauter, trügerisch teilnahmsvoller Stimme: »Sag, hat dich unser Gebet gestärkt und dir die Kraft zur Wahrheit und seelischen Läuterung geschenkt, Rupin Turville?« Tränen grenzenloser Verzweiflung liefen dem einstigen Tempelritter über das zerfurchte Gesicht. »Ja, mein Herr«, schluchzte er mit kraftloser, stockender Stimme. »Ich … ich bin um meines ewigen Seelenheils willen bereit, meine … meine zahllosen Sünden zu gestehen und von … von abscheulichen Dingen und Geschehnissen zu berichten … bei denen ich sowohl Zeuge als … als auch Mitwirkender war …«
Ein zufriedenes, kaum merkliches Lächeln nistete sich in den Mundwinkeln des Judasjüngers ein. »Nur zu, guter Mann! Befreie deine Seele von der drückenden Last deiner Sünden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass du die Kraft dafür findest – wo du doch nun gestärkt bist von meinem geistigen Beistand!«, erwiderte er mit bösartigem Hohn, der dem königlichen Rat verborgen blieb.
Rupin Turville begann mit stockender Stimme zu reden. Anfänglich klangen seine Anklagen blass und reichlich wirr. Doch je länger er von jenen Geschehnissen berichtete, die Sjadú in Gegenwart des königlichen Beraters hören wollte, desto fester wurde nicht nur seine Stimme, sondern auch seine Geschichte gewann an innerer Festigkeit und die Beschreibung der geheimen Zeremonien wurde immer detaillierter. Er steigerte sich mit jeder Minute. Immer Neues fiel ihm ein, das er noch hinzufügen musste. Und schließlich nannte er die Namen all derjenigen, von denen er wusste, wie er höchst eifrig versicherte, dass sie sich dieser frevelhaften Schandtaten und ungeheuerlichen Gottlosigkeiten schuldig gemacht und andere dazu angehalten hatten.
Im Gesicht des königlichen Rats rührte sich kaum etwas, während es immer flüssiger aus Rupin Turville heraussprudelte. Doch Sjadú entging nicht, dass Wilhelm von Nogaret aufmerksam zuhörte.
Als Rupin Turville schließlich nichts mehr hinzuzufügen wusste und erschöpft schwieg, stellte Wilhelm von Nogaret ihm bezeichnenderweise keine bohrenden Nachfragen, sondern wollte von ihm nur noch eines wissen: »Schwörst du auf die Bibel und beim Heil unseres Erlösers, dass du die Wahrheit gesprochen hast?«
Das Gesicht des geschundenen Mannes verzog sich zu einer Grimasse, in der Sjadú unschwer die innere Qual seines Opfers widergespiegelt sah. »Ja, ich schwöre es!«, stieß Rupin Turville schluchzend hervor und die Tränen der Scham über seinen Verrat liefen ihm über das bärtige Gesicht.
Wilhelm von Nogaret verlor augenblicklich das Interesse an dem Unglücklichen. Er wandte sich abrupt ab und gab dabei Sjadú ein knappes Handzeichen, ihm zu folgen. Schweigend verließen sie die Folterkammer und stiegen hinter der Tür die Steintreppe hoch und Sjadú war zu klug, um ihn mit Fragen zu bedrängen. Dabei brannte es ihm auf den Fingernägeln zu erfahren, zu welch gewagten Schritten Nogaret nun bereit war.
Erst als sie das Stockwerk mit der Folterkammer längst hinter sich gelassen hatten und sich schon auf der hell erleuchteten Treppe oberhalb der Kellergewölbe befanden, brach Wilhelm von Nogaret sein Schweigen. Er blieb plötzlich auf einem Treppenabsatz stehen, legte Sjadú seine Rechte vertraulich auf die Schulter und bedachte ihn mit einem anerkennenden Lächeln.
»Ich habe schon seit Langem gewusst, dass Ihr ein Mann nach meinem Geschmack seid und dass Euer Geist jene seltene eisige Schärfe besitzt, die zu kühnen Unternehmen befähigt. Und nun habt Ihr mich von Eurer gewagten Idee restlos überzeugt, Jean-Mathieu«, sagte er und in seinen Augen brannte jenes fanatische Feuer, das stets in ihm aufflammte, wenn es um ein Komplott zugunsten seines Königs ging. »Mir scheint, dass jetzt der passende Zeitpunkt gekommen ist, Seine Majestät und nur ihn allein von Euren faszinierenden Überlegungen in Kenntnis zu setzen. Nach den turbulenten Ereignissen der letzten Wochen dürfte er für derartige Anregungen in empfänglicher Stimmung sein.« Ein feines Lächeln umspielte seinen dünnlippigen Mund. »Und wer könnte Eure betörend scharfsinnigen Gedanken besser vortragen als Ihr selbst?«
Sjadú wusste, dass es Wilhelm von Nogaret in Wirklichkeit darum ging, sich beim König nicht in die Nesseln zu setzen. Dessen Stimmung wechselte nämlich häufig und schnell von einem Extrem ins andere. Und wie Philipp der Schöne auf das, was sein königlicher Rat ihm vortragen und anraten wollte, reagieren würde, war nicht abzuschätzen.
Aber all das kümmerte Sjadú nicht. Und im Notfall standen ihm zu seinem Schutz dunkle, erschreckende Mächte zur Verfügung, von denen nur die verfluchten Gralsritter wussten. Nein, was allein zählte, war, dass der König ihn anhören würde. Fünfzehn Jahre hatte er auf diesen Tag hingearbeitet. Und nun war es so weit! Nogaret verschaffte ihm die Unterredung mit dem König von Frankreich, aber nicht in Hörweite seines schwatzsüchtigen und intriganten Hofstaates, sondern es würde ein geheimes Gespräch sein. Und wenn alles nach Plan verlief, würde sich eine Sturmflut unvorstellbaren Ausmaßes erheben und für immer die Welt verändern – und zwar von Nacht zu ewiger Nacht!
2
»König Falschmünzer! … König Falschmünzer! … Verflucht soll er sein, der König der Falschmünzer!«
Die schwüle Sommernacht um den königlichen Palast auf der Flussinsel und in den angrenzenden Stadtvierteln auf beiden Ufern war bis auf das Kläffen einiger streunender Hunde ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Doch Philipp der Schöne, der sich grollend in seine prunkvollen Privatgemächer zurückgezogen und sich von seinen Bediensteten jedwede Störung strikt verbeten hatte, hörte im Geiste wieder das schrille Geschrei und die lästerlichen, unflätigen Flüche des aufgebrachten Pöbels.
Einen gut gefüllten Weinpokal in der schlanken Hand, ging der König rastlos in den langen Zimmerfluchten auf und ab. Aber der edle Tropfen wollte ihm nicht schmecken. Er konnte es nicht verwinden, dass seine Untertanen, dieses undankbare Gassenvolk von Paris, vor wenigen Wochen doch tatsächlich die Ungeheuerlichkeit besessen hatte, sich gegen ihn zusammenzurotten und die Stadt in einen blutigen Aufruhr zu versetzen!
Gut, er hatte schon seit Längerem alle paar Jahre den Anteil an Gold und Silber in seinen Münzen verschlechtert. Und in diesem Sommer hatte er den Gehalt an Edelmetall noch einmal so stark verringert, dass jede Münze nur noch ein Drittel ihres vorherigen Wertes besaß – und sich dadurch alles drastisch verteuert hatte. Zwar hatte er vorsorglich das Nachwiegen seiner Münzen bei schwerer Strafe verboten und die Öfen, in denen die Münzen verfälscht worden waren, zertrümmern lassen. Aber diese Maßnahmen hatten ihn doch nicht vor dem Zorn seiner Untertanen bewahrt. Denn dass jede Ware nun plötzlich dreimal so teuer geworden war wie zuvor, hatte auch der Dümmste aus dem Volk ohne Nachwiegen der Münzen schnell gemerkt.
Aber was war ihm denn zum Wohle Frankreichs und der Sicherung seiner Herrschaft anderes übrig geblieben? Zum Teufel noch mal, er hatte doch nur getan, was jeder andere Herrscher auch tat! Der aufwendige Hofstaat mit seinem nicht enden wollenden Reigen teurer Feste, das rasant wachsende Heer der Staatsbediensteten, die kostspieligen und leider nicht sehr erfolgreichen Kriege, die regelmäßigen Zahlungen für notwendige Bündnisse und Schenkungen, der Bau neuer Festungen, Paläste und anderer Bauwerke sowie die Mitgiften für seine zu verehelichenden Töchter – all das verschlang Jahr für Jahr Unsummen. Die Ausgaben wuchsen beängstigend schnell, ohne dass die Einnahmen auch nur annähernd mit ihnen Schritt hielten. Früher einmal hatten die Gelder, die aus Staatsgütern, Warensteuern, Zöllen sowie dem Verkauf von Titeln, Vieh und Leibeigenen in die königliche Kasse flossen, noch zur Deckung der Staatsausgaben genügt. Aber diese Zeiten gehörten längst der Vergangenheit an. Es half auch nicht viel, immer mehr Adelspatente zu verkaufen, die Juden bis aufs Blut zu schröpfen und der französischen Geistlichkeit immer neue Abgaben aufzuerlegen. Das Geld zerrann ihm förmlich zwischen den Fingern und er musste immer neue Schulden bei den Templern und italienischen Bankhäusern machen, um mit diesen Geldern wenigstens die größten Löcher in der Staatskasse zu stopfen. Seine Staatsfinanzen waren dermaßen zerrüttet, dass er sich doch wahrhaftig gezwungen gesehen hatte, die Arbeiten am Louvre, seinem neuen festungsartigen Königspalast vor den Mauern der Stadt auf dem rechten Seineufer, einstellen zu lassen!
Der Pöbel, diese dumpfe abstoßende Masse ungebildeten Volkes, besaß natürlich keine Einsicht in die Notwendigkeiten, mit denen sich ein König bei seinen Staatsgeschäften auseinandersetzen musste! Deshalb waren sie ja auch Untertanen und hatten königliche Entscheide in Demut und mit dem angemessenen Gehorsam hinzunehmen! Immerhin hatte ihm die Salbung mit dem heiligen Öl von Reims nicht nur königliche, sondern auch eine religiöse Weihe verliehen!
Und doch hatte sich der Pöbel erdreistet, gegen ihn – ihren von Gott geweihten König! – krawallschlagend auf die Straße zu gehen und zu revoltieren! Das aufgebrachte Volk hatte nicht nur Wagen mit Lieferungen für seinen königlichen Haushalt überfallen und deren Fracht in den Kot der Straße gezerrt, sondern das Gesindel hatte auch die Münze angezündet sowie Beamte der Krone erstochen und ihre Häuser geplündert. Es war zu blutigen Straßenschlachten gekommen und dann hatte sich der Mob sogar hier vor seiner Königsburg zusammengerottet! Trotz seiner Leibgarde hatte er sich in seinem eigenen Palast so sehr bedroht gefühlt, dass er keinen anderen Ausweg gesehen hatte, als in die gewaltige Stadtburg der Tempelritter zu flüchten. Bei ihnen war er so sicher gewesen wie an keinem anderen Ort der Welt.
Es waren dann auch die Ordensritter und nicht seine eigenen Soldaten gewesen, die dem Aufstand der Straße im Nu und ohne großes Aufheben ein Ende bereitet hatten. Denn so gefürchtet sie als todesmutige Krieger auch waren, es galt ihnen doch auch die Liebe und der Respekt der einfachen Leute. Das war der Lohn dafür, dass es die Templer waren, die sich seit zweihundert Jahren nicht nur in Paris der Hungernden und Armen annahmen und sich sogar schützend vor jene kleinen Leute stellten, die in finanzielle Bedrängnis gerieten und denen deshalb der Schuldturm drohte. Und nun hatte er, der König von Frankreich, hinter ihren mächtigen Mauern Schutz suchen müssen – Schutz vor seinem eigenen Volk!
Die Wut, die eben noch dem Aufruhr gegolten hatte, richtete sich plötzlich, getränkt mit dem ätzenden Gift der Missgunst und dem Empfinden tiefer Demütigung, auf den Orden der Tempelritter. Hatten sich die Ordensoberen, diese weiß gewandeten hochmütigen Ritter, nicht selbstgefällig damit gebrüstet, dass sie im Handumdrehen vollbracht hatten, wozu seine eigenen Soldaten nicht fähig gewesen waren? Hatten sie hinter seinem Rücken nicht vielleicht sogar über ihn gelacht und ihren Spott getrieben, weil er sich zu ihnen hatte flüchten müssen wie ein hilfloses, verängstigtes Kind, das unter dem Rock der Mutter Zuflucht suchte? Und womöglich hatten sie ihn sogar verflucht, weil er nach der Niederschlagung der Revolte als Vergeltung und Zeichen seiner Härte kurzerhand achtundzwanzig Menschen aus dem Volk hatte hinrichten und ihre Leichname vor den Toren der Stadt an die Bäume hängen lassen.
Blinder Zorn überwältigte ihn bei diesen finsteren Mutmaßungen, die ihn wie der Eiter eines aufplatzenden Geschwürs mit Übelkeit erfüllten, und in einem jähen Wutausbruch schleuderte er den Kristallkelch in den kalten, klaffenden Rachen des Kamins, vor dem er stehen geblieben war. Mit hellem Klirren zerschellte er an der rußgeschwärzten Kaminwand und verwandelte sich in einen Regen aus unzähligen Kristallsplittern, während der dunkle Rotwein wie Blut über das Mauerwerk spritzte.
»Verdammt soll diese eingebildete Templerbande sein, die sich für vornehmer und mächtiger als ihr König dünkt!«, fluchte er. Sein Herz raste und er hatte das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen. Mit hastigen Schritten durchquerte er das Prunkzimmer, riss zwei bodenlange Flügeltüren auf und stürzte hinaus auf den luftigen Bogengang, von dem aus er einen Großteil von Paris überblicken konnte.
Heftig atmend und mit geballten Fäusten trat er an eines der offenen Bogenfenster, lehnte sich auf die breite, steinerne Balustrade, starrte über den still dahingleitenden Fluss und suchte im Dunkel der Nacht nach den hohen Türmen der Templerburg.
Templerburg?
Bittere Galle stieg in ihm hoch, als ihm in diesem Moment erst so richtig zu Bewusstsein kam, was für eine Untertreibung dieses Wort in Wirklichkeit darstellte. Denn bei dem Vieux Temple, dem ersten Haus des Ordens in Paris auf dem rechten Ufer der Seine, handelte es sich nicht um eine Burg im üblichen Sinne, sondern um ein ganzes Stadtviertel! Allein zum inneren Tempelbezirk, der sowohl von hohen, mit Zinnen und Wehrtürmen bestückten Mauern als auch von einzigartigen, päpstlichen Privilegien vor jeder weltlichen Macht geschützt wurde, gehörten neben den beiden gewaltigen Turmburgen, dem Tour de César und dem Donjon du Temple, Dutzende von anderen, eindrucksvollen Gebäuden, unter anderem auch eine prächtige Kirche mit einer Rotonde und einer Basilika, die nach dem Vorbild der Heiligen Grabeskirche gebaut worden war. Und der Orden gebot nicht nur über einen eigenen Hafen an der Seine, sondern ihm gehörte in Paris noch so viel ungenutztes Land, dass der Präzeptor5 des Pariser Tempels vor gut zwei Jahrzehnten damit begonnen hatte, das Land in Parzellen aufzuteilen und eine rasch wachsende Neustadt zu gründen. Aber das alles reichte ihnen noch lange nicht, kauften sie doch ständig neues Land auf und dehnten ihre Macht als Grundherren auch dank zahlreicher Schenkungen immer weiter aus. Bald würden sie die wahren Herren von Paris sein, wenn es mit ihrem Machtzuwachs so weiterging!
Er stutzte.
Waren sie nicht vielleicht schon längst die wahren Herren? Befahlen sie denn nicht schon heimlich über die zweihunderttausend Einwohner zählende Stadt, wie die rasche Niederschlagung des Aufruhrs gegen ihn bewiesen hatte? Ja, womöglich steckten sie sogar hinter dieser schändlichen Erhebung! Wie hätte es ihnen andernfalls auch gelingen können, so geräuschlos und schnell und ohne großes Blutvergießen wieder für Ruhe zu sorgen? Konnte es sein, dass sie heimlich versuchten, seine Macht zu untergraben und ihn in ihre Abhängigkeit zu bringen? Was seine Finanzen betraf, so hatten sie ihn ja gewissermaßen schon in der Hand. Denn sie wussten so gut wie er, dass er weder willens noch in der Lage war, irgendwann auch nur einen Teil der enormen Gelder zurückzuzahlen, die er sich in den letzten Jahren bei ihnen geliehen hatte.
Leise Schritte, die sich in seinem Rücken näherten, holten König Philipp aus seinen dunklen, argwöhnischen Gedanken. Er brauchte sich nicht umzudrehen, um zu wissen, wer es da wagte, seinem strikten Befehl zuwiderzuhandeln und seine übellaunige Ruhe zu stören. Der Gang dieses Mannes, der sich so leise federnd und zugleich doch voller Selbstbewusstsein über das Parkett bewegte, war unverkennbar der seines Vertrauten Wilhelm von Nogaret.
»Was immer es ist, es wird bis morgen warten müssen, Nogaret! Und hat man Euch nicht mitgeteilt, dass ich von keinem gestört zu werden wünsche?«, rief er ihm über die Schulter hinweg zu.
»Das hat man, Sire«, erwiderte Wilhelm von Nogaret. »Aber das Anliegen, das mich zu Euch bringt …«
»Seit wann missachtet Ihr die Befehle Eures Königs?«, fiel ihm Philipp ins Wort.
»Was Euch in Unkenntnis meines Anliegens als Missachtung Eurer Befehle erscheint, ist in Wirklichkeit meine bedingungslose Hingabe für die Belange Eurer Majestät! Befehlt, dass man mich auf die Richtstätte führt, Sire, und ich werde meinen Kopf gehorsam unter das Schwert des Henkers beugen, wenn es Eurer Wille ist und zum Wohle Eurer Regentschaft geschieht, mein König!«, versicherte Wilhelm von Nogaret mit jener wohldosierten Spur von Pathos, für die sein Herr so empfänglich war. Gleichzeitig beugte er das Knie und senkte willfährig den Kopf, als erwartete er jeden Moment, dass ihm der Schwerthieb des Henkers den Kopf vom Rumpf trennte.
Philipp wandte sich nun zu ihm um und tat die schmeichlerischen Worte mit einer scheinbar ungeduldigen Handbewegung ab. Doch sie hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Wilhelm von Nogaret war mehr als nur ein scharfsinniger königlicher Rat, der sein Vertrauen genoss wie kein anderer. Er wusste, dass diese kühne, allseits gefürchtete Gestalt ihm in geradezu fanatischem Eifer treu ergeben war und vermutlich sogar tatsächlich sein Leben für ihn hingeben würde.
»Lasst den Unsinn und kommt hoch!«, befahl er ihm. »Ich weiß, was ich an Euch habe – auch wenn Ihr meine Nerven gelegentlich ein wenig über Gebühr strapaziert.«
Wilhelm von Nogaret tat wie befohlen.
»Also gut, was gibt es denn so unaufschiebbar Wichtiges, dass Ihr meint, dafür meinen Unwillen riskieren zu können?«, fragte der König.
»Einen ungeheuerlichen Skandal, der die gesamte Christenheit bis in ihre Grundfesten erschüttern wird, wenn er ans Licht des Tages kommt! Ihr müsst unverzüglich davon erfahren und die Gunst der Stunde nutzen, bevor andere einflussreiche Kreise Wind davon bekommen, die Führung in dieser höchst brisanten Angelegenheit an sich reißen und Entscheidungen treffen, die wohl kaum in Eurem Interesse liegen dürften!«, teilte ihm Nogaret mit. »Es handelt sich um ein abscheuliches Verbrechen der Gottlosigkeit, das jedoch in Eurer strafenden Hand, sofern sie rasch und beherzt zupackt, zu einer gewaltigen Waffe sowohl gegen Eure erklärten als auch gegen Eure heimlichen Feinde werden kann! Aber hört dazu erst einmal Jean-Mathieu von Carsonnac an. Ihr werdet es nicht bereuen, ihm für einige Minuten ein offenes Ohr geliehen zu haben, Sire.« Er deutete dabei hinter sich ins Prunkgemach.
König Philipp stutzte und furchte ungnädig die Stirn, bemerkte er doch erst jetzt die hochgewachsene Gestalt, die Nogaret mitgebracht hatte und die in respektvollem Abstand zu ihnen neben der hinteren Durchgangstür seines Gemaches stand. Der Mann, der einen eleganten dunkelroten Seidenumhang mit schwarzen Paspelierungen trug und ein Bild makelloser Schönheit abgab, war ihm nicht ganz unbekannt. Mit Sicherheit war er ihm auf einigen der vielen Hoffeste und wohl auch bei so mancher Jagd begegnet, aber mehr als Belanglosigkeiten hatte er mit ihm nie ausgetauscht.
»Ihr führt einen mir Fremden ohne meine vorherige Erlaubnis in meine Privatgemächer? Bei Gott, Euer Verhalten ist äußerst kühn, Nogaret!« Ein drohender Unterton schwang nun in seiner Stimme mit. »Ich hoffe für Euch, dass Ihr einen guten Grund habt, meine Gunst auf eine so harte Probe zu stellen! Es muss schon ein wirklich sehr triftiger sein, wenn ich Euch diese Eigenmächtigkeit nachsehen soll!«
»Seid versichert, dass ich dies wohl bedacht habe, Sire!«, beteuerte Wilhelm von Nogaret. Und nachdem er ihn noch leise über Jean-Mathieu von Carsonnac ins Bild gesetzt und auf das Gespräch mit ihm vorbereitet hatte, schloss er mit den Worten: »Hört ihn an. Und wenn Ihr hinterher nicht mit mir einer Meinung seid, dass Euch das Schicksal in dieser Stunde den größten Trumpf zur Vernichtung Eurer Widersacher in die Hände spielt, verdiene ich nicht länger Eure Gunst und meine Stellung als königlicher Rat Eurer Majestät!«
Ein sichtlich überraschter Ausdruck trat auf das Gesicht des Königs. »Bei Gott, Ihr spielt mit hohem Einsatz, Nogaret! Jetzt habt Ihr mich tatsächlich neugierig gemacht, was es mit diesem ungeheuerlichen Skandal bloß auf sich hat, der zugleich der größte Trumpf im Kampf gegen meine Feinde sein soll.« Sein Blick ging hinüber in die Tiefe seines Privatgemaches zu dem Fremden, den sein Vertrauter mitgebracht hatte. Er wedelte kurz mit der Hand und forderte Nogaret auf: »Also dann, sagt ihm, er soll nähertreten und sprechen!«
3
Von der starken Anspannung und Unruhe, die Sjadú in den langen Minuten des Wartens quälten, fand sich äußerlich nicht der geringste Hinweis. Keine fahrigen Bewegungen der Hände, kein unruhiges Wechseln des Standbeins und kein nervöses Mienenspiel. Aufrecht, ruhig und scheinbar die Gelassenheit in Person, so stand er neben der Tür und wartete darauf, dass der König ihm die Gunst gewährte, ihn anzuhören.
Doch hinter dieser perfekten Fassade der Selbstbeherrschung lauerte die nagende Furcht, die Eitelkeiten, den Machthunger und die Skrupellosigkeit des Königs falsch eingeschätzt zu haben und so kurz vor seinem Ziel mit seinem Plan doch noch zu scheitern. Denn Philipp IV. war ein Mann mit gefährlichen Charakterzügen, wie ihn seine Erinnerung ermahnte.
Einerseits hatte der König von Frankreich ohne die geringsten Gewissensbisse Papst Bonifazius verteufelt, verfolgt und durch Nogaret zu Tode gebracht, und mit dem jetzigen Stellvertreter Christi, Papst Clemens, dem er mit Geld und Erpressung auf den Heiligen Stuhl verholfen hatte, sprang er um wie mit einem dienstpflichtigen Vasallen. Er hatte ihn sogar gezwungen, seine Residenz nicht in Rom, sondern in Frankreich aufzuschlagen, um ihn besser unter Kontrolle halten zu können.
Aber andererseits schien der König auch ein Mann starken Glaubens zu sein, der zweimal die Woche fastete, ein härenes Hemd unter seinem kostbaren Königsgewand trug und sich von seinem dominikanischen Beichtvater sogar regelmäßig geißeln ließ. Er umgab sich auch nicht mit Mätressen oder Lustknaben, wie es so viele andere gekrönte Häupter und sogar Kirchenfürsten völlig schamlos taten und es nicht einmal zu verbergen suchten, weil sie jede Form der Ausschweifung aufgrund ihres hohen Standes als ihr verbrieftes Recht betrachteten.
Und dann war da noch jene andere Zwiespältigkeit, die den König von Frankreich kennzeichnete und sich mit seinem Beinamen »Philipp der Schöne« verband. Zu Recht pries man die Anmut seiner Züge, den Glanz seiner rötlich blonden Lockenpracht, die klaren Augen, die fast milchhelle, glatte Haut seines Gesichtes, die würdevolle Haltung seiner hohen Gestalt und die Eleganz seiner Manieren. Aber es gab auch diese Stunden dunkler Anwandlungen, finsterer Grübelei und erschreckender Wutausbrüche, die sogar den abgebrühtesten Höfling in Angst und Schrecken versetzen konnten. Nicht von ungefähr trug Philipp der Schöne noch einen zweiten, sehr viel weniger schmeichelhaften Namen, den man jedoch nur hinter seinem Rücken und einzig im Kreise von Freunden auszusprechen wagte, auf deren Schweigen man blind vertrauen konnte. »Metuendissimus« nannte man ihn, »Philipp den Furchtbarsten«. Nicht wenige verglichen ihn auch mit einem Habicht, der jäh aus luftiger Höhe auf seine ahnungslose Beute herabstürzt und seine furchtbaren Krallen in sein Opfer schlägt, bevor es weiß, wie ihm geschieht.
Und ausgerechnet diesen unberechenbaren Mann musste Sjadú nun als Komplizen gewinnen, um endlich den entscheidenden Schlag gegen den mächtigen Orden der Templer und die geheime Bruderschaft der Gralsritter zu führen! Ein fast schwindelerregend gewagtes Vorhaben, das jedoch der überragenden Stellung und besonderen Fähigkeiten eines erhabenen Ersten Knechtes wahrlich würdig war!
Gerade ertappte sich Sjadú bei dem Gedanken, dass er die verfluchten Gralsritter dennoch lieber im Kampf mit der blanken Klinge in die Knie gezwungen hätte, als Wilhelm von Nogaret ihm bedeutete, zu ihnen hinaus auf den Bogengang zu treten. Festen Schrittes folgte er der Aufforderung des königlichen Rates. Jetzt also galt es!
Nach den üblichen Bezeugungen des Respektes und der Ergebenheit überraschte Sjadú den König, indem er seine Ausführungen mit den Worten begann: »Sire, erlaubt mir, zuerst ein wenig von Eurer kostbaren Zeit darauf zu verwenden, über die mächtigen Herren Tempelritter und ihre Loyalität gegenüber Eurer Majestät zu reden!«
Philipp machte ein verblüfftes Gesicht. Dann zog er die Stirn in Falten und sagte zu Wilhelm von Nogaret gewandt: »Hattet Ihr nicht von einem ungeheuerlichen Skandal gesprochen, von dem Ihr Kenntnis erhalten habt und über den Ihr mich unverzüglich ins Bild setzen müsst, weil es rasche Entscheidungen zu treffen gilt?«
»Ja, das waren meine Worte und so verhält es sich auch, Sire«, bekräftigte Wilhelm von Nogaret. »Nur habt einige Augenblicke Geduld, mein König, und hört an, was er zu sagen hat.«
»Das eine hängt mit dem anderen unzertrennlich zusammen, Majestät«, fügte Sjadú hinzu.
Philipp der Schöne schüttelte, sichtlich verwirrt, kurz den Kopf, zuckte dann die Achseln und antwortete mürrisch: »In Gottes Namen, fahrt fort! Aber seid gewarnt, mein Herr von Carsonnac: Meine königliche Geduld ist schnell erschöpft, wenn man mir mit diesen hochmütigen Ordensrittern in den Ohren liegt!«
Sjadú hätte den König nur zu gern daran erinnert, dass er doch erst vor zwei Jahren den Großmeister der Templer gebeten hatte, ihn als Ehrenmitglied aufzunehmen – und dass der Konvent der Kriegermönche es doch wahrhaftig abgelehnt hatte, ihm, dem König von Frankreich, diese erbetene Ehre zu erweisen. Wie sich doch die Zeiten und die Ansichten eines Menschen ändern konnten!
Und so neigte er nur ergeben den Kopf und konzentrierte sich darauf, Salz in die klaffende Wunde zu streuen, die der König von den wahren und eingebildeten Demütigungen der Tempelritter davongetragen hatte.
»Wie kann es mit rechten Dingen zugehen, dass so gut wie jeder Fürstenhof der Christenheit mit einem wachsenden Berg von Schulden zu kämpfen hat, Sire, während die Tempelritter immer mehr Reichtümer anhäufen und zu den Finanziers von so manchem König werden, ohne dass ihr enormes Vermögen darunter Schaden nimmt?«
»Fürwahr eine gute Frage, auf die auch ich gern eine Antwort wüsste!«, knurrte der König grimmig.
»Nicht nur, dass der Templerorden ein schlagkräftiges Heer unterhält und sich eine eigene Flotte leisten kann«, fuhr Sjadú im Tonfall einer Anklage fort. »Auch nicht genug damit, dass er in allen Ländern große Häuser und Güter besitzt und sich die Zahl seiner Komtureien6 mittlerweile wohl auf mehrere Tausende beziffert. Nein, dieser unglaublich reiche Orden, der sich in Frankreich wohl am stärksten ausgebreitet und in diesem Land mehr als anderswo unermessliche Reichtümer angehäuft hat, dieser Orden mit seinen hochmütigen Herren im weißen Mantel entzieht sich dank immer neuer päpstlicher Privilegien Eurer Königsgewalt, Eurer Gerichtsbarkeit und Euren rechtmäßigen Steuern. Ein Templer kann die abscheulichsten Verbrechen begehen, doch kein Fürst, kein König darf Hand an ihn legen und ihn dafür zur Rechenschaft ziehen – das darf allein der Papst.«
Das Gesicht des Königs verdunkelte sich. Es schmeckte ihm ganz und gar nicht, so direkt und unverblümt daran erinnert zu werden, dass sich der Orden der Templer seiner Macht gänzlich entzog. Jeden Bischof seines Landes konnte er zum Heeresdienst zwingen und ihn mit Abgaben belegen, nicht jedoch die Tempelritter. Sie gehorchten keinem Fürsten, sondern führten selbstherrlich Kriege und schlossen Bündnisse, ganz wie es ihnen beliebte! Und die Päpste hielten seit zweihundert Jahren ihre schützende Hand über sie!
»Der Teufel soll diese ganze Pfaffenbande holen, die sich Stellvertreter Christi nennt und sich in ihrem Größenwahn anmaßt, über gottgeweihten Königen zu stehen!«, zischte Philipp kaum hörbar und seine Verachtung schloss auch den derzeitigen Papst Clemens mit ein, dem er selbst auf den Petristuhl verholfen hatte.
Sjadú hatte es sehr wohl mitbekommen, gab sich jedoch den Anschein, dass ihn diese lästerliche Verwünschung nicht erreicht hatte. Er spürte den tief sitzenden Groll, ja fast schon Hass, den Philipp der Schöne hegte, und er war entschlossen, dieses Feuer in ihm zu schüren, bis es stark genug war, um den Orden zu vernichten. Gelang das, war die geheime Bruderschaft in ihren Reihen des mächtigen Schutzes durch die Tempelbrüder beraubt und der Heilige Gral konnte ihr endlich entrissen werden!
»Und was würden Eure scharfsichtigen Augen sehen, Sire, wenn Ihr Euch wie ein Vogel über Paris in die Lüfte erheben könntet?«, setzte Sjadú seine Hetztirade gegen den Orden fort, um sogleich selbst die Antwort auf seine Frage zu geben. »Ich will es Euch sagen, Majestät! Ihr würdet sofort das gewaltige Areal bemerken, das die Villeneuve-du-Temple7 vor den Mauern Eurer Hauptstadt einnimmt. Und wer nur von einem Stadtteil spricht, der muss mit Blindheit geschlagen sein oder will einem Sand in die Augen streuen. Denn das Gelände, das dem Tempel gehört, umfasst mittlerweile gut ein Drittel von ganz Paris!«
Der König presste die Lippen zusammen, als müsste er an sich halten, diesem Mann nicht in die Rede zu fahren, die ihm das Gefühl vermittelte, bloßgestellt zu sein.
»Zudem ist es eine gewaltige, ummauerte Festung, wie es sie nur einmal im ganzen Abendland gibt!«, fuhr Sjadú unbeirrt fort. »Kein Ort der Welt gilt als sicherer als die Templerburg und nirgendwo lagern mehr unermessliche Schätze an Gold und Juwelen als hinter den Mauern des Tempels!« Er machte eine dramatische Pause, bevor er leise in die angespannte Stille hineinfragte: »Ist der Orden der Tempelritter nicht schon längst ein Staat in Eurem Staat, Majestät? Und dünkt er sich nicht schon längst mächtiger als jeder König? Ja, stehen die Templer in Wirklichkeit nicht über allen gekrönten Häuptern und sind selbstherrlicher als jeder noch so mächtige Fürst?«
Wilhelm von Nogaret zuckte kaum merklich zusammen und hielt den Atem an. Diese gefährlichen rhetorischen Fragen, die ihre bittere Antwort schon unausgesprochen in sich trugen, würden dem König kaum gefallen – und konnten Jean-Mathieu von Carsonnac unter Umständen gar den Kopf kosten!
Philipp der Schöne war sprachlos über diesen ungeheuerlichen Affront. Noch nie hatte jemand es gewagt, ihm so dreist ins Gesicht zu sagen, dass nicht er der wahre Herrscher Frankreichs sei! Doch bevor der König sich fassen und zu einer Entscheidung kommen konnte, wie diese grobe Unverfrorenheit angemessen zu ahnden sei, setzte Sjadú seine Ausführungen auch schon fort. Und nichts wies in seiner Stimme oder Miene darauf hin, dass er fürchtete, sich die Gunst des Königs mit seinen letzten Bemerkungen verscherzt zu haben und nun in Sorge um sein Leben sein zu müssen.
»Es scheint, diesen stolzen Rittern mit den weißen Mänteln, die das Gelübde der Armut geleistet haben und doch an Reichtum alle Fürsten und Päpste weit übertreffen, sind keine Grenzen gesetzt. Doch warum seltsamerweise nur denen, Sire? Warum vermehrt sich nur in deren Händen das Geld, als befänden sie sich im Besitz eines geheimen Zaubers? Und wenn sie wirklich einen dunklen Zauber in ihren Ordensmauern hüten, welcher Art ist dieser Zauber? Kennen sie vielleicht das alchimistische Geheimnis, wie man Eisen in Gold verwandelt? Mit welch dunkler Macht haben sie einen teuflischen Pakt geschlossen? Eine fürwahr erschreckende Vorstellung!«
Der König, der schon mit zorngeröteter Miene den Mund geöffnet hatte, vergaß bei der Erwähnung eines geheimen Paktes mit dunklen Mächten augenblicklich, dass er Jean-Mathieu von Carsonnac seine königliche Wut und Willkür hatte spüren lassen wollen.
Sjadú lachte kurz und voller Ingrimm auf. »Aber noch viel beunruhigender dürfte die Frage sein, was sie mit ihrem unermesslichen Reichtum und ihrer bedrohlichen militärischen Macht anfangen werden, wo das Heilige Land an die Muslime verloren gegangen ist und zurzeit wohl keine Aussicht auf einen neuen Kreuzzug besteht. Der Orden der Deutschritter drängt mit seinen Truppen kraftvoll nach Osten und hat dort seine neue Aufgabe gefunden. Und die Johanniter haben sich auf Rhodos ihr eigenes Reich erkämpft. Nur die Templer, die mächtigste aller Ritterschaften, verharren noch in Untätigkeit. Doch wie lange noch und warum? Welche geheimen Pläne schmieden sie? Sicher ist, dass sie wieder herrschen werden wollen, so wie sie es im einstigen Königreich Jerusalem getan haben. Doch wer wird ihr Opfer sein? Worauf haben sie ihr geheimes Augenmerk gerichtet? Gegen wen wird sich der mächtigste, schlagkräftigste und reichste aller Ritterorden wenden? Wen wird ihr gottloser Verrat treffen und vom Thron stürzen?« Jede Frage kam so scharf und gezielt wie ein Schwerthieb von seinen Lippen.
Der plötzlich hellwache, fast erschrockene Ausdruck auf dem Gesicht des Königs verriet Sjadú auch sofort, dass er sich spätestens jetzt der ungeteilten Aufmerksamkeit Philipps des Schönen gewiss sein konnte.
»Ihr nehmt mehr als nur kühne Worte in den Mund, indem Ihr es wagt, im Zusammenhang mit den Templern von Verrat und Teufelspakt zu reden, Jean-Mathieu von Carsonnac!«, stieß der König hervor und rang sichtlich erregt nach Atem.
Sjadú hielt seinem stechenden Blick mühelos stand. Jetzt hatte er den König da, wo er ihn haben wollte.
»Es bedarf keiner Kühnheit, die Tempelritter des drohenden Verrates zu verdächtigen, wenn man weiß, dass sie sich längst viel schändlicherer Verbrechen schuldig gemacht haben! Verrat und Umsturz werden sich gegenüber ihren abscheulichen geheimen Zeremonien und ungeheuerlichen ketzerischen Verbrechen wie kleine Verfehlungen ausnehmen!«
»Ihr bezichtigt den Orden der Templer der Ketzerei?«, stieß der König ungläubig und elektrisiert zugleich hervor.
»Es ist weit mehr als eine bloße Bezichtigung, Sire. Wir haben Beweise für unsägliche Schandtaten!«, brach nun Wilhelm von Nogaret sein langes, abwartendes Schweigen. Die Sache lief gut und da hielt er es für an der Zeit, sich wieder angemessen in Szene zu setzen und seinen König wissen zu lassen, dass die Aufdeckung dieses abscheulichen Verbrechens zu einem Gutteil ihm zu verdanken war. »Einen Zeugen habe ich persönlich vernommen und dabei meine schlimmsten Befürchtungen weit übertroffen gefunden! Andernfalls hätte ich es auch nicht gewagt, die Ruhe Eurer Majestät zu stören.«
Der König packte ihn mit festem Griff am Arm. »Welcher Art sind die Ketzereien, Nogaret?«, verlangte er zu wissen. Und das erregte Aufblitzen seiner Augen war ein deutlicher Hinweis darauf, dass ihn die Nachricht mehr mit grimmiger Genugtuung erfüllte als mit Abscheu. Ihm war anzusehen, dass er schon jetzt überlegte, wie er das Wissen zu seinem größtmöglichen Vorteil einsetzen konnte. »Sprecht! Von wem habt Ihr Eure Informationen und wie hieb- und stichfest sind sie?«
Wilhelm von Nogaret kam der Aufforderung des Königs nur zu bereitwillig nach und berichtete in großer Ausführlichkeit von der Vernehmung des einstigen Templers und was dieser schließlich gestanden hatte. Und Sjadú ließ es sich nicht nehmen, gelegentlich einiges beizusteuern, damit die Saat des Bösen schnell tiefe Wurzeln schlug.
Als die beiden Männer ihren Bericht beendet hatten, schwieg Philipp der Schöne für einen langen Moment. Stumm, die Lippen geschürzt und mit einem bösartig zufriedenen Ausdruck in den Augen, starrte er hinüber zu den Türmen der Templerburg. Dabei nickte er mehrmals mit dem Kopf, als hörte er eine innere Stimme, die zu ihm redete.
Und dann sagte er fast genüsslich: »Bei Gott, vor Ketzerei muss selbst der Papst seine Waffen strecken!«
Sjadú wusste sofort, was dem König soeben durch den Kopf gegangen war. Und dem galt es, Nahrung zu geben, damit die Versuchung unwiderstehlich wurde. »Ketzerei fällt unter die Gewalt der Inquisition. Und in einem solchen Fall, wo die päpstliche Gerichtsbarkeit offenbar schläft, kann der weltliche Arm die Anklage übernehmen.«
»So ist es und keiner versteht sich auf die Inquisition so gut wie die Dominikaner, mit denen Ihr doch in bestem Einverständnis steht, Sire«, warf Wilhelm von Nogaret geschickt ein.
»Es dürfte jedoch ratsam sein, vollendete Tatsachen zu schaffen und erst nach sorgfältiger Planung und Vorbereitung mit einem großen, vernichtenden Schlag gegen den Orden vorzugehen, bevor der Papst Wind von der Aktion bekommt und eingreifen kann«, legte Sjadú dem König und seinem Vertrauten nahe. »Zudem ist Clemens Papst allein von Euren Gnaden, Majestät, und ein Weichling, der es kaum wagen wird, sich gegen Euch zu stellen. Nur ist strikte Geheimhaltung eines solchen Vorhabens vonnöten, wenn der Orden zerschlagen werden und keiner der ketzerischen Tempelritter seiner gerechten Strafe entkommen soll.«
»Ja, das muss das Ziel sein! Denn wenn dem Orden das Verbrechen der Ketzerei nachgewiesen werden kann und es darüber zu seiner Auflösung kommt, dann haben die Tempelritter jegliches Recht an Gut und Geld verloren!«, bemerkte Wilhelm von Nogaret nicht ohne Hintersinn. »Alle Gelder und Besitztümer des Ordens werden in dem Fall an die Krone fallen!«
Der König holte tief Luft und lehnte sich kurz gegen einen der steinernen Bogenpfeiler, als hätte diese Vorstellung ihn für einen Augenblick schwindelig werden lassen.
»Majestät, Ihr seid der standhafte Bewahrer des wahren Glaubens, der hell leuchtende Stern unter den katholischen Fürsten!«, erklärte Wilhelm von Nogaret pathetisch. »Im Namen der Christenheit, geht auch jetzt tapfer voran und wacht in dieser dunklen Stunde der Heimsuchung über die Reinheit des Glaubens! Schlagt dem teuflischen Dämon der Blasphemie, der sich im Gewand des Templerordens in unserer Mitte erhoben und wie ein Krebsgeschwür im Leib der Christenheit ausgebreitet hat, beherzt den abscheulichen Kopf ab! Lasst die Ketzer im weißen Mantel auf dem Scheiterhaufen brennen!«
Im nächsten Moment funkelte das wilde Feuer der Heimtücke in den Augen des Königs, als er die Faust ballte und in Richtung der Templerburg den Schwur tat: »Bei Gott, das werden sie! Und nicht einer soll verschont werden!«
Sjadú nickte mit ausdrucksloser Miene, während wilder Jubel seine Brust fast zu sprengen drohte. Es war getan! Die Saat des Bösen war ausgebracht, war bei Wilhelm von Nogaret und König Philipp auf fruchtbaren Boden gefallen und würde zur Zeit der Ernte fürchterliche Früchte tragen!
Erster Teil
Verstreut in alle Winde12./13. Oktober 1307
1
Der Gasthof A la Rose Noire8, der sich am Westrand des Waldes von Andelys furchtsam unter den hohen und dicht stehenden Bäumen zu ducken schien, lag an der Landstraße von Rouen in der Normandie nach Paris.
McIvor von Conneleagh, der Gralsritter aus dem schottischen Hochland, saß an einem langen, derben Holztisch, der direkt vor dem schweren Kamin aus Feldsteinen stand. Weniger als zwei Schritte trennten ihn von den lodernden Flammen, und nach dem beschwerlich langen und regentrüben Oktobertag im Sattel genoss er die Hitze, die das prasselnde Feuer hinter ihm ausströmte. Sie drang mühelos durch den feuchten Templermantel und verschaffte seinen müden, schmerzenden Knochen Linderung. Seine Stimmung war niedergedrückt, ja fast so düster wie die Rose im Namen des Gasthofes und im schon reichlich verwitterten Holzschild, das draußen über dem Eingang hing und an seinen rostigen Ketten im launenhaften Herbstwind quietschend hin- und herschaukelte.
Der hünenhafte Templer mit der verbeulten Eisenklappe über dem rechten Auge hatte die Schankstube ganz für sich. An diesem Abend war er der einzige Reisende, der im A la Rose Noire über Nacht Station machte. Und die letzten einheimischen Zecher, eine achtköpfige Gruppe junger Burschen, die wohl als Knechte auf den umliegenden Gehöften in Brot und Arbeit standen, waren gerade unter lautem Gejohle aus der Schenke gewankt, als er vor dem Gasthof aus dem Sattel gestiegen war.
Bei seinem Eintreffen hatte er es als angenehm empfunden, die Schenke nicht mit einer Schar lärmender Bauern und Knechte teilen zu müssen. Mittlerweile wünschte er jedoch, es wären noch andere Gäste zugegen. Denn dann hätte die dickleibige und breithüftige Tochter des Schankwirts anderes zu tun gehabt, als ihn zu umschwirren wie eine Motte das Licht und ihn mit immer neuen Fragen in ein Gespräch verwickeln zu wollen. Ihm war zu dieser späten Abendstunde nicht nach geschwätziger Gesellschaft und schon gar nicht nach weiblicher Aufmerksamkeit zumute.
Seit er vor zwei Tagen im Morgengrauen an einem einsamen Küstenabschnitt der Normandie von Bord eines englischen Schmugglerschiffes gegangen war, das ihn im Schutz der Nacht über den Kanal gebracht hatte, hatte er die lichten Stunden des Tages im Sattel verbracht. Er wollte jetzt nichts weiter, als in Ruhe vor dem herrlich warmen Kaminfeuer den Krug mit heißem Gewürzwein zu leeren, danach oben in einer Kammer auf ein halbwegs weiches Lager zu sinken und dann so schnell wie möglich in einen hoffentlich tiefen, traumlosen Schlaf zu fallen. Nicht einmal nach Essen stand ihm der Sinn. Dafür war es auch schon viel zu spät, musste mittlerweile doch schon die letzte Stunde vor Mitternacht angebrochen sein. Aber die Ruhe, nach der ihn verlangte, schien ihm nicht vergönnt zu sein.
»Na, mundet Euch unser Gewürzwein, Tempelritter?«, fragte ihn die Wirtstochter, die schon einige Jahre jenseits der zwanzig sein musste und stark schielte. Dabei stützte sie sich mit der rechten Hand auf die Kante der Tischplatte und beugte sich weit zu ihm hinüber, als hätte sie es darauf abgesehen, dass ihr hervorquellender Busen jeden Moment aus dem sehr locker geschnürten Mieder sprang. Sie war auf den Namen Clotilde getauft und wurde jedoch von ihrem Vater, wahrlich nicht ohne Berechtigung, nur »Fettklößchen« gerufen.
McIvor von Conneleagh zuckte wortlos die Achseln, setzte den Steingutbecher an die Lippen und versuchte, ihre Gegenwart einfach zu ignorieren. Er hoffte, dass sie es leid wurde, auf ihre Fragen nur ein Achselzucken oder ein mürrisches Grunzen als Antwort zu erhalten, und ihn endlich in Ruhe ließ. Aber diese Hoffnung erfüllte sich nicht.
»Gebt nur zu, dass er Euch herrlich süffig die Kehle hinunterfließt«, bedrängte sie ihn. »Es ist, als würde einem ein Engel auf die Zunge strullen, nicht wahr? Und ratet mal, von wem das Rezept ist. Jawohl, es ist von mir!«
Sie zwinkerte ihm mit plumper Vertraulichkeit zu, um ihn dann mit gesenkter Stimme und eindeutiger Zweideutigkeit wissen zu lassen: »Ich verstehe mich aber nicht nur auf den besten Gewürzwein weit und breit, mein Herr Ritter, sondern auch auf so manch anderes, was den Sinnen eines Mannes großes Vergnügen bereitet!«
Jetzt reichte es McIvor von Conneleagh. Die dreiste Beharrlichkeit, mit der dieses schieläugige Fettklößchen namens Clotilde ihm mit ihrem einfältigen Geschwätz auf die Nerven ging, war schon unerträglich genug. Aber ihr Versuch, ihm nun auch noch ihre käuflichen Dienste als Tavernendirne schmackhaft zu machen, brachte das Fass zum Überlaufen. Er weckte in ihm nämlich einen bitteren, mühsam zu zügelnden Zorn, der viel mit der langen, hinter ihm liegenden Reise zu tun hatte – und mit dem Tod zweier Menschen, die er geliebt hatte wie niemanden sonst in seinem Leben. Eine Liebe, die ihn bei aller Stärke und Innigkeit jedoch nicht davor bewahrt hatte, diese beiden ihm teuersten Menschen in tiefe Verzweiflung zu stürzen und großes Unglück über sie zu bringen.
Ganz langsam setzte der Schotte den dicken Steinbecher ab und genauso betont langsam hob er den Kopf. Und schon in dieser spürbar beherrschten Bewegung lag eine unausgesprochene Drohung, die durch seine äußere, nicht gerade anmutige Erscheinung noch unterstrichen wurde. Denn es lag nicht allein an seiner bärenhaften Gestalt und der Eisenklappe, die über der rechten Augenhöhle von einem breiten, mit silbernen Fäden durchzogenen Lederriemen an ihrem Platz gehalten wurde, dass er aussah wie ein wüster Wikingerkrieger. Da war auch noch die weißliche Narbe, die sich von der rechten Stirn quer über die Nase und bis hinunter zum kantigen Kinn über sein Gesicht zog. Dazu kamen die zahlreichen Narben auf der vorderen, kahl geschorenen Schädelhälfte, die viel Ähnlichkeit mit einer von Schwert- und Beilhieben zerkratzten Eisenkugel besaß. Und das rötliche, strohdicke Haar der hinteren Kopfhälfte war im wulstigen Nacken zu einem gerade mal handlangen Zopf zusammengeflochten. Dieser wirkte durch die dichte Umwicklung mit einem schmalen Lederband, das wie der Riemen der eisernen Augenklappe gleichfalls von einem Geflecht silbriger Fäden durchzogen wurde, wie ein metallener Sporn, der ihm aus dem Hinterkopf ragte.
McIvor von Conneleagh nahm Clotilde mit seinem linken Auge scharf ins Visier, als er ihr nun mit unverhohlenem Grollen in der Stimme antwortete: »Wenn ich an ihm auch nichts halbwegs Engelhaftes finden kann, so ist Euer Gewürzwein doch angemessen heiß und hat den rechten Biss. Nur würde er mir wohl noch um einiges besser schmecken, wenn ich ihn endlich ungestört von lästigen Fragen und aufdringlicher Gesellschaft genießen könnte!«
Das schieläugige Lächeln, das wohl verführerisch sein sollte, gefror augenblicklich auf dem fleischig runden Gesicht der Wirtshaustochter. Im nächsten Moment schnappte sie sichtlich empört nach Luft und suchte nach einer passenden, schlagfertigen Entgegnung, ohne jedoch die richtigen Worte finden zu können. Dabei ging ihr Mund dreimal auf und zu, ohne dass ihr auch nur ein Laut über die Lippen kam. Gleichzeitig schoss ihr das Blut dermaßen heftig ins Gesicht, dass seine dunkelrote Farbe leicht mit der einer reifen Tomate hätte wetteifern können.
Und während Clotilde noch um Fassung rang, vernahm McIvor den Hufschlag von mehreren Pferden, die sich der Herberge rasch aus Nordwesten näherten. Er hörte das Klirren von Waffen und sein geübtes Ohr sagte ihm, dass es sich dabei um sechs oder sieben gut bewaffnete Reiter handelte. Sofort fragte er sich, wer diese Reiter wohl sein mochten und was sie veranlasste, noch zu so später Nachtstunde unterwegs zu sein. Sie mussten einen guten Grund haben oder von bösen Absichten geleitet sein, dass sie sich den Gefahren einer dunklen Landstraße aussetzten, deren übler Zustand schon bei Tage von jedem Reiter und Fuhrmann ein höchst wachsames Auge verlangte.
Hinter dem Ausschank tauschte der gleichfalls alarmierte Wirt mit seiner Frau einen besorgten Blick. Mit einer Flinkheit, die McIvor dem krummbeinigen und dickbäuchigen Mann nicht zugetraut hätte, kam er hinter dem primitiven Verschlag hervor, eilte nach vorn zur schweren Bohlentür und steckte den Kopf in die Nacht hinaus.
Der Schotte warf einen schnellen Blick über die Schulter schräg nach hinten. Er galt seinem kostbaren Gralsschwert mit der edlen Damaszenerklinge, die vor langer Zeit von der unübertroffenen Meisterhand eines geweihten Waffenschmieds und Mitglieds der Geheimen Bruderschaft der Arimathäer geschmiedet und geschliffen worden war. Er hatte die Waffe, deren Knauf ebenso wie die Enden der Parierstange in fünfblättrigen Rosenknospen auslief und deren Blatt ein Templerkreuz mit einer Rose zierte, mitsamt dem schweren Schwertgehänge und seinem dreckigen Kleidersack in der Ecke neben dem Kamin gegen die Wand gestellt. Und er überlegte nun, ob er aufspringen und sich den Waffengurt vorsichtshalber wieder umschnallen sollte. Er zögerte. Denn sein Verstand sagte ihm, dass es sich bei der Reiterschar kaum um räuberische Halunken handeln konnte. Denn wer einen nächtlichen Überfall im Sinn hatte, würde nicht so dumm sein, sich dem Ort seiner geplanten Schandtat im donnernden Galopp zu nähern und damit sein Kommen frühzeitig anzukündigen.
Clotilde war offensichtlich dermaßen empört über seine schroffe Zurückweisung, dass sie dem Geräusch der herangaloppierenden Reitergruppe keine Beachtung schenkte.
»Also, das ist ja wirklich …!«, brach es schließlich wutschnaubend aus ihr hervor. Ein weiteres Ringen nach Atem verhinderte jedoch, dass sie den Satz beenden konnte. Und so sollte es McIvor denn auch erspart bleiben, in den Genuss einer Kostprobe ihres reichhaltigen Wortschatzes an Obszönitäten und Verwünschungen zu kommen.
Und in diesem Moment rief der Wirt von der Tür her: »Donnerschlag, du wirst es nicht glauben, wer da zu dieser nächtlichen Stunde noch angeritten kommt, Weib! Es ist der Bailli9 aus der Stadt, der Herr Clermont von Amboise, der mit fünf von seinen Amtmännern zu uns will!« Verwundert schüttelte er den Kopf. »Aber was kann denn bloß der Grund sein, dass er sich um diese Zeit auf die Landstraße begibt? Und wo mag er mit seinen Schergen nur hinwollen? Wirklich merkwürdig. Eines ist jedoch sicher, Weib: Es muss um wichtige königliche Geschäfte gehen, wenn ein Herr wie Clermont von Amboise in einer so unerquicklichen Nacht das warme Bett mit dem harten Sattel vertauscht!«
»Zerbrich dir nicht den Kopf über Angelegenheiten, die dich nichts angehen und von denen du sowieso nichts verstehst, Claude!«, riet ihm seine Frau mit spitzer Zunge. »Geh lieber hinaus und hilf dem Bailli und seinen Männern, falls sie bei uns eine Rast machen oder gar hier nächtigen wollen. Ein Geschäft, das wir gut gebrauchen könnten.«
McIvor von Conneleagh entspannte sich. Das Schwert konnte stehen bleiben, wo es stand, und er war sehr erleichtert, dass er sich wieder seinem Wein zuwenden konnte. Und was immer den königlichen Beamten bewog, noch zu dieser Nachtstunde mit seinen Männern unterwegs zu sein, interessierte ihn nicht.