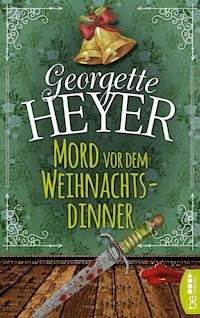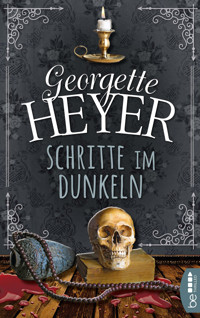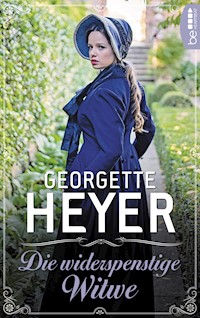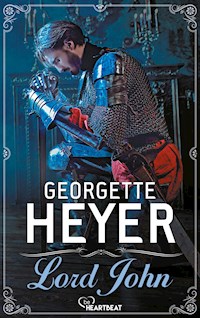6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
Der abenteuerlustige Sir Nicholas Beauvallet hat sich für das ebenso aufregende wie gefährliche Leben als Freibeuter im Auftrag ihrer Majestät, Königin Elisabeth I., entschieden. An einem stürmischen Wintertag begegnet sein Schiff der spanischen Galeone "Santa Maria" - in der darauffolgenden Schlacht macht der "tolle Nick" nicht nur reiche Beute, sondern auch die Bekanntschaft des widerspenstigen spanischen Edelfräuleins Dominica, Tochter des ehemaligen Gouverneurs von Santiago. Kann der mutige Seeräuber auch ihr Herz erobern?
In ihrem Roman "Der tolle Nick" (im Original: "Beauvallet") entführt Georgette Heyer ihre Leserinnen in das elisabethanische Zeitalter. Diese wundervolle Freibeuter-Liebesgeschichte begeistert mit einer aufregenden Handlung, atemloser Spannung und meisterhaft pointierten Dialogen.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Über dieses Buch
Der abenteuerlustige Sir Nicholas Beauvallet hat sich für das ebenso aufregende wie gefährliche Leben als Freibeuter im Auftrag ihrer Majestät, Königin Elisabeth I., entschieden. An einem stürmischen Wintertag begegnet sein Schiff der spanischen Galeone »Santa Maria« – in der darauffolgenden Schlacht macht der »tolle Nick« nicht nur reiche Beute, sondern auch die Bekanntschaft des widerspenstigen spanischen Edelfräuleins Dominica, Tochter des ehemaligen Gouverneurs von Santiago. Kann der mutige Seeräuber auch ihr Herz erobern?
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Der tolle Nick
Aus dem Englischen von Erika Kaiser
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1929
Die Originalausgabe BEAUVALLET erschien 1929 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1980.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Design Projects/Shutterstock
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0307-9
www.lesejury.de
Für F.D.H.
Kapitel 1
Das Deck war ein Schlachtfeld. Tote und Sterbende lagen umher; Holz war gesplittert, Planken waren zerborsten, Segel hingen in Fetzen; die Luft war erfüllt von Staub und Rauch und dem Gestank verbrannten Pulvers. Eine Kugel pfiff durch die Takelage; eine zweite peitschte die Wellen, die unter dem Bug der Galeone wild aufschäumten. Das Schiff schien sich aufzubäumen, zu schwanken, sich seitwärts zu neigen. Vom Quarterdeck schrie Don Juan de Narvaez einen Befehl; sein Leutnant stürzte über die Kajütstreppe in den Schiffsrumpf hinab.
Dort warteten die Soldaten in ihren stählernen Brustpanzern und Sturmhauben. Sie waren mit Hellebarden und Spießen bewaffnet, und manche hielten lange zweischneidige Schwerter in Händen. Alle starrten sie aufs Meer hinaus, dorthin, wo das kleinere Schiff, an dessen Mast das rote Georgskreuz flatterte, unbeirrbar seinen Weg auf sie zu nahm. Keiner zweifelte mehr daran, dass es zum Kampf Mann gegen Mann kommen würde; sie waren sogar froh darüber; waren sie nicht die besten Streiter der Christenheit? Was für Aussichten hatten diese Engländer denn gegen sie im direkten Kampf? Das englische Schiff hatte sich während der letzten Stunde außerhalb der Reichweite der spanischen Kanonen gehalten und die Santa Maria unaufhörlich mit seinen weiter reichenden Geschützen unter Feuer genommen. Die Soldaten im Bauch des Schiffes wussten nicht, wie schwer der angerichtete Schaden war, doch waren sie unruhig und wütend über die ihnen aufgezwungene Untätigkeit und das Unvermögen, ins Geschehen einzugreifen. Aber jetzt näherte sich das englische Schiff, dessen weiße Segel sich im Wind blähten und das wie ein Raubvogel durch die schäumenden Wellen auf sie herunterstieß.
Don Juan beobachtete, wie sich das Schiff näherte, wie seine Kanonen Feuer spuckten. Und schon war es da, kaum beschädigt, da die Hälfte der spanischen Kanonen von der hohen Galeone über den Engländer hinwegschossen. Die Venture – jetzt bestand kein Zweifel mehr, dass es die Venture war – nahm unbeirrt ihren Weg.
Bald lag sie längsschiffs und feuerte auf den Rumpf der Galeone, und wieder entkam sie unbehelligt. Dann wurde sie schneller, kreuzte den Weg des Spaniers, und ihre Kanonen wüteten furchtbar.
Die Santa Maria war nur noch ein Wrack, die Mannschaft in Panik und völliger Verwirrung. Don Juan erkannte, dass sein Schiff schwer angeschlagen war, und fluchte leise in seinen Bart. Aber er war besonnen und mutig und wusste, wie er seine Männer um sich scharen konnte. Die Venture hatte wieder Kurs auf die Galeone genommen – jetzt bestand kein Zweifel mehr, dass sie sich zum Entern anschickte. Das gab wieder Hoffnung. Mochte sie nur kommen – die Santa Maria war dem Untergang geweiht, aber auf der Venture befand sich El Beauvallet – Beauvallet, der Spanien verhöhnte, der Freibeuter, der Wahnsinnige! Seine Gefangennahme war den Verlust eines so stolzen Schiffes wie die Santa Maria wert: ja sogar noch mehr! Es gab keinen spanischen Admiral, der nicht davon träumte, Beauvallet in die Hand zu bekommen. Don Juan hielt bei diesem Gedanken den Atem an. Beauvallet, der Spanien unter dem Daumen hielt! Sollte es ihm wirklich gelingen, diesen Mann, dessen Leben vom Satan beschützt wurde, gefangen zu nehmen, dann hatte ihm das Leben alles geboten, was er wollte.
Das war Don Juans Beweggrund gewesen, die Venture anzugreifen, als sie an diesem Nachmittag in sein Gesichtsfeld gekommen war. Er wusste, dass sich El Beauvallet in diesen Gewässern aufhielt; in Santiago hatte er Perinat getroffen, der erst vor vierzehn Tagen ausgezogen war, die Venture zu bestrafen. Er war in seinem eigenen Rettungsboot nach Santiago zurückgekehrt, verzweifelt, ein geschlagener Mann. Er hatte wirr von Hexerei, von einem Teufel in Menschengestalt gesprochen, der alle verhöhnte. Don Juan hatte nur geschnaubt. Dieser Dummkopf Perinat!
Aber jetzt schien es, als liefe auch er Gefahr, seine Sache schlecht zu machen. Er hatte Beauvallet den Fehdehandschuh hingeworfen, ihm, der eine Herausforderung noch nie abgelehnt hatte, und Beauvallet hatte sich gestellt und war mit seinem wendigen Schiff durch das schimmernde Meer auf ihn gestoßen.
Es hatte natürlich auch der Wunsch mitgespielt, einer gewissen Dame zu beweisen, was ein Narvaez konnte. Don Juan biss sich auf die Lippen und fühlte einen Augenblick lang Reue in sich aufsteigen. Unten, in der getäfelten Kajüte, saß kein Geringerer als Don Manuel de Rada y Sylva, der ehemalige Gouverneur von Santiago, mit seiner Tochter Dominica. Don Juan wusste nur zu gut, in welcher Gefahr sich die beiden jetzt befanden. Aber bei einem Nahgefecht würde sich vielleicht noch alles wenden.
Die Soldaten waren bewaffnet und warteten im Rumpf oder auf dem Vorderdeck. Die Kanoniere standen schweißgebadet und schmutzig an den Geschützen; die kurze Panik war vorbei – sollte die Venture nur kommen!
Da war sie auch schon, trotzte dem Feuer aus den großen Geschützen; noch näher kam sie, und durch die Rauchschwaden konnte man die Männer sehen, die mit Enteräxten und Schwertern in den Händen bereitstanden, den Spanier anzugreifen. Dann plötzlich ein Krachen und Kreischen, ein Flammenmeer und der schwarze Rauch aus einem Dutzend Drehkanonen, die vom Deck der Venture auf den Rumpf der Santa Maria feuerten. Die spanischen Soldaten fielen haufenweise; Schreie, Stöhnen und Flüche erfüllten die Luft, und während das Chaos noch andauerte, näherte sich die Venture pfeilschnell und legte an der hohen Galeone an.
Männer kletterten eilig an ihren Seiten hoch, benützten die Enteräxte als Leitern. Von der Sprietsegelrah sprangen sie auf das Deck der Santa Maria hinunter, die Dolche zwischen den Zähnen, die langen Schwerter in den Händen. Die Spanier, schwer getroffen vom andauernden Beschuss, konnten die Engländer nicht halten. Sie drangen wütend auf sie ein, und auf Deck entspann sich ein erbitterter Kampf: Schwert traf auf Schwert, Dolch auf Dolch.
Don Juan stand am oberen Absatz der Kajütstreppe, das nackte Schwert in der Hand, eine hochgewachsene Gestalt in funkelnder Rüstung. Er versuchte, im Getümmel den Anführer der Freibeuter auszumachen, doch blieb sein Bemühen ohne Erfolg.
Es war ein verbissener, erbitterter Kampf über Verwundete und Tote hinweg; immer wieder blitzte Geschützfeuer auf. Das Getöse war unbeschreiblich; im Lärm des Stöhnens, der lauten Befehle, der Schreie und des Waffengeklirrs konnte man nichts mehr unterscheiden; lange Zeit wusste keiner, wer im Vorteil war; der Kampf wogte auf und ab, während die Santa Maria hilflos dahintrieb.
Plötzlich tauchte ein Mann in der Menge auf und bahnte sich den Weg zur Treppe. Einen Augenblick lang blieb er mit einem Fuß auf der ersten Stufe stehen, blickte Don Juan an; er hielt ein bluttriefendes Schwert in der Rechten, hatte den linken Arm mit einem Mantel umwickelt und hielt den Kopf mit dem schwarzen Spitzbart herausfordernd erhoben. Ein ziselierter Helm bedeckte den oberen Teil seines Gesichts, aber Don Juan sah die weißen Zähne in einem höhnischen Lächeln aufblitzen und machte sich zum Stoß bereit, der den Fremden ins Jenseits senden sollte.
»Hinweg, Hund!«, schleuderte er ihm entgegen.
Der Fremde lachte und erwiderte in reinstem Kastilisch:
»Nein, Señor, der Hund kommt zu Euch!«
Don Juan bemühte sich, das Gesicht, das ihm entgegensah, zu erkennen. »Komm herauf und stirb, Hund«, sagte er leise, »denn ich glaube, du bist der, den ich suche.«
»Ganz Spanien sucht mich, Señor«, antwortete der Fremde vergnügt. »Aber wer wird Nick Beauvallet wirklich töten? Wollt Ihr es versuchen?«
Er sprang leichtfüßig die Stufen hinauf, und sein Schwert traf das Don Juans in einer Finte, dass das Schwert des Spaniers zur Seite glitt. Er schwang den Mantel, sodass sich Don Juans Schwert darin verfing. Und wie ein Blitz stand er auch schon auf dem Achterdeck, während Don Juan rasend vor Wut sein Schwert aus den Falten des Stoffes zu befreien versuchte. Die Schwerter trafen klirrend aufeinander, aber Don Juan erkannte sofort, dass er hier seinen Meister gefunden hatte. Er wurde immer mehr an die Reling zurückgedrängt, obwohl er jeden Zollbreit verteidigte.
Cruzada, sein Leutnant, raste vom Hinterdeck herauf. Beauvallet wurde dessen gewahr und beendete den Kampf rasch. Sein Degen sauste in die Höhe und fuhr dann nieder, traf Don Juan an der Schulter und zerschlug die Schulterkappe.
Der Spanier sank halb betäubt in die Knie und ließ seinen Degen klirrend zu Boden fallen. Beauvallet wandte sich keuchend um und trat Cruzada entgegen.
Das Achterdeck war nun voll von englischen Seeleuten, die ihrem Anführer gefolgt waren, und von allen Seiten tönten die Rufe der Spanier um Gnade. Beauvallet hielt Cruzada mit seinem Degen in Schach. »Ergebt Euch, Señor«, sagte er. »Euer Anführer ist mein Gefangener.«
»Ich werde Euch noch töten, Pirat!«, stieß Cruzada hervor.
»Sei nicht so ehrgeizig, mein Kind«, sagte Beauvallet.
»Daw, Russet, Curl! Nehmt diesen Heuschreck fest! Vorsichtig, Burschen, vorsichtig!«
Cruzada erkannte, dass er umzingelt war, und schrie vor Zorn auf. Raue Hände ergriffen ihn von hinten und hielten ihn fest; er sah Beauvallet, der sich auf seinen Degen stützte, und nannte ihn fluchend einen Feigling und eine Memme.
Beauvallet lachte leise vor sich hin. »Lass dir einen Bart wachsen, Knabe, und komm wieder, wenn er gewachsen ist. Mr. Dangerfield!« Sein Leutnant trat zu ihm. »Bewacht mir diesen ehrenwerten Herrn«, sagte Beauvallet und deutete kurz auf Don Juan. Er beugte sich nieder, hob das Schwert des Spaniers auf und war im selben Augenblick auch schon auf dem Weg nach unten, in den Schiffsrumpf.
Don Juan kam langsam wieder zur Besinnung und bemerkte, dass er entwaffnet und Beauvallet fort war. Mühsam erhob er sich, wobei ihn ein Engländer stützte, und sah sich plötzlich einem blonden Jungen gegenüber. »Ihr seid mein Gefangener, Señor«, sagte Richard Dangerfield in gebrochenem Spanisch. »Der Tag ist unser.«
Schweiß perlte über Don Juans Stirn; er wischte ihn fort und erkannte, dass der Engländer recht hatte. Überall legten seine Leute die Waffen nieder. Die Wut und der Schmerz, die ihn gefangen hielten, waren plötzlich wie weggewischt; mit letzten Kräften raffte er sich zusammen, besann sich auf seine Erziehung und blieb aufrecht und unbewegt stehen. Er verbeugte sich leicht. »Ich bin in Euren Händen, Señor.«
Über das Achterdeck liefen die Seeleute auf der Suche nach Beute. Einige wilde Gestalten stiegen lautstark die Kajütstreppe hinunter, die zu den Kabinen führte. Dort bot sich ihnen ein Anblick, der sie in Erstaunen versetzte. Gegen die Wand gepresst, die Hände flach an der Täfelung, stand eine Dame mit elfenbeinfarbenem Teint, rosigen Lippen und schwarzen Haaren, die durch ein goldenes Netz zusammengehalten wurden. Ihre Augen waren dunkel und groß unter schweren Lidern, die Brauen fein geschwungen, die Nase kurz und gerade, die vollen Lippen üppig und einladend. Sie trug ein Kleid aus purpurfarbenem Kamelott, in das ein Muster aus Goldfaden gewoben war, über einem reich bestickten Unterrock. Ihren Nacken umschloss ein mit Bergkristall bestickter Spitzenkragen, der das reizende, liebliche Gesicht rahmte. Ihr Kleid war tief ausgeschnitten, und auf dem weißen Busen lag ein Edelstein, der sich unter ihrem raschen Atem hob und senkte.
Der erste der Eindringlinge blieb einen Augenblick lang erstaunt stehen, fasste sich aber, bevor die anderen zu drängen begannen. »Eine Dirne«, rief er laut lachend aus. »Und was für eine noch dazu!« Seine Kumpane drängten in den Raum, um dieses Wunder zu bestaunen. Die Augen des Mädchens blitzten vor Wut, aber diese Wut war mit Furcht gemischt.
Aus dem hochlehnigen Stuhl am Tisch erhob sich ein Mann in mittleren Jahren, dem das westindische Klima ganz offenkundig böse mitgespielt hatte. Er sah fiebrig aus; seine Augen glänzten allzu hell, und hie und da überlief ihn ein Schauder. Er trug einen langen, pelzgefütterten Mantel, eine Kappe, die den Kopf eng umschloss, und stützte sich auf einen Stock. Neben ihm stand ein Franziskanerpater in schwarzem Habit, den jedoch nichts anderes als sein Rosenkranz interessierte, den er durch die Finger gleiten ließ, wobei er unaufhörlich Gebete murmelte. Der andere schleppte sich mühsam vorwärts und stellte sich vor seine Tochter, um sie vor den gierigen Blicken zu schützen. »Ich verlange, vor Euren Kapitän geführt zu werden«, sagte er auf Spanisch. »Ich bin Don Manuel de Rada y Sylva, der ehemalige Gouverneur der Insel Santiago.«
Die englischen Seeleute verstanden wahrscheinlich nichts von seinen Worten. Einige von ihnen drängten sich vor und schoben Don Manuel beiseite. »Verschwind, Graubart!«, riet ihm William Hick und hob mit seiner schmutzigen Hand das Gesicht des Mädchens hoch. »Ein hübsches Ding. Gib mir einen Kuss, Mädchen!«
Stattdessen ertönte das scharfe Klatschen einer Ohrfeige. William Hick fuhr betroffen zurück und hielt sich die Wange. »Was, eine Beißzange ...«
John Daw ergriff das Mädchen und presste es an sich, wobei er mit seinen riesigen Pratzen ihre Arme festhielt. »Langsam, mein Herz, langsam«, kicherte er und gab ihr einen schallenden Kuss. »So macht man das, Burschen!«
Don Manuel, der von zwei Seeleuten gehalten wurde, rief verzweifelt: »Lasst sie los! Euren Kapitän! Ich verlange, Euren Kapitän zu sprechen!«
Sie verstanden die letzten Worte, die sie etwas ernüchterten. »Na gut, bringen wir sie vor den General. Das ist sicherer.« John Daw stieß William Hick beiseite, der den Anhänger am Hals des Mädchens umklammert hielt. »Lass sie los! Willst du denn, dass dich der verrückte Nick erwischt? Komm, Mädchen, auf Deck mit dir!«
Man schob das widerstrebende Mädchen zur Tür. Sie wusste nicht, was man mit ihr vorhatte, und wehrte sich heftig gegen die Hände, die sie vorwärts zogen, doch mit wenig Erfolg. »Verdammtes Luder!«, knurrte Hick, dessen Wange noch immer von der Ohrfeige brannte, die er empfangen hatte. Er hob sie hoch und trug sie die Leiter zum Hüttendeck empor.
Dort standen schon andere Seeleute, die das Erscheinen dieser wütenden, verstörten Frauensperson mit Erstaunen und Spott vermerkten. Hick setzte sie ab, und sie fiel sofort wie eine Wildkatze über ihn her. Sie überhörte die warnenden Rufe ihres Vaters, den seine Wächter ebenfalls auf Deck gebracht hatten, und schlug auf Hick ein, trampelte auf seinen großen Füßen herum und zerkrallte das bärtige Gesicht mit ihren Nägeln. Wieder ergriff man sie und hielt sie fest, und die beiden grinsenden Seeleute zu ihren Seiten umklammerten ihre Fäuste. Einer fasste sie unters Kinn und brach in dröhnendes Gelächter aus, als sie den Kopf wütend hochwarf. »Kleines Täubchen, sanftes Kätzchen ...« bemerkte John Daw sarkastisch.
Die Seeleute drängten sich um das Mädchen, erstaunt, spöttisch, und weideten sich an ihrem Anblick – mit schmatzenden Lippen, vielsagendem Augenzwinkern und schmutzigen Bemerkungen. Sie begann zu zittern.
Da ertönte plötzlich eine gebieterische Stimme aus der Menge, die sie umgab. »Zur Hölle! Was soll das? Macht Platz!«
Zwei Seeleute taumelten unter der Wucht des eisernen Griffes an ihren Schultern zur Seite. Das Mädchen blickte erschrocken auf und direkt in das Gesicht El Beauvallets.
Er hatte den Helm abgenommen, und sie sah sein krauses schwarzes Haar, das sich eng an den Kopf legte, und die blauen Augen – so blau wie das Meer im Sonnenschein. Es waren wache, fröhliche Augen, scharf und aufmerksam, und doch mit einem Ausdruck der Sorglosigkeit.
Sie blickten noch immer fröhlich, als er erstaunt stehen blieb. Er starrte das Mädchen an; dann hob er ungläubig die Brauen; Sir Nicholas Beauvallet schien seinen Augen nicht zu trauen und das Bild, das sich ihm bot, für ein Fantasiegebilde zu halten.
Mit raschem Blick erfasste er jede Einzelheit, und das Lachen schwand aus seinen Augen. Er handelte rasch, zu rasch für Hick, der noch immer das Handgelenk des Mädchens festhielt. Seine Faust traf Master Hick direkt am Kinn und sandte ihn in weitem Bogen zu Boden. »Schurken! Dummköpfe!«, schrie Beauvallet mit wütender Stimme und wandte sich um, um John Daw dasselbe Schicksal zuteilwerden zu lassen.
Aber Master Daw hatte das Handgelenk schon losgelassen und das Weite gesucht.
Beauvallet wandte sich an die Dame: »Ich bitte tausendmal um Vergebung, Señora!«, sagte er, als wäre nichts Besonderes geschehen.
Die Dame konnte nichts anderes als sich einzugestehen, dass ein gut aussehender junger Mann mit einem unwiderstehlichen Lächeln vor ihr stand. Mühsam verbiss sie sich ein Lächeln; einem englischen Piraten konnte man doch nicht freundlich gegenübertreten. »Lasst meinen Vater los, Señor!«, befahl sie hochmütig.
Ihr Tonfall schien Beauvallet zu erheitern; er schüttelte sich vor Lachen. Er blickte sich nach dem Vater der Dame um und sah ihn zwischen den beiden Wächtern stehen, die ihn aber eiligst losließen und verlegen zurücktraten.
Don Manuel zitterte und war aschfahl. Er verlangte nochmals atemlos: »Ich verlange, den Kapitän zu sprechen!«
»Ich bitte tausendmal um Vergebung«, wiederholte Beauvallet. »Ihr steht vor dem Kapitän, Nicholas Beauvallet, zu Euren Diensten.«
Das Mädchen schrie auf. »Ich wusste es ja! Ihr seid El Beauvallet!«
Beauvallet drehte sich wieder zu dem Mädchen um, zog die Brauen hoch und blitzte sie fröhlich an. »In Person, Señora. Und ganz zu Euren Füßen.«
»Ich«, unterbrach ihn Don Manuel mit eisiger Höflichkeit, »bin Don Manuel de Rada y Sylva. Ihr steht vor meiner Tochter, Doña Dominica. Ich verlange, den Grund dieser Freveltaten zu erfahren.«
»Freveltaten?«, wiederholte Beauvallet ehrlich erstaunt. »Was für Freveltaten?«
Don Manuel wurde rot vor Zorn und zeigte mit zitternder Hand auf das verwüstete Schiff. »Das fragt Ihr noch, Señor?«
»Ach so, der Kampf! Um der Wahrheit die Ehre zu geben, mein verehrter Herr, stand ich unter dem Eindruck, dass dieses Schiff auf mich das Feuer eröffnet hat«, meinte El Beauvallet freundlich. »Und ich habe noch nie eine Herausforderung abgelehnt.«
»Wo«, wollte Doña Dominica wissen, »ist Don Juan de Narvaez?«
»Er wird so lange unter Deck bewacht, bis er von Bord gehen wird.«
»Ihr habt ihn besiegt? Mit diesem kleinen Schiff?«
Beauvallet lachte laut auf. »Ich, mit meinem kleinen Schiff«, verbeugte er sich.
»Und was wird mit uns?«, unterbrach ihn Don Manuel.
Sir Nicholas sah ihn zerknirscht an. »Das ist allerdings ein Problem, Señor«, gab er zu. »Was, zum Teufel, tut Ihr auch auf diesem Schiff?«
»Ich glaube nicht, dass Euch das etwas angeht, Señor. Wenn Ihr es aber unbedingt wissen wollt, so erfahrt, dass ich von Santiago heim nach Spanien reise.«
»Welch ein Missgeschick«, erklärte El Beauvallet mitfühlend. »Und welch ein Einfall Eures Kommandanten, einen Kampf mit mir anzuzetteln!«
»Don Juan tat nur seine Pflicht, Señor!«, sagte Don Manuel hoheitsvoll.
»Wie traurig, dass Edelmut so schlechten Lohn findet«, sagte Sir Nicholas leichthin. »Und was soll ich mit Euch tun?« Er nagte an seinem Finger und überlegte. »Natürlich besteht die Möglichkeit, dass Ihr im Rettungsboot mitfahrt. Es wird so bald wie möglich ablegen und Kurs auf die Insel Dominica nehmen. Sie liegt ungefähr drei Meilen nördlich von uns. Wollt Ihr mitfahren?«
Doña Dominica trat rasch vor. Seit ihre Angst sich gelegt hatte, wuchs ihr Zorn. Das leichtfertige Benehmen Beauvallets war ihr unerträglich. Unbeherrscht stieß sie hervor: »Ist das alles, was Ihr sagen könnt, Seeräuber? Verhasster Pirat! Bedeutet es gar nichts für Euch, dass wir wieder zurück und vielleicht Monate auf das nächste Schiff warten müssen? Aber nein, Euch sagt das nichts! Ihr seht, dass mein Vater krank ist, aber es macht Euch nichts aus, ihn so zu misshandeln. Niedrige, abscheuliche Kreatur! Was schert es Euch? Gar nichts. Anspucken möchte ich Euch, Ihr elender englischer Freibeuter!« Sie schluchzte vor Wut und stampfte mit dem Fuß.
»Guter Gott!«, stieß Beauvallet hervor und blickte entgeistert auf die reizenden, jetzt vor Wut verzerrten Züge. Ein Lächeln der Erheiterung und Bewunderung überzog sein Gesicht. Daraufhin verlor Doña Dominica den letzten Rest ihrer Selbstbeherrschung. So war sie eben. Sie schlug nach ihm, und er fasste nach ihrer Hand, zog sie an sich und sah ihr augenzwinkernd ins Gesicht. »Vergebt mir, Señora. Wir werden alles wiedergutmachen.« Er wandte sich um und rief dröhnend nach seinem Leutnant.
»Lasst mich los«, sagte Dominica und versuchte, ihre Hand fortzuziehen. »Lasst mich los!«
»Wenn ich das täte, würdet Ihr mich kratzen«, erwiderte er spöttisch. Es war unerträglich. Sie senkte den Blick, der auf den Dolch in seinem Gürtel fiel. »Tapferes Mädchen!« Er ließ sie los, bot ihr den Dolch und breitete die Arme weit aus. »Kommt! Versucht's!«
Sie trat einen Schritt zurück, unsicher und verwirrt. Was war das für ein Mann, der vor ihr stand und über den Tod spottete? »Wenn Ihr mich anrührt, werde ich Euch töten!«, stieß sie hervor.
Doch er trat wieder auf sie zu, forderte ihren Mut heraus. Sie wich zurück, bis die Reling sie aufhielt.
»Stoßt zu«, forderte Beauvallet sie auf. »Ich bin sicher, dass Ihr Mut genug habt.«
»Meine Tochter!«, fuhr Don Manuel entsetzt dazwischen. »Gib sofort dieses Messer zurück. Ich befehle es! Señor, seid so freundlich und tretet zurück!«
Beauvallet drehte sich um. Es schien, als denke er überhaupt nicht mehr an die Dame, die eine so gefährliche Waffe in der Hand hielt. Er hakte die Daumen in den Gürtel und blieb lässig stehen, bis Dangerfield auf ihn zutrat.
»Sir, Ihr habt mich gerufen?«
Beauvallet wies mit großer Geste auf Don Manuel und dessen Tochter. »Bringt Don Manuel de Rada y Sylva und seine Tochter auf die Venture«, sagte er auf Spanisch.
Don Manuel fuhr zusammen; Dominica schrie auf. »Verspottet Ihr uns, Señor?«, wollte Don Manuel wissen.
»Warum in Gottes Namen sollte ich spotten?«
»Ihr nehmt uns also gefangen?«
»Nein, ich lade Euch ein, meine Gäste zu sein. Ich habe gesagt, dass ich alles wiedergutmachen werde.«
Das Mädchen geriet wieder in Wut. »Ihr spottet über uns! Wir werden nicht auf Euer Schiff gehen. Auf keinen Fall!«
Beauvallet stemmte die Hände in die Hüften. Wieder zog er die Brauen hoch. »Was soll das? Zuerst wollt Ihr, und dann wollt Ihr wieder nicht? Ihr heißt mich eine Kreatur, weil ich es Euch unmöglich mache, nach Spanien zurückzukehren, und verflucht mich und nennt mich einen Schurken. Ich habe versprochen, meinen Fehler wiedergutzumachen: Ich werde Euch so rasch wie möglich nach Spanien bringen. Was habt Ihr also?«
»Uns nach Spanien bringen?«, wiederholte Don Manuel verständnislos.
»Das könnt Ihr nicht!«, rief Dominica ungläubig. »Das wagt Ihr nicht!«
»Ich soll es nicht wagen? Bei Gott, ich bin doch Nick Beauvallet!«, erklärte Sir Nicholas verwundert. »Bin ich nicht voriges Jahr in Vigo eingelaufen und habe alles verwüstet? Wer sollte mich daran hindern?«
Sie hob die Hände, und der Dolch blitzte im Sonnenlicht auf. »Jetzt verstehe ich, warum sie Euch den verrückten Beauvallet nennen!«
»Da irrt Ihr«, unterbrach sie Beauvallet spöttisch. »Man nennt mich den verrückten Nick. Ich würde mich freuen, wenn auch Ihr mich so nennt, Señora.«
Don Manuel mischte sich ein. »Señor, ich verstehe Euch nicht. Ich kann nicht glauben, dass ihr ernst meint, was Ihr sagt.«
»Señor, es ist mir sehr ernst damit. Ist Euch das Wort eines Engländers gut genug?«
Don Manuel wusste keine Antwort darauf. Es blieb seiner Tochter vorbehalten, ein heftiges »Nein« hervorzustoßen. Aber die Antwort darauf war nichts als ein flüchtiger Blick und ein kurzes Auflachen.
In diesem Augenblick kam Don Juan de Narvaez auf sie zu, hoheitsvoll sogar noch als Unterlegener. Er verbeugte sich tief vor Don Manuel, noch tiefer vor Doña Dominica, und übersah Beauvallet völlig. »Señor, das Boot wartet. Erlaubt mir, Euch zu begleiten.«
»Steigt ein, Señor Punctilio«, sagte Sir Nicholas. »Don Manuel segelt mit mir.«
»Nein«, sagte Dominica. Aber dieses Nein war ein klares Ja.
»Ich sehe keinen Anlass, auf Eure Späße einzugehen, Señor«, bemerkte Don Juan kühl. »Don Manuel de Rada kommt selbstverständlich mit mir.«
Mit einer Handbewegung winkte Beauvallet dem Wächter. »Führt Don Juan zum Beiboot.«
»Ich weiche keinen Schritt, wenn mich Don Manuel und seine Tochter nicht begleiten«, unterbrach ihn Narvaez mit heldischer Pose.
»Bringt ihn weg«, gähnte Sir Nicholas gelangweilt. »Gute Fahrt, Señor.« Der widerstrebende Narvaez wurde weggeführt. »Señora, begleitet mich bitte an Bord der Venture. Diccon, kümmere dich sofort um ihr Gepäck!«
Dominica wehrte sich, doch mehr, um die Wirkung ihrer Worte zu erproben. »Ich komme nicht«, stieß sie hervor und umklammerte den Dolch. »Wagt es, wenn Euch Euer Leben lieb ist!«
»Ihr fordert mich heraus?«, fragte Beauvallet. »Wie unvorsichtig! Ich habe Euch doch gesagt, dass ich eine Herausforderung nie ablehne.« Er trat auf sie zu und wehrte lachend den Dolch ab, ergriff ihr Handgelenk und fasste sie fest um die Taille. »Ergebt Euch, meine Schöne«, sagte er und nahm ihr den Dolch aus der Hand, den er wieder in die Scheide steckte. »Kommt!«, rief er, hob sie hoch und trug sie über das Deck. Dominica wehrte sich nicht. Sie wusste, dass es sinnlos war und dass nur ihre Würde darunter leiden würde. Sie ließ sich gern auf diese Weise forttragen. In Spanien benahm man sich ganz anders. Der Arm, der sie hielt, war stark und fest, und die Sorglosigkeit dieses Mannes faszinierte sie. Ein seltsamer, verrückter Mensch, mit einer ganz eigenartigen Offenheit. Man musste ihn näher kennenlernen.
Er trug sie nach unten, wo die Seeleute gerade die Waren aufnahmen – chinesische Seiden, Leinen, Goldbarren, Silberbarren und Gewürze. »Räuber!«, sagte Dominica leise.
Er lachte. Es war aufreizend. Dann ging er mit ihr zur Reling, und sie fragte sich, was er nun tun würde. Leichtfüßig sprang er hinauf, blieb sekundenlang stehen und rief: »Willkommen an Bord der Venture, meine Teure!« Dann kletterte er, sie noch immer in den Armen haltend, hinunter auf das Deck seines eigenen Schiffes.
Sprachlos und verwirrt sah sie um sich und bemerkte, wie man ihrem Vater behutsam die Seiten der hochragenden Galeone herunterhalf. Don Manuel schien verwirrt, aber auch erheitert zu sein.
»Gebt ihnen ein gutes Quartier, Diccon«, befahl Beauvallet dem blonden Jungen und ging dorthin zurück, wo er hergekommen war.
»Wollt Ihr mir bitte folgen, Señora?«, stieß Dangerfield scheu hervor und verbeugte sich vor ihnen. »Eure Truhen werden bald hier sein.«
Don Manuel lächelte schief. »Entweder ist dieser Mensch verrückt – oder – oder ein seltsamer, schrulliger Bursche, meine Tochter. Aber das werden wir zweifellos bald erfahren.«
Kapitel 2
Doña Dominica wurde unter Deck geführt und in eine geräumige Kabine gebracht, die wahrscheinlich bis vor wenigen Augenblicken Master Dangerfield gehört hatte. Dort blieb sie allein zurück, während Dangerfield ihren Vater in eine andere Kabine führte. Sie sah sich um, und was sie sah, gefiel ihr – die dunklen, eichengetäfelten Wände, die gepolsterte Sitzbank unter dem Bullauge, der Tisch mit den geschnitzten Beinen, der Klappstuhl, die schöne flandrische Truhe und der Schrank an der Schotte.
Da klopfte es leise an der Tür. Sie rief »Herein!«, worauf ein kleiner Mann mit einer vorwitzigen Nase und kühn gelocktem Schnurrbart seinen Kopf durch die Tür steckte. Doña Dominica betrachtete ihn schweigend. Ein Paar listige graue Augen sahen sie missbilligend an. »Erlaubt mir, Eure Truhen hereinzutragen, Señora«, sagte der Ankömmling in tadellosem Spanisch. »Und Eure Zofe ist auch hier.«
»Maria!«, rief Dominica freudig aus.
Die Tür wurde aufgestoßen, und eine rundliche Frau lief, weinend und lachend vor Freude, auf sie zu. »Señorita – es ist Euch nichts geschehen!« Sie tätschelte Dominica die Hand und küsste sie mehrmals.
»Wo warst du denn die ganze Zeit?«, fragte Dominica.
»Sie haben mich in die Kabine eingesperrt, Señorita. Miguel de Vasso hat das getan. Geschieht ihm recht, dass er einen Hieb auf den Schädel bekommen hat. Und Ihr?«
»Mir ist nichts geschehen«, erwiderte Dominica. »Aber was mit uns werden wird, weiß ich nicht. Die Welt ist durcheinandergeraten –.«
Der schnauzbärtige Mann trat wieder ein; seine schmächtige Gestalt war in einen Anzug aus dunkelbraunem Tuch gekleidet. »Fürchtet Euch nicht, Señora«, erklärte er munter. »Ihr seid auf der Venture, und wir tun Frauen nichts zuleide. Beim Wort eines Engländers!«
»Wer seid Ihr?«, fragte Dominica.
»Ich«, erklärte der Mensch und blähte sich vor Wichtigkeit, »bin kein Geringerer als Joshua Dimmock, der Kammerdiener von Sir Nicholas Beauvallet. Zu Euren Diensten. Ihr dort! Bringt das Gepäck herein!« Sein Ruf hatte irgendjemandem auf dem Gang gegolten. Wenige Augenblicke später erschienen zwei schwerbeladene Jungen und ließen ihre Bürde auf den Boden niederfallen. Sie zögerten und starrten die Dame mit offenem Mund an, aber Joshua winkte sie fort. »Weg mit euch, ihr Dummköpfe!« Er drängte sie hinaus und schloss die Tür. »Wenn's Euch beliebt, edle Dame, lasst mich nur machen.« Er betrachtete sinnend den Berg von Truhen und Koffern, legte einen Finger an die Nase, trat dann an den Schrank und stieß ihn auf. Er war voll von Master Dangerfields Kleidungsstücken, was Maria mit einem lauten Kichern quittierte. Joshua tauchte in den Schrank hinein, erschien wieder mit einem Armvoll Wämser und Strümpfe und warf sie in hohem Bogen auf den Gang. »He, ihr da! Räumt diesen Kram fort!«, befahl er, und die zwei Frauen hörten, wie sich Schritte näherten. Joshua beugte sich wieder in den Schrank, räumte ihn völlig aus und warf auch die Stiefel und Pantoffeln, die ordentlich aufgereiht waren, aus der Kabine. Dann trat er zurück und betrachtete den neu geschaffenen Raum mit Stolz. »Gut so!« Sein Blick fiel auf die Truhe; er öffnete den Deckel, schnalzte ungeduldig mit der Zunge und ging hurtig ans Werk.
Dominica ließ sich auf der Fensterbank nieder, um die erstaunlichen Verrenkungen Master Dimmocks in Ruhe zu betrachten. Maria kniete an ihrer Seite, hielt ihre Hand noch immer in der ihren fest und kicherte leise vor sich hin. Im Gang hörte man eine entrüstete Stimme: »Wer hat denn alles hierhergeworfen! Dieser unverschämte Esel Dimmock! Joshua Dimmock, die Pest über dich! Master Dangerfields feines Leinen liegt hier im Staub! Komm heraus, du verhungerte Kröte!«
Joshua tauchte wieder auf, beladen mit Hemden und Unterkleidung. Die Tür wurde aufgerissen, und Master Dangerfields Diener stürzte in den Raum, wurde aber von Joshua aufgehalten, der ihm den Weg vertrat, ihm einen Stapel Kleider in die Arme warf und ihn dann wieder hinausdrängte. „Fort mit dir, du Narr! Diese Kabine gehört jetzt der edlen Dame! Auf Befehl des Generals! Sei überhaupt still, du Esel. Was ist mit deinem venezianischen Leinen, was soll denn das? Räum endlich hier auf! Und heb diese Manschetten, die Stiefel, die Strümpfe auf! Außerdem liegen da noch mehr Hemden herum! Warte auf mich!« Er kam zurück, machte eine weitausladende Geste und hob dann bedeutungsvoll die Achseln. »Schenkt ihm keine Beachtung, Señora. Ein dummer Narr! Master Dangerfields Diener. Aber wir werden alles gleich in Ordnung bringen.«
»Ich vertreibe Master Dangerfield ungern aus seiner Kabine«, bemerkte Dominica. »Gibt es denn keine andere, wo man mich unterbringen könnte?«
»Edle Dame! Verschwendet keinen Gedanken daran!«, unterbrach sie Joshua schockiert. »Master Dangerfield, wer ist denn das schon! Ein netter Herr, aber doch noch ein Grünschnabel, kaum seiner Amme entwachsen. So viele Gewänder! Aber diese jungen Männer sind ja alle gleich! Mindestens ein Dutzend Hemden! Sir Nicholas selbst besitzt deren nicht so viele!« Er warf den Rest von Master Dangerfields Gewändern aus der Kabine und schloss die Tür vor dem entrüsteten Diener.
Dominica sah ihm zu, wie er ihre Habe einräumte. »Ihr seid sicher ein sehr bedeutender Mann«, sagte sie mit leichter Ironie.
»Das stimmt, Señora, das stimmt. Ich bin der Diener von Sir Nicholas. Mir hört man zu, mir gehorcht man. Das ist so, wenn man der Diener eines bedeutenden Mannes ist«, bemerkte Joshua voll Überzeugung.
»Ist denn Sir Nicholas Eurer Meinung nach ein bedeutender Mann?«
»Es gibt keinen größeren als ihn, meine Dame«, antwortete Joshua wie aus der Pistole geschossen. »Ich diene ihm schon seit fünfzehn Jahren und habe keinen besseren gefunden. Und ich kenne die Welt, glaubt mir. Wir sind schon viel herumgekommen. Ich muss zugeben, dass Sir Francis Drake auch nicht übel ist, aber ihm fehlt es eben an den Dingen, in denen wir ihm überlegen sind. Seine Abstammung kommt der unseren nicht gleich. Und Raleigh? Ha, er ist nicht witzig; wir lachen über sein saures Gesicht. Howard? Darüber schweige ich lieber und lasse Euch selber ein Urteil bilden. Und dieser Hampelmann Leicester? Er fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Wir, und wir allein, haben noch nie einen Misserfolg verzeichnet. Und warum, das frage ich Euch? Ganz einfach, Señora: Wir sind, ›unverzagt‹. Das hat Ihre Majestät, die Königin, mit eigenem Mund gesagt. ›Zur Flölle!«, sagte sie – ihr Lieblingsfluch, müsst Ihr wissen –, ›zur Hölle, Sir Nicholas, Ihr solltet ›unverzagt‹ als Euer Motto nehmen!‹ Mit gutem Grund, edle Dame, wir verzagen wirklich nie. Wir werfen jedem, der es so haben will, den Fehdehandschuh hin. Wir nehmen uns, was wir wollen: Das ist so Beauvallets Art!«
Maria rümpfte die Nase. Joshua sah sie streng an. »Merkt Euch, Mistress: Das gilt für uns beide: unverzagt!«
»Er ist ein kühner Mann«, sagte Dominica halb zu sich selbst.
Joshua blickte sie wohlwollend an. »Da habt Ihr recht, Señora. Kühn, ja! Wie ein Panther! Angst verlachen wir. Das ziemt sich nur für niedrige Menschen. Wenn's Euch beliebt, werde ich jetzt diese Bündel aufschnüren.«
»Wer ist er? Woher stammt er?«, fragte Dominica. »Ist er ein Edelmann oder ein Gemeiner?«
Joshua legte seine ganze verletzte Würde in seinen Blick. »Würde ich einem Mann von niedriger Herkunft dienen, Señora? Nein! Wir sind von sehr edler Abstammung. Wir brauchen nicht zum Ritter geschlagen zu werden, um uns Würde zu verleihen. Eine Ehre, die uns nach unserer Reise um die Welt, die wir mit Drake machten, zuteilwurde. Es stand uns zu, war aber nicht notwendig. Sir Nicholas erbt den Titel eines Barons, nicht mehr und nicht weniger.«
»Ach ja?«, fragte Dominica interessiert.
»Ja, meine Dame. Er ist der Bruder von Lord Beauvallet. Ein gesetzter Mann, Señora, dem vielleicht unser sprühender Geist abgeht, aber ein kluger, freundlicher Herr. Ihm ist das Herumtreiben auf hoher See gar nicht recht.« Einen Augenblick lang vergaß Joshua seine Rolle als treuer und bewundernder Diener. »Und damit hat er auch recht! Immer in der ganzen Welt auf und ab, nirgendwo zu Hause – das schickt sich nicht. Wir sind ja kein kleiner Knabe mehr, der sich die Zeit mit verrückten Plänen und gefährlichen Abenteuern vertreibt. Aber was soll man tun? Wir sind wie besessen: Wir können es nicht lassen, überall die Gefahr aufzuspüren.« Er rollte die Schnüre auf, die er von den Bündeln gelöst hatte. »Ich verlasse Euch jetzt, Señora! Ah! Wir legen ab!« Er stürzte ans Bullauge und sah hinaus. »Gerade rechtzeitig; das andere Schiff sinkt schon. Ich werde jetzt nachsehen, wie man Euren edlen Vater untergebracht hat. Wenn Ihr gestattet, Señora.«
»Wo ist mein Vater?«, fragte Dominica.
»Ganz nahe. Ihr könnt an diese Wand klopfen, und er wird Euch hören. Mistress«, er sah Maria streng an, »kümmert Euch um die edle Dame!«
»Was für eine Frechheit!«, rief Maria. Aber die Tür hatte sich schon hinter Joshua Dimmock geschlossen.
»Ein seltsamer Narr«, sagte Dominica. »Aber wie der Herr, so der Diener.« Sie ging zum Bullauge, erhob sich auf die Zehenspitzen und sah hinaus. Die Wogen zischten die Seiten der Venture entlang. »Ich kann unser Schiff nicht mehr sehen. Der Mann hat behauptet, dass es sinkt.« Sie trat wieder zurück. »Jetzt sind wir also auf einem englischen Schiff und in der Hand des Feindes. Was wird nur aus uns werden?« Aber diese Frage schien ihr keine Sorgen zu bereiten.
»Sie sollen es nur wagen, Euch anzurühren!«, sagte Maria und stemmte die Arme in die Hüften. »Zweimal sperrt man mich nicht in meine Kajüte ein, Señorita!« Sie ließ von ihrer kriegerischen Haltung ab und begann, das Gepäck ihrer Herrin auszupacken. Sie schüttelte ein Kleid aus scharlachrotem Brokat aus und seufzte auf. »Schade um das schöne Kleid. Ihr hättet es heute Abend tragen sollen!«, jammerte sie.
Dominica lächelte verschmitzt. »Ich werde es auch tragen«, sagte sie.
Maria starrte sie an. »Euer schönstes Kleid wollt Ihr für einen englischen Piraten verschwenden? Wenn es Don Juan wäre –«
Dominica fuhr ungeduldig auf. »Don Juan! Ein Narr! Ein geschlagenes Großmaul! Wie ein Hahn ist er herumstolziert und hat geschworen, dieses Schiff auf den Meeresgrund zu schicken und den großen Beauvallet als Gefangenen nach Spanien zu führen. Ich hasse Männer, die sich besiegen lassen. Leg das Kleid zurecht, Mädchen. Ich werde es tragen. Und dazu die Rubine!«
»Sagt das nicht, Señorita!«, schrie Maria in ehrlicher Furcht auf. »Ich habe die Juwelen sicher in meinem Kleid versteckt. Sie würden sie Euch vom Hals reißen!«
»Die Rubine!«, wiederholte Dominica. »Wir sind hier als Gäste El Beauvallets, und wir werden diese Rolle mit allem Anstand spielen.«
Es klopfte leise an der Tür, und Don Manuel trat ein. »Nun, mein Kind?«, fragte er und blickte anerkennend um sich.
Doña Dominica wies auf den Raum und ihre Habe. »Wie Ihr seht, Señor, geht es mir gut. Und Euch?«
Er nickte und setzte sich neben sie. »Sie haben uns wirklich bequem untergebracht. Gerade eben gibt ein seltsames Individuum meinem Diener Befehle. Er behauptet, der Diener El Beauvallets zu sein. Ich verstehe diese englischen Diener nicht und weiß nicht, wieso sie sich so viel herausnehmen können. Dieser Mensch spricht ohne Unterlass.« Er zog seinen Rock zurecht. »Wir müssen uns mit einer unerwarteten Situation abfinden«, klagte er und sah seine Tochter ernst an. »Der Kommandant hat uns zum Abendessen eingeladen. Wir dürfen nicht vergessen, Dominica, dass wir uns als Gäste auf diesem Schiff befinden.«
»Nein«, bemerkte Dominica zögernd.
»Wir werden Sir Nicholas freundlich gegenübertreten«, fuhr Don Manuel fort.
»Ja, Señor«, erklärte Dominica, mit noch mehr Zögern in der Stimme.
Eine Stunde später stand Joshua wieder an ihrer Tür. Er meldete, dass angerichtet sei, und begleitete sie mit vielen Verbeugungen den Gang hinunter zur großen Kabine. Sie schritt wie eine Königin einher; die Rubine glänzten und funkelten an ihrem Hals. Das Dunkelrot ihres Kleides ließ ihre Haut noch weißer erscheinen; sie trug einen Fächer aus Federn in der Hand, und hinter ihrem Kopf prangte eine hohe, juwelenübersäte Spitzenkrause.
Die Kabine war niedrig und wurde von zwei Lampen erhellt, welche an Ketten von den starken Deckenbalken hingen. Auf der Wand gegenüber der Tür hing ein Wappen mit einem Schräglinksbalken, unter dem die Devise »Sans Peur« zu lesen war.
Der Tisch stand in der Mitte des Raumes, umgeben von hochlehnigen spanischen Stühlen. Neben einem dieser Stühle wartete Master Dangerfield, herausgeputzt mit einem abgesteppten seidenen Wams und den so modischen venezianischen Hosen. Er verbeugte sich, errötete, als er Dominica sah, und bemühte sich eifrig, ihren Stuhl zurechtzurücken.
Mit Dangerfield hatte es keinen Zwist gegeben; sie lächelte ihn an und machte ihn damit augenblicklich zu ihrem Sklaven, während sie sich setzte und gelangweilt ihren Fächer bewegte.
Plötzlich ertönte vor der Tür eine fröhliche, sonore männliche Stimme. Man wusste es immer, wenn sich Sir Nicholas Beauvallet näherte.
Er kam herein, offensichtlich im Begriff, einen Witz zu erzählen, und führte Don Manuel mit sich.
Dominica sah ihn unter gesenkten Augenlidern an. Sogar in seiner verbeulten Rüstung, mit schweißnassem Haar und pulvergeschwärzten Händen war er ihr anziehend erschienen. Jetzt trat er ganz anders auf.
Er trug ein purpurfarbenes Wams, geschlitzt und gefüttert, dessen weite, ebenfalls geschlitzte Ärmel das bestickte Leinenhemd sehen ließen. Ein hoher Kragen, der mit einer schmalen, gestärkten Krause besetzt war, umschloss seinen Hals. Sein Bart war klein und spitz und so schwarz wie sein kurzes Haar. Er trug französische Pluderhosen, die sich über den Hüften wölbten, Strümpfe, die in England allgemein als »Leicester-Strümpfe« bekannt waren, da nur ein Mann mit so eleganten Beinen wie Lord Leicester sie tragen konnte. Seine Schuhe waren mit Rosetten verziert, und unter den Knien trug er reich mit Silberspitzen besetzte geknüpfte Strumpfbänder. Von den Handgelenken fielen feine Spitzenmanschetten; sein Zeigefinger war mit einem Ring geschmückt, und um den Hals baumelte eine goldene Kette, an der eine stark duftende Ambrakugel hing.
Er betrat den Raum, und sein Blick fiel sofort auf Dominica. Er verbeugte sich tief und lächelte – jungenhaft und rasch, ansteckend.
»Nun, Señora? Hat mein Bursche alles für Euch besorgt? Einen Stuhl für Don Manuel! Diccon!« Sir Nicholas Beauvallet schien den ganzen Raum mit seiner starken Persönlichkeit auszufüllen.
»Ich schäme mich dafür, dass ich mir Señor Dangerfields Kabine angeeignet habe«, sagte Dominica und lächelte den Genannten gewinnend an.
Er wehrte stotternd ab. Es wäre ihm eine Ehre, eine Auszeichnung. Dominica übersah Beauvallet, der den Ehrenplatz eingenommen hatte, geflissentlich, und widmete sich ausschließlich Dangerfield, wobei sie alle ihre Reize einsetzte, ihn für sich zu gewinnen. Schwer fiel ihr diese Aufgabe nicht: Der junge Mann blickte sie unausgesetzt mit scheuer Bewunderung an.
»Ein seltsamer, spaßiger Bursche hat alles für uns getan, Señor«, sagte sie. »Ich muss mich entschuldigen: Ich war es nicht, die Eure Kleidung auf den Gang werfen ließ. Ich hoffe, dass der Herr nicht so wütend wie der Diener war!«
Dangerfield lächelte. »Aye, das wird Joshua gewesen sein, Señora. Mein Diener ist ein Narr, ein Tölpel. Er ist zornig auf Joshua. Ihr dürft nicht vergessen, dass Joshua ein Original ist, Señora. Ich bin überzeugt, dass er Euch gegenüber mit Sir Nicholas' Taten geprahlt hat – er nennt sich immer in einem Atem mit seinem Herrn!«
Dazu wusste Dominica nichts zu sagen. Dangerfield fuhr fort: »So ist er eben, aber er ist auch der Einzige unter uns, der es wagt, seinen Herrn zu tadeln. Allen anderen gegenüber stellt er Sir Nicholas gleich nach Gott; Sir Nicholas aber sagt –« Er brach ab und warf seinem Kommandanten einen fragenden Blick zu.
Sir Nicholas wandte den Kopf; Dominica hatte nicht gedacht, dass er ihnen zuhören würde. »Ja, zu Sir Nicholas sagt er Dinge, die Sir Nicholas' Würde verletzen würden, wiederholte man sie«, meinte Beauvallet lächelnd. Dann wandte er sich wieder an Don Manuel, der mitten im Satz abgebrochen hatte.
»Euer Diener scheint ihn nicht so zu schätzen, wie er selbst es tut, Señor«, sagte Dominica.
»O nein, Señora, aber schließlich hat er ja auch meine Kleider in den Gang geworfen.«
»Wahrscheinlich war es dort schmutzig«, sagte Dominica.
»Lasst das ja nicht Sir Nicholas hören, Señora«, meinte Dangerfield erheitert.
Das kleine Lächeln auf Sir Nicholas' Lippen, das sicher nicht durch die Reden Ihres Vaters hervorgerufen worden war, zeigte Dominica, dass Sir Nicholas ihr Gespräch noch immer verfolgte.
Dann wurde Fleisch aufgetragen, Hammelbrust in einer Safransauce. Dazu gab es Teigwaren und nachher ein Quittenkompott. Sie langte herzhaft zu und setzte ihre Unterhaltung mit Master Dangerfield fort.
Don Manuel versuchte mehr als einmal, die Aufmerksamkeit seiner Tochter auf sich zu ziehen, doch seine Versuche schlugen fehl, und so musste er seine Unterhaltung mit Sir Nicholas fortsetzen. »Dies ist ein gutes Schiff, Señor«, bemerkte er höflich.
»Es gehört mir, Señor.« Beauvallet hob eine Karaffe mit Wein hoch. »Ich habe hier einen Wein aus Alicante oder einen Burgunder, ganz wie es Euch beliebt. Rheinwein kann ich Euch ebenfalls anbieten. Sagt nur, was Ihr bevorzugt!«
»Ihr seid zu gütig, Señor. Den Alicante, danke.« Er bemerkte, dass sein Becher maurische Arbeit war, wie man sie in Spanien viel verwendete, und runzelte die Stirn, enthielt sich aber aus Höflichkeit jeder Bemerkung.
»Ihr habt meine Becher gesehen, Señor?«, fragte Beauvallet, dem dieses Feingefühl mangelte. »Sie stammen aus Andalusien.« Er sah, wie sein Gast zusammenzuckte, und lachte erheitert auf. »Nein, nein, Señor, sie haben niemals eine spanische Galeone gesehen – ich habe sie vor Jahren auf meinen Reisen erstanden.«
Durch diese Bemerkung machte er Don Manuel verlegen, der sich bemühte, eilig das Thema zu wechseln. »Ihr kennt mein Land, Señor?«
»Aber ja, ein wenig«, gab Beauvallet zu. Er sah Dominica an, die ihr Gesicht abgewendet hatte, »Darf ich Euch einschenken, Señora?«
Die Dame war so sehr in ihre Unterhaltung mit Dangerfield vertieft, dass sie ihn nicht zu hören schien. Beauvallet beobachtete sie einige Augenblicke lang erheitert und wandte sich dann an Don Manuel. »Glaubt Ihr, Señor, dass Eure Tochter Wein aus meinen Händen nehmen wird?«
»Dominica, man spricht mit dir!«, sagte Don Manuel scharf.
Sie zuckte gekonnt zusammen und wandte sich um. »Señor?« Sie blickte direkt in Beauvallets vergnügt zwinkernde Augen. »Verzeiht, Señor!« Er hielt ihr einen Becher entgegen. Sie nahm ihn und drehte ihn, um ihn genau zu betrachten. »Kommt er von der Santa Maria f« fragte sie unschuldig.
Don Manuel errötete ob der schlechten Manieren seiner Tochter und stieß einen abfälligen Laut aus. Beauvallet hingegen schüttelte sich vor Lachen. »Den habe ich ganz ehrlich erworben, Señora!«
Das Mahl nahm seinen Fortgang. Don Manuel, welcher über die Starrköpfigkeit seiner Tochter, die ihre Aufmerksamkeit ausschließlich Dangerfield schenkte, erschüttert war, bemühte sich, nun selbst eine Unterhaltung mit Dangerfield zu beginnen, und brachte es auf diese Weise zustande, Dominica zum Schweigen zu bringen. Wütend biss sie sich auf die Lippen und wandte nun ihre ganze Aufmerksamkeit einer Schüssel Marzipan zu. Zu ihrer Linken lehnte sich Beauvallet lässig in seinen Stuhl zurück und spielte mit seiner Ambrakugel. Dominica warf ihm einen verstohlenen Blick zu, sah den seinen auf sich gerichtet, fühlte den Spott unter den gesenkten Lidern und errötete heftig. Sie begann, an einem Stück Marzipan zu knabbern.
Sir Nicholas ließ die duftende Kugel fallen und richtete sich wieder auf. Seine Hand fuhr an den Gürtel; er zog den Dolch aus der Scheide. Es war ein schön gearbeitetes Stück, mit einem Griff aus ziseliertem Gold und einer blitzenden Klinge. Er beugte sich vor und bot der Dame den Griff.
»Ich schenke ihn Euch, Señora«, meinte er demütig.
Dominica warf zornig den Kopf hoch und versuchte, den Dolch von sich zu schieben. »Ich will ihn nicht.«
»Aber nicht doch!«
»Ihr wollt mich nur verspotten, Señor. Ich brauche Euren Dolch nicht!«
»Aber Ihr würdet mich so gern töten«, sagte Sir Nicholas leise.
Dominica sah ihn zornig an. Er war unausstehlich, und was noch schlimmer war – sein Lächeln machte das Herz eines schutzlosen Mädchens klopfen.
»Ihr lacht mich aus. Aber macht nur weiter, wenn Euch das gefällt: Ich werde mich durch Euren Spott nicht verwirren lassen!«
»Ich?«, fragte Beauvallet und ergriff ihr Handgelenk. »Seht mir einmal ins Auge und sagt mir dann, ob ich Euch wirklich auslache.«
Dominica sah stattdessen ihren Vater an, doch dieser hatte sich abgewandt und traktierte Master Dangerfield mit seiner Meinung über die Werke des Livius.
»Nun«, drängte ihr Peiniger. »Wie – Ihr habt doch nicht Angst?«
Sie war getroffen und sah ihn an. Trotz blitzte in ihren Augen. Sir Nicholas blickte sie unverwandt an, hob dann ihre Hand an die Lippen, küsste sie flüchtig und hielt sie noch immer in der seinen fest. »Ihr werdet mich noch besser kennenlernen«, sagte er.
»Danach gelüstet mich nicht«, antwortete Dominica, doch fehlte ihren Worten die Überzeugungskraft.
»Wirklich nicht? Seid Ihr da sicher?« Sein Griff wurde fester; seine Augen funkelten, doch dann ließ er sie los. Sie war seltsam verwirrt; dieser Mann durfte sie nicht so herausfordernd ansehen!
Sie schwiegen beide; Don Manuel war von seinem Thema fortgerissen worden und hatte sich den Werken des Horaz zugewandt, mit dessen Zitaten er Master Dangerfield überschüttete.
»Was habt Ihr mit Don Juan getan, Señor?«, fragte Dominica, durch das Schweigen verwirrt.
»Wahrscheinlich hat er Kurs auf die Insel genommen, die Euren Namen trägt, Señora«, sagte Beauvallet und verzog fröhlich sein Gesicht. »Señor Cruzada, wer immer das auch sein mag, leistet ihm sicher dabei Gesellschaft.«
Die Dame wählte ein weiteres Stück Marzipan aus der vor ihr stehenden Schüssel und lehnte ein Glas Hippocras ab. Sie sah sehr nachdenklich drein. »Ihr lasst also Eure Feinde tatsächlich ziehen?«
»Du lieber Himmel, habt Ihr anderes vermutet?«
»Ich hatte keine Ahnung, Señor. Man erzählt viel Seltsames von Euch in Westindien.«
»Das erscheint mir auch so.« Er sah erheitert drein. »Heißt es, dass ich foltere, brandschatze und morde, Señora?«
Sie sah ihm gerade in die Augen. »Ihr seid ein kühner Mann, Señor. Es gibt Leute, die behaupten, Ihr wärt ein Zauberer.«
Er warf den Kopf zurück und lachte laut auf. Don Manuel fuhr zusammen und brach mitten im Satz ab – zur größten Erleichterung Master Dangerfields, der über seinem Glas bereits eingedöst war. »Die einzige Hexerei, die ich betreibe, Señora, ist mein Wissen um das Meer«, sagte Beauvallet. »Ich trage keine Amulette, aber man sagt, dass ich in der Konstellation von Venus und Jupiter geboren wurde. Ein günstiges Omen! Ich trinke den Planeten zu!« Er erhob seinen Becher und leerte ihn.
»Alchimie ist Teufelswerk, genauso wie die Astrologie«, erklärte Don Manuel streng. »Ich halte die Grundsätze des Paracelsus für äußerst gefährlich, Señor, aber soweit ich weiß, werden sie in England eifrig studiert und beachtet. Was für eine absurde und ketzerische Lehre! Ich selbst habe einmal einen Mann daran zweifeln hören, dass sein Nachbar im Zeichen des Steinbocks geboren wäre, nur weil er einen rötlichen Teint und einen rotbraunen Bart hatte. Und Ihr werdet viele Menschen finden, die sich nicht einmal vor die Tür ihres Hauses wagen, ohne ein Stückchen Koralle mitzutragen oder einen Saphir, der ihnen Mut verleiht, oder irgendein anderes ähnliches Spielzeug, das nur für Kinder oder Heiden taugt. Man spricht auch überall davon, dass der Himmel in Häuser eingeteilt ist, welche dieses oder jenes regieren, und ähnliche Dummheiten mehr. Dummheiten, nur gut für dumme Menschen!« Damit war das Thema Paracelsus für Don Manuel erledigt.
Kapitel 3
Der zweite Tag war wolkenlos. Die Sonne brannte heiß herunter, während eine steife Brise die Segel wölbte. Don Manuel blieb in seiner Kabine; zu sehr hatten ihn die Aufregungen und Anstrengungen des vergangenen Tages geschwächt. Er nahm nur ein paar Bissen von in Wein getränktem Brot zu sich und wies seine Tochter aus dem Raum. Das Fieber schüttelte ihn, und sein Kopf schmerzte. Sein eigener Diener, Bartolomeo, war ständig um ihn bemüht, doch sah auch Joshua Dimmock nach ihm.
Joshua hielt ihm einen langen Vortrag über verschiedene Erkrankungen fiebriger Natur und riet ihm, da er Don Manuels Ansichten über die Chaldäer nicht teilte, einige Splitter eines Galgens bei sich zu tragen, was ein sicheres Heilmittel sei. Er zog sie aus irgendwelchen Taschen seines Gewandes hervor und pries ihre heilende Wirkung. Don Manuel winkte ihn gereizt fort, ließ sich aber dazu herab, ein Stärkungsmittel zu trinken, welches Joshua zufolge direkt aus der Küche von Lady Beauvallet kam, einer Dame, die mit allen Heilkünsten wohl vertraut war.
»Ein sicheres Mittel, Señor, wie ich schon oft erfahren habe«, erklärte Joshua. »Es enthält Julep und Angelika, eine Handvoll Wacholderbeeren und Zehrkraut, ganz zu schweigen vom Wermut, von dem jedermann weiß, dass er das Fieber heilt. Das Ganze, Señor, wird von unserer Herrin eigenhändig in Weingeist eingelegt und fest verschlossen aufbewahrt. Geruht nur, es zu erproben!«
Don Manuel versuchte das Stärkungsmittel und musste noch einmal die Versicherung von dessen heilender Kraft über sich ergehen lassen. Insgeheim aber schüttelte Joshua besorgt den Kopf und erklärte Sir Nicholas unter vier Augen, dass er einen Sterbenden an Bord der Venture mit sich führte.
»Das weiß ich«, sagte Beauvallet, ohne auf diese Bemerkung weiter einzugehen. »Wenn ich es richtig deute, so leidet er unter der cameras de sangre.«
»Das habe ich schon bemerkt, Sir. Auf den ersten Blick, möchte ich fast sagen. Sein Diener – ein dürrer, melancholischer Mensch und ein Dummkopf, wie ich kaum jemals einen gesehen habe – steht herum und schwatzt von Wechselfieber; aber ich habe dem Tölpel erklärt, dass es die cameras de sangre ist. Lasst mich die Falten Eurer Krause ordnen, Sir.« Er tat dies und trat zurück, um die Wirkung seiner Bemühungen kritisch zu betrachten. Und wie um seine Behauptungen zu unterstreichen, wies er mit seinem Stöckchen auf Sir Nicholas. »Hört mich weiter an, Sir! Es ist dies ein böses Vorzeichen! Ein Todesfall bedeutet Unglück. Ich spreche jetzt nicht von den zufälligen Todesfällen, wie sie sich im Gefecht ereignen. Das ist ja klar. Aber so ein langsames Sterben ist eine ganz andere Sache. Wir müssen den würdigen Herrn so rasch wie möglich an Land bringen.«
»Was? Was soll das, du Schurke?«, wollte Beauvallet wissen, der sich in seinen Stuhl zurückgelehnt hatte. »Ihn an Land bringen – wo und weshalb?«
»Ich glaube, dass die Kanarischen Inseln ein günstiger Platz wären, Sir. Der Grund dafür ist klar: Er muss an Land sterben – oder zumindest auf einem anderen Schiff als auf dem unseren. Dann geht uns die Sache nichts mehr an.« Er bückte sich rasch, um dem Stiefel zu entgehen, der mit voller Wucht gegen seinen Kopf geschleudert wurde.
»Schurke!«, fuhr Beauvallet auf. »Hör sofort mit diesem dummen Geschwätz auf! Wir werden den Herrn in Spanien an Land setzen. Merk dir das!«
Joshua hob den Stiefel auf und kniete nieder, um Sir Nicholas beim Anziehen zu helfen; er war nicht im Geringsten eingeschüchtert. »Erlaubt mir, Euch zu versichern, dass wir damit wieder einmal den Kopf in die Schlinge legen!«
»Sei sicher, dass du einmal so enden wirst«, erwiderte Sir Nicholas fröhlich.
»Was das anlangt, Sir, so bin ja nicht ich es, der in der ganzen Welt herumrast und raubt und plündert«, antwortete Joshua gleichmütig. »Stoßt noch ein bisschen nach, Sir, und der Stiefel sitzt. So!« Er strich eine Falte in dem weichen Leder aus Cordoba glatt und hielt den zweiten Stiefel bereit. »Ihr müsst wissen, Herr, dass mich das nicht trifft, denn mein Horoskop hat klar und deutlich ausgesagt, dass ich friedlich im Bett sterben werde. Es wäre gut, Herr, wenn Ihr Euer Horoskop erstellen ließet, damit wir wissen, wovor wir uns hüten müssen.«
»Behalt deine guten Ratschläge für dich, Narr, und verschwinde!«, empfahl ihm Beauvallet. »Du führst mich zu sehr in Versuchung.« Er machte eine kurze, vielsagende Bewegung mit seinem abgewinkelten Bein.