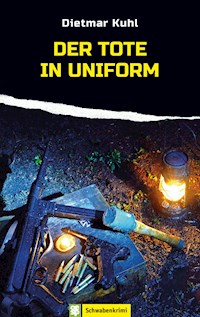Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oertel u. Spörer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Der Tote: Ein Hauptkommissar der Reutlinger Polizei. Die Tatwaffe: Ein Bolzenschussgerät. Der Tatort: Ein Theater. Wilhelm Klein, ein Kollege und Freund des Toten, steht vor einem Rätsel. Was hat sein Vorgesetzter Hans Görges im Theater gemacht? Warum wurde er dort getötet? Seine Ermittlungen führen ihn zu einer Laientheatergruppe, in der Görges mitgespielt hat. Bald gibt es klare Spuren. Aber die Verdächtigen kommen als Täter für Klein nicht in Frage. Doch dann hat der Reutlinger Kommissar eine Idee. Um den Fall zu lösen, muss er in den hohen Norden, wo sich einer der Verdächtigen verschanzt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Reutlinger Kriminalkommissar Wilhelm Klein wird eines Morgens rüde geweckt. Seine beiden Kollegen sind in seine Wohnung eingebrochen, weil er weder telefonisch erreichbar war noch auf ihr Klopfen reagiert hat.
Sie bringen ihm eine schlimme Nachricht: Sein Vorgesetzter und Freund Hans Görges wurde am Morgen tot am Café Winkler in der Innenstadt gefunden. Wie im Schock macht sich Klein auf den Weg in die Stadt, erledigt Einkäufe und kommt an Stätten seiner Kindheit vorbei. Schließlich beginnt er am Café Winkler mit seinen Ermittlungen. Die Spuren führen zu einer Laientheatergruppe, in der auch Hans Görges mitspielte. Da zwei der Schauspieler von Görges und Klein verhaftet und hinter Gitter gebracht wurden, scheinen die Schuldigen schnell gefunden. Einer flüchtet allerdings, und der andere beteuert seine Unschuld. Kommissar Klein wird schnell klar, dass diese Verdächtigen nicht die Täter sein können.
»Der Tote am Café Winkler« ist Dietmar Kuhls erster Kriminalroman mit seinem Hauptkommissar Wilhelm Klein. Seine autobiographischen Erinnerungen und eine gute Portion Reutlingen lassen den Leser eintauchen in eine Suche nach dem Täter, die schließlich zum Showdown im Norden führt.
Dietmar Kuhl wurde 1966 in Reutlingen geboren. Hier lebt er zusammen mit seiner Frau Silke und seinem Sohn Ragnar. Nach dem Besuch der Hauptschule erlernte er den Beruf des Schmieds. Seit nun fast 30 Jahren arbeitet er in einem Extrusionsbetrieb als Teamleiter. In seiner Freizeit trinkt er gerne ein Glas Wein mit einer Zigarette dazu in seinem Café. Der Tote am Café Winkler ist sein erster Krimi mit dem Hauptkommissar Wilhelm Klein. Der Protagonist erhielt den Namen vom Großvater des Autors. Er lernte diesen nie kennen.
Dietmar Kuhl
Der Tote am Café Winkler
Ein Reutlingen-Krimi
Oertel+Spörer
Dieser Kriminalroman spielt an realen Schauplätzen.
Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden.
Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen ergeben, so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt.
© Oertel + Spörer Verlags-GmbH+Co. KG 2015
Postfach 16 42 · 72706 Reutlingen
Alle Rechte vorbehalten.
Titelbild: Markus Niethammer, Reutlingen
Umschlaggestaltung: Oertel + Spörer Verlag, Bettina Mehmedbegović
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-88627-686-8
Besuchen Sie unsere Homepage und informieren Sie sich über unser vielfältiges Verlagsprogramm:
www.oertel-spoerer.de
Für meinen Opa Wilhelm Kleinundseine Tochter Anneliese
Um es kurz zu machen, er war tot. Er rührte sich nicht mehr, alles Leben war aus ihm entwichen. Es musste passiert sein, solange ich geschlafen hatte. Wie konnte das nur geschehen? Vor etwa sechs Stunden war er doch noch so unterhaltsam gewesen. Klar, in letzter Zeit hatte er morgens schon mal seine Probleme gehabt, in die Gänge zu kommen, was ihm ja bei dem Alter auch nicht zu verdenken war, aber ansonsten war doch alles tadellos gewesen.
Ich konnte meine Wut und meine Tränen nur schwer zurückhalten, wenn ich jetzt daran dachte, was wir nicht alles zusammen erlebt hatten. Die Feten und Partys, die wir gefeiert hatten, letzte Woche erst hatten wir über dich eine halbe Flasche Capion ausgeleert, aus Versehen natürlich. Du hast es ja auch nicht krummgenommen, bis auf ein komisches Brummen, sonst war nichts gewesen. Du warst der Erste, der Marion nackt gesehen hat. Damals, als sie nach dem Kinobesuch auf der Couch auf mich wartete, eigentlich wollten wir nur noch einen Kaffee bei mir trinken. Die Couch, ja, die hast du überlebt. Marion gibt es noch. Wie lange war das her? Zwölf Jahre bestimmt. Was sie wohl sagen wird, wenn sie es hört? Traurig wird sie sein, ganz bestimmt.
Was soll ich denn jetzt mit dir machen, dachte ich so bei mir, einfach anrufen, dass sie dich abholen, zuschauen, wie du lieblos verfrachtet wirst nach all den Jahren? Nein! Ich werde es nicht tun. Ich bring dich in den Keller und heb’ dich dort auf. Vielleicht gibt es ja in der Zukunft jemanden, der dich wieder zum Leben erwecken kann. Beim letzten Mal hatten sie mich schon gewarnt, dass dir bei einem neuerlichen Kollaps nicht mehr geholfen werden kann. »Es ist eben das Alter, wissen Sie«, hatten die beiden freundlichen Herren mir damals gesagt. Ach, Schluss jetzt mit der Trauer, das Leben geht doch weiter. Die Tagesschau kommt ohne dich trotzdem, und den nächsten Tatort will ich auch sehen. Es hilft nichts, dachte ich, ich brauche einen neuen Fernseher.
Bei all der Trauer über meinen toten Fernseher, der übrigens Kurt hieß, hatte ich das Telefon nicht bemerkt. Wenn mich das Display meines Telefons nicht anlog, so hatte Rüdiger schon dreimal vergeblich versucht, mich zu erreichen. Das erste Mal um neun Uhr fünf. Ts, ts, ts, der weiß doch, dass ich heute freihabe. Der wird sich schon wieder melden, dachte ich so bei mir und ging in die Küche, um mir einen Kaffee zu machen. Tiefschwarz musste er sein, wie es sich für einen Trauernden gehört und ohne Zucker, wie ihn die Cowboys trinken. Als mein Kaffee so langsam zu dampfen anfing, bekam ich Hunger und beschloss auch gleich mein Frühstück zu machen, das ich mir nach der Aufregung redlich verdient hatte.
Mindestens drei Scheiben Brot gehörten zu einem guten Frühstück. Die erste Scheibe musste süß sein mit Honig oder selbst gemachter Marmelade von meiner Mutti. Die zweite und dritte Scheibe waren dann mit Käse oder einem anderen herzhaften Brotbelag. Wurst gab es nicht immer. Seit ich das Lied »Die Würde des Schweins ist unantastbar« von Reinhard Mey gehört hatte, war mir klar geworden, dass ich mein Fleisch und meine Wurst nicht mehr bei Penny oder Aldi kaufen kann. Ich wollte nicht schuld sein am Elend dieser Tiere, die in sechs Monaten schlachtreif waren und die Sonne nur auf dem Weg zum Schlachthof sahen. Wie dem auch sei, als ich mit meinem voll beladenen Frühstückstablett wieder in mein Wohnzimmer kam, blinkte das Display meines Telefons schon wieder. Nach genauerer Untersuchung des Apparates stellte es sich heraus, dass er auf stumm geschaltet war. Kein Wunder wählte sich Rüdiger die Finger wund. Nun denn, ein weiteres Mal dachte ich, er wird sich wieder melden. Genüsslich nahm ich den ersten Schluck Kaffee, um gleich damit die erste Hälfte einer Blutdrucktablette zu schlucken. Na ja, mit einundvierzig Jahren lief »Mann« eben nicht mehr so rund. Vielleicht wird es doch noch ein schöner Tag, dachte ich so bei mir und schaute dem Regen zu, der seit gut zwei Stunden meine frisch geputzten Fenster ruinierte. Kaum hatte ich den Gedanken zu Ende gebracht, als es an der Tür klingelte. Nicht kurz und dezent, nein wie ein Irrer hing da jemand am Knopf.
Das Marmeladenbrot, das sich wohl schon stückchenweise im Nirwana gesehen hatte, knallte auf das Frühstücksbrett. Auf dem Weg zur Tür überlegte ich mir noch, welche Tantalusqualen ich dem penetranten Besucher angedeihen lassen sollte, als es schon wieder klingelte, diesmal aber nur kurz. Ich nahm den Hörer der Sprechanlage in die Hand und hauchte ein »Ja bitte?« in die Leitung. Nichts, keine Antwort, also sendete ich mein »Ja bitte?« nochmals durch die Leitung, um wieder keine Antwort zu erhalten. Stattdessen klingelte es erneut.
Gott sei Dank war kein Spiegel in der Nähe, ich glaube, ich hätte mich vor meinem eigenen Gesichtsausdruck erschrocken. Klingelputzer, schoss es mir durch den Kopf und mit der Wut eines Berserkers riss ich meine Dienstwaffe aus dem Halfter, das immer an der Garderobe hing. Na warte, denen wollte ich den Spaß verderben, und wenn es auch nur Kinder waren, sie waren eben zur falschen Zeit am falschen Ort. Natürlich wollte ich nicht schießen, allein die Waffe in der Hand zu halten, mit dem Lauf nach unten, genügte in neunundneunzig Prozent der Fälle um so viel Eindruck zu schinden, dass sie es bei mir nie wieder taten.
Mit der Waffe in der Rechten und nur mit einer Unterhose bekleidet, riss ich die Tür auf, um die Treppen vom zweiten Stock ins Erdgeschoss hinunter zu stürmen. Doch ich blieb wie angewurzelt stehen, direkt vor meiner Nase war der Lauf einer Walter-Pistole und dahinter die Augen von Rüdiger. Vor mir, quasi auf Geschlechtshöhe, hockte Aysel mit einem Dietrich in der Hand und starrte auf meine Unterhose. Erschrocken hielt sie sich die Hand vor den Mund und fing dann leise an zu kichern.
»Seid ihr noch zu retten, was soll der Scheiß hier?«
»Wir dachten, dir sei auch etwas passiert, wir haben ständig bei dir angerufen, aber du bist nicht rangegangen, also sind wir her und wollten schauen, ob alles in Ordnung ist. Als du nach dem zweiten Klingeln nicht geantwortet hast, ist deine Nachbarin zufällig vom Einkaufen gekommen und hat uns zur Haustür reingelassen. Nach dem dritten Klingeln haben wir dann beschlossen, die Wohnungstür zu knacken, aber das ist ja nun nicht mehr nötig.«
»Dir geht es gut?«, fragte Rüdiger.
»Blöde Frage, klar geht es mir gut, was man von euch nicht behaupten kann. Nur weil ich nicht ans Telefon geh’ und nicht sofort die Türe öffne, wollt ihr meine Wohnung stürmen? Habt ihr mal daran gedacht, dass heute mein freier Tag ist und ich eventuell meine Ruhe haben möchte?«
Ruhe, keiner von den beiden sagte ein Wort. Aysel, Königin von Saba, meine große, schlanke, türkische Kollegin, starrte auf den Boden und in ihren Augen, die immer zu kleinen Schlitzen wurden, wenn sie lachte, sammelten sich Tränen. Jetzt wurde mir erst bewusst, dass etwas nicht stimmen konnte.
Natürlich wussten beide, dass heute mein freier Tag war und natürlich würden beide nicht versuchen, mich telefonisch zu erreichen, geschweige denn versuchen, meine Wohnungstüre zu knacken, wenn nicht irgendetwas passiert wäre, das sie denken ließ, auch mir könnte etwas passiert sein. Ich sah in Rüdigers Augen, die sich eben noch hinter seiner Dienstwaffe versteckt hatten, und sah die Trauer darin.
»Was ist passiert?« Jetzt wurde ich laut. »Warum stehst du mit einer durchgeladenen Waffe vor meiner Tür und warum wolltet ihr in meine Wohnung einbrechen?«
Rüdiger sah mich an und sagte keinen Ton. Ich schaute Aysel an, sie war mit einem Taschentuch beschäftigt, das ihre Tränen aufsog. Jetzt fiel mir der Satz wieder ein, den Rüdiger vor gerade mal einer Minute gesagt hatte: »Wir dachten, dir sei auch etwas passiert.«
»Weiß Hans was ihr hier macht?«
»Hans ist tot«, kam es Aysel über ihre zittrigen Lippen.
Aus der Wohnung neben mir drang das Spiel eines Klaviers ins Treppenhaus, der kleine Sven versuchte mal wieder mit »Lavender« von Marilion seiner Mutter zu gefallen. Aus dem ersten Stock drang der inbrünstige Klang der kleinen Fredericke. Sie hatte wohl genug geschlafen und wollte nun mit ihren sechs Monaten die Welt weiter entdecken.
»Das kann nicht sein, ich war doch gestern noch bis einundzwanzig Uhr mit ihm zusammen. Wir waren im Winkler. Auf dem Heimweg sind wir noch an einem Imbiss vorbei, um uns was für den Nachhauseweg zu holen. Bis vor seine Haustüre hab ich ihn gebracht. Ich habe ihn sogar noch reingehen sehen, weil ich mich noch mal umdrehte, um einen schönen Abend zu wünschen.«
»Es ist aber so, heute Morgen haben sie ihn gefunden«, sagte Rüdiger.
»Was und wie ist es passiert?«
»Er wurde heute Morgen mit einem Kopfschuss aufgefunden!«
»Wie bitte? Was, wie, ich meine wo? In seiner Wohnung?«
»Nein, in einem Gebüsch am Rathaus, gegenüber vom Café Winkler, an der Stelle wird das Rathaus umgebaut. Dort haben ihn Bauarbeiter gefunden. Das war um sechs Uhr dreißig. Die Kollegen vor Ort haben uns sofort verständigt. Die Spurensicherung ist noch bei der Arbeit, hat aber noch nichts Konkretes gefunden, wird wohl bis morgen Mittag dauern, bis sie was sagen können.«
»Spuren gibt es genug, aber sie lassen sich schlecht zuordnen, sie denken, dass die meisten von den Bauarbeitern sind, die alles niedergetrampelt haben.«
»Also, dann wisst ihr noch nicht, ob es auch der Tatort war?«
»Nein, wissen wir nicht.«
»Und wie kommt ihr auf die Idee, dass mir etwas passiert sein könnte?«
»Gegen acht Uhr fünfundvierzig kam Marcel, um sein Café zu öffnen. Er konnte es auch kaum glauben, dass der Tote im Gebüsch Hans sein soll. Er hat uns dann erzählt, dass du und Hans bis zwanzig Uhr im Café wart und dann gemeinsam gegangen seid. Etwa eine halbe Stunde später kam dann ein Gast, den er nicht kannte, der einen Espresso trinken wollte. Als Marcel ihn darauf hinwies, dass er die Maschine schon geputzt habe, hat er sich nach Hans erkundigt.«
»Ja und was hat Marcel zu ihm gesagt?«
»Na, dass ihr vor einer halben Stunde gemeinsam gegangen seid. Der Mann hat dann, ohne sich zu verabschieden, das Café verlassen.«
»Habt ihr die Personenbeschreibung?«
»Ja, alles schon gemacht, ist schon unterwegs zum LKA.«
»Na ja, und als du übers Telefon nicht zu erreichen warst, sind wir zu dir gefahren.«
»Angerufen hätten wir dich so oder so, wir wollten nicht, dass du es morgen früh aus der Zeitung erfährst.«
»Ist gut, ich danke euch für eure Sorge, ihr habt alles richtig gemacht.«
»Na dann, wir müssen auch wieder, nicht wahr Rüdiger?«
»Ja ja, sind schon zu lange hier, haben noch viel zu tun.«
»Also Abmarsch und halt die Ohren steif, Wilhelm.«
»Mach ich, Aysel, mach ich.«
Sie drehten sich um und gingen die Treppen hinunter. Ich schaute ihnen hinterher wie in Trance. Sven spielte »Für Elise«. Jetzt hatte er es bestimmt geschafft und seine Mutter war begeistert von ihm. Die kleine Fredericke war verstummt, entweder bekam sie die Brust, oder sie war mit ihrer Mutter auf Entdeckungsreise in der großen weiten Welt ihrer Hundert-Quadratmeter-Wohnung. Als meine Kollegen fast unten waren, fiel mir noch etwas ganz Wichtiges ein. Ich sprang zum Treppengeländer und rief ihnen hinterher.
»Danke, danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin froh, dass es euch gibt!«
Der Vormittag war gelaufen. Als Rüdiger und Aysel gegangen waren, zog ich mich ins Wohnzimmer zurück. Ich legte Mark Knopflers »Shangri-La« auf und kuschelte mich mit einer Decke auf der Couch ein. Mit offenen Augen dachte ich an die Zeit mit Hans zurück.
Als ich vor vierzehn Jahren zur Kripo kam, wurde er mein Vorgesetzter. Hauptkommissar Hans Görges, als harter aber gerechter Hund bei der »Kundschaft« und bei den Kollegen bekannt, so wurde er mir vorgestellt. Ich war damals sechsundzwanzig und total grün hinter den Ohren, was die Kripo anbelangt. Die Welt wollte ich retten und der Kriminalität den Kampf ansagen. Die Welt zu retten, hab ich aufgeschoben, war dann doch für den Anfang ein bisschen viel, aber den Kampf habe ich aufgenommen. Zusammen mit Hans. Von Anfang an hat mich Hans an seiner Erfahrung teilhaben lassen und war dabei wie ein Vater zu mir. Den harten Hund hat er nie rausgehängt. Was haben wir nicht alles hinter Schloss und Riegel gebracht. Vergewaltiger, Autoschieber, Einbrecher, Drogendealer, Erpresser und einmal auch einen Mörder. Davon gibt es bei uns in der Stadt Gott sei Dank nicht so viele.
Richtig gute Freunde wurden wir vor etwa drei Jahren, als Rüdiger und Aysel unser Zweierteam verstärkten. Er bekam Aysel und ich Rüdiger unter die Fittiche. Rüdiger erfuhr alles von mir, was ich bei Hans gelernt hatte und auch an meinen eigenen Erfahrungen ließ ich ihn teilhaben. Eigentlich waren wir vier dicke Freunde und Kollegen geworden, und jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Geheimnisse gab es keine, selbst Probleme im Privatleben teilten wir miteinander. Es war einfach alles perfekt, gewesen.
Aus diesem Grund konnte ich nicht begreifen, was geschehen war. Warum war Hans noch mal weggegangen? Wen hatte er noch getroffen? Was war am Rathaus vor dem Café Winkler passiert? Fragen über Fragen, auf die ich bis jetzt keine Antworten wusste.
Ich beschloss, mir erst mal einen doppelten Espresso zu machen und mir dabei die erste Zigarette des Tages zu gönnen. Damit ließ es sich besser denken.
Als der blaue Dunst langsam durch das extra eingerichtete kleine Raucherzimmer waberte, schaute ich auf die Uhr. Sechzehn Uhr. Geschlagene drei Stunden hatte ich auf der Couch gelegen. Mark Knopfler hatte schon des Öfteren an diesem Tag sein »Shangri-La« in mein Wohnzimmer geträllert. Es half nichts, ich musste in die Gänge kommen. Ich öffnete das Fenster, um den Rauch entweichen zu lassen, was eigentlich nicht nötig war, da eine kleine Lüftung den Rauch gleich nach draußen beförderte. Es sollte aber noch ein wenig von der duftigen Herbstluft in den Raum strömen. Es regnete nicht mehr, und die Luft roch nach nassem Laub und feuchtem Unterholz.
Der Herbst war mit seinen vielen erdigen Farben, seinen tief dunkelgrauen Wolken, seinen kräftigen Winden und, bei gutem Wetter, mit seinen atemberaubenden Sonnenuntergängen eine meiner drei Lieblingsjahreszeiten, der Winter und der Frühling gehörten auch dazu. Der Sommer hingegen konnte mir gestohlen bleiben.
Durch abgefallenes Laub zu spazieren oder abends auf den Übersberg zu fahren, um Maultaschen zu essen und dabei durch die kahlen Bäume die Lichter der Stadt zu beobachten, war schöner als sich bei herrlichstem Sommerwetter mit Tausenden von anderen Menschen veruriniertes Freibadwasser zu teilen, um dann abends im Bett zu liegen und bei achtundzwanzig Grad Celsius Raumtemperatur vor Schwüle nicht schlafen zu können. Ich träumte schon wieder. Ich riss mich vom Fenster los und ging aus dem Raucherzimmer. Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, machte ich mich auf den Weg ins Wohnzimmer, um dort Ordnung zu schaffen. Als ich den Raum betrat, fiel mir Kurt, mein verstorbener Fernseher, ins Auge. Dich gibt es ja auch noch, sagte ich so vor mich hin und versuchte ein letztes Mal, ihn einzuschalten, aber er blieb stumm.
Innerhalb von zwanzig Minuten hatte ich das Wohnzimmer aufgeräumt, mich geduscht, rasiert und war auf dem Weg in den Keller, um mein Fahrrad zu holen. Ich hatte mir einen kleinen Plan zurechtgelegt: Fernseher kaufen, zwei Flasche Château Grillon besorgen und einen Abstecher ins Winkler machen. Die ersten beiden Wege führten mich von der Ost- in die Weststadt. Bei »Fernseh-Rath« wollte ich mir meinen neuen Freund erstehen. Meister Rath hatte sich zwölf Jahre lang rührend um Kurt gekümmert und deshalb sollte er auch mein Geld bekommen.
Guten Tag, Herr Klein«, wurde ich freundlich vom vollbärtigen Chef in Empfang genommen, »na, macht ihr Grundig wieder Probleme?«
»Nicht mehr«, antwortete ich. »Diesmal ist es der von ihnen angekündigte Exitus. Guten Tag, Herr Rath«, begrüßte ich ihn nun ebenfalls. »Ich brauche einen Neuen.«
»Besondere Wünsche?«
»Ja, einen habe ich, ein Grundig soll es wieder sein. Meine Eltern hatten schon einen Grundig, und ich habe es, als ich mir meinen ersten Fernseher kaufte, ebenso gehalten. Bei mir sind eben auch noch Kindheitserinnerungen beim Fernsehkauf mit zu berücksichtigen.«
»Röhre, Plasma oder LCD?«
HD Ready, Full HD und so weiter. Von so etwas hatte ich keine Ahnung, aber davon ganz schön viel.
»Er sollte so lang leben wie mein alter Kurt, Videotext sollte er auch noch haben und wie gesagt, ein Grundig halt.«
Ich durfte mir die drei Geräte, die er da hatte und auf die meine Wünsche zutrafen, einzeln in Betrieb anschauen und wurde beim Zweiten auch schon fündig. Ein LCD von Grundig mit zweiundneunzig Zentimetern Bildschirmdiagonale und Videotext. Dass heute eigentlich keine Fernseher mehr ohne Videotext verkauft werden, wusste ich ja nicht. Erst als ich das leichte Grinsen auf dem Gesicht von Herrn Rath sah, als ich ihn fragte, ob er denn auch Videotext habe, wusste ich, dass es wohl eine blöde Frage gewesen war, die ich gerade gestellt hatte. Herr Rath wurde jetzt redselig und klärte mich darüber auf, was in der Welt des Fernsehers in den letzten zwölf Jahren so passiert war. Als er zum Schluss seines Vortrags kam, hatte ich den Anfang schon wieder vergessen, tat aber so, als könnte ich sofort bei ihm in der Werkstatt anfangen. Na, wenigstens wusste ich jetzt, dass ich in zwölf Jahren nicht wieder nach einem Fernseher mit Videotext fragen musste.
»Nehmen Sie ihn gleich mit?«
»Nein, es wäre mir recht, wenn Sie ihn bringen könnten.«
»Kein Problem, wann?«
»Ginge es heute noch?«
»Klar bis neunzehn Uhr können wir liefern.«
»Hm, ich müsste noch ein paar Dinge erledigen und wäre dann erst so gegen zwanzig Uhr wieder zu Hause. Das wird wohl zu spät sein?«
»Eigentlich schon, aber Sie sind ja ein guter Kunde, und zudem haben Ihre Eltern ja schon bei meinem Vater eingekauft. Ich habe um halb sieben einen Termin im Schönen Weg, danach könnte ich noch bei Ihnen vorbeischauen. Das wäre dann aber gegen zwanzig Uhr dreißig, ist Ihnen das recht?«
»Ja, klar, auf jeden Fall, danke.«
Ich bezahlte mit meiner EC-Karte, bedankte mich nochmals und verließ den Laden. Als ich mich wieder auf mein Fahrrad schwang, schaute ich noch mal schnell auf die Uhr, siebzehn Uhr dreißig. Jetzt musste ich mich beeilen, durfte beim Weinmusketier höchstens eine halbe Stunde bleiben, was aber sehr schwer war, denn der Besitzer, Dieter Holzner, hatte immer irgendwie ein neues, leckeres Tröpfchen parat. Eine halbe Stunde war da nichts. Vom Fernseh-Rath zum Musketier waren es etwa fünfhundert Meter, das war natürlich von Vorteil. Dazwischen aber lag die Wohnung meiner Mutter, und wenn ich einfach vorbeifuhr, ohne bei ihr reinzuschauen, bekam ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen. Weil ich das nicht wollte, hielt ich sonst immer an. Heute nicht, denn ich wollte unbedingt noch ins Café, wollte mit Marcel reden und den Tatort anschauen. Meine Mutter würde das bestimmt verstehen.
Als ich dann an ihrer Wohnung vorbeifuhr, fiel mir ein Stein vom Herzen, weil ihr Auto nicht auf dem Parkplatz stand. Gott sei Dank, murmelte ich vor mich hin und rollte erleichtert die Straße entlang, um keine Minute später vom Rad zu steigen und »Didi« Holzners Laden zu betreten. Sobald man die Türe zum Laden öffnete, gelangte man in eine andere, in eine gemütliche Welt. Man glaubte es kaum, was sich in dem Flachdachbau aus den Fünfzigern verbarg. Leicht gedämmtes Licht erfüllte den Raum, der mit ein paar Stehtischen an der Probierecke zum gemütlichen Plausch einlud. Alte schwere Holzfässer, dunkelbraune in die Jahre gekommene Schränke standen an der einen Wand, dort wo es die Bordeauxweine aus dem leicht gehobenen Preissegment gab.
Die Spanier und Italiener standen am Eingang schön aufgebahrt auf selbst gebauten Tischen, die schon fast ins Schwarz übergingen und aus der Zeit meiner Urgroßeltern hätten stammen können.
Den größten Teil des Ladens aber nahmen die Franzosen ein, von denen es nicht nur Bordeaux- oder Beaujolais-Weine gab. Zum Beispiel der weiße Colombard aus der Gascogne, dem Land der Musketiere. Ein Gedicht, im Frühjahr bei zweiundzwanzig Grad auf dem Balkon zu sitzen und eine Flasche davon neben sich zu haben, am besten, wenn man im Vorfeld noch etwas Gegrilltes gegessen hat. Oder der »Mas du Petit Azegat« aus der Rhône, es gibt nur eine Jahresproduktion von sechzehntausend Flaschen, die von Madame Compagne, der Winzerin, gehegt und gepflegt werden und auch noch nach biologischen Richtlinien ausgebaut werden. Ein Roter, den ich nicht mehr missen mochte.
Eine kleine Ecke mit kulinarischen Köstlichkeiten wie Käse, Oliven, Wildschweinsalami, Pasta und Pesto gab es auch. Ebenso Cognac, Liköre, Pastis, eigentlich einfach alles, was zu einem gemütlichen Abend so dazugehörte. Es war ein Ort, an dem ich mich wohlfühlte und an dem ich gerne war.
Dass ich so gerne dorthin ging, konnte aber auch daran liegen, dass ich als Kind schon gerne hierhergekommen war. Damals war es noch ein Konsum gewesen, später dann ein Coop. Mit meinem Einkaufszettel bewaffnet, war ich regelmäßig als kleiner Knirps zum Einkaufen geschickt worden. Ich weiß noch genau, wo die zwei Kassen gestanden hatten. Der Obst- und Gemüsestand war gleich rechts beim Eingang gewesen. Wie heute auf dem Wochenmarkt hatte dort eine Verkäuferin den lieben langen Tag nichts anderes gemacht, als Obst und Gemüse abzuwiegen, zu verpacken und mit einem dicken Bleistift den Preis auf die Papiertüte zu schreiben. Sie wusste auch über alles Bescheid, was ihre Produkte anbelangte. Welcher Apfel am besten zum Backen für den Kuchen ist und ob die Orangen besser zum Essen oder eher zum Auspressen sind. Von Selbstbedienung und Anonymität war keine Spur, nicht zu vergleichen mit dem Supermarkt von heute, wo die Äpfel schon von hundert Kunden angefasst worden sind. Die Metzgerei war ganz hinten am anderen Ende vom Laden gewesen, dort wo heute eine Natursteinwand war.
»Hallo Wilhelm«, begrüßte mich der ehemalige Gitarrist der schwäbischen Rockband »Schwoißfuaß«, Dieter Holzner, mit seinem schütteren Haar und einem Grinsen über das ganze Gesicht. Hier war man aufgehoben, es gab genug Weinhändler in der Stadt aber keiner war so mit Leib und Seele dabei. Er war keiner, der seinen Laden nur betrieb, weil er sonst nicht wusste, was er mit seinem Geld anfangen sollte. Dieter lebte davon, und das merkt man. Wer einmal einen seiner »Jour-Fixe« mitgemacht hatte, weiß, wie er ins Schwärmen kommen konnte. Über jeden seiner Weine hatte er eine Geschichte auf Lager und oft kam das Trinken auf seinen Proben zu kurz, weil er wieder kein Ende fand in seinem amüsanten und spannenden Wortschwall.
Hallo Didi, ich hab nicht viel Zeit. Wollte nur zwei Flaschen Château Grillon für heute Abend mitnehmen.«
»Für ein Gläschen Dolcetto wirst du wohl Zeit haben«, sagte er und drückte mir ein Glas in die Hand.
Ich wusste es, es würde schwer werden, hier in einer knappen Viertelstunde wieder rauszukommen.
»Ich habe aber höchstens zehn Minuten.«
Na also, und schon hatte ich den köstlichen roten Saft in meinem Glas. Ich schwenkte das Glas mit der rechten Hand, steckte meine Nase rein, um schnell ein bisschen zu riechen und nahm danach einen so großen Schluck, dass mehr als die Hälfte des Inhalts im Glas fehlte.
»Du hast ja wirklich keine Zeit«, bemerkte er mit traurigem Gesichtsausdruck.
»Tut mir leid, ich muss wirklich los, ich würde gerne noch bleiben, aber Termine eben.«
»Ich lass dich laufen, was hast du, die beiden Flaschen? Macht dreizehnachtzig.«
Ich bezahlte, steckte die Flaschen in meinen Rucksack und verabschiedete mich. Als ich schon bei meinem Fahrrad stand, froh darüber, seinen Fängen entkommen zu sein, ging die Tür noch mal auf und Didi schaute heraus.
»Sag Hans Bescheid, dass er endlich seine drei Kisten Colombard abholen soll.«
Die Tür ging wieder zu. Zum Glück, ich hätte nicht gewusst, was ich hätte sagen sollen.
Einerseits würde er es sowieso bald erfahren, anderseits war es aus ermittlungstechnischen Gründen zu früh, etwas zu erzählen. Ich wollte den Ermittlern in diesem Fall keinen Weg verbauen, um ihre Fäden zu knüpfen und dazu gehörte eben auch Schweigen.
Ich setzte mich wieder auf mein Rad und fuhr die gleiche Strecke wieder zurück, wie ich gekommen war. Vorbei an der Wohnung meiner Mutter, deren Auto noch immer nicht auf dem Parkplatz stand. Vorbei am Fernseh-Rath, wo sie eben vielleicht meinen neuen Freund in den VW-Bus des Chefs einluden. Für den brauche ich auch noch einen Namen, dachte ich beim Abbiegen von der Mozartstraße in die Hindenburgstraße.
Ich fuhr an der Pomologie vorbei und die Hindenburgstraße hinunter bis zur Lindachstraße. Dann bog ich links ab, überquerte die sehr stark befahrene Lederstraße und fuhr an der Jos-Weiß-Schule vorbei hinein in die Altstadt. Über das Kopfsteinpflaster holperte ich die Kanzleistraße entlang, überquerte die Oberamteistraße und hielt mich dann links, um am Osiander vorbei in die Rebentalstraße einzubiegen. Ziel erreicht. Ich stand vor dem Café Winkler.
Ich stellte mein Rad ab und vertäute es ordentlich. Dann streifte ich meinen Rucksack ab und ging, ohne nach links oder rechts zu schauen, ins Café. Ich wollte erst mit Marcel reden, bevor ich mir die Stelle anschaute, die vielleicht der Ort war, an der Hans’ Herz aufgehört hatte zu schlagen.
Ich hatte Glück, es waren wenig Gäste da und Irina, die kleine hübsche und lustige Ukrainerin, Marcels Aushilfe, hatte Dienst. Ich ging an die Theke, um bei Irina einen doppelten Espresso und – das wird sie aus der Bahn werfen, dachte ich mir – einen doppelten Grappa zu bestellen. Ich kam nicht dazu, denn als sie mich sah, schaute sie mich mit ihren großen Augen an und fragte in ihrem Akzent: »Wilhelm, was ist da passiert mit Hans? Ich habe nicht gewusst, dass er Probleme hatte.«
»Probleme? Was für Probleme meinst du?«
»Na ja, wenn jemand umgebracht wird, dann muss er doch wohl Probleme gehabt haben.«
»Ach so, ja weißt du, das muss nicht sein, es sind schon Leute ermordet worden, nur weil sie verwechselt wurden von irgendeinem Auftragskiller. Oder, weil sie etwas gesehen oder gehört haben, mit dem sie vielleicht nichts anfangen hätten können, aber andere dadurch sich in ihrer Sicherheit gefährdet fühlten und dann die ahnungslosen Zeugen einfach ermorden. Du siehst, es muss nicht immer ein Problem dahinter stecken.«
Ich sagte ihr nicht, dass auch ich dachte, dass Hans ein Problem gehabt hatte, denn anders konnte ich mir sein abruptes Ende auch nicht erklären.
»Was mit Hans genau passiert ist, kann ich dir auch nicht sagen, weil ich nichts weiß. Aber selbst wenn, ich dürfte dir nichts sagen.«
»Na gut, Wilhelm, es tut mir auf jeden Fall sehr leid um deinen Freund, er war immer so höflich und fröhlich. Ich werde ihn bestimmt vermissen.«
»Danke, mir geht es genauso.«
»Hab ich doch richtig gehört, hab mir gedacht, dass du heute noch kommst. Hallo Wilhelm.« Vor mir stand Marcel, er legte heute wohl einen Bürotag ein.
Obwohl er sich bestimmt täglich rasierte, hegte man ständig den Verdacht, er sei morgens nicht zum Rasieren gekommen. Ich denke mal, dass bei ihm jeder Elektrorasierer in die Knie geht, so dicht waren seine Barthaare. Von schlanker, drahtiger und sportlicher Gestalt, war er der Schwarm vieler seiner Kundinnen. Dazu war er ein sehr angenehmer Mensch, mit dem auch »Mann« gute Gespräche führen konnte, und er war ein Genießer. Was ihn mir umso sympathischer machte.
»Hallo Marcel«, grüßte ich zurück.
»Hast du schon bestellt?«
»Nein noch nicht.«
»Espresso und Frizzante?«
»Nein heute nicht, einen doppelten Espresso und einen doppelten Grappa, bitte.«
Er schaute mich an, wollte was sagen, ließ es aber dann und begann, meine Bestellung abzuarbeiten.
»Können wir uns raussetzen, ich würde ganz gerne eine rauchen?«
Ich bekam ein kurzes Kopfnicken von ihm als Bestätigung. Das genügte mir, um mich auf den Weg nach draußen zu machen. Mein Lieblingsplatz, gleich links neben dem Eingang, war frei. Ich setzte mich auf die Bank. Keine zwei Minuten später kam Marcel mit dem Tablett, auf dem neben Espresso und Grappa auch ein Glas Chardonnay stand, das er für sich mitgebracht hatte. Er setzte sich auf den Stuhl rechts von mir, hob sein Glas in die Höhe in Richtung Tatort.
»Auf Hans«, sagte er.
Ich tat es mit dem Grappa ebenso, ließ aber ein bisschen im Glas, um diesen Rest dann auf die Erde zu schütten, wie es viele Völker auf dieser Welt tun. Ich war überzeugt, dass Hans in diesem Moment neben uns stand und mit uns aus unseren Gläsern trank. Wir zündeten uns Zigaretten an und rauchten eine Zeit lang vor uns hin, bis ich die Stille unterbrach.
»Rüdiger hat mir heute Morgen gesagt, dass sich gestern Abend ein Gast nach Hans und mir erkundigt hat. Kennst du ihn oder kannst du ihn beschreiben?«
»Ich habe Rüdiger schon alles gesagt, was ich weiß, aber wenn du möchtest, dann erzähle ich es dir eben noch mal.«
»Es ist Hans, verstehst du? Es ist kein Fremder, ich kann nicht einfach so tun als wäre es irgendein Toter. Ich weiß nicht, wie weit sie mit den Ermittlungen schon sind. Ich weiß auch nicht, wer für Hans zuständig ist, ich hoffe, dass sich nicht das LKA die Sache unter den Nagel reißt.«
Im Inneren wusste ich, dass es wahrscheinlich so sein würde, denn es war ein Kollege, der umgebracht worden war.
»Also Marcel, ich würde es gerne noch mal von dir selber hören. Wie sah er aus, und kennst du ihn?«
»Ich versteh dich gut, Wilhelm. Jetzt komm aber erst mal wieder runter und beruhige dich. Ich hol dir noch einen Grappa und dann erzähle ich dir alles noch mal von vorn.«
Damit stand er auf und ging ins Café.
»War ich eben irgendwie nervös«, murmelte ich vor mich hin und zündete mir dabei die dritte Zigarette des Tages an.
»Das kann man wohl sagen.«
Erschrocken drehte ich mich nach links, woher die Stimme kam. Andreas Panne hatte sich unbemerkt neben mich gesetzt.
»Guten Tag, Herr Direktor«, begrüßte er mich, und dabei hatte er sein typisches Grinsen aufgelegt. Der Spross einer alten, wohlhabenden und einflussreichen Familie der Stadt war nicht leicht zu nehmen. Man musste ihn kennen, um zu merken, dass es ein Mensch war, der ein großes Herz hatte und nur nach außen eine harte Schale besaß. Seine manchmal protzige, aber auch rebellische und unkonventionelle Art stieß oft auf Widerstand. Er war keiner mit runden Kanten und Ecken. Keiner, der sich anpasste, nur weil es eben Mode war und keiner, der anderen Menschen Honig ums Maul schmierte, weil sie eben gerne hören wollten, wie toll sie waren. Richtige Ecken und Kanten hatte er, ein Neinsager, wenn er mit etwas nicht einverstanden war. Ich hatte ihn wegen diesen Eigenheiten sehr gerne. Glatte, runde Menschen, die immer nur ja sagten und jedem Trend hinterherliefen, gab es genug. Von so Leuten, wie der Andy einer war, brauchte die Welt mehr.
Worin es wohl keinen gab, der ihm etwas vormachte, das war Kaffee. Es war wie eine Erfüllung für ihn, einen guten oder besser, perfekten Kaffee herzustellen. Seine Kunden fand er in der Gastronomie, in Büros, und man glaubte es kaum, in Bäckereien. Auch Kaffee für Schnelltrinker konnte man in fast perfekter Qualität herstellen. Das spiegelte sich in seinem Erfolg wieder.
»Mensch Andy, hast du mich erschreckt. Hallo erst mal.«
»Also, dass ich mich an einen Polizisten so leicht anschleichen kann, hätte ich nicht gedacht. Ein Wunder, dass dir noch nichts passiert ist. Sind halt auch nicht mehr das, was sie mal waren.«
»Was ist denn los, warum hast du denn Marcel so von der Seite angemacht?«
»Hast du es denn noch nicht gehört«, fragte ich verwundert. Es gab fast nichts, was Andy nicht wusste.
»Was denn?«
»Was mit Hans passiert ist.«
»Nein, hab ich nicht. Haben deine Kollegen ihn besoffen beim Autofahren erwischt?«
»Er ist tot«, sagte ich leicht vergrämt.
»Oh, scheiße, dass tut mir leid. Sorry, Wilhelm, aber ich komm eben erst aus Hamburg und wollte nur schnell Marcels Bestellung vorbeibringen. Ich hab nichts gewusst.«
»Ist schon gut Andy. Sie haben ihn heute Morgen dort hinten gefunden.«
Ich zeigte auf die Ecke, links neben dem Seiteneingang des Rathauses, an der nicht mal mehr ein Absperrband vorhanden war. Ein Zeichen dafür, dass die Spurensicherung ihre Arbeit beendet hatte. Morgen würde ich erfahren, was sie gefunden hatten und ob etwas Brauchbares dabei war. Andy sagte keinen Ton mehr und Marcel kam schon mit dem zweiten Grappa und noch einem Espresso.
Ich trank einen kleinen Schluck aus der Tasse und zündete mir schon wieder eine Zigarette an.
»Mach langsam Wilhelm, mach aus dem Genuss keine Sucht«, sagte ich zu mir selber und beschloss, eine Pfeife zu rauchen, wenn ich nach Hause kam.
Ohne große Umschweife begann Marcel, mir zu erzählen, was er wusste. Ich konnte nicht viel herauslesen, männlich, circa dreißig Jahre alt, ein Meter fünfundachtzig groß, dunkelbraune volle Haare, die wie geölt aussahen und nach hinten gekämmt waren, vermutlich Deutscher ohne Akzent. Sein Auftreten war eher unhöflich, da er sich nicht mal für die Auskunft von Marcel bedankt und sich auch nicht verabschiedet hatte. Morgen sollte er bei unserem Fachmann ein Phantombild anfertigen, Marcel war sich sicher, dass er sein Gesicht noch im Kopf hatte. Etwas anderes war dann viel interessanter.
Er erzählte mir, und Andy bestätigte dies, dass Hans in letzter Zeit öfter als sonst im Café gewesen war. Ungewöhnlich daran war, dass er sonst höchstens einmal im Monat das Café besuchte. Aber noch ungewöhnlicher war dann die Aussage, dass er meistens mit Laienschauspielern des neu gegründeten Theaters gekommen war. Angeregt und lustig war es immer bei ihnen am Tisch zugegangen, berichtete Marcel.
Ich machte mir ein paar Notizen und wusste eigentlich nicht recht, was ich damit anfangen sollte. Schauspieler, das passte so gar nicht zu Hans. Wie das wohl zusammenhing?
»Also, ich mach dir jetzt noch einen Grappa und dann muss ich aber meine Büroarbeiten fertigmachen. Die gute Irina ist morgen nicht da und dann will ich zeitig ins Bett.«
»Ich bekomm noch einen Prosecco«, sagte Andy.
Er erzählte mir von seinen neuen Projekten, die er im Kopf hatte. Wenn er die nur immer auch verwirklichen würde. Ich war mir sicher, es würde mehr als hundert Arbeitslose weniger geben. Sein Problem war, dass er nicht abgeben konnte. Er wollte immer alle Fäden selber in der Hand halten. Wenn man sah, was Manager aus vielen Firmen gemacht hatten, und dass sie für Bruchlandungen auch noch mehrere Millionen Abfindung bekamen, aber gleichzeitig Hunderte Arbeiter und Arbeiterinnen arbeitslos wurden. Da konnte ich ihn schon verstehen, wenn er sagte: »Wenn die mit ihrem persönlichen Kapital für ihren Mist, den sie bauen, haften müssten, dann sähe die Welt anders aus.« Aus diesem Grund wollte er dann doch lieber etwas bescheidener bleiben.
Der Grappa war leer, und es war jetzt auch schon richtig kalt geworden. Meine Uhr zeigte schon neunzehn Uhr fünfzig an, Zeit zu gehen. Ich verabschiedete mich von Andy und wollte zahlen, aber die kleine Irina nahm mein Geld nicht.
»Dankeschön«, rief ich noch in Richtung Büro und verließ dann das Café. Auf dem Weg zum Rad überlegte ich noch, ob ich den Tatort besichtigen sollte, aber zu sehen gab es bestimmt nichts mehr. Es war ja schon alles dokumentiert, und auf meine Kollegen konnte ich mich verlassen.
Also ging ich weiter und machte mein Fahrrad los, um den Heimweg anzutreten. Es war zwanzig Uhr fünf, als ich zu Hause ankam. Ich stellte mein Rad in den Keller und ging die Treppe hoch.
Im Erdgeschoss kam mir der kleine Sven entgegen. Er war auf dem Weg in den Keller, um Getränke zu holen. Seine Angst war ihm ins Gesicht geschrieben.
»Na Sven, wie sieht’s aus bei dir, alles in Ordnung?«
»Weiß nicht, ist noch jemand unten?«
»Nein, alles dunkel. Musst du Getränke holen?«
»Ja.«
»Angst?«
»Hm, ja.«
»Kenn ich, ging mir auch immer so als Kind.«
»Was hast du dagegen gemacht?«
»Gar nichts, ich musste, sonst hätte ich schlechte Karten gehabt bei meinem Papa, aber ich kann dir sagen, dass ich heute weiß, dass die Angst unbegründet war. Es gibt nichts Schlimmes im Keller. Keine Räuber, Diebe, Mörder, Gespenster oder sonst irgendwas, kannst du mir glauben.«
»Meine Mutter hatte mir das auch immer gesagt, aber geholfen hatte es nie was.«
»Pass mal auf, wir machen einen Deal, wenn du mir ein Konzert auf deinem Klavier versprichst, dann geh ich mit dir in den Keller, was hältst du davon?«
Schlagartig hellten sich sein Blick auf, und man konnte förmlich spüren, wie die Angst aus ihm wich.
»Ja klar, mach ich, überhaupt kein Problem. Wann?«
»Das werde ich dir noch sagen, hab im Moment viel um die Ohren. Los komm, lass uns gehen.«
Trällernd lief er die Kellertreppe nach unten, ich folgte ihm bis zu ihrem Keller, wartete ordentlich, bis er sein kleines Körbchen voll hatte, und ging dann mit ihm wieder die Treppen hinauf. Man konnte richtig Mitleid haben, wie er da unter seiner Last schnaufte. Trotz allem hatte ich ihm schon genug geholfen. Zu meiner Zeit hätte ich von keinem Erwachsenen Hilfe erwarten können, die hätten dann höchstens noch im Keller gewartet, um einen zu erschrecken.
Auf den letzten Stufen zum dritten Stock sah ich schon, dass etwas nicht stimmte. Meine Wohnungstüre war nicht verschlossen und stand einen Spalt weit offen, aus dem Flur drang Licht ins Treppenhaus. Ich hatte ein ungutes Gefühl im Bauch. Ich verabschiedete mich von Sven und versprach ihm, mich zu melden, wenn ich Zeit hätte, um seinen musikalischen Klängen zu lauschen.
Als er die Tür hinter sich schloss, wartete ich, bis das Licht im Treppenhaus ausging, um besser hören zu können, was in meiner Wohnung vor sich ging. Ein Tipp, den ich von einem Blindenlehrer bekommen hatte. Am Anfang konnte ich es kaum glauben, aber es war tatsächlich so. Bei Dunkelheit verbesserte sich wirklich das Gehör. Vorsichtig ging ich in Richtung Tür, um zu lauschen. Schranktüren klapperten und Schritte waren zu hören, einige dumpfe Schläge und undefinierbares Gemurmel drang zu mir durch.
Ich sollte die Kollegen rufen, dachte ich, aber dann kamen die Schritte in Richtung Flur und bogen in die Küche ab. Mir fiel etwas ein, was mir Hans immer wieder angekreidet hatte. Meine Dienstwaffe hing im Flur, wenn sie der Eindringling nicht schon an sich genommen hatte. Du bist nicht Kojak und wohnst nicht in Amerika, hatte er immer gesagt. Ich schwor auf alles, was mir heilig war. Wenn ich meine Waffe wieder in den Händen hatte, würde ich sie nie wieder an die Garderobe im Flur hängen.
Ich musste eine Entscheidung treffen und beschloss, den dümmeren Weg zu gehen. Mir schlug das Herz bis zum Hals, als ich auf Höhe der Tür war. Den Rucksack hatte ich abgelegt und dabei peinlich genau darauf geachtet, dass die beiden Flaschen nicht klapperten. Jetzt war Ruhe in der Wohnung, und ich konnte nicht lokalisieren, wo die Person sich aufhielt. Stand sie hinter der Tür und hatte mich gehört? Eine Minute wartete ich, vielleicht hörte ich doch noch was.
Ein gurgelndes Geräusch kam den Flur entlang und ich war perplex, die Klospülung. Entweder, der Eindringling war besonders dreist oder er hatte was an der Blase. Jetzt hieß es aufpassen. Wenn er von der Toilette kam, musste er unweigerlich durch den Flur, egal ob er die Wohnung verließ oder in ein anderes Zimmer ging. Die Toilettentüre ging auf, und leise Schritte waren zu hören, die sich wieder Richtung Küche entfernten, er musste barfuß oder in Socken unterwegs sein. Was suchte er da?
Egal, jetzt war der Zeitpunkt gekommen, länger durfte ich nicht warten. Ich drückte leicht gegen die Wohnungstüre und verfluchte im gleichen Augenblick meine Faulheit, die ich an den Tag legte, wenn es um die Arbeit im Haushalt ging. Die Tür gab ein aufdringliches Knarren von sich. Seit Tagen wollte ich sie schon ölen. Ich verringerte den Druck schlagartig. Scheinbar hatte er nichts gehört, denn es kamen immer noch Geräusche aus der Küche.
Zweiter Versuch, diesmal nicht langsam und zaghaft, sondern schnell und energisch öffnete ich die Tür. Ohne einen Laut glitt sie in ihren Scharnieren, bis ich sie stoppte. Geschafft, fast ohne einen Laut war ich in den Flur gelangt und stellte erleichtert fest, dass meine Waffe noch an ihrem Platz hing. Vorsichtig holte ich sie aus dem Halfter. Das Durchladen und Entsichern ging ohne Geräusche vonstatten. Ich nahm sie in beide Hände und machte mich auf den Weg in die Küche. Ich ging vorsichtig den Flur entlang, bis ich vor der Küche stand, deren Tür angelehnt war. Es drang Geklapper und Geschepper heraus und ich war mir sicher, dass ich bis jetzt unbemerkt geblieben war. Wenn mir vorhin das Herz bis zum Hals geschlagen hatte, so sprengte es jetzt fast meine Schädeldecke. Meine Hände begannen zu schwitzen, und mir kochte förmlich das Wasser im Hintern. Trotzdem ging jetzt fast alles automatisch. Nachdem er an der Tür vorbei gelaufen war und ich wusste, dass er mit dem Rücken zu mir stand, stieß ich die Tür auf, stürmte in die Küche und schrie: »Polizei, Hände hoch, keine Bewegung oder ich schieße.«
Eine Schüssel mit angemachtem Hackfleisch fiel auf den Boden und zerbrach in Tausend Scherben. Ein schriller Schrei brachte fast mein Trommelfell zum Bersten, und gleich danach bekam ich von meinem Gegenüber ein: »Du dummes Arschloch«, an den Kopf geknallt.
Marion stand in der Küche, nur mit Slip und BH begleitet, unter dem sich ihre Erregung abzeichnete. Gänsehaut zierte ihren ganzen Körper bis auf die Hände, die mit Hackfleischteig überzogen waren. Ein genussvoller Anblick war sie ohnehin, aber wie sie so dastand, war sie einfach umwerfend.
»Hast du sie noch alle? Ich hätte einen Herzinfarkt bekommen können oder sonst irgendwas! Also echt, solche Aktionen kannst du dir sparen, das war kein Spaß mehr.«
»Marion, entschuldige, für mich war es auch kein Spaß. Ich komme nach Hause und die Wohnungstüre steht einen Spalt offen. Da dachte ich, es ist ein Einbrecher in der Wohnung.«
»Ach so, und auf die Idee, dass ich es sein könnte, kommt der Herr nicht. Ich habe dir extra heute Morgen noch eine Nachricht an die Pinnwand gemacht.«
»Hab ich nicht darauf geachtet«, sagte ich und ging zur Pinnwand im Flur. Dort fand ich einen Zettel mit einem kleinen Herz am Ende.
»Lieber Bulle,
es war schön mit Dir heute Nacht. Um es zu wiederholen, leihe ich mir Deine Ersatzschlüssel aus für den Fall, dass du später kommst als ich. Vielleicht kannst Du noch Wein besorgen, ich koche heute für uns. Hab dich schon schlimm lieb.
Marion.
P.S.: Ich habe das Telefon auf stumm geschaltet, damit Du nicht wach wirst und fit bist für heute Abend.«
Ich wusste nicht warum, aber mit einem Mal löste sich die Anspannung, die sich über den ganzen Tag angestaut hatte. Ich sank im Flur zusammen und begann hemmungslos zu weinen. Marion kam aus der Küche gerannt, setzte sich neben mich, nahm mich in den Arm und wiegte mich wie ein Baby in ihren Armen.
»Was hast du? Hey, ich hab dich immer noch lieb, mach dir doch keine Sorgen. Ich bin nur so schlimm erschrocken, deshalb war ich so wütend, aber es ist doch schon wieder gut.«
Mein Gott, wie schön das war. Seit meiner Kindheit hatte mich keiner mehr so getröstet. Jetzt kannte ich Marion schon gute zwölf Jahre, aber so hatte ich sie noch nie erlebt. Ich versuchte, mit dem Weinen aufzuhören, aber es war, als wollten sich all die Tränen, die sich über die Jahre angesammelt hatten, mit einem Mal den Weg in die Freiheit bahnen.
Nach ich weiß nicht wie langer Zeit hatte ich mich insoweit wieder im Griff, dass ich die Papiertaschentücher benutzen konnte, die Marion mir hinhielt. Wir saßen noch eine Weile wortlos, Arm in Arm im Flur auf dem Boden. Es tat so gut!
»Jetzt erzähl mir bitte, was dich so fertigmacht?«
Ich haderte mit mir, aber dann erzählte ich ihr es doch.
»Also heute Morgen, als ich aufstand, wollte ich Kurt anmachen, und er ging nicht.«
»Das habe ich auch schon bemerkt, hab es auch schon ein paar Mal versucht, aber nicht mal auf mein Klopfen hat er reagiert.«
Das waren wohl die dumpfen Schläge gewesen, die ich vorhin gehört hatte, armer Kurt, ging es mir durch den Kopf.
»Deswegen bist du so traurig?«
»Nein!«