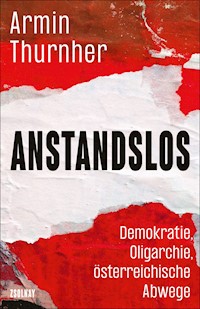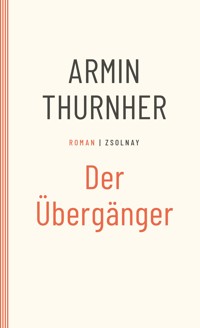
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sein Beruf ist Journalist, seine Passion die Musik, sein Leitstern der Pianist Alfred Brendel. "Der Übergänger" handelt von der übergroßen Verehrung des Erzählers für Brendel. Gerade deswegen wagt er es lange Zeit nicht, ihn um ein Interview zu ersuchen; als er es dann doch tut, wird die Bitte prompt abgeschlagen. Er schickt Brendel aber einen Text, den er über ihn geschrieben hat. Nun ist dieser zu einem Treffen bereit, es wird jedoch immer wieder verhindert. Als der Erzähler vom bevorstehenden Rückzug Alfred Brendels aus dem Konzertleben erfährt, beschließt er, es noch einmal zu versuchen. Armin Thurnher, Autor und Herausgeber der Wiener Stadtzeitung Falter, hat einen hinreißenden Roman geschrieben, eine Annäherung mit Elementen einer Autobiographie, die in zahlreichen Irrungen das Ziel immer wieder verfehlt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Sein Beruf ist Journalist, seine Passion die Musik, sein Leitstern der Pianist Alfred Brendel. »Der Übergänger« handelt von der übergroßen Verehrung des Erzählers für Brendel. Gerade deswegen wagt er es lange Zeit nicht, ihn um ein Interview zu ersuchen; als er es dann doch tut, wird die Bitte prompt abgeschlagen. Er schickt Brendel aber einen Text, den er über ihn geschrieben hat. Nun ist dieser zu einem Treffen bereit, es wird jedoch immer wieder verhindert. Als der Erzähler vom bevorstehenden Rückzug Alfred Brendels aus dem Konzertleben erfährt, beschließt er, es noch einmal zu versuchen. Armin Thurnher, Autor und Herausgeber der Wiener Stadtzeitung Falter, hat einen hinreißenden Roman geschrieben, eine Annäherung mit Elementen einer Autobiographie, die in zahlreichen Irrungen das Ziel immer wieder verfehlt.
Armin Thurnher
Der Übergänger
Roman
Paul Zsolnay Verlag
1. Eine merkwürdige Matinee
Du mit deinem Brendel-Tick, sagt Vera, meine Frau.
Vera ist Malerin. Ich bin politischer Journalist mit Hang zum Feuilleton, überhaupt zu unerwiderter Liebe.
Verehrung ist ja was Schönes, sagt Vera, aber muss man sie gleich bis zur Anbetung treiben?
Nur Ungläubigen ist Verehrung möglich, sage ich.
Ich mag es, mit halben Zitaten aufzuwarten, die Halbierung erhöht den Reiz des Paradoxen. Über die zweite Hälfte des Satzes denke ich noch nach. Sie lautet: Gläubige haben nur Lachen und Kriege. Zur Verleihung des Beethovenrings zu gehen hieß die Sache auf die Spitze zu treiben. Mit einem wie mir war dort nicht zu rechnen, musste ich mir bei Betrachtung des Publikums sagen. Noch weniger durfte ich erwarten, Fritz zu treffen. Unter all den staubig-verstockten Wiener Bürgern, unter all den quallig-giftigen Kulturbe triebs nu deln, unter all den blendend aufgelegten akademischen Tunicht guten, die sich zur Ehrung versammelt hatten, ausgerechnet Fritz. Fritz, den linken Intellektuellen, Leiter einer so genannten Denkfabrik der Sozialdemokraten. Den fröhlichen Fritz. Rundes Gesicht, geselchte Seele, spitze Zunge.
Hatte ich ihm gesagt, ich würde zur Verleihung des Beethovenrings gehen? Die Hochschule für Musik und darstellende Kunst war mir nicht vertraut. Wohl kannte ich Leute, die dort unterrichteten, genau genommen stand ich selbst auf der Liste der Lektoren, las in einem Postgraduate-Lehrgang etwas über Journalismus und Literatur, ohne je zu erwähnen, dass ich das für eine contradictio in adjecto hielt. Wozu auch, bei Studenten, die weder wussten, was auf dem Wiener Kongress verhandelt wurde, noch, ob der zur Zeit Karls des Großen oder Beethovens stattgefunden hatte und ob das nicht sowieso die gleiche Zeit gewesen war: die Vergangenheit.
Beethoven. Erst zum zweiten Mal sollte heute der Beet hovenring verliehen werden, und zwar an den Pianisten Alfred Brendel. Genau genommen war es der dritte Versuch, der zweite hatte vor Jahrzehnten mit einem Skandal geendet, als Brendels Kollege Friedrich Gulda den Preis zurückwies. Kaum jemanden hier kannte ich persönlich, aber alle sahen aus, als sollte man sie kennen. Manche hatte ich in Konzerten gehört, manchen ging es mit mir wie mir mit ihnen, sie hatten dieses Gefühl, mir zunicken zu müssen, was in mir den Zurücknickreflex auslöste, sodass bald aus allen Richtungen ein ander die Häupter zunickten, als striche ein Wind durch den Saal und bewegte die Köpfe der Anwesenden. Ein wogendes Feld einander mäßig gewogener Nicker.
In dieser Ein-, Ab- und Zunickstimmung war es mir recht, Fritz zu sehen. Den anglophilen Fritz, dessen Schärfe nur Platz für einen weichen Punkt ließ, allerdings einen insel großen: England. Seiner Englandverehrung wegen rief ich Fritz »Gordon«. Selbstverständlich war Gordon als konsequenter Englandfreund ein Anhänger des Dritten Wegs, daneben gab es für ihn keinen zweiten. Als sozialdemokratischer Denker befand er sich permanent auf dem Abstellgleis dieser Partei. Das Denken überlassen sie dort den Meinungsforschern, die haben das Ohr an den Massen, was schert sie ein anglophiler Habermas-Verehrer wie Gordon, der nur Unsinn wie den herrschaftsfreien Dialog im Sinn hat. So blieb ihm genügend Zeit, am helllichten Vormittag die Verleihung des Beethovenrings an Alfred Brendel zu besuchen.
Gordon nannte den zu Ehrenden »Krusty« oder auch »Krusty, den Clown«, damit auf dessen Aussehen ebenso anspielend wie auf dessen Vorliebe für bizarren Humor. Brü-der im Angelsächsischen sozusagen, Gordon und Krusty, nur wusste Krusty nichts von Gordon. Gordon hingegen wusste über meine Verehrung für Alfred Brendel Bescheid, er hielt es offenbar für nötig, ein Salzkorn in die Wunde dieser Verehrung zu streuen, indem er den Verehrten Krusty nannte. Findest du nicht, Krusty spielt heute einen Hauch zu laut, fragte er in der Pause eines Konzerts im Musikverein, bei dem Brendel mit dem Bariton Matthias Goerne auftrat. Er wollte mich ärgern, Brendel spielte keineswegs zu laut, vielmehr spielen die meisten Liedbegleiter zu leise, und gerade bei Brendel und Goerne ergab sich durch das mitmusizierende statt wie oft nur begleitende Klavier eine gleichwertige Partnerschaft zwischen Sänger und Pianist.
Ich fand sein Krusty-Gerede respektlos, konnte aber wenig dagegen tun. Widerspruch hätte Gordons Spleen nur gesteigert, wer weiß, was ihm noch eingefallen wäre. Er kannte natürlich die Geschichte, wie Brendel sich das erste Mal im Film sah und erschrak, weil der Kerl, den er da erblickte, mit seiner Körpersprache und mit seinem Gefuchtel so gar nicht ausdrückte, was die Musik ausdrücken sollte. Brendel stellte sich dann einen Spiegel neben das Klavier, in den er zwar selten schaute, der ihn aber zur Zurückhaltung mahnte. Auf das Problem war er aufmerksam geworden, als ihm im Schwung seines Schumannspiels die Brille über das Klavier davongeflogen war.
Die Feier begann mit Ansprachen. Auch in der Hochschule wusste man um den Humor des zu Ehrenden Bescheid. Man sang unter Anleitung des berühmten Chorleiters, zufällig war er gerade Rektor, einen Kanon auf den Text »Brendel ist ein schöner Name«, zu welchem Zweck der Saal in vier Abschnitte unterteilt wurde. Die öffentliche Probe war zugleich die Aufführung, und ich war froh, mich weit hinten hingesetzt zu haben, von wo ich das Gesicht des Ringempfängers nicht sehen konnte. Frisch und vierstimmig schallte durch den fichtenhell verschalten Saal, Brendel sei ein schöner Name. Mir schien, der solcherart gepriesene Namensträger sinke ein paar Zentimeter tiefer in seinen Sitz, als Schauspielschüler mit Ausdruck und Emphase einige seiner Gedichte vortrugen.
Bei der Rede eines bekannten, pianistisch tätigen Witzbolds richtete er sich ein wenig auf. Der erzählte von den Frühzeiten in den fünfziger Jahren, von den Referenzaufnahmen, die Brendel immer vorgelegt habe, wenn ihnen in Wien gerade ein Vorbild fehlte, wie sie ihre Beethovensonaten oder Schubertimpromptus zu spielen hätten. Wie lustig es gewesen sei, Brendel in Istanbul zu treffen, wobei das Lustige allein im Exotischen des Orts lag — Brendel in Stambul, man stelle sich vor! Deutsche Tänze um die Hagia Sophia, Alla Turca neben der Blauen Moschee, vielleicht eine fromme Meditation von Liszt über Mohammeds Fußabdruck im Topkapi-Palast, groß wie der Fuß eines Yeti nennt ihn Joseph Brodsky. Brendel im Zug, Brendel im Bus quer durch Europa, Brendel über miserable Klaviere fluchend, in schlecht geheizten oder überhitzten Sälen, dauernd im Streit mit mittelmäßigen Dirigenten und verlassen von unfähigen Klaviertechnikern. Brendel, Platten aufnehmend in ungeeigneten Studios, wo die Holzscheite in den Kaminen knacken und die Böden knarren, aber das sagte er nicht mehr, der Witzbold.
Ich dachte, das Fortgehen Brendels aus Wien könnte auch eine Flucht vor dieser Art des Wiener Humors gewesen sein. Dieser Wiener Humor fand die Tücke des Objekts lustig, die sich einer jungen, ganz und gar ungewissen Karriere in den Weg stellte. Im Rückblick schien dem Wiener Bürgerhumor all die Mühsal nur mehr ein Spaß gewesen zu sein. Der Wiener Bürgerhumor schätzt die Gegenwart nicht, aber er kann über die Vergangenheit lachen, wenn auch nicht über jede. Brendels Laudator bot ein Beispiel jenes Wiener Bürgerhumors, der sich bei Geburtstagen am Singen von Kanons erfreut, im Halten humoristischer Ansprachen sein Formbedürfnis erschöpft, im geselligen Verzehr von Szegediner Gulasch seinen Beitrag zur bürgerlichen Öffentlichkeit leistet und in der Aufführung von Stegreifspielen seine Erfüllung findet. War Brendel, der gesagt hat, Wien sei eine sehr gute Stadt gewesen, um im Protest darin zu leben, vor dieser humorigen Wiener Szegedinervergulaschung ins englische Stilvermögen entwichen? Vom Krautfleisch zum Rindfleisch, vom Stahlbad des Bürgerhumors in die vis comica der Civil Society?
Dabei liebten ihn die Wiener Bürger. Man kann sich seine Liebe nicht aussuchen. In den Augen manches konservativen Politikers gewann ich geradezu menschliche Züge, sobald ihm meine Brendelverehrung bekannt wurde. Ein kohlschwarzer Kanzler gewährte mir ein Interview nur wegen eines Textes, den ich über Brendel geschrieben hatte, wie mich seine Pressechefin bei dieser Gelegenheit huldvoll wissen ließ. Die Kabinettschefin des kohlschwarzen Kanzlers hatte mich angerufen und tatsächlich gefragt, ob ich nicht ebenfalls Goerne für indisponiert gehalten hätte, sie habe mich im Konzert bemerkt, ich hätte ergriffen ausgesehen, sagte sie. Das mochte so gewesen sein, jedenfalls waren es die einzigen privaten Worte, die ich je mit ihr gewechselt habe. Und nein, Goerne war nicht indisponiert, sagte ich. Brendel spielte nur zu laut.
Das Beethovenstreichquartett an der Hochschule stand Brendel mit Würde durch; es war keine schlechte Aufführung, man konnte im Gegenlicht die Staubpartikel tanzen sehen, als der koreanische Stimmführer sich mit etwas dün-nem Ton durch das Allegretto von Opus 135 geigte. Danach sprach der frisch Beringte, und er sprach wirklich frisch, gerade weil er leicht ermüdet wirkte. Müde von den Ausschweifungen des Wiener Bürgerhumors, aber unter dem Mantel seiner unresignierten Müdigkeit setzte er dem Bürgerhumor seinen Witz entgegen. Einen vorsichtigen, tastenden Witz, bemüht darum, nicht durch Schärfe zu kränken oder zu verletzen. Einen gleichsam intonierten Witz. Wenn Brendel sprach, schien hinter dieser Behutsamkeit ständig jener Stachel zu lauern, den es ihm vor allem zu vermeiden galt; Menschen, die Angst haben, andere zu verletzen, haben diese Angst nur deswegen, weil sie wissen, wie gut sie verletzen können. Er verstand es, die Spitze seines Witzes in Filz zu hüllen.
Diese vorsichtige, jede Formulierung abwägende Art zu reden berührte mich. Er mag seine eigene Maliziosität und ist deswegen auf der Hut vor ihr, dachte ich. Nichts Auftrumpfendes war da, bloß dargestellte Skepsis. Vorläufige Endgültigkeit auf leisen Sohlen. Der Anfang schon im Bewusstsein, der Übergang zum Ende zu sein. Dabei redete Brendel nicht, er las einen Text vor, durchaus mit Gusto an seinen eleganten Formulierungen. Hier, jenseits des Krautfleischhumors, blieb kein Raum für Anekdotisches. Hinter Brendel klaffte der Steinway. Was fangen die stahlgebadeten Krautfleischianer mit dem an, was er ihnen über die Diabellivariationen erzählt, dachte ich, dieses Beethovensche Spätwerk, das er so bedeutend analysiert hat. Sie warten bloß darauf, dass er ihnen etwas vorspielt.
Es war nicht das erste Mal, dass ich Alfred Brendel sprechen hörte, nein, aber immer wieder nahm mich die zurückhaltende Art seines Vortrags ein. Seine Scheu vor den Zuhörern schien mir zugleich und mehr noch die Scheu vor dem Objekt seiner Rede zu sein. Merkwürdig, ein Mensch, der im Frack am Flügel die größten Auditorien bezwungen, der schon als Knabe im Zagreber Opernhaus deklamierend sein Publikum charmiert hatte, schien im Sakko und mit einem Manuskript in der Hand sein Verhältnis zu seiner Hörerschaft ganz neu finden zu müssen.
Andererseits hatte er dieses Publikum im Griff. Er leistete sich seine Schüchternheit im sicheren Bewusstsein einer funktionierenden Schlusspointe. Es war gewissermaßen eine Art Woody-Allen-Scheu, die er da zeigte, es waltete eine Art komischer Vorsicht, die leise rief, seht her, hier steht ein Mensch mit seinen Zweifeln und Schwächen, aber einer, der zweifellos darüber Bescheid weiß und mit ihnen, von ihnen und für sie lebt. Der Humor in der Musik war, nicht zum ersten Mal, sein Thema. Brendel konnte seinen Vorrednern dankbar sein, sie hätten für keinen besseren Kontrast sorgen können. Das Niesen als Thema einer Diabellivariation war es, auf das er hinauswollte, und er schloss mit dem Satz: »Denn Beethoven war Allergiker, wie ich.«
Sprach’s, setzte sich an den Steinway und spielte in den Beifall hinein die Variation als musikalische Demonstration einer allergischen Reaktion — besonders schlecht, wie er später mir gegenüber behauptete, aber vielleicht hatte er im Rückblick auch die Veranstaltung verwechselt. Mir gefiel’s. Es war zu schnell vorbei. Wir sahen einander zufrieden an, Gordon hatte keine Frechheit mehr parat, Krusty hatte sie ihm weggespielt, sozusagen.
2. Eine Schlange
Die Zeremonie war zu Ende, unversehens und riesengroß stieg der Zweck meines Hierseins vor mir auf. Ich hatte nämlich vor, Brendel zu fragen, ob er mir ein Interview geben wollte. Künstlerzimmer und dergleichen waren mir immer ein Gräuel gewesen, einen Agenten ansprechen oder Mittelsmänner einschalten wollte ich nicht, einfach anrufen konnte ich nicht, also würde ich es heute wagen müssen. Während sich die Sitzreihen leerten, formierten sich die Gratulanten; Ottern und Kaninchen stellten sich in Zweierreihen auf, am Kopf der Schlange wartete Brendel, mit seinem großen Körper überragte er die Menge, leicht neigte er den Oberkörper nach vor und legte den Kopf schräg, um zu hören, was für Freundlichkeiten die Menschen ihm ins Ohr zu blasen hätten.
Das geb ich mir wirklich nicht. Gordon war wieder er selber. Nein, echt, da willst du dich anstellen? Ich sicher nicht. Ich stand noch nicht in der Zweierreihe, und mein Zweier war im Begriff, mir abhanden zu kommen. Leichten Schritts bewegte sich Gordon zur Tür und machte beim Abgang ein artiges Katzbuckerl.
So long! Da stand ich, der Letzte in der Reihe. Nein, ein Paar wartete hinter mir, der kultivierte Kulturmanager mit seiner Frau. Wären sie nicht gewesen, ich hätte es mir anders überlegt und wäre nach Hause gegangen. Jetzt aber, den kultivierten Kulturmanager im Rücken, durfte ich mich eingekeilt fühlen, brauchte an Flucht nicht mehr zu denken und konnte mich langsam nach vorne schieben lassen. Es gibt kultivierte und unkultivierte Kulturmanager. Die unkultivierten werken mit derartiger Selbstverständlichkeit an den Schalthebeln des Kulturbetriebs, dass man sich wundert, wenn man noch einen kultivierten Kulturmanager trifft. Das seltene Exemplar hinter mir hatte Klavier, Komposition, Physik und Finanzwissenschaften studiert, und zwar an der Sorbonne. Darüber hinaus war er ein Experte für zeitgenössische Musik und ein vornehmer Mensch. Er sprach so leise und schien so viel Kraft zur Artikulation zu brauchen, dass man das Ohr ganz nahe zu seinem Mund bringen musste, wollte man hören, was er sagte. Trotz seiner Unaufdringlichkeit hatte sich der kultivierte Kulturmanager stets entschieden für Moderne und Avantgarde eingesetzt. Er hätte wohl gesagt: bloß für gute Musik.
Brendel, schien es, hatte für jeden in der Schlange Zeit, schien jeden zu kennen, sich für jeden zu interessieren, hatte jedem etwas zu sagen. Langsam schob sich die Schlange voran, sie verkürzte sich beim Schieben, es war beinahe, als würde der ungeheuer freundliche Brendel, auf den sie zudrängte, sie vertilgen. Ein freundliches Ungeheuer. Endlich war sie beinahe aufgebraucht.
Jetzt ich.
Ich stelle mich mit meinem Namen und dem meiner Zeitschrift vor.
Lieber Herr Brendel, äh, ich möchte Ihnen herzlich zum Beethovenring gratulieren und Ihnen sagen, wie sehr ich mich freue.
Viel hölzerner kann man es kaum formulieren.
Vielen Dank. Freundlich fragender Blick.
Herr Brendel, ich verehre Sie schon lange, und ich weiß, Sie haben viel zu tun, wollte Sie aber bei dieser Gelegenheit doch fragen, ob Sie Zeit für ein Interview hätten?
Freundlich-amüsiertes Lachen. Fast ein Ohr-zu-Ohr-Lachen. Der Neigungswinkel nach vor nimmt um drei Grad zu. Was ist denn das für ein komischer Kleiner, fragt er sich.
Oh Gott, ich wusste es die ganze Zeit, so macht man das einfach nicht. So kann man das nicht machen! Vergiss Brendel, du Idiot!
Nein, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, und das bisschen Zeit, das ich habe, brauche ich zum Schreiben meiner Gedichte, sagt Brendel. Seine Konzerttournee zum siebzigsten Geburtstag habe ihn schon zu sehr vom Schreiben abgehalten.
Immerhin redet er nicht herum. Irgendwie fühle ich mich erleichtert. Totale Niederlage, aber wenigstens kein Stress. Brendel hält noch immer meine Hand mit beiden Händen. Sie sind warm, trocken, groß, kräftig vom Üben, man spürt die durchgebildete Muskulatur, Mister Universum von der Fingerspitze bis zur Handwurzel. Gordon hätte gesagt: Krusty von der Handwurzel zu den Zehenspitzen! Jetzt nicht so etwas denken! Über seine Fingerspitzen, die er beim Spiel stets mit Hansaplast zuklebt, hätte ich ihn zum Beispiel gern ausgefragt. Daraus wird nun nichts.
Mut zusammennehmen: Haben Sie den Text gelesen, den ich zu Ihrem Geburtstag geschrieben habe? Natürlich hatte ich den Geburtstag auch verpasst, die Geschichte ist erst zehn Tage danach erschienen, das sage ich noch dazu, ich Idiot!
Nein, habe ich leider nicht …
Na also, das war’s. Super hingekriegt. Abgang. Wenigstens halbwegs Haltung bewahren dabei. Halt: Da kommt noch was.
… aber ich habe einiges davon gehört!
Oho, doch nicht alles verloren! Darf ich Ihnen dann den Artikel schicken?
Er bittet darum. Ich empfehle mich, ihm unpassenderweise viel Glück beim Schreiben wünschend.
Schon fasst er voller Wärme den verbindlich lächelnden kultivierten Kulturmanager ins Auge, schon hat er dessen Hand in seine beiden Hände genommen. Der sagt erst einmal nichts. Ich hätte gern gehört, wie man es eleganter macht. Reden ist Silber, leise reden ist Gold. Gut, die kennen einander aus Jahren Salzburg, der kultivierte Kulturmanager war kaufmännischer Direktor der Festspiele gewesen. Nach einem Schritt bin ich außer Hörweite. Beiseite warten ein paar von Brendels Freunden. Die Quartettspieler haben Instrumente und Noten eingepackt. Niemand beachtet sie. Saaldiener werden sichtbar. Ich werde unsichtbar.
3. Am Apparat
Hallo, hier spricht Alfred Brendel. Ich bin jetzt wieder in Wien und habe unterwegs Ihren Aufsatz gelesen. Ich wollte mich dafür bedanken, er gehört zum Besten, was über mich geschrieben wurde. Mir gefällt die Art, in der er formuliert ist, und ich danke Ihnen vor allem auch für die Wärme, mit der er geschrieben ist. Ich hoffe, dass wir im März, wenn ich zu meinem Philharmonischen nach Wien komme, Gelegenheit haben, einander zu sehen und miteinander zu reden.
Könnte ein Tag schöner beginnen als mit dem Abhören des Anrufbeantworters? Früher begann jeder Tag mit dem Abhören des Anrufbeantworters, niemandem wäre es ein-gefallen, seine Mobiltelefonnummer auf der Visitenkarte preiszugeben. Sofern man überhaupt ein Mobiltelefon hatte. Es war der Tag vor meinem Geburtstag. Dieser Anrufbeantworter durfte nie mehr gelöscht werden, egal ob es Kosten verursachte oder mich schwerer erreichbar machte. Vielleicht sogar für Anrufe von Alfred Brendel.
Brendels siebzigster Geburtstag war der 5. Jänner 2001 gewesen. Damals musste man schon ein Handtelefon haben, durfte aber noch nicht ohne Festnetztelefon sein. Ich war froh darüber, so konnte ich mir Brendels Nachricht gleich noch einmal laut anhören. Sie war zweifellos echt, ich erkannte seine Stimme wieder. Brendel fand nicht nur meinen Text gut, er wollte mich sogar treffen. Abgeschlagenes Interview hin oder her, das war doch was!
Dass er meinen Text mit Wärme geschrieben fand, wunderte mich nicht. Er war mit Feuer geschrieben! Ich hatte mich auf die Etymologie seines Namens bezogen, wie sie Brendel selbst in einem umfangreichen Interview mitgeteilt hatte. Brändle bedeutete demnach so viel wie »kleiner Brand«. Mit dem Diminutiv ist man dort, wo ich herkomme, auf du und du, dort richtet man sich mit Hilfe des Diminutivs das ganze Leben dem eigenen Format gemäß ein. Und Brendel gefiel sich offenbar in seiner Rolle als genealogisch programmiertes Feuerteufli.
In jenem von Brendel gelobten Artikel hatte ich mit Wärme die Gefahr durch Feuer geschildert. Meine Wohnung, schrieb ich, wäre abgebrannt, und wäre nicht als Einziger des ganzen Wohnhauses ich noch wach gewesen, hätte eine schlimmere Feuersbrunst mehrere Menschenleben kosten können. Ich war damals gerade umgezogen und hatte noch ein paar Kisten im Gang stehen, die ich — das Haustor war schon versperrt, es ging auf Mitternacht — dort stehen ließ, in der sicheren Annahme, es würde sie niemand stehlen. Erst später ging ich hinunter, sie zu holen, und entdeckte, dass aus einer Wohnung dichter Rauch quoll. Der Grund für meine Eile: Ich wollte Alfred Brendel nicht versäumen, der spätnachts im Fernsehen Schubert spielte und erklärte.
Dieser Hausbrand hatte mir als Vorwand gedient, Brendels Fernsehvortrag zu schildern. Ironisch, mit poetischer Kraft, mit Witz und mit intellektueller Durchdringung seines Gegenstands, wie man es von einem klassischen Musiker in der Regel nicht (und damals, es handelt sich um die späten siebziger Jahre, schon gar nicht) erwartete, sei Brendel vorgegangen. Ich lobte seine Fähigkeit, für Musik einen adäqua-ten sprachlichen Ausdruck zu finden, was bekanntlich selten gelinge. Den Des-Dur-Mittelteil von Schuberts viertem Moment Musical D 780 in cis-Moll etwa habe er als »Traumpolka« beschrieben, die über Abgründe und Klüfte einer scheinbar harmlosen Idylle dahinschwebe.
Auch war zu berichten, dass die Umstände der Arbeit an dieser ganz Schuberts Klavierwerk gewidmeten dreizehnteiligen Serie, die der Norddeutsche Rundfunk 1975 und 1977 aufnahm, schwierig waren. Ich ließ Brendel selbst zu Wort kommen: »Es war die erste Stereoaufnahme im Bremer Fernsehen. Die Kabel liefen in den Saal hinein, es war Sommer und zum Teil fürchterlich heiß. Wir wollten nicht viele Kameraeinstellungen machen, wie das sonst manchmal üblich ist, sondern möglichst ruhig über lange Strecken etwas stehen lassen, um Konzentration herzustellen und den Eindruck eine Konzertaufführung zu vermitteln. Das bedeutete, oft mehr als 200 Takte am Stück spielen zu müssen, und man weiß, macht man einen Fehler, muss man von vorne anfangen.«
Brendels Aufnahmen waren für mich ein fröhlicher Schock gewesen. Dabei, schrieb ich, sei einem einer entgegengetreten, der den herkömmlichen Begriff des Interpreten entscheidend erweiterte. Umfassend gebildet, skeptisch, unerbittlich am Notentext orientiert, trotzdem an dessen Kontext interessiert, kritisch, aber gleichsam mit nachsichtigem Augenzwinkern, erhaben, aber irgendwie lausbübisch — so einen, schrieb ich, hatte ich noch nie gesehen, und so hatte ich Schubert noch nie spielen hören. Gewöhnlich hört man diese Stelle so, pflegte er zu sagen, ich hingegen — lausbübisch verhaltenes Lächeln — spiele sie so. Brendel erklärte, warum er sie anders akzentuierte. Dazu kamen eine Mimik und eine Gestik, die zuweilen grotesk schienen, aber in ihrer Weise nichts anderes taten, als die intellektuelle und emotionale Intensität der Auseinandersetzung auszudrücken.
Die fliegende Schumann-Brille war längst Geschichte, mit Hilfe seines Spiegels hatte sich der wilde Kerl bereits zurückgenommen. Und doch schien er mir im Vergleich zu Pianisten, die gerne leere Entrückungsgesichter zeigen, völlig anders: ein Gesicht, das Schalk und Ergriffenheit, Skepsis und Offenbarung vereinte. Er hatte aus seinem Problem eine Stärke gemacht, schrieb ich. Er hatte die Konsequenz aus seiner Erkenntnis »viele Leute sehen ja leider besser, als sie hören« gezogen. Nun zeigte er kontrollierte musikalische Schauspielkunst.
Ich erinnerte mich, einen Vortrag besucht zu haben, den Brendel im Rahmen des Zyklus seiner Beethovensonaten hielt. Dabei demonstrierte er das Crescendo innerhalb eines angeschlagenen Tons. So etwas hält man nicht für möglich, da das Klavier bekanntlich kein Streichinstrument ist. Er, Brendel, strebe allerdings danach, sagte er, die Klangmöglichkeiten des Instruments zu erweitern, er fasse ein Stück instrumentiert auf, imitiere da Flöten-, dort Streicherklang, wenn es der Charakter des Stücks erfordere. Und nun bitte er, genau zuzuhören: Brendel schraubte sich in die Taste hinein, applizierte eine Art Vibrato mit Finger und Pedal, stauchte scheinbar das Gewicht seines ganzen Körpers auf den fraglichen Finger, vibrierte dazu mit Hals und Backe und Fußspitze, und siehe da, der Ton, einmal angeschlagen, wurde nicht schwächer, sondern stärker. Übrigens, fügte Brendel, der die Verblüffung im Saal sichtlich genoss, nach einer kleinen Pause hinzu, gehöre bekanntlich zu jeder Bühnenaufführung ein Stück Suggestion.
So hatte ich damals geschrieben, und es hatte Brendel gefallen. Denn es war alles wahr und nach bestem Wissen und Gewissen aufgezeichnet. Aber es war bei weitem nicht alles, was aufzuzeichnen gewesen wäre.
Brendel saß im Fernsehstudio am Flügel, ich saß vor dem Fernseher in meiner Wohnung im achten Wiener Bezirk und betrachtete sein Spiel. Die Wohnung gehörte einem Wiener Apotheker von gesündestem Krautfleischhumor, der in Holland wohnte. Seinen Humor zeigte dieser tüchtige Pharmazeut, indem er eine sieben Seiten lange Inventarliste anfertigte, die jedes Stück anführte, das sich in der Wohnung befand, und sei es noch so wertlos. Der Mietvertrag und drei Durchschläge dieser Liste waren in Kitzbühel zu unterfertigen, wo der Apotheker Skiurlaub machte und die Ablöse bar einstrich. Ich kam von Bregenz und hatte mit der Eisenbahn einen mehrstündigen Umweg in Kauf zu nehmen. Die Kitzbüheler Bleibe des Apothekers war in entsetzlichstem Rustikalgeschmack eingerichtet, es schneite heftig, der Zug hatte mehrere Stunden Verspätung, zudem fiel die Heizung aus, sodass ich verkühlt und fiebrig in Wien ankam. Ich war nur dieses eine Mal in Kitzbühel gewesen, diesem Zentralort österreichischen Unwesens, den ich vorgehabt hatte, nie zu betreten.
Die Inventurliste und die regelmäßigen Briefe des Apothekers voll zudringlicher Neugier vermiesten mir den Aufenthalt in der komfortablen Wohnung. Was ich an ihr am liebsten mochte, war die Reflexion des nächtlich beleuchteten Brunnens auf dem Albertplatz. Das Wasser spiegelte sich an meiner Zimmerdecke, auf dem Rücken liegend, konnte ich der Wellenbewegung zusehen und mich fortwohin wünschen.
Es ging gegen Mitternacht. Brendel trug eines jener leicht entflammbaren Seventies-Nylonhemden, es war hellblau und hatte zwei Brusttaschen mit dreieckigen, verschließbaren Klappen. Es lag eng am Körper an, zeigte die muskulösen Oberarme und Ansätze der Brustbehaarung seines Trägers. Er las von mit Schreibmaschine beschriebenen Blättern herunter, was er zu Schuberts Kompositionen geschrieben hatte.
Die Kamera zeigte sein Bild in einer ruhigen Einstellung und enthielt sich jenes fahrigen Zoomhantierens, das zeitgenössische Fernsehregisseure für modern halten und mit dem sie jeden Ansatz von Betrachtung zerstören. Sie vertragen weder die Abwesenheit von Lärm noch den unbewegten Ausschnitt eines Bildes. Was machen diese Leute, dachte ich, wenn sie vor einem Baum oder einem Gemälde stehen? Brendels Ansicht jedoch blieb auf eine beinahe störrische Weise unbewegt, er las sein Blatt bis zum Ende, machte eine leichte Wendung, die Kamera wechselte die Einstellung, und er las das nächste Blatt bis zum Ende.
Wenn er das Werk dann spielte, war er festlicher gekleidet, trug Anzüge mit auf Hamburger Art ausgestellten Hosen und breitknotige Krawatten, wie sie damals Mode waren. Die drei Klavierstücke aus dem Nachlass seien in Schuberts Todesjahr komponiert worden, sagte er; man finde in ihnen Übergänge von einer Kahlheit wie beim späten Liszt, zum Beispiel jene Stelle im letzten Stück, er spiele sie kurz vor, wo das C-Dur ohne jedes vermittelnde Zwischenglied nach Des-Dur wechsle.
Ich musste zwei-, dreimal in den Hausflur, um die Umzugskartons heraufzuholen. Beim ersten Mal schien es, als habe einer sein Schnitzel zu scharf angebraten. Je später der Abend, desto dunkler das Schnitzel, dachte ich. Bedauerlich, aber nicht besorgniserregend. Beim zweiten Mal durchzog außer dem Duft schon ein leichter Dunst den Gang. Es roch definitiv brenzlig. Es brendelte so stark im Flur, dass ich in die Wohnung zurücklief und die Feuerwehr anrief. Man bringt in solchen Fällen zuerst die Notfallnummern durcheinander, aber ehe man verblutet ist, sagen einem die bei der Polizei gern die richtige Nummer der Feuerwehr. 122, falls Sie diese zu Recht hoch geschätzte zivilgesellschaftliche Institution einmal brauchen sollten.
Die Herren in der Zentrale dieser Institution hoben sogleich ab. Sie wirkten sehr entspannt. Es brennt ja dauernd irgendwo, Zimmerbrände, Katzen auf hohen Bäumen und umgekippte Lkw-Züge werden schnell zur Routine. Leider konnte auch ich keinen Großbrand eines Chemikalienlagers oder einer Feuerwerkskörperfabrik bieten.
Sind Sie sicher, dass es brennt?
Ich sehe Rauch, und es riecht nach einem Brändle.
Die entspannten Herren hatten offensichtlich zum Diminutiv eine weniger entspannte Beziehung als ich: Sie wissen, wenn wir kommen, und es ist kein Feuer, zahlen Sie den Einsatz, sagte der Mann am Telefon der Zentrale.
Kein Rauch ohne Feuer? Ich sah den Löschzug vor mir, zwei Lkw, drei Begleitfahrzeuge, Polizei, Rettung, Notarzt, jede Menge hoch geschätztes, zivilgesellschaftlich wichtiges Personal, überschlug im Kopf die Summe, fand sie zu hoch, bedankte mich höflich und legte auf.
Im C-Dur-Stück, dem letzten, träfen zwei böhmische Nationaltänze aufeinander, erklärte Brendel. Eine Polka und eine Sousedská. Die Polka klinge, als stamme sie aus der »Verkauften Braut«, man höre nur, während die Sousedská in Dvo®áks »Slawischen Tänzen« stehen könnte. Er spielte auch diese an.
Ich wurde unruhig und ging ein drittes Mal hinunter. Diesmal war der Gang voll dichtem Rauch. Er quoll in Schwaden unter einer Tür im Erdgeschoß hervor. Der Geruch war beißend. Es roch so eindeutig, dass ich die Kartons sein ließ, an der Rauchquelle Sturm läutete, mit Fäusten an die Tür trommelte, als sich noch immer nichts rührte, wieder die Stufen zu meiner Wohnung im Stock darüber hinaufhetzte und die Nummer der Feuerwehr wählte. Diesmal erwischte ich sie auf Anhieb.
Kommen Sie sofort, es brennt, rief ich ins Telefon, ich zahle alles!, und eilte wieder ins Erdgeschoß, ohne die Antwort abzuwarten.
Eben öffnete sich die Tür, an der ich geläutet hatte. Eine große, knochige Frau in Unterhose trat auf die Schwelle. Sonst war sie nackt, böhmisch, dachte ich, ich weiß nicht warum, waren es ihre dunklen Haare und ihre großen, schwarzen Augen, mit denen sie mich fassungslos ansah? Hinter ihr stand die Wohnung in Flammen. Die Voilegardinen waren nur noch Fackelstummel, neben einem Polstersessel brannten müde die Reste eines Couchtischs. Der Fauteuil verschmorte und schmolz tropfenweise auf den versengten Teppich. Sie war offenbar von Sinnen und brachte kein Wort heraus.
Im rechten Winkel zu ihrer Wohnung, unmittelbar daneben, eine zweite Wohnungstür. Ihre Bewohner befanden sich in höchster Gefahr, also läuten! Keine Reaktion, es war ja schon fast Mitternacht. Die Knochige drehte sich um, sah mich vorwurfsvoll an, wollte in die Flammen zurückgehen und die Tür hinter sich schließen. Ich fasste sie gerade noch am Arm. Sie begann sich zu wehren. Stumm rangen wir miteinander. Sie war stark, aber zwischendurch gelang es mir, immer wieder beim Nachbarn zu läuten. Endlich öffnete er und streckte sein verschlafenes Grantgesicht heraus.
Wosislos?
Ich versuchte immer noch, meine Arme um die Knochige zu schlingen. Der Anblick ihrer Brüste schien ihn zu wecken, aber auch zu irritieren.
Es brennt!
Wo?
Eine Geste genügte, Schlafmützes Blick folgte meiner Bewegung und sah in einen Glutofen. Jetzt war Schlafmütze wach und bewegte sich, holte Frau, Kind und Hund aus dem Bett und wollte weglaufen.
Moment, rief ich, halten Sie die da fest. Sie will sich umbringen.
Ich drückte dem Kerl die stumme Knochige in die Hand und lief wieder die Stiege hinauf. Blick zurück: Ein schönes Paar, schon ging der Tanz los, sie im Slip, er im Nachthemd mit verrutschter Brille. Wenigstens hatte er kapiert, was los war, und ließ sie nicht zurück in ihre Wohnung. Weiß Gott, wie und warum sie ihr Heim in einen Herd verwandelt hatte. Ihr Fernseher war längst implodiert, es ließ sich nicht mehr feststellen, ob Brendel darauf gelaufen war oder nicht.
Haben Sie je die Feuerwehr angerufen? Sofort hatten die Herren von der hoch geschätzten zivilgesellschaftlichen Institution die Telefone des gesamten Wohnhauses unter Kontrolle, telefonieren war nicht mehr möglich. Statt des Freizeichens hörte man ein Tonband mit nützlichen Verhaltensregeln: Schließen Sie die Fenster, verlassen Sie die Wohnung nicht. Wir werden in wenigen Minuten an der Einsatzstelle sein. Wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie.
Hallo!, rief ich laut. Ehe ich hinzufügen konnte, hier spricht Alfred Brendel, meldete sich eine beruhigende Stimme aus der Zentrale. Schweres Wienerisch, das kam dezidiert nicht aus Bangalore. Dort können Sie angeblich texanischen Drawl imitieren oder Dialekte der Inuitsprache so simulieren, dass Rednecks und Eskimos ohne zu Murren ihre Gebühren zahlen, aber das Meidlinger L haben sie gewiss nicht im Repertoire.
Hallo, ich bin der, der Sie verständigt hat! Wann werden Sie hier sein? Haben Sie einen Psychiater im Team? Sollte noch keiner vorgesehen gewesen sein, wurde er vermutlich jetzt verständigt. Ich brauche mich nicht aufzuregen, beschied mir das geschulte L, es könne sich nur um Minuten handeln.
Da war es schon, das Folgetonhorn. Tönt übrigens viermal so laut wie in den fünfziger Jahren. Blaulicht zuckte, wischte die Wasserspiele auf meiner Decke weg und verwandelte den Albertplatz in eine Notfallsdisco, während im Fernseher noch immer Brendel feurig das dritte der Klavierstücke aus dem Nachlass interpretierte, Deutschverzeichnis 946, in C-Dur, munter wechselten einander Polka und Sousedská ab.
Nie begrüßte ich ein Blaulicht freudiger. Hurtig sprangen die behelmten Männer aus dem Löschzug, rollten Schläuche aus, schlossen Pumpen an, spritzten Fontänen in die zwei Fenster, aus denen Flammen schlugen, trampelten im Laufschritt die Stiegen hinauf, des Liftes nicht achtend, Äxte gezückt. Die Knochige war kaum von ihrer Wohnung wegzubringen, die Rettung kümmerte sich um sie, atemlos erklärte ich dem Einsatzleiter die Lage, während oben Holz splitterte.
Holz? Äxte! Wieder schnellte ich die Stufen hinauf. Ich lernte den Architekten dieses Gemeindebaus zu schätzen, es war eine bequeme Stiege, Stufenhöhe ideal, die Steine an den Rändern rutschfest gestöckelt, prestissimo ließen sich drei Stufen mühelos auf einmal bewältigen.
Mit behaglicher Professionalität hatten die Axtschwinger, die militante Abteilung der hoch geschätzten zivilgesellschaftlichen Institution, gerade die Tür zu meiner Nachbarwohnung demoliert. Niemand zu Hause. Sie zuckten die Achseln und gingen daran, mit krachenden Axthieben den Parkettfußboden aufzuhacken. Es war die Wohnung genau über dem Brandherd, und sie wollten sichergehen, dass die Balken nicht Feuer gefangen hatten.
Immerhin konnte ich sie durch Vorweisen des Schlüssels davon abhalten, die Tür zu meiner Wohnung ebenfalls einzuschlagen, aus der Schuberts nachgelassenes C-Dur-Impromptu gerade in die furiose Coda mündete.
4. Wasserflüsse Babylons
Seit diesem Feuer war ich hinter Brendel her. Einmal saß ich sogar auf der Bühne in seinem Rücken. Von den Beethovensonaten hatte ich ihn einige im Konzert spielen hören, ein Konzert mit der Alban-Berg-Sonate und Mozarts a-Moll-Sonate war mir in besonderer Erinnerung, der Art wegen, wie Brendel den zweiten Vorschlag im ersten Thema des ersten Satzes spielte. Ich meinte ihn beinahe dazu sagen hören: Gewöhnlich hört man diese Stelle so, ich hingegen … und sah ihn ein kaum wahrnehmbares, diabolisches Lächeln zeigen, ehe er sich zur Tastatur wendete. Zum anderen war da dieser langsame Satz, der einen lehren konnte, was Erhabenheit bedeutet. Unvergesslich bleibt mir das Konzert der letzten Zugabe wegen. Brendel spielte Ferruccio Busonis Bearbeitung des Bachschen Choralvorspiels »Nun komm, der Heiden Heiland«, das große Hände verlangt, wie Brendel sie hat, damit der Canto sich gleichsam ungezwungen von der diskreten, in Oktaven fortschreitenden Orgelpedalbegleitung abhebt.
Brendel spielte das so schön, so orgelhaft und klar, er ließ den Gesang über den Bässen so deutlich hervortreten, hob ihn so trennscharf von den Zwischenspielen ab, wie es selbst der pianistische Halbgott Dinu Lipatti nicht zustande gebracht hatte, jedenfalls auf der letzten Aufnahme nicht, die wir von ihm haben. Brendels Orgelbass, weich durch die Verschiebung, ging samtpfötig und unerbittlich wie der Fluss der Zeit; obstinat schritt er auf den Augenblick der Erlösung zu, ein Stück, um alle Musikstücke zu enden, ein Ende für jedes Konzert und für alle Konzerte, eine Ewigkeit von knapp vier Minuten. Es strömte der Gesang silbrig wie an Wasserflüssen Babylons, ohne dass man eine Sekunde daran gezweifelt hätte, dass Babylons Wasserflüsse silbrig flossen, er strömte hinauf in den dritten Rang des Musikvereins, wo wir saßen; Brendel da unten war ganz klein, aber sein Ton war groß, zart und einfach, und wie er strömte, hielt der Saal insgesamt den Atem an und war still, was nicht so oft vorkommt in diesem Goldenen Saal, wo immer einer hustet, scharrt oder knarrt, aber nun war es nicht toten-, sondern lebensstill, ein inniges Innehalten, eine kollektive religiöse Ekstase ohne einen Gott, ein Augenblick, wie ihn eben nur Musik hervorrufen kann.
Selten genug gelingt es ihr, das liegt an den Musikern, mehr noch an den Hörern, nun aber gelang es, es strömte silbrigzart in die Stille, und silberzart widerhallte es aus den Reihen von uns. Ein Stöhnen der Verzückung, wie es schien, ein epileptischer Anfall, wie sich zeigte, als Brendels letzter Akkord verklungen war.
Brendel merkte nichts davon, er nahm längst den Beifall entgegen, wir brauchten nicht zu helfen. Ärzte sind im Musikverein immer zur Stelle, der Goldene Saal ist voller Ärzte, Ärzte, die ihre Jeunesseabonnements schon vor der Matura hatten, fürchterlich Quartett spielende Ärzte, Ärzte, welche stöhnende Philharmoniker zum Krautfleischessen zu sich nach Hause einladen, Ärzte, die dann Bücher über Todesarten von Musikern verfassen. Auch Manager, Diplomaten und Banker sehen hier aus wie Ärzte. Ein iatrischer, nicht nur ein geriatrischer Saal. Manchmal meint man dort ein wenig Karbol oder Lysoform zu riechen, ein andermal macht sich eine leicht narkotisierte Stimmung breit, immer klingt es wie auf einer pulmologischen Station für nervöse Reizhustenkranke. Bei Herzinfarkt oder einem epileptischen Anfall wäre unbedingt der Goldene Saal zu empfehlen, es ist ausreichend sachverständiges Personal da.