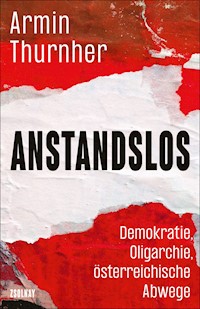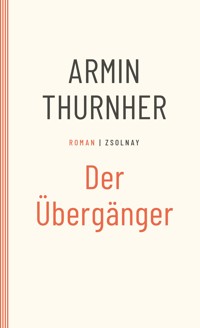Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ist es zum Fürchten um Europa, besteht noch Hoffnung? Die "New York Times" illustriert den Aufstieg rechter Kräfte in den Ländern der EU graphisch: Den kräftigsten roten Balken erhält Österreich. Jetzt muss aufgrund bürokratischer Schlamperei die Wahl des künftigen Bundespräsidenten wiederholt werden. Im Mai 2016 erhielt der Kandidat einer Partei, die fundamentale europäische Werte in Frage stellt, fast die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Ist es Orbánisierung? Jörg Haiders Erbe? Oder nur ein besonderer Fall von Verkommenheit? Es ist, als spürte die krisengeschüttelte EU, dass Österreich wieder einmal die kleine Welt ist, in der die große ihre Probe hält. In seinem fulminanten Essay zeigt Armin Thurnher, was es mit der Europaverdrossenheit auf sich hat und was man der Rechten in der Politik entgegensetzen sollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die New York Times illustriert den Aufstieg rechter Kräfte in den Ländern der EU graphisch: Den kräftigsten roten Balken erhält Österreich. Im Mai erhielt der Kandidat einer Partei, die fundamentale europäische Werte in Frage stellt, fast die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Besorgt blicken die Staaten Europas auf das österreichische Beispiel: Ist es Orbánisierung? Jörg Haiders Erbe? Oder nur ein besonderer Fall von Verkommenheit? Es ist, als spürte die krisengeschüttelte EU, dass Österreich wieder einmal die kleine Welt ist, in der die große ihre Probe hält.
In seinem fulminanten Essay zeigt Armin Thurnher, jahrzehntelanger Chefredakteur und Herausgeber der Wiener Wochenzeitung Falter, was es mit der Europaverdrossenheit auf sich hat und was man der Rechten politisch entgegensetzen sollte.
Zsolnay E-Book
Armin Thurnher
Ach, Österreich!
Europäische Lektionen
aus der Alpenrepublik
Paul Zsolnay Verlag
ISBN 978-3-552-05833-0
Alle Rechte vorbehalten
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2016
Umschlag: Sonja Scheungrab, München
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Inhalt
I. Prolog
II. Außen und innen
Was ist los bei euch in Österreich?
Achtung, Österreich!
Selbsterklärung, Fremderklärung. Etwas uber Wut
III. Wahl und Wahn
Erste Runde. Gute Unterhaltung!
Amt und Aufregung
Schauen Sie her da! Die Zerstörung des Gesprächs durch Gespräch
Wie geht man mit Rechtsextremen und Faschisten um?
Eine Wahl ist keine Wahl
Viel Aufhebens
IV. Politik
Faschistische Partei Österreichs? Zur FPÖ
Das Rätsel ÖVP
SPÖ – Deal oder Stil?
Grüne, Neos, Zivilgesellschaft
V. Austriaca
Doppelelegie auf zwei große Österreicher
Austrian Airlines. Operette nach Nestroy
Museum der Grausamkeiten
VI. Perspektiven
I. Prolog
Nie mehr wieder! Ich glaube, in jedem meiner Österreich-Bücher habe ich das Versprechen abgegeben, nie mehr ein Österreich-Buch zu schreiben. Immer folgte ein nächstes, und ich hörte nicht auf zu versprechen, aufzuhören. Das Repetitive nervt, vor allem weil es die Vergeblichkeit aller Besserungsversuche zeigt. Österreich-Essays sind allesamt Besserungsversuche, so auch dieser. Weil jede angesagte letzte und jede allerletzte Chance unergriffen verstreicht, kann die Reihe der Österreich-Essays nicht enden.
Wie könnte das ins Gerede geratene Gemeinwesen Österreich verbessert werden? Die politische Klasse meint, ihre Botschaften nur besser verpacken zu müssen. Besser wäre es, sie würde, statt Botschaften zu versenden, Tatsachen sprechen lassen. Die Verbesserung von Mitteleuropa war einmal ein höchst ironisch gemeinter Romantitel. Vielleicht sollten wir uns mit unserer Unverbesserlichkeit und der Unverbesserlichkeit dieses Landstrichs einfach abfinden. Das fiele leichter, wäre nicht gerade die Resignation eine der hervorstechenden Eigenschaften seiner Bevölkerungen.
Nur hier konnte einem Dichter der Satz einfallen, die edelste aller Nationen sei die Resignation, was in Bezug auf die Nation wahr ist und in Bezug auf die Resignation in österreichischer Hinsicht bezweifelt werden muss. Vorbehaltlose Zustimmung zu Nestroys Satz würde mich um mein Einkommen bringen und kommt schon aus diesem Grund nicht in Frage. Unsereiner bringt ja allerhand und bringt auch allerhand gern um, aber er bringt nicht gern sich selbst um etwas.
Die Verbesserung von Österreich dient also auch der Selbsterhaltung des Publizisten Armin Thurnher. Genaugenommen profitiert er mehr von der Verschlechterung Österreichs, aber er leidet auch unter ihr. Er hat, wie man früher sagte, noch Ideale. Von jüngeren Publizisten wird er übrigens gern aufgefordert, nicht so oft »ich« zu sagen, worauf er antwortet, der Gebrauch der dritten Person, wie in diesem Absatz vorgeführt, diene erst recht der Entrückung und Selbstüberhöhung des drittpersönlich auftretenden Subjekts, dieses Heiligen Geists der Selbstverleugnung, der vor allem im Sinn hat, dass man noch verehrbarer werde, weswegen rechte Politiker sich gern dieses Tricks bedienen.
Zudem konnte mir nicht entgehen, dass die Kritik an meinem Gebrauch des Personalpronomens vornehmlich von Leuten geäußert wird, die in den Social Media am Tage ein paar dutzend Mal nichts anderes tun, als in dem ihnen zu Gebote stehenden Formenrepertoire »ich« zu sagen: Ich finde, ich meine, ich lobe, ich mag nicht, schaut mal, was ich mies und was ich prima finde und so weiter – am besten unter Vermeidung von Verben.
Ich dagegen so: Wenn Narzissten bei anderen die Narzissmusbremse zu ziehen versuchen, geht sich bei mir eine Portion Prosa-Ich justament noch aus. Gewiss gehört zur Verbesserung Österreichs nicht nur die Hervorbringung politischer Ich-Prosa, sondern auch eine Rekonstruktion der Öffentlichkeit und, um bescheiden zu bleiben, eine Neuerfindung der Europäischen Union, die diese tragfähiger und politisch akzeptabler machte. Dazu hätte Österreich einiges beizusteuern, es weiß es nur selber nicht.
Österreich 2016, das ist ein Land, in dem sich die Probleme der Welt brennpunktartig wiederfinden, manche von ihnen sogar verschärft. Der Aufstieg der extremen Rechten, der hausgemachten gewinnenden Faschisten, verläuft in keinem europäischen Land so nachhaltig, so ausdauernd, so bizarr und scheinbar unaufhaltsam wie hier. Er dauert inzwischen schon dreißig Jahre an.
Österreich 2016 ist ein Land, dessen wählende Bevölkerung bei der Wahl zum Bundespräsidenten zu fünfzig Prozent den Kandidaten der FPÖ wählte, ein Land, in dem die FPÖ den Umfragen zufolge auch die Wahlen zum Nationalrat hoch gewinnen würde. Österreich 2016 ist ein Land, dessen Wirtschaft trotz vielfältiger Klagegesänge gut dasteht, dessen Sozialsystem einigermaßen verteidigt werden konnte, wenngleich der defensive Charakter seiner Befürworter längst ein Hauptproblem darstellt.
Österreich 2016 ist ein Land mit einer Hauptstadt, die man als milde sozialistisch bezeichnen kann (vielleicht gilt das für das Land insgesamt), ein Sozialstaat, der im Großen und Ganzen noch vorbildlich funktioniert. Die Symptome dieses anschwellenden »Noch«, die Erscheinungen seiner beginnenden Krise sind nicht zu verbergen: Zweiklassenmedizin, zerstörte Universitäten, privilegierte, aber moralisch ungefestigte Eliten; und die Einkommensschere öffnet sich auch hierzulande immer weiter.
Österreich 2016 ist ein Land, in dem langsam und mit Verspätung das Gift der neoliberalen Denkungsart seine Wirkung entfaltet. Die traditionell dysfunktionale Öffentlichkeit hat sich durch Digitalisierung nicht verbessert; ihre Untiefen werden nur neu vermessen.
Seine geopolitische Lage macht Österreich 2016 besonders interessant, gleichsam als Scharnier zwischen den Visegrád- und den Balkan-Staaten der EU, als kleines Muster des großen Nachbarn Deutschland und mit dem Brennpunkt Brennergrenze als Satyrspiel der großen Südtirol-Krise der Nachkriegszeit. Umso brisanter war es, als Österreich in der Flüchtlingskrise und den Fragen von Migration und Asylpolitik die deutsche Hegemonie attackierte.
Österreichs Rechte fordert vorläufig keinen Brexit, nicht einmal ein Referendum. Sie hat Zeit, und möglicherweise hat sie einen Partner in der Regierung, einen, der die Außenpolitik bestimmt. Bruno Kreisky tobte, als die SPÖ einst das Außenministerium aus der Hand gab; nicht erst 2016 zeigen sich die innenpolitischen Konsequenzen.
Österreich 2016 reizt ausländische Betrachter zu allerhand Mutmaßungen, denen man sich als Inländer gern widersetzt; auch das ist ein Thema dieses Essays. Unser eigener Blick ist durch Selbstimmunisierung getrübt. Durch die Fragen der anderen können wir mehr über uns lernen als durch unsere eigenen; umgekehrt müssen wir uns davor hüten zu meinen, es sei das reine Erkenntnisinteresse der anderen, das sich auf uns richte. Vieles von dem, was sie fragen, fragen sie in eigener Mission. Man muss wissen, wozu die Antworten dienen, die man ihnen gibt, und man sollte versuchen, die anderen nicht mit jenen Klischees zu beliefern, nach denen sie gieren. Deswegen setzen sich Teile dieses Essays auch mit der Dialektik von Fremd- und Selbstwahrnehmung auseinander, einer Wechselwirkung, die zum Wesen einer offenbar wenigstens teilweise existierenden übernationalen Öffentlichkeit gehört.
Bisher habe ich in jedem meiner Österreich-Bücher das Versprechen abgegeben, nie wieder ein Österreich-Buch zu schreiben. Immer folgte ein nächstes, und ich hörte nicht auf zu versprechen, aufzuhören. Vielleicht funktioniert es umgekehrt. Ich garantiere hiermit eine Fortsetzung. Vielleicht unterbleibt sie dann. Ich wünsche es mir, für Österreich und ein bisschen auch für mich.
II. Außen und innen
Was ist los bei euch in Österreich?
Die Frage ist so treffend wie jene, die man Politikern aus jedem anderen Land stellen kann, sobald einem der Gesprächsstoff ausgeht.
Sagen Sie, was ist eigentlich bei Ihnen im Süden los?
Ihr Gesprächspartner wird sich am Kopf kratzen und an seine Problemregion denken.
Der Konversationstrick würde auch bei einem österreichischen Politiker funktionieren. Kärnten, das war schon immer ein Sonderfall. Die Steirer fühlen sich gern als Rebellen und behaupten, ihr Blut sei kein Himbeersaft, sondern eine Art Schwarzeneggerjuice. Nach den vergangenen Wahlergebnissen wird man eher von Blaubeersaft sprechen müssen. Neuerdings muss man auch das Burgenland mit seiner sozialdemokratisch-rechtsextremen dumpfbackigen Sheriff-Koalition zum österreichischen Süden zählen.
Was ist bei euch in Österreich los?
Die Frage funktioniert bei jeder Wortstellung. Was ist bei euch los in Österreich? Was ist los bei euch in Österreich? Bei euch in Österreich, was ist da los?
Ein in Konversation Geübter antwortet mit einer oder zwei Gegenfragen. Österreich sei ein gespaltenes Land, hört man immer wieder. Aber was ist mit Großbritannien? Zerrissen zwischen Leave und Remain? Mit den USA zwischen Clinton und Trump? Mit den amerikanischen Demokraten zwischen Clinton und Sanders? Was ist mit den Menschenfreunden, die Flüchtlingen helfen, und jenen stählernen Realisten, die sie lieber draußenhalten wollen? Was mit den Leuten in der Stadt und jenen auf dem Land? Mit Männern und Frauen, mit Jungen und Alten? Mit Neoliberalen und Keynesianern? Ein Spalt tut sich auf zwischen globalem Norden und globalem Süden, zwischen Naturschützern und Klimaschützern, zwischen Österreichs liberalem Westen und reaktionärem Osten, zwischen Stadt Wien und Umland. Die Konservativen sind in sich ebenso gespalten wie die Sozialdemokraten. Noch nie hatten wir, scheint es jedenfalls, derart gespaltene Gesellschaften wie heute. Das Einzige, was nicht gespalten scheint, ist mein Kaminholz für den Winter. Ich gehe jetzt Holz spalten.
Zu mehr Ernst aufgefordert, gebe ich zu bedenken: Im frühen Menschenleben bedeutet Spaltung einen Abwehrmechanismus. Man ist beleidigt, weil man sich von der Mutter abspalten muss, und zürnt ihr, dem Objekt, das man nun widerwillig als außer sich selbst befindlich erkennt. Überwindet man die Spaltung, gelingt es, im Bösen anderer auch Gutes zu erkennen; überwindet man sie nicht, spricht die Psychiatrie von einer »pathologischen Fixierung auf den primitiven Mechanismus der Spaltung« und von einer unreifen Persönlichkeit, die andere und anderes als Bedrohung empfindet.
Fern sei es mir, Nationen oder ganze Bevölkerungsgruppen zu psychologisieren. Aber die Rede von der Spaltung ist auffällig. Eine manichäische Betrachtungsweise, die Welt in Gut und Böse einzuteilen, greift um sich. Wir müssen uns abspalten, abschotten, dichtmachen. »Österreich völlig dichtmachen« lautete eine Schlagzeile der Kronen Zeitung, Triumph und Forderung in einem. Das Blatt forderte das Dichtmachen für sein lesendes Publikum, und diesem teilte es mit, sein politisches Publikum, also das von der Krone am Nasenring geführte politische Establishment, die (nunmehrige Ex-)Ministerin Mikl-Leitner und die Minister Kurz und Doskozil seien sich einig: »Österreich völlig dichtmachen.«
Die Nation macht dicht, aber zugleich ist sie gespalten. Eine Nation der Dichter und Spalter. Halt, ruft sie, da ist ein Spalt, und alles lacht, denn vor dem Spalt warnt uns der ewige Bergführer, der alle Kanzler, Präsidenten und CEOs auf hohe Gipfel führt, zum Beweis, dass sie uns anführen können, wenn nicht anschmieren, nein, und wir fallen gern darauf herein, fallen gern in jede Spalte, und sei sie nur aus Druckerschwärze, denn fallen wir hinein, lachen alle wie befreit, 1. April, aus unseren Reinfällen werden wir wundersam gerettet; wir haben ein Recht auf Bergrettung und darauf, dass der von unserer Reiseversicherung gedeckte Rettungshubschrauber in zwei Minuten da ist, und die anderen Geschichten, von denen, die in Spalten erfrieren, verhungern oder sonstwie umkommen, haben wir gleich vergessen.
Wir fürchten uns zu Recht vor Spaltungen. Kernspaltungen sind uns nicht geheuer. Politische Abspaltungen von Ländern, Provinzen, Parteien und Parteiungen gehören zu krisenhaften Entwicklungen und führen zu Kriegen. Firmen werden von anderen Firmen abgespalten, damit sie in Ruhe Pleite gehen können, auf Kosten der Lieferanten und kleinen Handwerker, während der Firmenboss mit der EU-Subvention in der Tasche die nächste Firmenabspaltung gründet.
Ja, die Vereinigungen und die Spaltungen! Zweifellos stellt die EU eine höhere Art der Rationalität dar, eine Überdemokratie und die Staatsform der Zukunft, aber ebenso zweifellos spielten sich im Schutz dieser Vereinigung und von dieser subventioniert alle Arten von Schweinereien ab, die dem kleinen Mann, der nicht nur nicht mitschneidet, sondern handfest die Zeche zahlt, die höhere Rationalität vermiesen.
Dass Spaltungen in einem Zeitalter der Vereinigung, des Zusammenwachsens der Welt, der übernationalen Verbände zu einer Einheit mit einer Weltregierung oder einem Weltverband besonders auffallen, versteht sich. Man kann sie als Momente des Zerfalls interpretieren oder, bei besserem Willen, als Kollateralschäden des Fortschritts.
Das Erste, das sich auflöst oder spaltet, ist die Nation. Die Nation als Organisationsform und Aggregatzustand bürgerlichen Bewusstseins hat sich in der nachbürgerlichen Epoche überlebt. Sie wird in übernationalen Zusammenschlüssen aufgehoben, und sie wehrt sich durch Spaltungen in regionale und lokale Einheiten. Sie protestiert gegen die höhere Mischform, die sie als minderwertig bezeichnet, und pocht auf die Reinheit und Einheit von Kultur, Sprache, Ethnie.
Diese Prozesse gehen nicht glatt vonstatten, die Bestie des Nationalismus lässt sich nicht ohne Weiteres einschläfern; im Traum schlägt sie um sich, wehe uns, wenn sie schlecht träumt, und noch schlimmer, wenn sie wieder zu Bewusstsein kommt. Ganz arg wird es, wenn deutschnationale Rassisten mit slawischen Namen in einem Mischwesen wie Österreich von Reinheit träumen. Ein möglicher Alptraum heißt »Europa der Vaterländer«, die Vorstufe zum Europa der Vatermörder, die sich zu Übervätern aufschwingen wollen.
Österreich war die Vorform der Europäischen Union, eine Übernation, eine Mischnation, ein Reich, eine Vielvölkermonarchie, die als Völkerkerker interpretiert wurde, als der Nationalismus aufkam. Feudale Unterdrückung und Multinationalität wurden miteinander vermengt; das Supremat der Deutschösterreicher, die keine gleichberechtigte Koexistenz mit den Slawen wollten, spaltete das Ganze. Wir hier kennen also beides, den Überstaat, die Übernation und deren Auflösung durch Nationalismus.
In Restösterreich blieben fast nur Deutschösterreicher übrig, die sogar ihrem Deutschnationalismus abschwören mussten. Wohin mit ihren Überlegenheitsgefühlen? Nicht nur die Vorläufer der heutigen Rechten, sondern auch Sozialdemokraten wie Karl Renner waren Deutschnationale. Soll man nun sagen, die Rechte speist sich auch aus sozialdemokratischen Quellen? Jeder brave Parteigänger würde diese Idee entrüstet zurückweisen, aber auch sie gehört ins Arsenal der verdrängten oder auch nur vergessenen österreichischen Identität.
Victor Adler, Karl Lueger und Georg von Schönerer, der jüdische Sozialist, der antisemitische Christlichsoziale und der rassistische Rechte, beschlossen gemeinsam 1882 das Linzer Programm, das Deutschösterreich näher an das Deutsche Reich rücken wollte. In der Ersten Republik existierten deutschnationale Tendenzen in beiden Lagern, auch wenn nur das dritte Lager, die Schönerer-Erben, sich explizit deutschnational nannte und schließlich nach 1938 in Hitlers NSDAP aufging.
Nach 1945 lautete das Staatsziel Neutralität und ungeteilte Unabhängigkeit. Beides musste von den Alliierten mit unterschiedlichen Zielen erreicht werden, von der Sowjetunion und den Westmächten. Das brachte mit sich, dass sich Österreichs Zweite Republik als Negation Deutschlands definieren musste; das dritte Lager durfte nicht existieren, es ging teilweise in den beiden Großparteien auf und gründete erst ein paar Jahre später seine Nachfolgeparteien, zuerst den Verband der Unabhängigen (VdU), dann die FPÖ.
Der Deutschnationalismus blieb eine Wunde, die weiterschwärt, und jene, die am meisten an ihr leiden, die Erben der Nationalsozialisten, schminken sich im grellsten Rotweißrot und grölen am lautesten austrochauvinistische Parolen. Sie wissen nicht, wohin mit ihren Überlegenheitsgefühlen, und richten sie gegen sich, als Opfer. Es ist ein Skandal: Niemand erkennt und würdigt ihre wahre Größe.
Die Deutschnationalen stehen uns also heute wieder in der FPÖ gegenüber, fast als lebten wir zu Georg Ritter von Schönerers Zeiten. Die Auseinandersetzung um das Amt des Bundespräsidenten holte unversehens die Erste Republik in die politische Arena zurück. Die Erste Republik hat das Amt des Präsidenten entscheidend verändert. Aus den Möglichkeiten, welche die Vielvölkermonarchie geboten hätte, machen ihre Nachfolger nichts. Außer dass sie an einem Phantomschmerz litten und leiden, der heute auf lästige Weise aktualisiert wird, durch Zuwanderung von Slawen und Muslimen, denen kein wohlwollender Herrscher mit Toleranz begegnet, weil er sie beim Militär braucht (obwohl unser Heer bereits stolz auf seinen ersten Imam für islamische Militärseelsorge verweist).
Das kleine Österreich spürt immer noch den Phantomschmerz nach dem Verlust der Habsburgermonarchie, verarbeitet ihn aber nur in kitschbeladenen Ausbrüchen bei Monarchenbegräbnissen, die mit Pomp, Kardinal und Staatsfernsehen begangen werden. Oder in Anfällen von Größenwahn bei Sportereignissen. Sei es, wenn sich das Land bei Randsportarten in die Illusion steigert, seine Siege hätten weltweite Bedeutung. Oder vor Fußballturnieren, bei denen man sich zuvor zum Geheimfavoriten erklärt, nicht einmal ansatzweise das Tiefstapeln durchhält und jeden Realismus über Bord wirft, um bei aufgedecktem Geheimnis beschämt fast ohne Punkte und Tore nach Hause zu fahren.
Jetzt sind wir wieder dort, wo wir hingehören, sagte ein weiser Handwerker scharfsichtig schon nach dem ersten Spiel der vergangenen Fußballeuropameisterschaft, als andere noch von einem bald zu korrigierenden Fehlstart phantasierten. Spaltung auch hier: zwischen Größenwunsch, nein, Größenwahn, und Kleinmannssucht, Selbstinfantilisierung und dem Wunsch, zurechtgestutzt zu werden.
Ihr Erbe positiv zu wenden, im Sinn einer religiös toleranten, multinationalen, übernationalen Gesellschaft, gelingt der österreichischen Gesellschaft nur teilweise. In Abwesenheit eines im eigenen Interesse agierenden Kaisers bringen wir Fremden entweder überschießendes Ressentiment oder überschießende Willkommenskultur entgegen.
Spaltung prägt die ganze Welt. Religiöse Spaltung hat uns dreißigjährige Kriege gebracht, nun bringt sie uns die islamische Verschärfung; die Spaltung innerhalb der islamischen Welt, zwischen Schiiten und Sunniten, befeuert den Konflikt. Über Migration und Terrorismus wirkt die Islam-Frage in die EU hinein. Eine Religion, welche die Trennung von Staat und Kirche nicht akzeptiert, kann man nicht tolerieren. Genauso wenig kann man jene tolerieren, die im Namen eines leicht zu durchschauenden Realismus die Errungenschaften der Aufklärung zurücknehmen möchten, natürlich im Namen von Freiheit und abendländischer Kultur.
Österreich spürt eine vage Verpflichtung, war doch der Islam in der Monarchie anerkannte Staatsreligion, der bosnischen Moslems wegen, die man als Staatsdiener aller Art benötigte. Dass es seiner Verpflichtung zur Toleranz ausgerechnet mit einem von Saudi-Arabien finanzierten, wahhabitisch inspirierten Zentrum für interreligiösen Dialog in Wien nachkommt, ist schwer verständlich.
Die Epoche der Harmonie, die nach den großen Kriegen in Europa zu herrschen schien, droht zu Ende zu gehen. Man merkt das an den zivilen Konflikten in den Gesellschaften. Je differenzierter und diffiziler diese werden, desto vielfältiger wird die Parteienlandschaft, desto schwerer kommen Mehrheiten zustande, desto unregierbarer scheint das Ganze.
Dazu kommen übernationale Gebilde wie die Europäische Union, mit der lokale, regionale, nationale Politiker ihr berüchtigtes Doppelspiel treiben. Das führt dazu, dass sie mit gespaltener Zunge sprechen: Zuhause schieben sie die Schuld an jenen Beschlüssen, an denen sie selbst mitgewirkt haben, auf Brüssel und kommen nie zu einem Resultat, wer stärker ist: sie oder sie. Das Publikum registriert Bewusstseinsspaltung oder zumindest Unglaubwürdigkeit.
Ja, zu allen anderen Spaltungen, mit denen wir leben müssen, leben wir auch noch im Zeitalter der gespaltenen Zunge. Das Publikum spürt dieses unauthentische Sprechen, es merkt, dass Interessen nur vorgeschoben werden. Kaum jemand redet frei heraus und sagt, was er meint. Diese Kritik betrifft Politiker und Politikkritiker, sie betrifft aber ebenso das Publikum. Der Kummer der Meinungsforscher ist auch unserer, aber er geht weit über ihr Problem hinaus. Sie beklagen nach Wahlen, bei denen ihre Prognosen auf den Kopf gestellt werden, dass die sogenannte Bekenntnisfreudigkeit zu wünschen übrig lässt; und wenn sie diese geringe Bekenntnisfreudigkeit einkalkulieren, wie früher bei der Wählerschaft der Rechten, stellt sich diese Bekenntnisfreudigkeit auf einmal im Übermaß ein. »Jo, mir ham eh an Hofa gwöd.«
Ich weiß nicht, ob es je so etwas wie echte Bekenntnisfreude gegeben hat. Bekennerfreude war immer etwas Exklusives, wenn nicht gar eine Pose. Selbst Jean-Jacques Rousseau, der über die Krümmung seines Penis referiert und sich bis in die kleinsten Verästelungen seiner Seele selbst bezichtigt, hinterlässt bei uns das berechtigte Misstrauen, er habe etwas zu verbergen, gerade dort, wo er sich am offensten gibt.
Andererseits herrscht heute Bekenntniszwang; offensichtlich bekennen viele Menschen in den Social Media mehr von sich, als sie bekennen würden, wären sie bei Trost. Aber im wirklichen Leben wollen wir verlangen, dass Menschen einem ihnen unbekannten Wahlforscher ihre politische Präferenz offenbaren? In Österreich zumal, wo Sklavenmentalität noch immer zu den geachteten Tugenden gehört und das Schlaucherltum die höchstgeachtete, weil realitätstauglichste Verhaltensform darstellt, da in manchen Gegenden die Leibeigenschaft real erst Mitte des 19. Jahrhunderts zu existieren aufhörte.
Schlaucherl nennt man auf Wienerisch einen schlauen Menschen, eine, wie das Dialektlexikon weiß, raffinierte Person. Wobei die Aspiration noch den Schlauch dazutut, den neuen, aus dem die Schlaucherln ihren guten alten Wein süffeln. Ja, es wird ein Wein sein, und wir werden nimmer sein, aber Schlaucherln werden wir immer sein …
Nein, mit diesen Versuchen in Lokalkolorit lenke ich nicht von der Frage ab, was in Österreich los ist. In Österreich ist verhältnismäßig wenig los. Zumindest auf den ersten Blick. Fast möchte man Österreich ein verschnarchtes Konsensland nennen. Eine Idylle aus gemütlicher Ungemütlichkeit. »Gemütsmensch« nennt man hier jemanden, der entspannt zusieht, wie seine Frau ertrinkt, oder der seine Kinder im Keller einmauert. Diese Gemütsmenschen sind ebenso real wie jene Helferinnen und Helfer, die sich selbstlos im Einsatz für Flüchtlinge und Migranten aufreiben.
Und überall herrscht eine Herzlichkeit, der man sich nicht entziehen kann, eine Stimmung, zu der man besser nicht Nein sagt. Auch im Tourismus herrscht zähnefletschende Willkommenskultur, allerdings nur gegenüber zahlenden Gästen. Dazu der repräsentative Kulturalismus, abgemildert durch Identitätsmarketing im Qualitätstourismus, voller Mozart und Lipizzaner, aber justament nicht nur, sondern mit einem Schuss Modernität, der Pop, linke Hüttenwirte, biologische Landwirtschaft und demnächst, hundert Jahre danach, eine Wertschätzung der Wiener Moderne mit einschließt.
Der Konsens aber erhält seine Würze durch die unter seiner scheinbar starren Oberfläche strömenden Traditionen, zum Beispiel durch den sublimierten Bürgerkrieg. Bruno Kreisky hatte ihn noch im Blut, er ist in den Gefängnissen der Austrofaschisten gesessen (gemeinsam mit illegalen Nazis), und er konnte im Parlament noch glaubhaft wütend auf die ÖVP werden und autoritativ brüllend diesen verflossenen Bürgerkrieg beschwören.
Heutzutage ist so etwas unmöglich, es wäre lächerlich; die Wut hat die Seiten gewechselt. Aber die alte Wut ist noch da, gemildert durch Neues, verschärft durch Ungeklärtes. Am zarten Plätschern und Murmeln, am sanften Sägen und Nagen dieser Unterströmungen ändert auch nichts, dass die Sozialpartnerschaft, der erfolgreich aufgehobene Bürgerkrieg, einen europaweit nicht einzigartigen, aber doch recht gutartig verteilten Wohlstand schuf. Die Wirtschaftsdaten sind erfreulich, das Pensionssystem ist unvergleichlich besser als das deutsche, von sozialen Verwerfungen kann keine Rede sein.
Woher kommt das Unbehagen, das Ungenügen, das anschwellende und vor allem bei Wahlen immer stärker spürbare Murren? Rot und Schwarz regieren schon zu lange gemeinsam.
Bürgerkriege haben die Gewohnheit, unendlich lange zu dauern, sagte T.S. Eliot 1947. Bürgerkriege, auch sublimierte, fleischen sich ein. Den Hass aufeinander können Schwarze und Rote nur im Off und zwischen zusammengebissenen Zähnen artikulieren. Aber sie behindern einander, wo es nur geht, während sie zugleich zum Aufbruch mahnen. Das Publikum erträgt dieses Schauspiel schon lange nicht mehr. Die Medien – konflikt- und streitsüchtig, wie sie nun einmal sind – haben ihre Lust an dieser permanenten Tragikomödie der Spaltung, die als selbstauferlegte Harmonie daherkommt, und befeuern sie in jeder einzelnen Nachrichtensendung. Hunde, ihr wollt nicht streiten? Wir werden es euch lehren!
Sie können den Ernst der Stunde nicht erkennen, weil ihnen wichtiger als ihre eigenen Interessen geworden ist, jene des Gegners zu behindern. Als Gegner sehen sie den Partner. Sie benehmen sich wie ein altes Ehepaar, das permanent zum Rosenkrieg rüstet, aber die Kosten der Anwälte scheut.
Außerdem erkennen wir Österreicher den Ernst der Stunde nicht, weil wir ihn nicht leiden können. Dem Ernst mit heiligem Unernst zu begegnen ist ein Teil unseres Wesens, man mag das sympathisch finden oder nicht. Im Zeitalter der gespaltenen Zunge tun wir uns auch damit schwer. Ironie ist als Ausnahmereaktion gut erträglich, als allgemeiner Dauerstand aber eine Katastrophe. Wenn sie nur öfter gelänge! »Einen Trottel so darstellen, dass der Autor plötzlich fühlt: das bin ich ja zum Teil selbst,«1 das wäre ein Ziel. Wenn der Soziologe Heinz Bude Deutschland eine ironische Nation nennt, weil sich dort Skepsis und Realismus mischen, was um Himmels willen ist dann Österreich, das die Skepsis durch das Abwinken und den Realismus durch den Fatalismus ersetzt?
Wer kann es noch hören, wenn sich jemand als glühender Europäer bezeichnet? Diese Leute glühen schon so lange, sie müssten längst ausgeglüht sein wie jene Glühbirnen, die sie auf Geheiß der Herstellerlobby eliminiert haben. Sie sind’s ja schon, sie merken es nur nicht. Dennoch sind wir Europäer, und wir sind es so gern, dass Drohungen mit einem Ausstieg aus der Union nicht einmal die Faschisten hinter dem Ofen hervorlocken. Zumindest noch nicht.
Immer wieder wird in der Politik eine Stunde Null eingeläutet, eine letzte Chance zur Selbsterkenntnis, eine Möglichkeit zum Neuanfang, eine Notwendigkeit des Durchstartens. Die Zeit, in der dieses Buch geschrieben wird, ist so eine Phase. Jetzt oder nie, man will es nie mehr hören und hört es doch immer wieder. Vielleicht hören wir es wider Willen nicht einmal ungern? Die Versuchsstation des Weltuntergangs erbringt zugleich dessen empirischen Gegenbeweis. Wir versuchen unterzugehen und wursteln immer weiter, vom Neuaufbruch zum Stillstand und zurück.