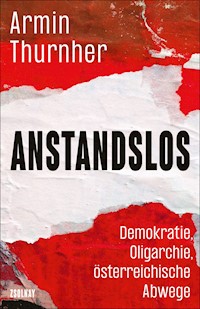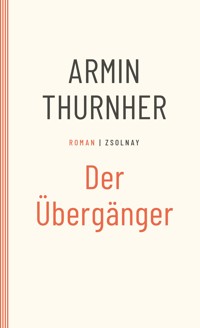Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein amerikagläubiger junger Mann reist 1967 aus der Provinz in Österreich in die USA, nach New York, in die Metropole der Metropolen, ins Zentrum der Welt. Doch alles ist ganz anders als in seinen Vorstellungen. Er steht an einem Wendepunkt seines Lebens, er taucht ein in eine Welt der Glaspaläste und der Obdachlosen, von Subkultur und Rassismus, Sex und Revolte. Was dieser junge Mann erlebt und was er versäumt, beschreibt Armin Thurnher in diesem so ernsthaften wie ironischen Roman, der dem eigenen Leben nahe ist. Er erforscht, wie einer seine Sicht auf die Welt ändert und wie es kommt, dass er am Ende doch kein Amerikaner wird. Obwohl nicht viel fehlt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Seit jeher waren die USA sein Sehnsuchtsort. Jetzt ist er da. In New York, der Metropole aller Metropolen, im Zentrum der Welt. Und alles ist ganz anders. In eine glänzende Zukunft wollte er aufbrechen, jetzt wird ihm klar, er muss von seinen Vorstellungen Abschied nehmen. Er steht an einem Wendepunkt seines Lebens, er taucht ein in eine Welt der Glaspaläste und der Obdachlosen, von Subkultur und Rassismus, Sex und Revolte.
Was dieser junge Mann 1967 erlebt und was er versäumt, beschreibt Armin Thurnher in diesem so ernsthaften wie ironischen Roman, der dem eigenen Leben nahe ist. Er erforscht, wie einer seine Sicht auf die Welt ändert und wie er in eine fremde Kultur initiiert wird. Aber wird er sich zum Amerikaner machen lassen?
Armin Thurnher
Fähre nach Manhattan
Mein Jahr in Amerika
Paul Zsolnay Verlag
VORWEG
Wer spricht? Ich bin es. Zu erkennen, wer dieses Ich ist, daran arbeitet mancher ein Leben lang. So ist es nur billig, dass das Publikum dieses Ich für einen anderen nehmen muss. Für einen Achtzehnjährigen, von dem ein Siebzigjähriger in Ich-Form erzählt. Können sie ein und derselbe sein?
Der junge Mann zieht in ein fremdes Land und weiß nicht recht, warum; außer dass er dort ein Königreich sucht, von dem er eine vage Vorstellung hat. Ein Land, in dem alles funktioniert, wo alles gerecht ist und kein Mangel herrscht. Ein weites Land, in dem sich jeder verwirklichen kann, in dem jeder reich werden, jeder Präsident werden kann. Ein Land ohne Parteien und Vereine, die Karriere und Laufbahn regeln. Ein Land ohne aufmerkende Nachbarschaft, die mit Kleinstadtklatsch die Räume eng macht. Ein Land voller schöner Frauen und starker Männer, voller großartiger Städte, weiter Prärien, wilder Berge, hinreißender Gedichte, zwischen zwei Ozeanen, mit der Krone aller Städte, New York. Ein Land voller Königinnen und Könige.
Mit einem Wort, unser Held sucht einen Kindertraum.
Ein vom Autor verehrter Schriftsteller und Musiker sagt, er werde seine Autobiografie nicht schreiben, weil er nicht bereit sei zu lügen. Daran soll es bei mir nicht scheitern. Glauben Sie mir also kein Wort, vor allem nicht, wenn ich »ich« sage. Zur Orientierung darf ich auf Arno Schmidt verweisen: »Ich hab immer das Gefühl, als wenn ›ich‹ mich etwa in Kopfhöhe hinter ›mir‹ befände.« Ja, so ein Ich ist etwas anderes.
An manches andere versuche ich mich zu erinnern. Ich sehe mich um im tiefen, dunklen Keller dieser Erinnerung und folge dem Licht meiner Phantasie, das durch die Glasziegel in der Decke fällt und einiges beleuchtet.
Vielleicht hilft ein Wort von Sławomir Mrożek, der seine Autobiografie als Therapie gegen Gedächtnisverlust nach einem Schlaganfall schrieb: »Was uns integriert, sind Gedächtnis und Sprache. Das ist das einzige Königreich des Menschen.«
AUGUST
1
In den Vereinigten Staaten hat sich die Produktion von Gütern und Dienstleistungen pro Arbeitsstunde seit 1917 verdreifacht. Diese Produktivitätsrate der Arbeitnehmer ist der in jeder anderen Industriegesellschaft weit überlegen. Eine Nation mit solch enormer Fähigkeit, ihre Ressourcen optimal zu nutzen, kann und wird auch die Armut überwinden. Regierung, Wirtschaft, Arbeit, Erziehung und Religionsgruppen müssen alle an diesem gemeinsamen Ziel arbeiten.
Business builds a better community, Broschüre, Good Reading Rack Service, New York City 1967
Diese Geschichte beginnt mit Onkel Johann. Genau genommen ist Johann ein Großonkel. Johann ist eines der zwölf Geschwister meines Großvaters. Die Bauernfamilie konnte nicht alle ernähren, sodass der Johann in den 1920er Jahren wie viele Vorarlberger vor dem Hunger floh und in die Neue Welt auswanderte. Nun war er wieder da, auf Besuch, und ich fürchtete mich ein wenig vor dem alten Mann. Onkel John, so hieß er jetzt, trug merkwürdige Hüte und statt einer Krawatte eine durch eine Glasperle zusammengehaltene dicke grüne Schnur. Immer wieder schlüpften ihm englische Wörter in die Rede.
»Kann man des net endlich changen?«, sagte er zum Beispiel missbilligend, als der Griff am Garagentor noch gleich schief herunterhing wie beim vorigen Besuch. Das gefiel mir. Der Griff störte auch mich, ohne dass ich es für angebracht gehalten hätte, den Erwachsenen etwas zu sagen. Es waren zwei lose Schrauben, an denen der Griff hing. Er funktionierte, aber er wackelte. Von Zeit zu Zeit zogen Großvater oder Vater die Schrauben nach. Ein neuer Griff wäre zu teuer gekommen, vielleicht hätte es sogar ein neues Tor gebraucht.
John sprach langsam und ein wenig herrisch, fast wie Marlon Brando im Film »Der Pate«. So kam es mir vor, ohne dass ich diesen Film hätte gesehen haben können. Man schrieb das Jahr 1955, ich war sechs und hatte überhaupt noch nie in meinem Leben einen Film gesehen. Als ich dann einen sah, fünf Jahre später, war es »Ben Hur« und nicht »Der Pate«. Jedenfalls kam der Onkel aus einem Land, wo man nicht lange nachdachte, ob man sich einen neuen Garagentorgriff leisten konnte.
Onkel Johns Frau sprach kein Wort Deutsch und hatte silberviolettes Haar. Tochter Rosemary kaute Kaugummi, trug Pettycoats, Stöckelschuhe und eine Sonnenbrille von Ray Ban. Die Marke identifizierte ich später auf Fotos. Mit Rosemary konnte ich mich nicht verständigen. Ich starrte sie bewundernd an und machte mich vor meinen Freunden damit wichtig, dass ich eine aus Amerika kannte, mit so einer Sonnenbrille.
In den 1950er Jahren waren Autos in Privatbesitz selten. Mit der Zahl zugelassener Insassen nahm man es nicht so genau. John hatte ein DKW-Cabrio gemietet, beige, mit Weißwandreifen und Lenkradschaltung. Es sah aus wie eine Schildkröte. Mit seinen 39 PS bewegte es sich nicht besonders schnell. Vier Familienmitglieder, darunter ich, pferchten sich zu den drei Amis in den DKW hinein. So ging es auf die umliegenden Höhen der Voralpen. Im Unterschied zu meinem Vater, der einen Busführerschein hatte, wusste Onkel John nicht, wie man am Berg fährt. Abgestellte Autos mit geöffneten Kühlerhauben waren auf kurvenreichen Straßen nicht selten, man musste manchmal Kühlerwasser nachfüllen. Stell den Motor nicht ab, sagte Großvater zu John, als es unter der Kühlerhaube des DKW hervordampfte. John kannte sich nicht aus. Aus seiner neuen Heimat war er wohl eine Automatik gewohnt, schaltete viel zu spät, ließ aber niemand anderen ans Lenkrad. Mercedes und DKW sind faul am Berg, sagte der Großvater, seinen Bruder entschuldigend.
Am Bodensee blühten die Kirschbäume. Weiß schwebten die Obstbaumkronen über dem azurblauen Wasser, da und dort durchstochen von den Zwiebeltürmchen weißer Barockkirchen. Die Schildkröte durchquerte den Blütenschaum. Zarte, weiße Kirschblüten regneten auf Rosemary und mich nieder. Mir konnte die Schildkröte gar nicht träg genug vorankommen.
Zuhause blühte der Apfelbaum. Beim Abschied drückte mir Onkel John einen Dollar in die Hand und sagte: »Da hast a Bildle!« Ich nahm den heiligen Schein wie eine Eintrittskarte in ein Land, wo alle reich sind, glänzende Griffe an den Garagentoren prangen, die Frauen seltsam attraktive Sonnenbrillen tragen und überhaupt Milch und Honig fließen. In dieses Land, dort musste ich hin.
2
Als Reaktion auf ein Ansuchen von Newarks Bürgermeister Hugh Addonizio schickte Gouverneur Hughes 2500 Nationalgardisten. Jeeps, Lastwagen und ein rasselnder elf Tonnen schwerer gepanzerter, bewaffneter Transporter dröhnten ins Ghetto. Als einige Polizisten von schwarzen Scharfschützen eingekesselt wurden, eröffnete der bewaffnete Transporter Maschinengewehrfeuer. Der Mob wusste nicht, dass die Maschinengewehre mit Platzpatronen geladen waren. Die Polizisten entkamen. Gleichzeitig durchkämmten Wachebeamte und Polizeipatrouillen mit aufgepflanzten Bajonetten die Straßen und nahmen jeden Schwarzen in Sicht fest. Black-Power-Dramatiker LeRoi Jones, 32, wurde aus seinem Volkswagen heraus verhaftet. Er hatte zwei 0.32-mm-Pistolen in der Tasche. Jones, der einst Schwarze aufgefordert hatte, weißen Männern die »jelly white faces« zu zerschlagen, wurde selbst geschlagen. Eine stumpfe Waffe traf seinen Schädel. Die Wunde musste mit sieben Stichen genäht werden.
Time Magazine, 21. Juli 1967
Zwölf Jahre später stehe ich auf dem Rollfeld von Kloten, dem Flughafen von Zürich. Mein beiger Schnürlsamtanzug erscheint mir als Spitze der Eleganz. Die braunen Lederknöpfe, übers Kreuz geflochten, ein weißes Hemd, dazu eine schmale gehäkelte weinrote Wollkrawatte, die unten wie abgeschnitten in kleinen Fransen endet. Einmal im Jahr kauften mir die Eltern bei Sagmeister, dem zweitbesten Haus der Stadt, eine Jacke, eine Hose oder einen Anzug. Allzu modisch durfte das Kleidungsstück nicht sein. Jeans gab es keine; die waren im Gymnasium Bregenz verboten. Für Dauerhaftes wählte man Lederhosen.
Der beige Schnürlsamtanzug ist das Schickste, was ich dem konservativen Geschmack der Eltern je abgetrotzt habe. Mutters Augen glänzen, so gut steht er mir. Jetzt geht es nach Amerika, da braucht es das Beste. Ich weiß zwar nicht genau, was ich werden will, aber irgendwie wird es mit mir aufwärts und vorwärts gehen. Ich habe das Gymnasium der Heimatkleinstadt absolviert, mit links absolviert, muss man sagen. Mit 14 habe ich das Lernen eingestellt, auch in den alten Sprachen, und es hat bis zur Matura gereicht. Gerade gereicht. Nur in Griechisch musste ich etwas nachfassen, bei Sophokles wurde es knapp.
Ich hatte mich als Einjährig-Freiwilliger zum Bundesheer gemeldet, das gehörte zu meiner vagen, aber entschlossenen Absicht, Karriere zu machen. Absicht ist zu viel gesagt. Es war nicht anders denkbar. Als kommender Reserveoffizier rechnet man sich zur Elite. Man ist katholisch, nicht von der muffigen Art der Kartellverbände, mehr von der weltoffeneren Fraktion, aber katholisch allemal. »Als Dank für deine Mitarbeit am Reich Gottes«, schreibt mir der freundliche Arbeiterpriester in ein Buchgeschenk.
Das Buch heißt »Zwischen Mensch und Gott«, es handelt vom richtigen Leben in Freiheit, aber eben nicht nur. Eine vage kosmische Faszination geht davon aus. Im Pfarrheim hing ein Bild von Teilhard de Chardin. Michel Quoist, Arbeiterpriester auch er, war eine Art Teilhard für Halbwüchsige. Unser Bregenzer Arbeiterpriester sorgte als Religionslehrer ganz im Sinn des Vatikanischen Konzils für geistige Nahrung und für Realitätsbezug. Die katholische Jugend verteilte vor Weihnachten Pakete an Arme. Dass es die ausreichend gab, war mir neu. Ich kam in Wohnungen, wo man zu viert in einem Zimmer hauste. Wo man kleine Dinge, die mir selbstverständlich schienen, mit großer Dankbarkeit und kleiner Beschämung entgegennahm. Ich merkte es mir. Die Beschämung war ganz auf meiner Seite.
Dass ich an ein protestantisches College unterwegs bin, gesponsert von der lutherischen Kirche, weiß ich nicht. Es wäre mir egal. Ich bin neugierig und kritikbereit, aber weltanschaulich gefestigt, wie man sagt.
Ich bin ein Erfolgsmodell. Ums Haar wäre ich Landesjugendmeister im Tennis geworden, hätte ich nicht vor und nach der Matura das Training schleifen lassen und mit Freunden zu viel gefeiert. Scheint da eine Spur von mangelndem Ehrgeiz auf? Ich nahm es hin, dass mich im Verein kaum einer richtig förderte, dass die Alten im Verein sich, das kann ich aus viel späterer Perspektive sagen, im Vergleich zu heutigen Talenten einen Dreck um mich und meine Freunde kümmerten. Vielleicht war es ohnehin besser, später sagen zu können, man sei ein Talent gewesen, als dieses Talent unerbittlich auszureizen.
So groß wäre es nicht gewesen, das Talent. Genau genommen habe ich überhaupt kein Talent, außer einem: mich zum Drill überwinden zu können. Das kann ich besser als andere, deswegen behielt ich die in den ersten vier Jahren Gymnasium eisern einstudierten lateinischen Vokabeln, Deklinationen und Konjugationen im Gedächtnis und lebte bis zur Matura davon. Zuhause trainierte ich mit dem Ball, gleich ob Tennis- oder Fußball, stundenlang allein an der Garagenwand. Was andere auf dem Klavier durch Begabung schafften, übte ich mir unermüdlich ein.
Die Familie interessierte sich nicht für meine sportlichen Erfolge. Nicht einmal zum Finale der Jugendmeisterschaften kamen sie. Dafür war ich dankbar. Dass ich im Auto des Vaters meines Gegners zum Finale anreisen musste, war mir weniger recht, aber was sollte ich machen. Es gab niemanden, der mich coachte oder betreute. Das hätte nichts geholfen. Im Match ließ ich mir sowieso nicht dreinreden. Im Finale führte ich 5:2 und 30:0, traf zweimal hintereinander mit einem möglichen Winner die Netzkante und verlor das Spiel 5:7, 1:6. Mein Gegner hatte wirklich Talent.
Mein Tennisspiel brachte mich wohl auch hierher auf dieses Rollfeld. Ein Professor des Colleges, zu dem ich unterwegs war, hatte zwei Töchter. Mit denen war ich befreundet, denen half ich ein wenig bei der Rückhand. Es waren zauberhafte Mädchen. Der Professor leitete das europäische Studienprogramm des Colleges in unserer Kleinstadt. Pro Jahr setzte das College einem jungen Vorarlberger ein Stipendium nach New York aus. Ich tat alles, um mir dieses Stipendium zu sichern. Den Töchtern des Programmleiters gab ich Tennisstunden; die amerikanischen Studentinnen und Studenten begleitete ich als Hilfsskilehrer beim Skikurs. Sogar einen Abendkurs in Russisch besuchte ich am College, weil ihn mein geliebter Englischlehrer hielt.
Als ich 16 war, platzte dieser Mann in das selbstgefällige Milieu des humanistischen Gymnasiums mit seinen bildungsfrohen Spießern, deren Bildung in ein paar lateinischen Zitaten und der Beherrschung unregelmäßiger griechischer Verben gipfelte. Alles andere galt neben diesen Sprachen wenig; Deutsch war ein verstaubtes Repetitorium von Schriftstellern, die weniger öd waren, als man sie den Schülern machte. Unsere Lehrer überzogen sie mit dem Mehltau jahrzehntelanger oberstudienrätlicher Routine: Jeremias Gotthelf, Conrad Ferdinand Meyer, Marie von Ebner-Eschenbach. Den Humanismus-Spießern verzieh ich am wenigsten, dass sie uns die Schönheit der antiken Poesie nicht nur verbargen, sondern regelrecht vermiesten.
Dieser Englischlehrer war anders. Jung, ungestüm und rotzig, bestand er darauf, dass man mit ihm nur englisch rede. Obwohl wir die Sprache bereits ein Jahr lang gelernt hatten, verstanden wir kein Wort. Wir liebten den Kerl dafür, dass er uns anbrüllte, er werde in dieser Stunde fortan kein deutsches Wort dulden. Sportler war er auch, hatte den Abfahrtslauf einer Studentenolympiade gewonnen. Da sein Vater, ein prominenter konservativer Politiker, ein Nazi-Opfer war, nahm er sich in der Stadt, in die er zurückkehrte, kein Blatt vor den Mund und grüßte Leute in der Stadt mit ihrem gewesenen NS-Rang: »D’Ehre, Herr Obersturmbannführer …« Das berichteten die Knaben einander flüsternd, und es gefiel ihnen ungemein, da sie in anderen Fächern unter Knute und Schaftstiefel mehr als eines alten Nazis litten.
Der Englischlehrer hatte mich ins Herz geschlossen, und auch aus diesem Grund schien es klar, dass ich das vom College ausgeschriebene Stipendium erringen würde. Ich errang es auch. Jahrzehnte später erfuhr ich, dass dieser Lehrer, mein Lehrer, es zuerst einem anderen Knaben angetragen hatte, einem fleißigeren Schüler, der aber gar nicht wusste, was er in diesem Amerika sollte, und das Angebot ablehnte.
3
Bregenz ist eine bezaubernde Stadt am Fuße des Arlbergs und am Ufer des Bodensees. Reste der römischen Mauern und Tore erinnern an die antike Geschichte der Stadt, als sie Brigantium hieß. Bregenz weist eine große Vielfalt an kulturellen Aktivitäten auf. Sein Theater bietet eine Reihe von Aufführungen. Seine Konzerthalle präsentiert regelmäßig berühmte Ensembles und Virtuosen. Sein Museum gibt dem Besucher die seltene Gelegenheit, viele der traditionellen Gebräuche und kulturellen Aspekte von Bregenz und seiner Nachbarschaft zu besichtigen. Alpine 3000er befinden sich nur 45 km entfernt vom Campus. Dampfboote auf dem Bodensee machen alte Städte wie Lindau, Konstanz und Schaffhausen leicht erreichbar. Zürich, die größte Stadt der Schweiz, ist nur zwei Stunden entfernt. Die deutschen Metropolen München und Stuttgart sind ebenso leicht erreichbar, Italien und Frankreich nur eine kurze Tagesreise entfernt.
Werbebroschüre für das Wagner College Study Program, Bregenz
Die Passagiere rücken in Viererreihen auf dem Beton in Richtung Gangway vor. Die Gangway lehnt am Jet. Man fährt in Kloten nicht mit dem Bus zum Flieger, man geht zu Fuß. Das Wetter ist trocken, leicht windig und sonnig. Es ist Dienstag, der 22. August 1967.
Die DC-8 »Matterhorn« schimmert in der Sonne, der Bauch stählern, der Rücken weiß, das Schweizerkreuz auf der roten Heckflosse. 1960 überquerte sie als erstes propellerloses Flugzeug der Swissair den Atlantik. Normalerweise fliegen Studenten Icelandic Airlines mit Zwischenlandung in Reykjavík, aber die Mutter bestand auf Swissair, der Sicherheit wegen. Obwohl 1963 eine Swissair-Caravelle bei Dürrenäsch brennend abstürzte und alle achtzig Insassen umkamen. Wenig später explodierten Bomben in Swissair-Flugzeugen, eine DC-8 wurde gekidnappt und auf einem Wüstenflughafen gesprengt. Aber Swissair war Swissair. Der Inbegriff von Solidität und Sicherheit. Während die Schweizer ihre österreichischen Nachbarn als eine Art Untermenschen verachten, schwören die Österreicher bedingungslos auf Schweizer Qualität und Solidität.
Im Flughafengebäude steht die Familie. Vater, Mutter und Schwester, die Zurückgebliebenen blicken durch die großen Glasfenster auf das Rollfeld. Ich bin schon weit weg, und obwohl ich mich noch umblicke und winke, sehe ich niemanden mehr, außer mich. Gut schaue ich aus in meinem beigen Schnürlsamtanzug.
Was tut diese Stewardess? Sie hält die Leute ab, die Gangway zu besteigen, durchmustert, eine Liste in der Hand, die Reihen der Passagiere, holt einzelne heraus, auch mich. Ich werde upgegradet. Ich darf in der ersten Klasse sitzen, obwohl meine Eltern nur für die zweite bezahlt haben. Der kleine König wird würdig in Amerika einschweben.
Der ältere Herr neben mir, joviales Gesicht, rotbackig, stellt sich als Englischprofessor Jacobson vor.
Ihr erster Flug?
Ja, gewiss.
Nervös?
Nein.
Sie haben keinen Grund. Im Gegenteil. Freuen Sie sich. Ich werde Ihnen zeigen, wie es geht. Wir fangen mit einem Manhattan an, da fliegen wir ja hin.
Ich bin dabei. Wir haben neun Stunden Zeit. Die Bordspeisekarte mit ihren knalligen Grafiken von Hummern, Spargeln, Tomaten und hartgekochten Eiern verspricht nur das Beste.
Dann nehmen wir den Malossol mit dem Mumm, der Lafitte kommt später.
Ich denke nicht daran zu widersprechen.
Da tun Sie gut daran, junger Mann. Wir werden uns für das Beef entscheiden, der Professor lacht.
Mit einem Steak nach New York, das halte ich für angemessen.
Sie müssen sagen, wie Sie es wollen.
Wie?
Na, blutig, medium oder durch. Ich würde medium empfehlen.
4
Schrittweise wird die Wahrheit über die friedlichen Ziele unserer Nation und unser Respekt für die Rechte anderer zu allen Völkern der Erde gebracht werden.
Dwight D. Eisenhower, Präsident der Vereinigten Staaten, Window to America, Broschüre, 1958
Während wir auf den zweiten Manhattan warten, fragt Professor Jacobson mich aus. Ob er das College kenne, frage ich zurück. Er habe davon gehört, ja, könne aber nichts Genaues sagen. Es werde schon in Ordnung sein, wenn auch nicht die berühmteste Schule der Welt. Ich vergesse, den Professor zu fragen, wo er unterrichtet.
Mir ist es gleich, sage ich, wo ich hinkomme, Hauptsache USA. Deswegen habe ich mir auch zwei Stipendien besorgt, eines vom American Field Service, das war leicht zu bekommen. Aber die schicken einen dann in irgendwelche Käffer, das musste nicht sein. Und eben jenes für das College.
Ja, sagt der Professor. Wahrscheinlich ist er gerade unterwegs in so ein Kaff. Obwohl die weltmännische Art, mit der er das Menü zusammenstellt, gegen diese Annahme spricht.
Gänseleber oder kalter Hummer?
Der Professor entscheidet sich für Hummer.
Gänseleber ist schon beim Steak dabei, haben Sie es nicht bemerkt? Was mussten Sie tun, um zu Ihrem Stipendium zu kommen?
Ich musste durch ein auf Englisch geführtes Gespräch mit dem Programmdirektor und dessen österreichischem Englischlehrer. Im Zentrum stand ein Test meiner politischen Ansichten. Wer beim Sechstagekrieg im Recht war, das gehörte zu den einfacheren Fragen. Ob Israel den Arabern nicht doch Unrecht getan habe. Was ich zum Vietnamkrieg zu sagen wisse. Ich wusste wenig und ergriff umso leidenschaftlicher Partei für Israel und die USA.
Die Mutter hamsterte kiloweise Zucker, als der Sechstagekrieg ausbrach, der Vater beruhigte wie immer. Es gebe keinen neuen Weltkrieg. Die Ruhe des Vaters hatte mir schon 1961 imponiert, als im Urlaubsort all die Wiener Professoren und Psychiater bei der Nachricht vom Mauerbau durcheinanderliefen wie die Hühner. Vater, der sich nie wichtigmachte, erwies sich als der Einzige, der zu einer vernünftigen politischen Einschätzung imstande war. Auf einmal kristallisierte sich der Kreis dieser Entertainer, Glanzmacher und Luftikusse um ihn, der sonst lieber ihnen zuhörte.
Den politischen Tauglichkeitstest bestand ich. Nach Wollköpfen und Krawallmachern in den europäischen Städten wurde ich nicht gefragt. Ich hätte auch nichts dazu sagen können, obwohl die Kommune 1 gerade Berlin auf den Kopf stellte und der Student Benno Ohnesorg am 2. Juni dort von einem Polizisten erschossen worden war. Berlin schien mir Kleinstadt-Knaben weiter weg als New York. Wenn ich Unruhe stiften wollte, ließ ich es beim Biertrinken umgehen und lärmte nächtens mit meinen Freunden durchs Städtchen. Ich konnte mich wahrheitsgemäß als treuer Freund des Westens und als Mini-Atlantiker präsentieren, Alternativen waren mir bis dato nicht in den Sinn gekommen.
Zwischendurch, wenn die Stewardess gerade wieder etwas vom Professor bestelltes Feines bringt, denke ich, dass dies mein erster und einziger Flug sein könnte. Ich freue mich, wenn ich auf das Blau und den Glanz über der unendlichen grauweißgoldenen Wolkendecke schaue.
Das Filet de Bœuf Cordon Rouge kommt. Die Stewardess lüftet eine silberne Haube. Gegen den Château Smith Haut Lafitte vermag ich nicht einmal einzuwenden, dass die Jahrgangsbezeichnung fehlt. Zum Bœuf hat der Professor Haricot Verts, Kartoffelkroketten und gegrillte Tomaten gewählt.
Auch sonst musste man einiges beisammenhaben. Die Gesundheitsatteste zum Beispiel. Für das AFS-Stipendium hatte es eine Untersuchung beim Hausarzt und eine kleine Reise an die Uniklinik nach Innsbruck getan. Das College nahm sich wichtiger als das AFS, das sah man schon beim Gesundheitszeugnis. Das College schickte mich nach Zürich, zum Vertrauensarzt der amerikanischen Botschaft. Der residierte im Niederdorf, in einer kleinen, aber fein holzvertäfelten Ordination und sprach während der ganzen Untersuchung keine drei Worte, ohne dabei besonders unfreundlich zu wirken. Bei diesem verschwiegenen Besuch, zu dem ich mit dem Zug gereist war, wehte mich das Gefühl an, eine Nebenrolle in einem eleganten Kalten-Kriegs-Thriller zu spielen.
Den Professor amüsieren diese Geschichten fast noch mehr als die unglaubliche Völlerei, die er mit seinem Ticket zum Unterschied von mir ja selbst bezahlt hat. Er lässt mich aus mir herausgehen. Man könnte auch sagen, er holt mich aus.
Ich komme mir richtig wichtig vor, als ich mit dem Professor nach der Bayerischen Creme, dem Käse, dem Obst, dem Kaffee und den Pralinees – Professor Jacobson besteht auf Vollständigkeit – wieder zu Whiskey übergehe.
5
Während in der amerikanischen Öffentlichkeit die Kritik an der Bombenoffensive sprunghaft wuchs, verschärfte das Pentagon den Luftkrieg mit Angriffen auf die Vororte Hanois und auf Flussdeiche bei Viet Tri (11. und 12. August 1967). Nach einem Großeinsatz von 186 Maschinen am 18. August wies der Chef der 7. amerikanischen Flotte, Vizeadmiral Hyland, den Vorwurf zurück, seine Rekordzahlen seien falsch. Der Marinepilot Alex Waier hatte bei der Rückkehr nach Amerika erklärt, seine Staffel hätte ein Drittel ihrer Bombenlast über dem Meer abgeworfen, um schneller fliegen und Abwurfrekorde erzielen zu können. Oft seien »völlig nutzlose Bombenangriffe« geflogen worden.
Volksstimme, Wien, 20. August 1967
Trotz der neun Stunden Flugzeit und der Manhattans fühle ich mich nicht müde. Wie auch? Es ist erst Mittag, und ich bin in Amerika. Hey, ich bin da! Der König ist gelandet! Scheint keinen zu kümmern.
Bei der Zollkontrolle bittet mich ein gemütlicher großer Schwarzer, vielleicht durch den anmutigen Glanz meines Schnürlsamts misstrauisch gemacht, den Koffer zu öffnen, aber als er die absichtsvoll oben hineingelegten neuen Fußballschuhe sieht (italienische Marke, federleicht, Schraubstollen, in der Schweiz gekauft), drückt er den Deckel mit freundlichem Lächeln gleich wieder zu.
Die Einwanderungsformalitäten sind läppisch. Nimm ein Taxi, hatte die Mutter sich gewünscht, schau, dass du gleich direkt ins College fährst.
Der freundliche italienische Taxler führt mich über die Verrazzano-Narrows Bridge nach Staten Island. Frisch eröffnet, die Brücke, erklärte er mit großer Geste. Zahl nicht mehr als dreißig Dollar, hatte mir Professor Jacobson eingeschärft. Der Italiener nimmt vierzig. Vom an diversen Mautstellen zu entrichtenden Kleingeld abgesehen. Mir, der dreihundert Dollar dabeihat, zum Teil in Form von Reiseschecks, ist der Fahrpreis ebenso egal wie diese mir von mancher Alpenstraße vertraute private Form der Wegelagerei.
Ich bin da.
Das Taxi überwindet den steilen Hügel und fährt auf ein neugotisches, breites, zweistöckiges Gebäude zu. Es hat zwei kleine Außentürmchen und zwei asymmetrische Türme in der Mitte. Die Beschriftung »Main Building« hätte es nicht gebraucht. Das riesige Tor und die ausladende Treppe sagen genug. Der Inbegriff von College-Architektur. Gebaute höhere Bildung.
Niemand zu sehen. Ich fühle mich auf einmal ein wenig müde, als ich dem Taxi nachschaue. Recht besehen, hätte nicht der Fahrer, sondern ich ein Trinkgeld verdient, dafür, dass ich mir die ganze Familiengeschichte des gutgelaunten Italoamerikaners anhörte, der von vornherein wusste, dass er mir Grünschnabel zehn Dollar zu viel abknöpfen würde.
Wo sind die Türme von Manhattan?
Nicht zu sehen.
Das hier ist eine Vorstadtidylle, sonnig, ruhig und grün. Fast geräuschlos und auf schattenhafte Art brutal schiebt sich ein schwarzweiß lackierter Streifenwagen mit offenen Fenstern langsam auf das Main Building zu. Der Inspektor nimmt die verspiegelte Sonnenbrille nicht ab, verzieht keine Miene und gleitet im Schritttempo vorbei.
Hinter dem Main Building liegen mehrere Gebäude, kleine Häuschen aus dem 19. Jahrhundert, eine Villa, moderne Bauten, vier sechsgeschoßige mit Gängen verbundene Türme aus Glas, Beton und roten Ziegeln. Eine Brücke führt zum Haupteingang, darauf steht ein hölzernes Bänkchen.
Ein Pärchen sitzt in der Nachmittagssonne. Es ist ein prächtiger Spätsommertag. Die Blätter der riesigen Ahorne und Buchen werden schon bunt. Als ich näher komme, sehe ich, dass es zwei Männer sind, die Händchen halten.
Willkommen in New York. Ich habe, kaum glaubhaft für jemanden, der nahe der katholischen Kirche aufwuchs, keine Vorstellung von Homosexualität. Ich nehme die Erscheinung hin, würde gern meinen schweren Koffer loswerden und stelle mich vor.
Der eine ist der Verwalter, Mr. Applebaum. Ich stehe vor meinem Wohnort für die nächsten zehn Monate, erklärt er mir, aber ich bin zu früh dran, das College erwartet die Erstsemestrigen erst nächste Woche.
Ich habe geschrieben, sage ich.
Mr. Applebaum geht ins Büro und sieht nach.
Ich finde zwar keinen Brief, aber Ihren Namen. Also gut, wenn Sie schon da sind. Willkommen im Dormitory Tower! Ihre Zimmernummer ist B607, gleich hier rechts im sechsten Stock.
Er gibt mir den Schlüssel. Tatsächlich, ein Zweibettzimmer. Das Bett ist gemacht.
Wer wird mein Zimmernachbar sein?
Na, Bruce, wer sonst.
Das beruhigt mich. Bruce ist der erste Amerikaner, den ich in meiner Kleinstadt kennenlernte. Bruce ist ein wenig sonderbar, leicht verrückt, ein bisschen anders als die anderen Amis. Er bemühte sich immer, Deutsch zu sprechen, laut, schnarrend, falsch und – anders als ich – unbekümmert um seine Fehler. Bruce nimmt mich ernst. Als er bei uns zuhause zum Essen geladen war, sagte er zu meiner Mutter gleich Mutti, das gefiel ihr. Bruce ist in mancher Hinsicht ein Freak. Immer neugierig, wie das Leben dort läuft, wo er gerade ist. Immer auf der Seite der kleinen Leute. Immer weg vom Ami-Pulk. Immer abseits, immer mittendrin.
Während sich die anderen über meinen deutschen Akzent amüsieren, hilft mir Bruce, ihn zu beseitigen. Das R sei nicht so wichtig. Das lerne man. Das Schlimmste sei die Angewohnheit von uns Deutschzüngigen, das V wie ein W auszusprechen. Das gewöhne ich mir als Erstes ab.
Bruce ist ein Reisender. Aus unserer kleinen Stadt war er zum Beispiel nach Schweden gestoppt, hatte sich in Uppsala einer Studentengruppe angeschlossen und war schnell mit ihnen in die Sowjetunion gefahren. »Inside no difficulties at all«, schrieb er munter. Allein seine Art, Postkarten zu beschriften, nahm mich für ihn ein. Mit handgezogenen Linien schuf er ein kleines Adressfeld, um mehr Platz für den Text zu haben, mit dem er den Rest der Karte diagonal in kleinstmöglicher Druckschrift bedeckte.
Aus Frankreich schrieb er mir: »The Cote d’Azur is freezing cold (The ›Mistral‹). Nonetheless some fantastic experiences.« Auf dem Weg nach Süden sei er mit rechten Terroristen der frankreichfreundlichen OAS im Zug gesessen, auf der Rückfahrt mit deren Feinden, mit algerischen Freiheitskämpfern. In einem verschlafenen französischen Provinznest kam er um drei Uhr nachts an. Alle Hotels waren geschlossen, so nächtigte er in einem Haus mit unversperrter Haustür auf der Stiege. Der Hausbesitzer rief die Polizei. Bruce war darauf aus, die Welt zu erfahren. »Bis Wiedersehen«, schrieb er, »herzlicht, Bruce.« Bruce ist vielleicht ein wenig mühsam, aber er ist vermutlich der beste Zimmergenosse, den ich mir wünschen kann.
Wo ist Bruce?
Keine Spur von Bruce.
Wahrscheinlich irgendwo unterwegs im Land.
Essen gibt es da drüben, in der Dining Hall.
Applebaum zeigt auf einen weiteren modernen Ziegelbau im brutalistischen Stil der Sechzigermoderne.
Dreimal täglich gibt es frische Mahlzeiten, aber es ist durchgehend geöffnet, es gibt immer was zu essen.
Das klingt gut.
6
»Don’t Look Back«, ein abendfüllender Dokumentarfilm über Bob Dylan, den Folksänger, hatte gestern bei der Premiere beim Montreal International Film Festival ein volles Haus. (…) In einer Sequenz wird Mr. Dylan über seine Meinung zum Time Magazine befragt. Seine Antwort voller Four-Letter-Words wurde geradezu in den Raum gebrüllt, weil der Ton so laut war. Als Mr. Dylan seinen Kommentar abgeschlossen hatte, brach tosender Applaus aus …
The New York Times, 15. August 1967
Was wird von mir erwartet? Darüber mache ich mir keine Gedanken.
Das College erwartet einen dankbaren Repräsentanten des Landes, in dem es mit seiner Dependance zu Gast ist. Es erwartet wohl auch ein Mitglied der College-Gemeinschaft, das es später herzeigen, mit dem es vielleicht sogar werben kann. Wie Kari Pederson, die Schönheitskönigin des Staates New York 1967, oder den berühmten Religionsphilosophen Peter L. Berger, der hier in den 1940er Jahren seine akademische Karriere begann und von dessen Existenz ich natürlich nichts weiß.
Es gibt zwei, drei College-Mitarbeiter aus Bregenz, die Amerikaner geworden sind. Sie kommen mir dienstwillig, eilfertig, überangepasst vor. Wie sie kann und will ich nicht werden. Ich bin für die USA, aber so einschmiegen werde ich mich nicht.
Die Menschen, die mir halfen, erwarten Dankbarkeit und Berichte. Die Mutter ist ängstlich, sie will Bescheid wissen. Sie erwartet einen Brief, viele Briefe. Der Vater tut gelassen, er setzt Vertrauen in mich, um ihn muss ich mich nicht kümmern. Das heißt nicht, dass er mir vertraut, aber er ist klug genug, um zu wissen, dass Misstrauen oder Druck noch weniger bringen.
Ein Bild der Mutter taucht manchmal in meiner Erinnerung auf. Es ist später Abend, draußen ist es dunkel. Sie steht am Küchenfenster, schiebt immer wieder den Vorhang beiseite und schaut in die Einfahrt. Sie wartet sehnsüchtig auf die Scheinwerfer des Autos, das Vater von der Dienstfahrt ins Gebirgstal zurückbringt. »Hoffentlich ist ihm nichts passiert!«, sagt sie jedes Mal, wenn sie den Vorhang wieder loslässt. Ich konnte den Satz nicht mehr hören. Was passiert, passiert, dachte ich. Am Fenster Stehen wird daran nichts ändern. Vater ist noch immer heimgekommen.
Der österreichische Staat? Erwartet gar nichts. Das Bundesheer aufzuschieben erwies sich als leicht. Der amerikanische Staat? Erwartet er vielleicht einen neuen Bürger? Das bleibt abzuwarten.
Ich enttäusche sie alle. Verrate sie leichten Herzens, tue so, als sähe ich diese Erwartungen nicht.
Was erwarte ich selber?
Will ich ins Traumland, um neu anzufangen? Alles hinter mir lassen? Nein. Ich bin aufgebrochen wie in einen längeren Urlaub. Nicht ahnungslos, aber auch nicht vorbereitet. Planlos. Habe ich vor, mich anzufüllen mit Eindrücken, zu lernen, angereichert zurückzukehren, um weiterzumachen wie bisher? Wie denn? Keine Ahnung. Die Berufsberater sagten allesamt Unsinn. Ein mit Vater befreundeter Psychologe empfahl mir ein Medizinstudium. Ein Musiker riet zu Musik. Die Jesuiten blickten mir tief in die Augen und schwärmten mir von der Härte ihrer Berufung vor. Ich ahne was von Schreiben, aber zu wenig, um es einen unabweisbaren Wunsch zu nennen.
In Wahrheit will ich Zeit. In Wahrheit rebelliere ich gegen die Idee eines Lebensplans. In Wahrheit misstraue ich dem Erfolgsmodell, das ich erfolgreich mime. Ich fühle mich als Sieger, als Durchreißer, gebe mich aber auch mit dem Erreichen des Finales, mit der Nummer zwei zufrieden. Amerika ist mein Glaube an eine glänzende Zukunft, die ich nicht kenne. Amerika ist, wo sich die Nebel lichten. Ich habe keine Ahnung, was für einer ich werden will.
Ich bin nicht einmal entschlossen, Brücken abzubrechen, nicht zurückzublicken. Von Österreich kennen sie hier nur »The Sound of Music«, das wiederum ich nicht kenne. Bin stolz auf Europa, aber so auf das Kommende fixiert, dass die Erwartungen anderer nicht mehr zählen. Bin ein Amerikagläubiger ohne Siegerplan. Kann das gutgehen?
7
Der State-Polizist sagte, die Detroiter Polizeibeamten hätten die Schwarzen an die Wand gestellt und sie aufgefordert zu beten. Er sagte, er sah zwei Beamte aus einem Zimmer kommen, in dem eine Leiche lag, und hörte sie etwas sagen wie »griff nach der Pistole« oder »der hatte eine Pistole«. Er sagte, er sah zwei Schwarze mit Schusswunden. Sie waren schon tot, als er das Motel betrat.
The New York Times, 15. August 1967
Allein im Zimmer.
Tower B607.
Zwei Betten, auf der Schmalseite ein geräumiger Kasten und die Tür. Auf der anderen eine eingebaute Schreibtischplatte, breit genug für zwei Arbeitsplätze.
Ein großes Fenster auf der Längsseite: noch immer nicht Manhattan im Blick. Aber die gerade neu eröffnete Verrazzano-Narrows Bridge, ein Riesenbauwerk, verbindet Staten Isand mit Brooklyn. Weiter links müssen sie sein, die Türme der Stadt. Chrysler Building, Empire State Building. Ich kann ihre Nachbarschaft spüren. Aber nicht sehen.
Ich mache mich auf in die Dining Hall. Den Koffer lege ich unausgepackt aufs Bett. Leicht gehe ich im beigen Glanz meines Schnürlsamts. Die Dining Hall ist leer und voll zugleich. Sie bietet an Tischen für je zwölf Personen 600 Menschen auf einmal Platz. 550 Sessel sind unbesetzt.