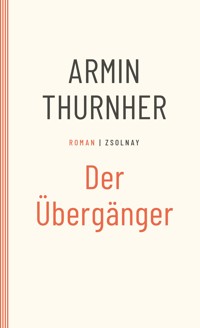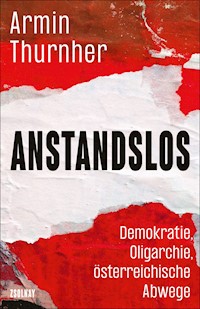
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Armin Thurnher, „einer der scharfsinnigsten Analytiker österreichischer Politik“ (NZZ) über die Politik Österreichs, von Sebastian Kurz über Korruption zum Weltuntergang „Die Welt steht auf kan Fall mehr lang“, heißt es in Nestroys berühmtem „Kometenlied“. Vieles von dem, was einst zum festen Bestand demokratischer Selbstverständlichkeiten zählte, scheint abgeschafft zu werden. Wir wissen nicht mehr, was wir für wahr halten sollen. Ganz schnell löste sich etwa der falsche Glanz des konservativen Hoffnungsträgers Sebastian Kurz auf in einer Wolke von Skandalen, Korruption und dubiosem Gefolge. Während die multiplen Krisen das Publikum aber vollends verunsichern, findet Kurz mühelos Anschluss an jene Kreise um Donald Trump, die unser politisches System lieber heute als morgen über Bord werfen möchten. In seinem neuen Buch sondiert Armin Thurnher die Lage und zeigt, dass der große Weltuntergang wie immer in Österreich seine kleine Generalprobe hält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Armin Thurnher, »einer der scharfsinnigsten Analytiker österreichischer Politik« (NZZ) über die Politik Österreichs, von Sebastian Kurz über Korruption zum Weltuntergang»Die Welt steht auf kan Fall mehr lang«, heißt es in Nestroys berühmtem »Kometenlied«. Vieles von dem, was einst zum festen Bestand demokratischer Selbstverständlichkeiten zählte, scheint abgeschafft zu werden. Wir wissen nicht mehr, was wir für wahr halten sollen. Ganz schnell löste sich etwa der falsche Glanz des konservativen Hoffnungsträgers Sebastian Kurz auf in einer Wolke von Skandalen, Korruption und dubiosem Gefolge. Während die multiplen Krisen das Publikum aber vollends verunsichern, findet Kurz mühelos Anschluss an jene Kreise um Donald Trump, die unser politisches System lieber heute als morgen über Bord werfen möchten.In seinem neuen Buch sondiert Armin Thurnher die Lage und zeigt, dass der große Weltuntergang wie immer in Österreich seine kleine Generalprobe hält.
Armin Thurnher
Anstandslos
Demokratie, Oligarchie, österreichische Abwege
Paul Zsolnay Verlag
1. Ortsbestimmung
Wir sind niemand. Will sagen, ich bin niemand, der sich als Teil eines Wir verstehen würde. Seit einiger Zeit habe ich Posten in der Einschicht bezogen. Die Pandemie legte mir nahe zu tun, was ich immer schon hatte tun wollen, aber das hat hier nichts zu bedeuten. Bin Mitglied der sogenannten Vulnerablen, aber sind wir das nicht alle? Der Rückzug in die Einschicht schützte mich scheinbar gesundheitlich und löste mich aus manchen sozialen Zusammenhängen.
Vielleicht lässt sich die Auflösung vieler Wir-Gewissheiten auch daran ablesen, dass dieses Personalpronomen so inflationär gebraucht wird. Je kleiner die Gemeinschaften, desto größer ihr Anspruch aufs Ganze. Je kleiner die Gruppe, desto laustärker schallt ihr »wir«. Kein Wir hier, ermahne ich mich also gleich zu Beginn. Nicht einmal ein majestätisches Ego-Wir. Kein Pluralis Majestatis, diese Selbstkrönung publizierender Würstchen, die auch ich in schwachen Momenten nicht verschmähe. Und schon gar kein verlogenes Generationen-Wir, das löst sich mit der Zeit sowieso auf.
Ich sehe die Dinge aus einer gewissen Distanz, mehr als früher, als mich jeder Tag mit einigen jener Menschen zusammenbrachte, über die ich schrieb. Manchmal stellte ich mir damals eine Gefängniszelle als idealen Ort vor zu schreiben. Der Konzentration auf das Blatt wegen, sei es das leere, das vor einem liegt, oder die leere Zeitung, die jede Woche neu gefüllt sein will.
Das Blatt ist dem Schirm gewichen, der die Konzentration erschwert, weil er lebt und einem — abgesehen von den Partikeln, mit denen er einen fortwährend beschießt — unentwegt Dinge aus der Außenwelt nahebringt, die ich beachte, obwohl ich sie nicht beachten müsste. Beschuss der Zustand, Ablenkung der Imperativ. Einem bekannten Wort zufolge bedeutet Zerstreuung, und die ist das Ergebnis von Ablenkung, dass eine Aufgabe kulturell gelernt worden sei, aber was wäre hier die Aufgabe? Dass man aufgegeben hat, für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen? Dass man es vergessen hat?
Die Zelle ist da. Auch wenn sie ein paar hundert Quadratmeter misst, samt Park, so bleibt es doch eine Zelle.
Der Park übrigens — Sie sehen, ich bin in einem Lebensstadium angekommen, an dem ich aus meinen Lebensumständen kein Hehl mehr mache —, der Park ist ein Schlosspark, aber ich ziehe mich nicht in ihn zurück, um zu ruhen, zu reflektieren oder gar zu schreiben. Das habe ich mir früher so ausgemalt. Komm in den totgesagten Park und schau!
Ich schaue nicht, ich plage mich. Der einst herrschaftliche Park ist mangels Personal meine Knechtsphäre. Kraftgärtnern wäre nicht das richtige Wort für das, was ich tue. Ich berichte meinem Publikum darüber regelmäßig in meiner täglich erscheinenden »Seuchenkolumne« und merke, dass Mitteilungen über unsere Kunstnatur und meine dilettantische Koexistenz mit ihr dieses Publikum mehr begeistern als das meiste, was ich über Politik sage. Das ist natürlich (hier passt das Wort) so, weil eine durch unser Zutun entgleisende Natur ebenso zu den großen Angstkrisen gehört, die alle Tage beherrschen, wie die Krisen von Politik, Wirtschaft und Gesundheit. Und weil andererseits die Vorstellung fremder, in diesem Fall meiner Plagen das eigene Dasein erträglicher macht. Ich mache mich zum Affen, das macht sympathisch.
Man lebt im Neobarock, sündengewiss, prangersüchtig und verhängnisfroh, der gerechten Strafe für sein frevelhaftes Tun gewärtig. Aufklärung war gestern und kommt vielleicht morgen wieder; die Gegenwart aber hat es geschafft, jene Mischung aus Rationalität, Maschinentheater und Gegenreformation erneut zu aktualisieren, die man Barock nannte, aber vielleicht besser Operettenbarock nennen sollte.
Was ich über die Präferenzen des Publikums sagte, stimmt nicht ganz. Kritik an der herrschenden Partei wird akklamiert; auch Kritik an der Opposition, überhaupt Kritik an der Politik im Allgemeinen. Selbst Medienkritik, wenn sich die mitgemeinte Blase ausgenommen vorkommen kann. Den Zensursplitter im Auge haben immer die anderen.
Seit ich mich aus meiner Welt-Erscheinung etwas zurückgezogen habe, veröffentliche ich mehr über mich. Noch so ein zeitgenössisches Paradoxon: Die Monaden rufen ungeniert ihr Privatzeug in die Welt hinaus; als sie noch aufeinander trafen und beieinander saßen, waren sie in gewissen Dingen verschlossener.
Dem Sog des falschen Wir der sogenannten Social Media kann sich bei Strafe des Absterbens seiner öffentlichen Erscheinung kein Publizist entziehen, der jünger ist als siebzig. Ich bin zwar älter als siebzig, aber nicht gewillt, diesen sozialen Tod kampflos hinzunehmen. Gegen das Absterben ansterben. Wer immer sterbend sich bemüht, trägt bei zu unseren Erlösen, sagen dazu die CEOs der Social Media, und wir machen mit, wie alle Mitmacher im vollen Wissen dessen, was wir bewirken. Wir schon wieder. Nein, ich mache mit, die meisten haben offenbar keine Ahnung oder es ist ihnen egal, wobei sie da mitmachen und was da mit ihnen gemacht wird. Auch dazu werde ich versuchen, etwas zu sagen.
Mein Park ist ein Stadion meines großen Noch. Wie lange noch werde ich die Kraft haben, mit Kettensäge und Heckenschere, mit Krampen und Schaufel, mit Rechen und Sense zu Werke zu gehen? Wie lange werden wir uns das alles leisten können? Wie lange werden die Bäume noch Blätter tragen, wie lange werden sie den unvermittelt über sie hereinfallenden, immer stärker blasenden Sturmböen standhalten? Wie lange wird der Erde Grün von neuem uns erglänzen, wie es selbstverständlich bei Hölderlin steht?
Und wie lange noch werden wir uns der repräsentativen Demokratie erfreuen, in der wir meinen, uns zu bewegen? Der demokratische Park droht zum Reservat zu schrumpfen. Umstellt von autoritären Großmächten hat er aufgehört, seine Vorzüge in Schwellenländer, in den Süden und in den pazifischen Raum zu exportieren; stattdessen ist auch dort in den größten Demokratien Indien und Brasilien der Übergang zur Autokratie erreicht, wenn nicht überschritten. Von innen aber sind gleichfalls Großmächte am Werk, die, um ihn zu erhalten, bereit sind, ihn zu zerstören. Ein übles Durcheinander.
Der Park ist auf dem Land nicht gut angesehen. Nachbarn fühlen sich von hohen Bäumen belästigt; der Sturm droht sie auf ihre Dächer zu kippen, herabfallende Äste bedrohen ihre Gesundheit, und vor allem machen sie Schmutz in Form von Blättern, die im Herbst von den Straßen und Wiesen gefegt werden müssen; sie zu sammeln und zu kompostieren bleibt herrschaftliches Privileg. Der Bürger und die Bürgerin entledigen sich des Biomülls in der Biotonne: Es gibt kaum einen absurderen Anblick als all die Häuser mit Garten, vor denen Woche für Woche die Biotonne zur Abholung bereitsteht, für die Deponie. Im Frühling kaufen die Landleute dann ihre Bioerde im Supermarkt.
Was haben wir gelacht. Das Lachen ist mir nicht vergangen. Gott allein, an den ich umso weniger glaube, je mehr ich ihn anrufe, weiß, warum.
Ehe ich zum Grund für mein Gelächter komme, gestatten Sie mir drei Worte. Eines zu der erwähnten Seuchenkolumne, eines zur Form dieses Buches und eines zum titelgebenden Anstand.
Als ich mich Mitte März 2020 aufs Land zurückzog, nach Niederösterreich, ins südwestliche Waldviertel, begann ich mit dem Schreiben einer täglich außer Sonntag online erscheinenden Kolumne, einem Blog, den ich »Seuchenkolumne« nannte, in der sicheren Gewissheit, dass mir die Seuchen weder während noch nach Corona ausgehen würden. Das habe ich bis zum Schreiben dieses Buches durchgehalten. Die Menge des von mir in dieser Zeit Veröffentlichten umfasst etwa 25 Bücher vom Umfang dieses Essays.
Immer wieder schreiben mir Leserinnen und Leser der Kolumne, sie würden sich auf ihre Veröffentlichung in Buchform freuen; die wird es schon dieser Menge wegen nie geben. Für dieses Buch habe ich aber noch einmal nachgelesen, was ich so schrieb, wenn der Tag lang, die Seuche hart und die Dummheit groß waren. Kann sein, dass das eine oder andere in kommentierter, verwandelter Form oder als bloßer Anklang hier auftauchen wird.
Bei diesem Buch handelt es sich jedoch um keinen Digest der Seuchenkolumne, sondern um einen Essay zum Zustand des Landes und der Welt, wie sie sich mir zeigen. Also zu meinem Zustand. Dazu gehören unabweisbar auch Streiflichter ins pandemische Leben. Vom Einschnitt der Seuche in unser Leben und von der Art, in der Politik und Gesellschaft mit ihr umgingen und umgehen, werden wir uns weit langsamer erholen als von den zweckoptimistischen Prognosen von Trendforschern und Politikbeobachtern oder von den apokalyptischen Sprüchen mancher präsumtiver Seuchengewinnler. Bald wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist, sagte einst Österreichs Alt-Juniorkanzler Sebastian Kurz, der sich schon als mit absoluter Mehrheit ausgestatteter Seuchen-Autokrat sah, dann aber als von der Schwindlerseuche befallen entlarvt aus der Politik verjagt wurde, was ihm in Österreich ein immerwährendes ehrendes Andenken sichert.
Warum schrieb ich die Seuchenkolumne? Als Angehöriger der Risikogruppe 70+ fühlte ich mich verpflichtet, der Gesellschaft ein Intensivbett möglichst lange freizuhalten. Ich schuldete der Welt einen Toten, um mit Heiner Müller zu sprechen, aber ich wollte mir bei der Rückzahlung Zeit lassen. Die Selbstisolation war nicht ausschließlich selbstgewählt. Der Rückzugsort war vorhanden. Er war einschichtig, denn ein Schloss in belebter Gegend kann ich mir nicht leisten.
Die Kommunikation per Internet verläuft auf dem Lande nicht so einfach wie in der Stadt. Die Leitung ist langsam. Längst ist zwar Glasfaser versprochen, auch sind schon Kabel verlegt, aber es geht ja eher um ein Sinnbild: Informationen fließen hier nicht üppig. Auf dem flachen Land, in Niederösterreich, gibt es keine autochthonen Tageszeitungen, bloß die mutierten Ausgaben der Wiener Blätter. Das Gebiet ist also auch journalistisch ziemlich weiß.
Kommuniziert wird eher per Dekret der Bauernkammer als über eine mediale Öffentlichkeit. Dieses debattierende und alles in Frage stellende Milieu wurde hier immer schon als störend empfunden. Die Presse hat mit der Politik zu kooperieren, basta. Message-Control war hier schon gottgegeben, ehe das Wort von ihr in die Welt kam. Kommunikation lief hier immer krisengerecht, als Erbrecht des Feudalherrn, der anschafft. Die ÖVP erzielt bei Wahlen mehr als achtzig Prozent, und seit der afrikanische Pater im Dorf den Gottesdienst übernommen hat, gehen die Leute auch nicht mehr in die Kirche. Sie verstehen seinen Akzent nicht.
In der Politik hingegen gibt es nur diesen Akzent. Die niederösterreichische Organisation der Volkspartei (ÖVP) stellt Kanzler und Minister, präsidiert das Parlament, kontrolliert das Innenministerium und andere Schlüsselministerien als Urbesitz, kurz, sie beherrscht die Republik derart, dass man von einer Verniederösterreicherung sprechen muss, wie das der zu Unrecht vergessene Dichter Hermann Schürrer zu tun pflegte, wenn er sich in den 1970er Jahren in einem Szenelokal trunken und übelgelaunt erhob, die Menge überschaute und mit Stentorstimme rief: »Olles Niederösterreicher!«
Aktuelle Politik steht dennoch immer wieder zur Debatte. Etwa wenn die Frage auftaucht, in welcher Form man des austrofaschistischen Diktators Engelbert Dollfuß gedenken solle, der in der Ersten Republik das Parlament ausschaltete und sozialdemokratische Arbeiter ermorden ließ. Er ist eine insofern stets aktualisierbare Figur, als er den ewig weiterschwelenden und auch die Zweite Republik vergiftenden Konflikt zwischen den ehemaligen Bürgerkriegsgegnern symbolisiert, die, nun verpflichtet, die Macht miteinander zu teilen, den Wunsch, einander auszuschalten, nur unzureichend sublimiert haben. Außerdem können sie damit ihren Konflikt auf die terminologische Ebene verschieben: War der Austrofaschismus ein Faschismus oder nicht? Aus Postfaschisten werden oft die glühendsten Demokraten, sagt man.
Allerdings ist Misstrauen angebracht, wenn etwas glüht. Sie seien »glühende Europäer«, bringen in der Regel die eiskältesten und egomanischsten Typen vor. Das einzige Glühen, das mir unverdächtig scheint, ist jenes der Glühwürmchen.
Im Ausnahmezustand des ersten Seuchenschocks erwies sich der Zugriff einer einzigen Partei mitunter als Segen. Das Dorf, in dem ich wohne, wies — etwa dem Ergebnis der Bürgermeisterwahl entsprechend — eine Durchimpfungsrate von achtzig Prozent auf. Vor allem zu Beginn der Pandemie waren die Corona-Tests überzeugend effizient organisiert. Einschüchterungen und Angstmache griffen zwar hier bei alten Leuten besonders unangenehm; die taten sich schwer, nötige Vorsichtsmaßnahmen von politischer Medienrhetorik zu unterscheiden. Andererseits blieben die Protestmilieus vom gemeinen Landfreak bis zum anthroposophischen Landwirt isolierte Inseln des Coronaleugnerkultes in einem Ozean von Kooperation.
Das Landleben hatte den Vorteil, dass man solche Trennungen der Milieus sauber durchzuhalten vermochte und sich deswegen sicherer wähnen konnte als in der Stadt.
Ich versuchte, die Seuchenkolumne thematisch wie formal frei anzulegen; Politik war nur einer ihrer Inhalte. Nachrufe auf verstorbene Freunde in Hexametern, Musikalisches, Poetisches (eigene Gedichte, seien Sie gewarnt!), Szenen einer Staatsoperette, Gespräch mit dem Kater, Rezepte für ungesundes Essen, Polemiken, Sottisen, Satiren, Buchrezensionen, Reiseberichte, Hommagen, Vernichtungen, Liebeserklärungen, Filmkritiken, Reprints alter Artikel, Medientheoretisches und vieles mehr kamen hier vor. Das Programm der Kolumne war, keines zu haben, außer dem, diagnostisch die Krankheiten unserer Zeit zu umkreisen. Bald gesellte sich mir als Koautor der klinische Epidemiologe Robert Zangerle zu. Ein Gschenk — mehr dazu im Kapitel 5.
Die Kolumne ist frei, sie ist meine Wette auf die Freiheit, mein Ausbruchsversuch aus jenem redaktionellen Korsett, in dem ich mich journalistisch schreibend stets bewegt hatte, zugleich wider dieses löckend, es immer wieder durchlöchernd, den Journalismus kritisierend, getreu dem Karl-Kraus-Aperçu, er habe keine Auswüchse, er sei einer, ihn nicht ernst nehmend, ihn ausreizend, in ihm selbst gegen ihn Stellung nehmend. All das tat ich nun weiterhin, jedoch ließ ich die Instanz von Kontrolle wegfallen, die demokratisch wertvollen Journalismus legitimiert, weil es ihn erst zum redaktionellen macht.
Dieser Essay gleicht insofern dem redaktionellen Journalismus, als er den Gesetzen der Buchproduktion genügt und einen strengen Lektor hat (Lektoren sind immer vorher zu streng, danach zu wenig). Die Seuchenkolumne ist wildgewordene Autorschaft oder sollte es zumindest sein. Der Essay bietet kein »Best of Seuchenkolumne«, aber das Beste der »Seuche«, wie die Kolumne im Volksmund mittlerweile heißt, wird hoffentlich in ihn Eingang finden. Das Land der Seuche mit der Kolumne suchen. Auch an Kalauern herrschte kein Mangel. Der Kolumne mangelt es auch nicht an Tippfehlern, das ist der Preis ihrer Freiheit. Diese Fehler haben ein von mir so genanntes Volkskorrektorat ins Leben gerufen, eine Gruppe von bis zu fünf Menschen, die mir jeden Morgen ihre Korrekturen schicken, die ich alsbald einfüge. Meine persönliche Kombination aus digitalem Morgensegen und kalter Dusche.
Das Wilde hat doch einen Sinn: Es möchte in den Blick nehmen, was die Seuche so brutal beleuchtet hat. Wie konnte es mit uns so weit kommen? Was ist da genau geschehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Was hat die österreichische Gesellschaft, in der die Welt angeblich stets die Probe hält, zumindest als Versuchsstation des Weltuntergangs, von einer gemäßigt solidarischen zu einer unmäßig gierigen gemacht, der alle Maßstäbe abhandenzukommen drohen? Gab es Tipping-Points, und wo waren diese? Was sagen uns die Reaktionen auf die Pandemie über den Zustand des politmedialen Komplexes und seine Reife? Was lernen wir über den Stand des autoritären Kapitalismus, dem diese Seuche entsprang? Was über die Auflösung einer Öffentlichkeit, die von der Postaufklärung hinüberdriftet in einen präabsolutistischen Zustand? Warum ging und geht das alles, um das Wort endlich zu nennen, anstandslos vor sich?
Nämlich ohne Anstand der Protagonisten. Und wenig beanstandet von den Betroffenen. Oder wenn beanstandet, dann mit möglichst wenig Anstand, allenfalls als Retorsion auf erhobene Anschuldigungen, als vorauseilende Selbstverteidigung, als Untergriff, als Hetze, als Desinformation und als desinformierter Aufstand, etwa von sogenannten Coronaleugnern, anderswo auch Wahlleugnern, Election-Deniers.
Anstand. Ein Begriff, der bei der Linken in keinem hohen Ansehen steht. Ein Allerweltswort, vor allem von Reaktionären üppig gebraucht. SS-Chef Himmler führte es 1943 im Mund, als er in seiner berüchtigten Posener Rede vor Gauleitern sagte: »Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn hundert Leichen beisammenliegen, wenn fünfhundert daliegen oder wenn tausend daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei — abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen — anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Das ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte …« Sollte das Wort danach nicht für alle Zeiten diskreditiert sein?
Immerhin kann man zur Kenntnis nehmen, dass Anstand ein bürgerlich-kleinbürgerlicher Kampfbegriff gegen den Feudaladel war, aber selbstverständlich auch der Inbegriff der Heuchelei, der verlogenen Wohlanständigkeit. Es geht weniger darum, Anstand zu fordern, sondern sein Fehlen gerade bei denen zu konstatieren, die am leidenschaftlichsten auf ihn pochen, jenen Anwälte der »Anständigen und Fleißigen«, die sich dann oft als die unverschämtesten Nehmer, Abgreifer und Korruptionisten herausstellen. Anstand hat mit Würde zu tun; auch Würde besaß ja eine soziale Sprengkraft, als die empörten Bürger darauf hinweisen konnten, dass im Feudalismus die Würde des Amtes und jene der Person allzu oft auseinanderfielen.
Der Anstand des österreichischen Bürgertums, zumindest von großen Teilen seiner politischen Vertretung, ging offenbar verloren. Wann und wo genau verloren die ihre Würde? Als sie mit den Rechtsextremisten der FPÖ koalierten? Als jene türkise Gang, die Sebastian Kurz ins Kanzleramt schummelte, weder Umfragebetrug noch Medienkorruption scheute? Als sie bloße Popularitätshascherln wie den nicht rechtskräftig wegen Untreue und Beweismittelfälschung verurteilten Karl-Heinz Grasser in Spitzenämter emporhoben und gewähren ließen? Als sie Konzepte wie die ökosoziale Marktwirtschaft oder gar der katholischen Soziallehre aufgaben, die unter Kanzler Wolfgang Schüssel durch eine Art Austro-Neoliberalismus ersetzt wurden und dann, unter Kanzler Kurz, durch eine Art Austro-Trumpismus?
Es gibt das eine oder andere, das man für den Anstand vorbringen könnte. Im Anschluss an Kant sagt der Philosoph Dieter Thomä dazu: »Wer anständig ist, tut so, als ob er moralisch wäre, und wird es damit am Ende selbst.« Dass selbst das Tun, als wäre man anständig, in Österreich aus der Mode kam, zeigt den Ernst einer Lage, in der es kein moralisches Halten gibt.
Das hat im Übrigen mit der Kritik des Moralisierens wenig zu tun. Diese soll vor allem diskreditieren oder Kritik entwerten. »Der moralisiert ja nur.« Moralisieren als das verlogene Vorschützen von Moral ist abzulehnen. Aber damit gleich Moral selbst zu diskreditieren, also die Anleitung, wie wir richtig handeln und leben sollen, mit einem Bann zu belegen, hieße doch, das Kind mit dem Bad auszuschütten.
Also ist der Begriff des Anstands vielleicht für dieses Unternehmen doch brauchbar. Denn er bezeichnet jenes eingefleischte, anerzogene Wissen über