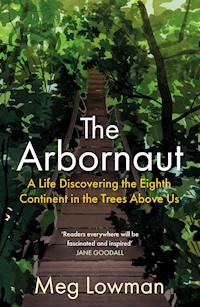9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Meg Lowman ist die weltweit führende Expertin für den Lebensraum der Baumkronen. Sie entwickelte eigene Techniken wie die »Skywalk«-Stege, die den von ihr so getauften »achten Kontinent« erschließen - das Blätterdach, in dem die Hälfte aller Spezies unseres Planeten lebt.
In ihrem neuen Buch schildert Lowman ihren Weg zum Erfolg auf einem von Männern dominierten wissenschaftlichen Gebiet, erzählt von den Menschen, die in und von den Wäldern leben, in denen sie arbeitet, und warnt vor dem rasanten Verschwinden des Lebensraums Wald. Vor allem aber lässt sie ihre Leser*innen an ihrer Entdeckung einer Welt teilhaben, die - verborgen über unseren Köpfen - auch heute noch voller Geheimnisse steckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Als kleines Mädchen durchstreifte Meg Lowman staunend die Birken-, Ahorn- und Buchenwälder in ihrer Heimat an der amerikanischen Ostküste. Als junge Biologiestudentin begann sie, den Lebensraum der Bäume von den stürmischen schottischen Highlands über die Tropen Malaysias bis zu den Weiten australischer Eukalyptuswälder zu erforschen. Was sie fand, war ein unentdeckter »achter Kontinent: die hoch über unseren Köpfen verborgene Welt der Baumkronen – das artenreichste und geheimnisvollste Ökosystem unseres Planeten …
»Der unentdeckte Kontinent fängt die Magie einer kaum bekannten Welt ein – und erzählt von Pionierarbeit. Was wir hier über die Natur lesen, fasziniert und inspiriert.« Jane Goodall
»So aufregend und erfinderisch kann Wissenschaft sein. Dieses Buch muss man einfach lesen.« E. O. Wilson
Zur Autorin
Meg Lowman, geboren 1953 in New York, studierte an der Aberdeen University in Schottland und promovierte an der University of Sydney in Australien. Sie ist Biologin, Aktivistin und Autorin. Ihre Erforschung des Ökosystems Wald, insbesondere der Baumkronen, die sie seit über dreißig Jahren auf allen Kontinenten betreibt, gilt international als wissenschaftliche Pionierarbeit.
MEG LOWMAN
DER UNENTDECKTE KONTINENT
Mein Leben und Forschen in der Welt der Baumkronen
Aus dem Englischen von Elsbeth Ranke
Blessing
Originaltitel: The Arbornaut – A Life Discovering the Eighth Continent in the Trees Above UsOriginalverlag: Farrar, Straus and Giroux, New YorkDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Verlag bedankt sich bei Dr. Alexandra Kehl, Wissenschaftliche Leiterin des Botanischen Gartens der Universität Tübingen, für die fachliche Beratung.
Copyright © 2021 by Margaret Lowman
Copyright © 2022 by Karl Blessing Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by arrangement with Farrar, Straus and Giroux, New York
Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin
Umschlagabbildung: © plainpicture/robertharding/Matthew Williams-Ellis
Illustrationen: © 2021 by Na Kim
Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-26318-8V002www.blessing-verlag.de
Dieses Buch ist den ewigen Helden des Planeten gewidmet – den Bäumen. Ich hoffe, meine Leidenschaft für diese Blattriesen lässt meine Leser:innen mitstaunen über unseren achten Kontinent, und vielleicht können wir gemeinsam dazu beitragen, ihn zu retten.Ein dickes Dankeschön an Eddie und James dafür, dass sie fröhlich mit ihrer Mom in so vielen Wälder geklettert sind.
INHALT
VORWORT VON SYLVIA A. EARLE
ZEHN FELDBIOLOGISCHE TIPPS FÜR ANGEHENDE ARBORNAUT:INNEN
VORWORT
Wie man den ganzen Baum sieht (und was das für den Wald bedeutet)
1 VON DER WILDBLUME ZUM MAUERBLÜMCHEN
Ein Mädchen erforscht die Natur im ländlichen Amerika
Amerikanische Ulme (Ulmus americana)
2 WERDEGANG EINER WALDDETEKTIVIN
Erste Forschungen in den Mischwäldern von New England bis Schottland
Meine Lieblingsbirken (Betula papyrifera, B. pendula und B. pubescens)
3 DREISSIG METER HOCH IN DER LUFT
Das Blätterdach im australischen Urwald – wer es studieren will, muss erst mal hinaufkommen
Coachwood (Ceratopetalum apetalum)
4 WER HAT VON MEINEN BLÄTTERN GEFRESSEN?
Wie man australische Insekten beobachtet (und entdeckt!)
Australische Riesenbrennnessel (Dendrocnide excelsa)
5 ARTENSCHWUND IM OUTBACK
Wie man im Urwald heiratet und das Absterben australischer Gummibäume untersucht
New-England-Eukalyptus (Eucalyptus nova-anglica)
6 DAS GLÄSERNE KRONENDACH
Vom Hochranken, Zurechtgestutztwerden und wie man als Frau in den Wissenschaften überlebt
Feigen (Ficus spp.)
7 ARBORNAUT:IN FÜR EINE WOCHE
Citizen Scientists erforschen den Amazonas-Urwald
Kapokbaum (Ceiba pentandra)
8 TIGERSPUREN, BAUMLEOPARDEN UND VEDIPPALA-FRÜCHTE
Wie ich Wissen und Werkzeug mit angehenden Arbornaut:innen in Indien teilte
Vedippala (Cullenia exarillata)
9 EIN BAUMKRONEN-BIOBLITZ
Wie wir in zehn Tagen 1659 Arten im Tropenwald von Malaysia zählten
Dunkelroter Meranti (Shorea curtisii)
10 VERTRAUEN SCHAFFEN ZWISCHEN PRIESTERN UND ARBORNAUT:INNEN
Wie wir den äthiopischen Wald retteten – Kirche für Kirche
Afrikanische Kirsche (Prunus africana)
11 DAS SCHWEBENDE KLASSENZIMMER – FÜR ALLE!
Rollstühle und Bärtierchen in den Baumkronen
Küsten-Mammutbaum (Sequoia sempervirens)
12 KÖNNEN WIR DIE WÄLDER RETTEN, DIE WIR NOCH HABEN?
Wie man Naturschutz fördert: Mission Green
GLOSSAR
DANK
BILDTEIL
VORWORT VON SYLVIA A. EARLE
Ich werde Bäume nie wieder so sehen wie früher, und der Rest der Welt auch nicht – dank der Autorin dieses Buchs. Es klingt selbstverständlich: Das meiste, was einen Baum ausmacht – und woraus ein Wald besteht –, befindet sich über Augenhöhe, aber bis Meg Lowmans unüberwindbare Neugier sie dazu antrieb, Bäume von oben nach unten zu betrachten, sahen die meisten Menschen sie doch eher von unten nach oben. Verpasst haben sie dabei das meiste, was Baumwipfel nicht nur als Individuen zu Wundern macht, sondern auch als Kollektiv: Sie sind Obdach und Nahrungsgrundlage für die meisten Waldbewohner und werfen auch für die übrigen Geschöpfe auf der Erde noch eine Rendite ab. Ich war sofort fasziniert, als ich von einer Botanikkollegin hörte, die auf ganz eigenen Wegen nicht nur ihr natürliches Klettertalent nutzte (das können schließlich alle Primaten), sondern beim Baumklettern mithilfe genialer Hubtechniken in ungekannte Höhen vorstieß und schließlich sogar Laufstege durch die Blattkronen der Bäume baute. Was sie dabei zu sehen bekam, vermittelt sie uns in diesem packenden Buch mit Geschichten, die schon allein deswegen wahr sein müssen, weil man sich so etwas nicht ausdenken kann!
Für Wissenschaftler und Forscher ist es eine Genugtuung, Neues zu entdecken, Orte, die noch keine Frau (und kein Mann) zuvor betreten hat, Aussichten, die noch niemand gesehen hat, und bedeutungsvolle Puzzlestücke des großen, quirligen Mosaiks des Lebens, das die Welt einmalig macht. Doch Meg Lowman tut noch mehr: Sie kommuniziert ihre Erkenntnisse nicht nur in der obskuren Sprache der Zahlen und Grafiken an die wissenschaftliche Community, sondern vermittelt sie mit ansteckender Begeisterung und Tiefsinn auch an Laien und erklärt in Sprache und Ton ihres Publikums, warum Bäume so wichtig sind und worin die untrennbaren Verbindungen zwischen ihrem und unserem Leben bestehen. Und sie macht uns klar, warum es so unerlässlich ist, die erhaltenen natürlichen Wälder der Erde besser zu schützen, in Klassenzimmern und Chefetagen davon zu sprechen, in Dörfern jenseits der Wolkenkratzer, in den Beamtenstuben der Regierungen, virtuell und im gedruckten Buch, weltweit.
Schon immer hat der Mensch sich aus der Natur von den Böden und Gewässern der Welt genommen, was er brauchte oder wollte. Als wir noch wenige waren und die Natur weitgehend intakt, hinterließen wir dabei kaum relevante Spuren, aber nach 100 000 Jahren eines mehr oder weniger friedlichen Verhältnisses zur Natur markieren die letzten 500 und ganz besonders die letzten 50 Jahre einen Wendepunkt, der für die Zukunft des Lebens auf der Erde nichts Gutes verheißt. Die Fähigkeit des Menschen, die Natur in ihrer Essenz aufzubrauchen und zu verändern, bringt uns heute an gefährliche Kipppunkte für Klima, Biodiversität und die Nutzung von Land und Wasser, die obendrein unter massiver Verschmutzung leiden; das alles führt zu immer massiveren Veränderungen von globalen Prozessen und der Grundlage dessen, was die Erde zu dem bewohnbaren Planeten macht, den wir kennen. Die gute Nachricht ist der andere Kipppunkt: das Wissen. Die Kinder des 21. Jahrhunderts (und auch die Erwachsenen) besitzen wahre Superkräfte. Sie wissen, wie die Erde vom Weltraum aus aussieht, sie sehen und hören in Echtzeit von Ereignissen überall auf der Welt und begreifen die neuen Perspektiven der geologischen Zeit, erkennen die Rolle der Erde im Universum, reisen in die inneren Abläufe von Zellen, auf den Grund der tiefsten Ozeane und in die Wipfel der höchsten Bäume. Noch vor einem halben Jahrhundert dachte man, die Erde wäre too big to fail. Inzwischen wissen wir es besser. Wenn die Erde für unsereins bewohnbar bleiben soll, müssen wir uns um die verbliebenen Naturräume kümmern, die in 4,5 Milliarden Jahren entstanden sind und in knapp über 4,5 Jahrzehnten zerstört wurden; wir müssen unser Möglichstes tun, um geschädigte Gebiete zu restaurieren. Noch ist Zeit, die letzten Oasen mit intakten Bäumen zu erhalten und ihre wunderbaren Bewohner zu schützen, die für unser Leben so essenziell sind wie wir für ihres.
Bravo, Meg Lowman, »Eure Hoheit«, dass Sie uns in diesem Buch auf Ihre Reise mitnehmen und dass Sie Mission Green ins Leben gerufen haben, die Initiative, die Erkenntnis und Wissen darüber vermitteln möchte, warum wir die Natur schützen müssen, als würde unser Leben von ihr abhängen. Denn das tut es.
Sylvia A. Earle, »Ihre Tiefheit«, Gründerin und Ozeanografin bei Mission Blue, Botanikerin, National Geographic Explorer in Residence
ZEHN FELDBIOLOGISCHE TIPPS FÜR ANGEHENDE ARBORNAUT:INNEN
Habe immer eine Stirnlampe dabei, nicht nur im Wald, sondern überall … selbst im Flugzeug oder im Auto.Habe immer ein paar Taschentücher dabei: für Notfallwaschungen hinter einem Baum!Trage Westen mit Unmengen von Taschen.Trinke immer nur die Hälfte deines Wasservorrats, damit du immer noch etwas übrig hast; und es ist immer sinnvoll, jemandem deine Reiseroute mitzuteilen, falls eine Rettung nötig wird.Habe deine Kamera für wunderbare Entdeckungen griffbereit, zur Not geht auch die Handykamera.Trage einen Poncho. Er kann als Bodenplane oder als Regenschutz dienen.Oreo-Kekse sind ein herrlicher Energie-Snack!Wenn du Kinder hast, nimm ein paar Fotos von ihnen mit – sie sind ein prima Eisbrecher in fremden Kulturen, vor allem bei Sprachhürden.Nutze alle fünf Sinne, und das ständig.Führe Tagebuch, damit du dich an unglaubliche Geschichten, die Biodiversität und deine Beobachtungen erinnern kannst.VORWORT
Wie man den ganzen Baum sieht (und was das für den Wald bedeutet)
Stellen Sie sich vor, Sie gehen für einen Gesundheitscheck zum Arzt, und der untersucht ausschließlich Ihren großen Zeh. Am Ende erfahren Sie, dass Sie vollkommen gesund sind, dabei wurden Ihre Vitalfunktionen, Puls, Sehkraft oder irgendein anderer Körperteil gar nicht untersucht – sondern nur Ihr großer Zeh. Vielleicht haben Sie einen gebrochenen Arm oder Bluthochdruck und Kopfweh, aber da der Arzt nur die äußerste Extremität eines Ihrer beiden Füße bewertet hat, konnte er das eigentliche Problem gar nicht diagnostizieren. Wie fänden Sie das? Wahrscheinlich würden Sie zumindest einmal den Arzt wechseln.
Jahrhundertelang wurde die Gesundheit von Bäumen, auch die jener uralten Riesen, die haushoch in die Wolken aufragen, genau auf diese Weise begutachtet. Die Wissenschaftler untersuchten die verholzten Stämme auf Augenhöhe, sozusagen die »großen Zehen« ihrer Patienten, und schlossen daraus großzügig auf die Waldgesundheit, ohne die Hauptmasse des Baums, seine Krone, überhaupt in den Blick zu nehmen. Die einzige Gelegenheit, bei der Forstwissenschaftler einen ganzen Baum untersuchen konnten, war der Moment seiner Fällung – als wollte man die gesamte medizinische Geschichte eines Menschen von seinen sterblichen Überresten ablesen. Vor allem in tropischen Wäldern unterscheiden sich die unteren Etagen von den oberen Stockwerken wie Tag und Nacht. Bis auf den Boden dringt gerade einmal ein Prozent des Lichts vor, das auf die Krone scheint. Das Unterholz ist also dunkel, windstill und häufig feucht, während der obere Kronenraum von der Sonne versengt und von Hochwinden gepeitscht wird und zwischen den Regengüssen oft knochentrocken ist. Auf dem dunklen Waldboden tummeln sich ein paar schattenliebende Lebewesen, während die Krone eine üppige Lebensvielfalt beherbergt – Millionen Arten in allen erdenklichen Farben, Formen und Größen, die Blüten bestäuben, Blätter fressen und einander auch gegenseitig vertilgen.
Vor den 1980er-Jahren übersahen die Waldforscher unglaubliche 95 Prozent ihres Sujets; fast niemand beachtete die Baumkronen. Dann kam 1978 eine junge Botanikerin mit einer lebenslangen Leidenschaft für grüne Riesen und einer närrischen Liebe zu ihren Blättern dank eines Forschungsstipendiums über tropische Wälder nach Australien. Sie stammte aus der gemäßigten Klimazone und war in Bezug auf die Tropen völlig grün hinter den Ohren. Bei ihrem ersten Besuch in einem australischen Regenwald starrte sie in die schwindelerregendsten Bäume, die sie je gesehen hatte, und dachte: »Du heilige Scheiße, ich sehe noch nicht mal den Wipfel!« Diese völlig geplättete Botanikerin war ich.
Ich hatte eine grenzenlose Liebe zu Bäumen im Gepäck und plante, meine Zukunft darauf zu verwenden, ihre Geheimnisse zu lüften. Nach ein paar Missgeschicken war mir klar, dass ich, um den ganzen Wald zu verstehen, in seine obersten Etagen vordringen musste. Anfangs hoffte ich, dass ich die Baumwipfel einfach mit dem Fernglas zu mir herunterholen könnte. Doch nach vielen Überlegungen und einigem Herumprobieren fand ich eine Möglichkeit, mich selbst in dieses magische, unerforschte Wunderland aufzuschwingen, das von der sechsbeinigen Geschäftigkeit der Insektenwelt wimmelte und mehr Schattierungen von Grün enthielt, als ich es für möglich gehalten hatte. Ich nannte diese wunderbare neue Welt den »achten Kontinent«. Höhlenforscher steigen an einem Seil in die Tiefe, ich hingegen kletterte nach oben. Bergsteiger treiben Eisenhaken in Felswände, ich umschlang vorsichtig große Bäume, um nur ja keine Blätter zu beschädigen oder Tiere zu verschrecken. Und um meine Seile an den oberen Ästen zu befestigen, baute ich mir aus einer Eisenstange eine spezielle Schleuder. Meine Idee erwies sich als einfache, wenig kostspielige Technik, und sie war der Startschuss für meine Erkundung dieses »achten Kontinents«, einem komplexen Biodiversitäts-Hotspot, der nicht Hunderte oder Tausende Kilometer entfernt war wie der Meeresboden oder das Weltall, sondern praktisch griffbereit direkt über unseren Köpfen. Ich nannte mich eine »Arbornautin«.
Bei diesen ersten Ausflügen in die Blattkronen fand ich mich verzückt Auge in Auge mit Tieren, die ich mir nie hätte vorstellen können und die damals dem Rest der Welt völlig unbekannt waren. Ich staunte über einen hübschen Rüsselkäfer, der mit seiner schwarzen Schnauze Blätter aussaugte, über elegante, farbenfrohe Bestäuber, die durch blühende Ranken huschten, über riesige Nestfarne, die Ameisen ein Obdach boten, und über Abertausende meiner Lieblingsobjekte: Blätter. Auf meinem Weg vom Boden in den Wipfel blieb mir die Sprache weg angesichts der Veränderungen, die ich beobachtete. Das Laub im schattigen unteren Kronenraum war schwarzgrün, größer, schöner und, wie sich später herausstellte, langlebiger (dank der windstillen, geschützten und dunklen Umgebung nah am Waldboden). Die Blätter im hellen Sonnenlicht ganz oben waren klein, ledrig, gelbgrün und sehr robust. Wohin ich auch blickte, offenbarten die Wipfel Geheimnisse, die vom Boden aus nicht zu erahnen waren – glänzende Käfer fraßen junges (aber kein altes) Blattgewebe, Raupen operierten in Gangs, die ganze Äste vom jüngsten bis zum älteren Laub kahl fraßen, Vögel schnappten sich diese arglosen Larven, als bedienten sie sich an einer Salatbar, und plötzliche Regengüsse trieben alle diese wuselnden Geschöpfe auf der Suche nach Unterschlupf unter die nächsten Blätter oder in einen Spalt in der Rinde. In den folgenden Jahren sollte die Baumkronenforschung zu der Erkenntnis gelangen, dass mehr als die Hälfte aller landbewohnenden Tiere dreißig Meter oder noch höher über unseren Köpfen leben und nicht, wie man zuvor angenommen hatte, auf dem Boden. Bald stellte ich fest, dass die meisten Arten in den oberen Baumkronen der Wissenschaft unbekannt waren. Fast jede der über 60 000 Baumarten beherbergt einzigartige Lebensgesellschaften.
Bei der Konfrontation mit neuen Grenzen entwickeln Naturwissenschaftler neue Techniken und neue Geräte, um Lebensräume in Ruhe erforschen zu können. Die Erfindung des Drucklufttauchgeräts (Scuba) in den 1950er-Jahren eröffnete der Wissenschaft die außerordentliche Biodiversität der Korallenriffe. Die Mondlandung in den 1960er-Jahren war nur möglich, weil die NASA die Raketentriebwerke für Weltraumfahrten entwickelt hatte. Festtreibstoffe waren für die Astronauten das, was für Arbornauten meine einfache, selbst gebastelte Schleuder war – eigentlich keine Neuerfindung, sondern eine innovative Art und Weise, eine alte Technik einzusetzen. Und wie die Raumfahrt eine Generation von Astronauten hervorbrachte, schuf der Zugang in die Baumkronen neue Aussichten für Arbornaut:innen. Wenn Sie gerne auf Bäume klettern, aufgepasst: Es gibt einen Beruf für Sie! Ich war eine der ersten Baumerforscher:innen und wohl die einzige, die so verrückt war, auf allen Kontinenten geforscht zu haben (selbst in der Antarktis, auch wenn die Wipfel von Moos und Flechten dort nur wenige Zentimeter hoch sind, sodass man sich hinknien muss, statt zu klettern, um ihre winzigen Kronen zu erreichen). In vierzig Jahren habe ich Tausende Blätter markiert und ihre Lebensgeschichte verfolgt. Manche haben mehr als zwanzig Jahre überdauert trotz der beständigen Bedrohung durch Tiere (meist Insekten), die versuchten, sie zu fressen, zu zerreißen, zu durchtunneln oder sonst wie zu verunstalten. Und dass unser Ansatz in der Waldwissenschaft sich in so luftige Höhen verschoben hat, führte auch zu neuen Erkenntnissen über globale Zyklen wie Wasserkreislauf, Kohlenstoffbindung und Klimawandel.
Es sollte nicht überraschen (überrascht aber so manchen immer noch), dass die Gesundheit des Planeten direkt mit dem Wald zusammenhängt. Sein Kronendach produziert Sauerstoff, filtert Regenwasser, wandelt Sonnenlicht in Zucker um, reinigt unsere Luft, indem es CO2 absorbiert, und bietet der außerordentlichen genetischen Vielfalt aller erdbewohnenden Tiere Unterschlupf – und das sind noch lange nicht alle seine wichtigen Funktionen. Und anders als für Stromnetz und Wasseraufbereitungsanlagen brauchen wir für die Wartung dieser komplexen Waldindustrie, die unsere Erde gesund hält, keine teuren Steuern und Abgaben. Damit der Wald gut funktioniert, müssen wir ihn allerdings vor der Zerstörung durch den Menschen schützen. In den gut sechzig Jahren meines Lebens hat die Zerstörung des Amazonas-Regenwalds einen Kipppunkt überschritten; dass er sich restaurieren lässt, ist unwahrscheinlich. Länder wie Madagaskar, Äthiopien und die Philippinen haben fast keine primären Wälder mehr, aus denen sie Samen für künftige Bestände gewinnen könnten. Und noch bestehende Waldfragmente von Kalifornien über Indonesien bis Brasilien sind durch Brände, Dürre, Straßenbau und Abholzung stark bedroht. Wir müssen uns noch mehr beeilen, um die Geheimnisse der Baumwipfel zu entschlüsseln, bevor sie verschwinden; oder besser noch, wir müssen eine Möglichkeit finden, diese übrigen grünen Archen Noah zu bewahren. Als ich vor etwa fünfzig Jahren Gartenbäume untersuchte, gehörte »Klimawandel« noch nicht zu meinem Wortschatz, heute macht dieser Begriff es noch dringlicher, Naturräume und insbesondere Wälder zu verstehen und zu erhalten.
Ein Weg, mehr Bäume zu retten, besteht darin, mehr Menschen in ihre Wunder einzuweihen. Nachdem ich sichere Seiltechniken ausgearbeitet hatte, entwarf ich Laufstege durch das Kronendach, sogenannte Baumwipfelpfade oder -Walkways, und Plattformen, von denen aus ganze Gruppen die Baumkronen untersuchen können, wo vorher nur einzelne Beobachter an einem Seil baumelten. Diese Laufstege waren nicht nur ein wichtiges Werkzeug für Forschung und Bildung, sondern auch humanitär wirksam; sie ermöglichen indigenen Gemeinschaften Einkünfte aus dem Ökotourismus statt aus der Holzwirtschaft, und das wiederum animiert sie zu nachhaltigem Artenschutz. Neben Seilen und Skywalks entwarf, bastelte und benutzte ich noch weitere diverse Hilfsmittel zur Baumkronenforschung, etwa Hubarbeitsbühnen, Heißluftballons, Baukräne und Drohnen. Jedes dieser Hilfsmittel erlaubte einen besonders guten Zugang zu jeweils unterschiedlichen Aspekten des Waldes und ermöglichte die Beantwortung diverser Forschungsfragen. Die Erkundung ganzer Wälder und nicht nur des Waldbodens brachte Gemeinschaften in aller Welt – von der malaysischen Regierung bis zu äthiopischen Priestern – dazu, Partnerschaften mit Arbornaut:innen einzugehen, um ihr wertvolles grünes Erbe zu retten, das für das Überleben der Menschheit so entscheidend ist. Meiner Erfahrung nach steht und fällt wirksamer Umweltschutz damit, dass Wissenschaftler:innen und lokale Akteure einander vertrauen, und nicht mit den neuesten Fachveröffentlichungen. Und es kann nie schaden, ein paar Führungspersönlichkeiten aus den Gemeinschaften ins Kronendach einzuladen! Die Menschen liebten es sichtlich, auf Bäume zu klettern – auch die, die dachten, sie wären aus dem Alter heraus.
Keiner hätte gedacht, dass ein schüchternes Mädchen aus dem ländlichen Norden des Staates New York, eine Einzelgängerin, die ihre Kindheit damit verbrachte, am Straßenrand Wildblumen zu sammeln, mit ein paar selbst gebastelten Gadgets unseren Blick auf den Planeten verändern könnte. Mit ein paar einfachen Werkzeugen, die in einen Seesack passen, reise ich jetzt durch die Welt und erforsche den achten Kontinent, lüfte seine Geheimnisse und erzähle jedem, der mir zuhört, von den Wundern der Baumkronen. Meine Geschichte beweist es: Jedes Kind kann große Entdeckungen machen, indem es seine Umwelt erforscht. Dieses Buch soll von diesem Kick erzählen, den die Forschung in den Lüften einem geben kann – bereichert durch Tausende Meter Seil, viele danebengegangene Würfe einer selbst gebastelten Schleuder, jede Menge entlegene Urwälder, Hunderttausende an ihrem Geburtsort untersuchte Blätter (nicht etwa abgeschnitten oder tot auf dem Waldboden liegend), Unmengen von stechenden Ameisen und Abertausenden anderen Geschöpfen in ihren grünen Penthouse-Wohnungen. Nach vier Jahrzehnten als Arbornautin sind und bleiben die Wälder meine besten Lehrer. Wenn Sie durch dieses Buch mit mir ins Blätterdach gestiegen sind, werden garantiert auch Sie das dringende Bedürfnis verspüren, sich für ihren Schutz zu engagieren.
1VON DER WILDBLUME ZUM MAUERBLÜMCHEN
Ein Mädchen erforscht die Natur im ländlichen Amerika
Ich hatte mir den Wecker gestellt, aber vor Aufregung wachte ich schon eine halbe Stunde früher auf. Um vier Uhr morgens lag nur ein leichter Lichtschimmer auf dem Horizont, und ich stahl mich auf den Zehenspitzen ins Wohnzimmer unserer Hütte am Seneca Lake, damit ich meine zwei kleinen Brüder nicht weckte.
In unserer Stadt, Elmira im Bundesstaat New York, war es im Sommer so unerträglich heiß, dass wir vierzig Kilometer weit zu einer Hütte flohen, die der Wald mit seinem Zauber der natürlichen Kühlung umgab. Das Gelände, auf dem wir diese Sommerwochen verbrachten, gehörte zu einer aufgelassenen Mühle. Viele Jahre zuvor, vermutlich vor einem Jahrhundert, hatte sich dort eine Ulme angesiedelt. Mein Großvater, ein Steinmetz und Zimmermann, baute mit viel Liebe die Hütte um ihren Stamm herum, der als markantes Element mitten im Wohnzimmer aufragte. Bei Regen tropfte Wasser durch das Dach und an der Rinde entlang auf ein Stück nackte Erde zwischen den Steinplatten. Oft suchte ich in all den Holzspalten nach winzigen Insekten. Die Krone der Ulme überragte das gesamte Hüttendach, spendete unserem Haus im Sommer Schatten und hielt im Winter mit seinen kahlen Ästen Wache. Ich liebte jeden Zentimeter dieses Baums bis zu den diversen Pilzen, die sich über den Stamm ausbreiteten, als er einer Krankheit, dem Ulmensterben, zum Opfer fiel. Sein besonderer Platz im Inneren unserer Hütte war immer so tröstlich und sein Tod einer der traurigsten Momente in meiner Kindheit. Von einer gefährlich hohen Leiter aus schnitt mein Großvater sorgfältig alle abgestorbenen Äste ab und ließ den geliebten Stamm als Denkmal übrig, das die Hausmitte schmückte. Manchmal erlaubten mir meine Großeltern, einen der dicken, flachen Baumpilze zu ernten, die neben unserem Esstisch hingen. Mit höchster Kreativität zeichnete und malte ich Bilder von Pflanzen auf diese lebenden Leinwände, die manchmal auch als Malerpilz bezeichnet werden. Der Sommer in unserer einfachen Hütte war meine Zuflucht, ein Ort, an dem ich forschen, beobachten und sammeln und alles an Natur aufsaugen konnte, was mein kleiner Körper zu absorbieren vermochte.
Vorsichtig rüttelte ich Mom wach, und noch vor Sonnenaufgang schlichen wir nach draußen und fuhren fünf Meilen weit über einen Feldweg zu meinem Lieblingsteich, um dort Vögel zu beobachten. Für mich war dieser Ausflug in die Natur eine riesige Sache. Mom besaß nicht einmal ein Fernglas, und ihr Wissen über meine gefiederten Freunde beschränkte sich darauf, dass im Frühling manchmal Stare ihre Salatpflänzchen ausrissen. Doch sie wusste, dass ich im zarten Alter von sieben Jahren für mein Leben gerne Vögel beobachtete, und so bot sie mir an, mich an einen besonderen Ort zu bringen, um dem Dämmerchor zu lauschen – einem exklusiven Konzert des geflügelten Chors zu Sonnenaufgang. Unser alter Rambler holperte über eine staubige Piste durch Kirschbaumplantagen, wo mein Bruder und ich ein bisschen Geld mit Obstpflücken verdienten, an einem alten Spukhaus vorbei, von dem ich Gänsehaut bekam, und an einer kleinen Bar, in der die Farmer mit ihrem Mais prahlten. Am Ufer des Teichs standen Weiden, deren Wurzeln den durchnässten Boden vertrugen. An einem Ast war ein löchriger alter Kahn vertäut. Den ganzen Sommer über hatte ich davon geträumt, einmal hinauszurudern, um Silber- oder Graureiher zu beobachten. Wenn sich diese majestätischen Vögel zeigten, würden sie mir fünf große Sterne auf meiner bescheidenen Liste bescheren. Als wir ankamen, machte meine Mutter sich Sorgen, wir könnten unbefugt das Land irgendeines Farmers betreten, obwohl nirgends ein Haus zu sehen war. Nur sehr widerstrebend kletterte sie in das heruntergekommene Boot voller Spinnweben und Staub. Dann ruderten wir los. Ich fühlte mich wie eine Prinzessin in einer Silberkutsche, obwohl die alte Kiste an diversen Stellen leckte! Wir mussten beim Rudern ständig Wasser schöpfen, um nicht unterzugehen. In der Mitte des Teichs hielten wir an, und ich stellte mein riesiges Sears-Fernglas scharf. Es war lächerlich unförmig, wog etwa genauso viel wie ich selbst und ließ sich wahrscheinlich gar nicht scharf stellen, aber ich fühlte mich damit wie eine professionelle Ornithologin. Staunend sah ich einen großen Kanadareiher heranfliegen, der wie gerufen am Ufer landete. Sogar meiner Mutter blieb der Mund offen stehen.
Während die Kinder von heute dem Ansturm der Home-Technologie ausgesetzt sind, und die Bildschirme ihre Augen strapazieren, litt ich wahrscheinlich an einer Überdosis Sauerstoff und Grünblindheit. Seit ich laufen konnte, sammelte ich unermüdlich Dinge aus der Natur. Am See machte ich Häufchen aus besonderen Muscheln und Steinen. Unter meinem Bett in Elmira hortete ich Wildblumen, Zweige, Vogelnester, noch mehr Steine, Federn, tote Zweige (ich wollte Winterknospen untersuchen!) und sogar Schlangenhäute. Meine Eltern gaben meiner Liebe zur Natur ohne großes Tamtam, aber aufmerksam nach; immer hielten sie am Straßenrand, wenn ich dort etwas pflücken wollte, oder lobten mich für die Basteleien aus Stöckchen, Blättern, Rinde oder anderem botanischen Abfall. Ich war ein echter Naturfreak. Keiner meiner Kindheitsfreunde teilte meine Begeisterung – und zumindest in den jüngsten Generationen der Lowmans gab es keine leidenschaftlichen Botaniker (wenngleich mein Großvater die Natur offenbar genug respektierte, um einen Ulmenstamm in sein Haus zu integrieren). Im ländlichen New York stießen wir nicht gerade an jeder Ecke auf ein Naturkundemuseum, wissenschaftliche Vorbilder oder sonst etwas, womit man die Liebe eines Kindes zur Naturwissenschaft hätte fördern können. Aber wir spielten immer draußen, und dieses einfache Vergnügen machte aus dem Kleinstadtkind eine junge Naturforscherin.
Die langen Tage im Freien lehrten mich die Geduld für einsame Naturbeobachtung, die viele Stunden der Stille mit sich brachte. Vermutlich trugen sie auch zu meiner Schüchternheit bei. Als ich in die Vorschule kam, wurde ich zum Mauerblümchen der Klasse, und ich fühlte mich elend, wenn ich mit den lärmenden Kameraden drinnen eingesperrt war. Wenn ich nicht aufgerufen wurde, brachte ich dort praktisch kein Wort heraus. Die Lehrerin sagte meiner Mutter, dass irgendetwas mit mir nicht stimme. Ich wurde zu unserem Hausarzt geschleppt, der lächelte und mit seinem schroffen deutschen Akzent meinte: »Frau Lowman, haben Sie schon mal überlegt, was die Alternative wäre?« Am letzten Vorschultag bewertete Miss Jones, unsere Lehrerin, unsere Arbeitshefte. Ich bewunderte sie, weil sie uns in aller Schlichtheit erzählt hatte, warum sie Beinstützen tragen musste: Tapfer lebte sie mit Kinderlähmung, nachdem sie von ein paar Jungs in einen Tümpel gestoßen worden war, wo sie brackiges Wasser geschluckt hatte. Die Geschichte der Lehrerin verfolgte mich und steigerte meine Angst vor den Rabauken. Mein Vorschulheft war in diesem Jahr fehlerfrei bis zu dem Tag, an dem meine beste Freundin Mimi eifersüchtig wurde und auf der letzten Seite mit ihrem großen, schwarzen Stift die falsche Antwort umkreiste. Bekümmert gab ich trotzdem pflichtgemäß ab, ohne ein Wort zu sagen. Miss Jones seufzte und sagte: »Ach, Meg, dein Heft war beinahe perfekt, bis zu dem Fehler heute.« Die Tränen strömten, und entsetzt sah ich, wie Miss Jones mir für das Jahr einen silbernen (und keinen goldenen) Stern verlieh. Ich hatte nicht einmal den Mut, meine beste Freundin zu verpetzen. Jahrelang versteckten Mimi und ich das schändliche Arbeitsheft in unserem geheimen Baumhaus und lachten über seine umstrittene Geschichte. (Trotz dieses verpassten Goldsterns ist Mimi bis heute eine meiner engsten Freundinnen!) Später bedauerte ich, dass ich in meiner Kindheit keinen echten Biologen oder professionellen Botaniker kannte, der mich hätte anleiten und inspirieren können.
Nachdem ich in der Bibliothek die Biografien von Rachel Carson und Harriet Tubman gelesen hatte, nahm ich mir die beiden Frauen zum Vorbild. Carson knöpfte sich in ihrem Buch Der stumme Frühling die Chemieindustrie vor, denn sie hatte herausgefunden, dass das Singvogelsterben auf den Einsatz von Pestiziden zurückzuführen war. Sie erklärte ihr Anliegen ruhig, aber mit Nachdruck, sodass das Publikum auch dem naturwissenschaftlichen Teil folgen konnte. Tubman verhalf im 19. Jahrhundert durch das Schleusernetzwerk »Underground Railroad« Sklaven zur Flucht in den Norden und orientierte sich auf ihren nächtlichen Wegen am Moos an den Baumstämmen – sie war eine wahre Naturpionierin. Auch ich schloss im Wald gern die Augen, tastete nach dem Moos und versuchte, mich zurechtzufinden. Das war nicht einfach, weshalb ich Harriet Tubman nur noch mehr bewunderte. Meine einzigen beiden Vorbilder waren allerdings längst tot – im Rückblick vermute ich, dass mir also die Bäume als Lehrer dienten und viele Lektionen fürs Leben mitgaben. Sie stehen aufrecht, bieten bereitwillig Schutz, stabilisieren Boden und Gewässer und zeigen sich ihrer Gemeinschaft immer erkenntlich.
Meine drei besten (und einzigen) Vorschulfreundinnen wohnten in der Nähe und spielten mit mir draußen im Wald, wenn auch manchmal nur widerwillig. Heute begreife ich, dass ich meine naturwissenschaftliche Karriere nicht nur meiner Sammelleidenschaft verdanke, sondern auch ein paar loyalen Nachbarinnen, die bereit waren, mit mir den Garten zu erforschen. Mimi war eines von zehn Geschwistern und mein ganzes Gegenteil, denn sie war mutig und geradeheraus. Betsy kam aus einer Familie mit neun Kindern und trug die Kleider ihrer älteren Schwestern auf. Sie war unser Modeguru und wurde von sämtlichen Jungen angehimmelt. Außerdem beobachtete sie als einzige meiner Freundinnen gerne Vögel, und das war entscheidend. Maxine war schwungvoll und lustig und heckte oft verrückte Pläne aus. Einmal brachte sie uns dazu, hohle Stöcke zu rauchen, woraufhin wir alle überzeugt waren, in Kürze dem Lungenkrebs zu erliegen. Wir waren ein eingeschworenes Team und dachten uns unsere eigenen kleinen Abenteuerreisen aus, noch bevor es in der Stadt Kabelfernsehen gab, das uns mit National-Geographic-Dokumentarfilmen hätte versorgen können. Dreißig Meter hinter meinem Elternhaus stellten wir uns vor, wir wären auf einer unserer »Hullaballoo-Expeditionen« nach Sibirien – das Wort hatten wir als Geheimcode für unsere Missionen erfunden. Manchmal nahmen wir Wurstbrote, eine Flasche Erdbeermilch (mein Lieblingsgetränk) und eine Picknickdecke mit. Wir hatten immer ein paar Marmeladengläser dabei, in denen wir Insekten sammeln konnten, eine Plastiktüte für Pflanzen und ein paar leere Schuhschachteln, um kleine Tiere zu retten. Jungs waren nicht zugelassen. Damals gehörte das Wort Klimawandel noch nicht zum Wortschatz der Jugend, der Bürger:innen und nicht einmal der Wissenschaftler:innen; die größte Bedrohung für unsere Flora waren Banden von Teenagern, die durch den Sumpf rannten und genau die Blüten zertrampelten, die ich so eifrig sammeln wollte. Um Begegnungen mit diesen wilden Jungs zu vermeiden, lernte ich, still und unsichtbar im Wald zu sitzen – eine wichtige Fertigkeit für eine künftige Feldbiologin.
Die Mädchen und ich wünschten uns einen Ort, an dem wir vor den Erwachsenen, den Jungen und allen anderen Ablenkungen sicher wären. Wir bauten eine simple Hütte in den unteren Ästen von ein paar Birken und Ahornen. Als Baumaterial diente uns anfangs Holz aus dem Brennhaufen meines Vaters und ein nahe gelegenes Dickicht von jungen Bäumen. Ein Architekturwunder war es nicht, nur ein paar festgenagelte Planken und dazu ein paar Zweige und Decken in der Astgabel eines herrlichen Zuckerahorns einen guten Meter über dem Boden (was allerdings für uns Sechsjährige durchaus schon bemerkenswert war). Wir aßen in unserem Versteck, malten und erzählten uns Geschichten. In dieser klapprigen Konstruktion verbrachten wir viele Stunden, versorgten Vogelküken, die aus ihrem Nest gefallen waren, versuchten, Schmetterlinge mit gebrochenen Flügeln zu heilen, oder sammelten einfach Blüten, die ich später presste und unter mein Bett stopfte. Eines Nachmittags retteten wir Regenwürmer, die unsere Väter beim Rasenmähen durchtrennt hatten, und versuchten, sie mit Pflastern wieder zusammenzukleben, doch die armen Tierchen überlebten unsere rudimentäre Chirurgie nicht. Wir stellten uns vor, wir wären Entdecker, Krankenschwestern, Heldinnen, Naturforscherinnen und Schiffbrüchige. Die Birken mit ihrer sich schälenden weißen Borke brachten uns auf die Idee, uns in Mitglieder des ortsansässigen Stamms der Cayuga zu verwandeln, die einst aus Birkenrinde Kanus und andere praktische Gegenstände bauten. In diesem Baumhaus lernte ich die ersten Grundlagen der Waldsukzession, machte mir klar, wo es die größten Bäume gab, die stärksten Äste, die schattigsten Kronen und wie gern jede Art wilde Tiere beherbergte. Wie Essigbaum und Schwarzpappel waren Birken im Staat New York relativ kurzlebig, sogenannte Pionierarten in einem frühen Sukzessionsstadium, weil sie auf einer Waldlichtung als Erstes wuchsen. Aber ihr Holz war so schwach, dass sie bei starkem Wind oder Schneesturm leicht umstürzten. Ersetzt wurden die Birken im Lauf der Sukzession durch Klimaxbäume wie Ahorn, Buche oder Hemlock-Tanne. Meine Eltern hatten unser Haus auf einem kürzlich abgeholzten Grundstück gebaut, daher verbuschte der Garten allmählich; im Verlauf meiner Kindheit wurden mehrere Birken und Schwarzpappeln, die unser Spielgelände gewesen waren, von Ahornen in den Schatten gestellt – ganz nach den Gesetzen der Waldsukzession. Ich beobachtete den Übergang von Schwarzpappel und Birke zu Ahorn und Buche, deren dichte Kronen mit ihrem Schatten wiederum viele der Wildblumen auf dem Waldboden verdrängten.
Meine ganze Kindheit über war ich wie besessen davon, alles über die Natur und vor allem über die Blumen zu lernen. Ich wurde zur örtlichen Expertin in Sachen Phänologie, dem jahreszeitlichen Ablauf der Naturereignisse, bevor irgendwer in Elmira, New York, dieses Wort auch nur gehört hatte. Ich wusste genau, wann und wo im Wald man Dreiblatt-Feuerkolben fand, wo ein paar Wochen später der Ostamerikanische Hundszahn blühte und großartige Veilchen in Farbtönen von Rosa über Lila zu Blau und Weiß. Diese frühen Wildblumen, die blühen, solange das Sonnenlicht noch den Boden erreicht, bevor die Bäume Laub bilden, heißen Frühlingsephemere. Dank dieser schlauen Strategie können sie wachsen und sich vermehren, bevor die Beschattung durch die Baumkrone über ihnen die für die Blüte notwendigen Lichtbedingungen verdirbt. Die Flora des ausgehenden Frühlings und des Sommers gedeiht auf sonnigen Feldern und offenen Wiesen, aber nicht im tiefen Schatten unter dem Blätterdach von Ahorn oder Buche. Mit zehn kannte ich den phänologischen Kalender vieler Wildblumen im Staat New York. Sorgfältig führte ich Tagebuch, um alle Arten von Saisonalität aufzuzeichnen – wann Pflanzen blühten, Bäume grünten, Zugvögel eintrafen, Mücken stachen und Glühwürmchen blinkten.
Meine Blumensammlungen nahmen riesige Ausmaße an. Unter meinem Bett stapelte ich alte Telefonbücher, die ich als Pflanzenpressen zweckentfremdete, und durchsuchte stapelweise Botanikführer aus der Stadtbibliothek, um sie zu bestimmen. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, meine Blumensammlungen zu pressen, denn ein Herbarium bekam ich vor dem College nie zu sehen, und einen echten Botaniker, der mich in die technischen Feinheiten des Pflanzensammelns hätte einweihen können, kannte ich auch nicht. Irgendwie kam ich zu der Feststellung, dass eine gepresste Wildblume etwas besser aussah als ein welkes, vertrocknetes Halmgerippe, nachdem ich zugesehen hatte, wie viele meiner dicken Blumensträuße auf dem Küchentisch traurig verwelkt waren. Bei all ihrer Geduld für meine Betätigung beklagte sich Mom darüber, dass die gepressten Überreste vom Straßenrand unter dem Bett die Mäuse anlockten. Sie stellte Mäusefallen mit Käse auf, aber glücklicherweise waren die Pelztierchen von meinen getrockneten Sammlungen so satt, dass die Fallen nie mitten in der Nacht zuschnappten. Stundenlang hockte ich fast täglich auf dem Boden vor meinem Bett, der mein Labor wurde, und brütete über abgegriffenen Golden Guides aus der Bibliothek, mit denen ich Arten zu bestimmen versuchte. Wenn ich nach etwa einem Monat Wartezeit die Seiten der Telefonbücher öffnete, lagen da Dutzende flache braune Leichen. Nach all der Mühe mit dem Pressen und der langen Trocknungsphase musste ich mit großer Enttäuschung feststellen, dass die meisten Pflanzen, wenn sie tot sind, ihre Farbe verlieren. Dass ich so den Tücken der Färbung ausgesetzt war und zudem nicht einmal irgendein technisches Botanikbuch zur Verfügung hatte, machte die Bestimmung vieler Arten extrem mühsam.
Den botanischen Jargon eignete ich mir vor allem mithilfe einer Reihe naturenzyklopädischer Hefte von der Supermarktkasse an, die ich mir kaufen durfte – immer einen Band, jeder kostete einen Dollar –, wenn ich Mom beim Einkaufen half. Ich liebte alle sechzehn Bände. Sie enthielten elementare Definitionen, auch Diagramme von Stempel, Staubblättern und Pflanzensex – zumindest etwas genauer als in den einfachen Golden Guides. Mir war unbehaglich dabei, dass das Wort pistil (das männliche Geschlechtsteil einer Pflanze, der Stempel) vom Klang her so der tödlichen Waffe pistol glich, wo sie sich doch so grundlegend voneinander unterschieden. Ich hatte viel zu lernen! Ich war nur ein Kleinstadtmädchen, das die Natur liebte, mit den Feinheiten der wissenschaftlichen Terminologie aber nichts am Hut hatte.
Als die Lehrerin in der fünften Klasse beiläufig erwähnte, dass der nächste naturwissenschaftliche Schülerwettbewerb des Staates New York nicht weit von uns in Cortland stattfinden würde, war ich zugleich zögerlich und wild entschlossen, meine Sammlung auszustellen. Vielleicht würde ich auf diesem Festival andere Kinder kennenlernen, die die Natur erforschten? Ich zeichnete ein Plakat mit den wichtigsten Bauteilen einer Wildblume: Kronblätter, Kelchblätter, Stempel und so weiter. Es war rudimentär, aber ich fühlte mich meiner Heldin Rachel Carson so nah wie nie, denn ich hatte in den letzten fünf Jahren mehrere Hundert lokale Pflanzenarten zu einer »wissenschaftlichen Sammlung« zusammengefasst, alle sorgfältig gepresst und in lächerlich kleine, 13 mal 18 Zentimeter große Fotoalben eingeklebt. Ich wählte vier Alben aus, also etwa die Hälfte meines selbst gemachten Herbariums. Da ich nicht wusste, dass Pflanzen in einem professionellen Herbarium auf große Papierbögen von 28 mal 35 Zentimeter geklebt wurden, hatte ich im heimischen Drugstore Alben gekauft, die für Babyfotos gedacht waren – jetzt prangten darin getrocknete (und überwiegend braune) Wildblumen mit kleinen Schildern, auf denen Name, Sammeldatum, -ort und Lebensraum verzeichnet waren. Ich versuchte, die besten zu nehmen, also entweder Exemplare mit ein paar Farbresten oder mit wirklich coolen Namen (zum Beispiel Schwarze Schlangenwurzel, Fetthenne oder Indian Pipe), und behielt die weniger attraktiven für mich, etwa einen Rohrkolben, der geradezu explodiert war und seine weißen Samen über die ganze Seite verteilte.
Dad, der zwar bis auf Laub rechen und Rasen mähen von Botanik keine Ahnung hatte, gab sich väterlich-begeistert und stand am Tag des Science-Festivals um fünf Uhr morgens auf, um mich die zwei Stunden nach Cortland zu fahren. Ich tat in der Nacht davor kein Auge zu und zitterte vor Angst, dass irgendjemand mir zu meinem Projekt Fragen stellen könnte. Nicht nur war ich von der Vorstellung, mich bei so einem öffentlichen Auftritt wiederzufinden, ziemlich eingeschüchtert. Ich war auch noch nie einem echten Naturwissenschaftler begegnet. Vorsichtig luden Dad und ich die Alben mit den gepressten Pflanzen und die handgezeichneten Plakate in unseren gebrauchten 1953er Ford Crestline Sunliner und machten uns auf zu unserer großen Expedition. Wir schrieben das Jahr 1964, und Dad tankte immer nur im Sonderangebot. Wahrscheinlich waren die Spritpreise in dieser Woche recht hoch, denn er hatte vergessen zu tanken. Ganz offensichtlich wollte er mich nicht verunsichern, und als wir über die Hügelkuppe in die Stadt fuhren, sagte er: »Halt dich fest.« Das Auto rollte im Leerlauf bergab, raste über rote Ampeln und durch Straßen, die im Morgengrauen noch wie leer gefegt waren. Als die Tankstelle öffnete, standen wir ganz vorne in der Reihe.
Das Science-Festival fand in einer riesigen Turnhalle am staatlichen College statt, wo ich einen kleinen Tisch für meine Ausstellung zugewiesen bekam. Ich war eingezwängt zwischen gefühlt 499 unbändigen Jungen; Mädchen sah ich nicht, hoffte aber, dass sich in der Menge ein paar versteckten. Ich sehnte mich danach, eine verwandte Seele zu finden. Verblüfft registrierte ich, auf wie vielen Tischen Vulkanausbrüche simuliert wurden: Man gieße in der Mitte einer Pyramide aus Pappmaschee Essig auf Backpulver, und voilà: ein Vulkanausbruch! Selbst wenn es im Saal nur 50 solche Vulkane auf 500 Schüler gab, ernteten sie doch lautstarken Beifall und zogen die Gaffer an, was ihre Schöpfer nur noch stolzer machte und mir einfach völlig gegen den Strich ging. Wäre ich nicht so verlegen gewesen, hätte ich es vielleicht witzig finden können – eine Wildblumensammlung, präsentiert von einem vollendeten Mauerblümchen mitten im Chaos von schäumenden Essigvulkanen. Ich aber war überaus nervös als einzige Botanikerin (und eines der ganz wenigen Mädchen) im Saal, wie die Juroren mir später sagten. In der gesamten Ausstellung sah ich auch kein einziges anderes biologisches Projekt. Die Juroren kamen im Rudel und gaben keine Kommentare ab, sahen lediglich ein paar Seiten getrocknete Blumen durch und machten ein paar höfliche Anmerkungen über die Schwierigkeit, Pflanzen zu pressen, ohne sie zu beschädigen. (Ich wollte am liebsten rufen: »Klar, Dummkopf, schon wenn man eine Pflanze pflückt, beschädigt man sie, und am Ende tötet man sie sogar!«) Anders als die meisten Schüler, die ihre Klassenkameraden dabeihatten, war ich das einzige Kind aus meinem Schulbezirk, konnte also nicht mit einer Clique durch die Gänge ziehen und andere Projekte besehen. Ich stand den ganzen Tag neben meinen Wildblumen. Selbst mein ansonsten loyaler Dad machte ein paar Besorgungen, um sich die Zeit zu vertreiben. Nach diesem langen Tag wollte ich nur noch die Ausstellung einpacken und nach Hause in mein sicheres Kinderzimmerlabor zurückkehren. Dann wurde ich zu meinem Erstaunen auf die Bühne gerufen und erhielt einen zweiten Preis. Sprachlos, aber stolz erhielt ich eine kleine Plastiktrophäe und konnte nur hoffen, dass Harriet Tubman und Rachel Carson mit einem zustimmenden Nicken vom Himmel herabsahen. In den Augen meiner Familie kam diese Auszeichnung dem Nobelpreis gleich und thronte mehrere Monate lang auf unserem Küchentisch. Obwohl er mein Ansehen auf dem Schulhof nicht im gleichen Maß steigerte, wie es eine Sportmedaille getan hätte, verlieh er meinen Eltern einen Schimmer von Hoffnung, dass die ungewöhnliche Naturliebe ihrer Tochter sich am Ende vielleicht doch noch irgendwie bezahlt machen würde.
Nachdem ich mit der Wald-und-Wiesen-Botanik das Science-Festival der Fünftklässler erobert hatte, stolperte ich ein paar Jahre später zufällig in ein ornithologisches Projekt. Beim Aufräumen fand ich auf dem Dachboden meiner Großeltern zwei verstaubte alte Kisten mit Vogeleiern, die ein Vorfahre aus dem 19. Jahrhundert gesammelt hatte. (Vielleicht ein Naturliebhaber in meiner Familie, über den nie irgendjemand ein Wort verloren hatte?) Diese wunderschönen Eier hatte der Pinsel von Mutter Natur mit Blau, Grau, Weiß und Zimtbraun besprenkelt. Leider waren die Etiketten dem Fraß der Staubläuse zum Opfer gefallen. Meine Großmutter war eine engagierte Englischlehrerin und perfekte Hausfrau und betrachtete diese Eier bestimmt als schmutziges Gerümpel. Also erlaubte sie mir, diesen Schatz in mein Kinderzimmerlabor mitzunehmen und zu versuchen, sie zu bestimmen. Ich machte mich auf in die Bibliothek und tauschte Botanikführer gegen Vogelbücher. Es war relativ einfach, Literatur mit Abbildungen der Vögel selbst zu finden, aber schon sehr viel mehr Detektivarbeit war gefragt, um Beschreibungen der Eier aufzutun. Schnell lernte ich, dass ein wichtiges Kriterium für die Klassifizierung die Farbe war, außerdem die Form und die genaue Größe. Ein gewöhnliches Lineal reichte nicht aus; Vogeleier verlangen genauere Messgeräte. Manche Bücher aus der Bibliothek erwähnten spezielle Messschieber, mit denen sich Größe und Dicke der Eierschalen bestimmen ließen. Mutig schrieb ich an eine Firma für biologische Laborausstattung, deren Anzeige ich in einer Ausgabe des Audubon-Magazins gesehen hatte, und forderte einen Katalog an. Wenn ich im Haushalt half, bekam ich ein kleines Taschengeld, also überredete ich meine Mom dazu, einen Scheck für diese Bestellung auszustellen – ich würde die Summe aus meinem Sparschwein zurückzahlen. Für nur 13,95 Dollar war ich bald im Besitz eines Messschieber-Sets und verbrachte Hunderte Stunden damit, die Eier von Walddrossel, Baltimoretrupial, Rotkehlchen, Goldzeisig und Keilschwanz-Regenpfeifer zu vermessen.
Die Bestimmung von Vogeleiern war noch vertrackter als die von Pflanzen und mit einfachen Bestimmungsbüchern fast unmöglich. Die Beschreibungen in populären Vogelführern beschränkten sich meist auf »mittelgroß, blau« oder »einzelnes weißes Ei«. Ich tauchte tiefer in die ornithologische Literatur ein und grub in der Bibliothek verstaubte Bände von John Burroughs, John James Audubon und anderen Naturforschern des 19. Jahrhunderts aus. Schließlich brachte ich mir selbst ein neues Vokabular bei: metrische Maße (statt Zoll und Fuß), Muster wie Fäden, Punkte, Flecken, Sprenkel und die Unterscheidung zwischen zimt-, haselnuss-, kastanien- und einfach nur braun. Ich konnte keinen Lehrer um Rat fragen, nicht einmal eine Schulfreundin, die meine Vogelleidenschaft teilte, war also ziemlich einsam. Damals war ich unter den etwa hundert Mitgliedern des Vogelschutzbunds Audubon Society praktisch die einzige Minderjährige und konnte mir nicht vorstellen, dass irgendeines der anderen Mitglieder auf meinem Kinderzimmerboden Platz nehmen würde, um Vogeleier zu studieren. Meine Mutter hatte mir die Mitgliedschaft in der Audubon Society zum Geburtstag geschenkt, und ich war immer dabei, wenn in einem Saal in der Stadt Naturfilme gezeigt wurden. Manchmal luden die älteren Vogelbeobachter mich freundlich zu einem Sonntagsausflug ein. Sie adoptierten mich quasi, erklärten mir, wie man die Größe eines Zugvogelschwarms schätzte und wie man die verwirrende Vielzahl von Sperlingsvögeln bestimmte – eine der größten Herausforderungen für jeden Amateur-Ornithologen. Obwohl ich blutige Anfängerin war, faszinierte mich die Vogelbeobachtung, aber ich war zu sehr auf den Mund gefallen, um von meiner Eiersammlung zu erzählen.
Hin und wieder fuhr Mom mit mir zum Cornell Laboratory of Ornithology, wo wir die Lehrpfade abschritten und Vögel beobachteten. Dieses Institut, nur eine Stunde von zu Hause entfernt, besaß einen Ausstellungsraum mit einer großen Fensterfront, die einen Teich überblickte, von dem aus Vogelstimmen ins Innere übertragen wurden. Es war sensationell, den Schrei der Kanadagänse, das Quaken der Stockenten oder die Frühlingsgesänge der heimkehrenden Zugvögel zu hören zu bekommen. Zweimal stand ich auch mindestens eine Stunde lang verschüchtert in der Eingangshalle vor den Büros der Wissenschaftler und hoffte, irgendjemand würde ein kleines Mädchen ansprechen, das eine Tupperdose mit Vogeleiern umklammerte. Dazu kam es nie, den hoffnungsfrohen Versuchen zum Trotz. Beide Male hatte ich ein paar problematische Eier dabei und hoffte, ich würde einem Experten begegnen, der sie mir flugs richtig bestimmen würde. Wie traumhaft es gewesen wäre, mit einem Vogelkundler sprechen zu können. In Erinnerung an die maßlose Enttäuschung darüber, dass niemand von mir Notiz nahm, antworte ich heute ohne Ausnahme jedem Kind, das zu mir Kontakt aufnimmt.
Einmal grübelte ich vergeblich über einem großen weißen Ei. Fast ein Jahr später begegnete mir das Rätsel dieses vollkommen weißen Exemplars wieder. Ich verglich es mit den Fotos in allen Führern, vermaß wieder und wieder Länge und Breite und zerbrach mir wochenlang den Kopf. Es war größer als die Eier von Sperlingsvögeln oder Drosseln und wies keinerlei distinktive Färbung auf. Als ich dann eines Samstags zum Frühstück Rührei verquirlte, hatte ich mein Heureka und begriff, dass ich die Antwort die ganze Zeit vor der Nase gehabt hatte! Ich schnappte mir eine Eierschale und rannte nach oben. Wow! Sie war praktisch identisch mit dem rätselhaften Ei. Ein Jahr lang hatte ich mir ausgemalt, ich hätte das Ei eines Riesenalks oder Schreikranichs vor mir liegen – und dann stellte sich heraus, dass es sich um ein ganz gewöhnliches Hühnerei handelte. Ich hatte kurz zuvor noch einmal Der stumme Frühling meiner Heldin Rachel Carson gelesen, in dem sie die tödliche Wirkung von Pestiziden auf Singvögel erklärte, und das inspirierte mich, ein bemerkenswert schlichtes wissenschaftliches Projekt zu entwerfen. Mitte des 20. Jahrhunderts hatte Carson entdeckt, dass Vögel (auch Hühner) Pestizide zu sich nehmen. Deren Giftigkeit führt dazu, dass die Eier dünnere Schalen ausbilden, aus denen nie Junge schlüpfen. Meine verstaubten alten Eier waren Mitte des 19. Jahrhunderts gesammelt worden und damit ungefähr einhundert Jahre alt. Ich holte mir aus Moms Kühlschrank mehrere Eier des Jahrgangs 1970 und bestimmte mit meinen Messschiebern, wie dick ihre Schalen waren. Dann brach ich vorsichtig das alte Ei entzwei, vermaß die Schalendicke und verglich sie mit der der modernen Eier. Die hundertjährige Eierschale war 0,019 Zoll dick – also fast einen halben Millimeter –, eine aktuelle Eierschale dagegen durchschnittlich 0,011 Zoll, nur knapp 0,3 Millimeter. (Meine Messschieber waren altmodisch in Zoll statt metrisch geeicht.) Im Grundkurs Statistik erfuhr ich später, dass wissenschaftliche Forschung an nur einem Exemplar nicht gerade als valide gilt, doch damals fühlte es sich an wie ein Durchbruch. Ich archivierte dieses Mini-Forschungsprojekt – Vergleichsstudie an Eierschalen mit einem Altersunterschied von einhundert Jahren – in einer bescheidenen Zigarrenkiste mit handgeschriebenen Etiketten, die die Ergebnisse zusammenfassten. Noch heute thront sie auf meinem Bücherregal und erinnert mich daran, welchen Kick wissenschaftliche Entdeckungen einem geben können.
In der Mittelstufe hatten meine drei Musketier-Freundinnen die Baumhäuser gegen Jungs eingetauscht. Doch in mir wuchs die Leidenschaft für die Natur immer weiter, und unverdrossen verbrachte ich meine Samstage mit der Vogelbeobachtung in den nahe gelegenen Parks. Ich fertigte wie besessen Listen an und hielt alle Sichtungen fest: Ein Highlight waren Abendkernbeißer, außerdem Spechte mit ihrem pausenlosen Getrommel auf all die unterschiedlichen toten Bäume. Dass ich im ländlichen Amerika aufwuchs, hatte seine Vor- und Nachteile. Jeder kannte jeden. Wir gingen zu Fuß zur Schule, spielten draußen, schippten Schnee, pflückten auf den Feldern Brombeeren und fingen Glühwürmchen. Doch in den Schulen gab es nicht wenige Rabauken und Drogenprobleme, und Freunde mit ausgefallenen Interessen wie Vogelbeobachtung zu finden, war schwierig. Ich war so entschlossen, eine Freundin zu finden, die ebenfalls die Natur liebte, dass ich an Duryea Morton schrieb, einen prominenten Vertreter der National Audubon Society, dessen Name ich im Magazin gefunden hatte. Ich erklärte ihm, ich sei Vogelbeobachterin, und fragte, ob er mir helfen könne, Kinder mit derselben Leidenschaft kennenzulernen. Wunderbarerweise schrieb Morton aus seinem Loft in New York zurück und hatte eine Lösung parat. Er schlug mir eine Sommerfreizeit in West Virginia vor, die ein mit ihm befreundeter Ornithologe namens John Trott organisierte. Damals war es das einzige naturkundliche Ferienlager für Jugendliche in ganz Amerika, und er meinte, ich könnte dort vielleicht jemanden finden, der auch Vögel mochte. Meine Eltern waren zwar nicht begeistert, dass sie mich bis nach West Virginia bringen sollten, und die Teilnahmegebühr war eine ziemliche finanzielle Belastung, aber trotzdem meldeten sie mich für den nächsten Sommer zum Burgundy Wildlife Camp an – in der dringenden Hoffnung, ich müsste meine Sozialkontakte dann nicht mehr ausschließlich auf die über siebzigjährigen Vogelfreunde aus Elmira beschränken. Wir traten also die lange Tagesreise nach Capon Bridge, West Virginia, an. Die letzte Schotterstraße zum Lager führte um eine Brennerei herum, vor der eine bunte Menge Einheimische ihren selbst gebrannten Fusel genoss. Nachdem wir noch einen Bach durchquert hatten, kamen wir auf das Lagergelände, und es grenzte an ein Wunder, dass Dad nicht auf der Stelle kehrtmachte. Das Lager war primitiv, aber großartig gelegen mitten im Wald – ein Bach, in dem man Wassertiere fangen konnte, Baumkronen voller Singvögel, meilenweit Wanderwege, Netze für die Vogelberingung, eine Feuerstelle, rundherum Hütten mit allem möglichen Material zur Naturbeobachtung, und das Allerbeste: neunzehn andere jugendliche Naturliebhaber.
In den zwei Wochen Sommercamp, die mein Leben veränderten, fand ich Freunde, die einen Blick für Ameisen, Felsen, Wildblumen, Salamander, Moose und, ja, Vögel hatten! Für mich war es der Himmel auf Erden, und die Campleiter, John und Lee Trott, wurden für mich und viele andere Teilnehmer:innen zu lebenslangen Mentoren. Ich bekam eine obere Liege im Mädchenquartier zugewiesen, eine einfache Konstruktion aus Zeltplanen und grob behauenen Holzblöcken, in der ein Dutzend Mädchen unterkamen. In der ersten Nacht spürte ich einen Luftzug wenige Zentimeter vor meinem Gesicht und verkroch mich erschrocken unter die Decke, fragte mich, was da wohl auf mich losging. Als ich am nächsten Tag diesen Angreifer erwähnte, erklärte die Betreuerin, in den Dachsparren direkt über meiner Liege wohne eine Fledermaus; ich könne mich glücklich schätzen, weil sie alle Mücken auffresse. Das linderte meine Panik, allerdings nur ein bisschen. Den ganzen Tag über verdaute ich nach und nach ihre Erklärung und ließ mich letztlich davon überzeugen, dass eine Fledermaus in der Tat eine ganz außergewöhnliche Mitbewohnerin war.
Das Wildlife-Lager veränderte meinen Blick auf die Natur in vielerlei Hinsicht, nicht nur in Sachen Fledermäuse. Im Zelt für die Vogelberingung hielt ich einen lebenden Goldzeisig in der Hand, eine unglaubliche spirituelle Erfahrung für eine Vogelliebhaberin wie mich. Ich lernte die Sterne am Nachthimmel des unbesiedelten West Virginia kennen, wo keinerlei künstliche Lichtquellen störten. Unser einziger Sport war es, in einem schlammigen Weiher zu schwimmen, und als ich unter meinem Badeanzug eine platt gedrückte Kaulquappe fand, beglückwünschte der Lagerleiter mich für den Fang eines wertvollen Stückchens aquatischer Biodiversität. Ich war immer noch schüchtern und zog besonders ausgiebig die Bettlaken glatt, um bei der täglichen Inspektion nicht aufzufallen, wenn die Schlafräume auf Sauberkeit geprüft wurden. Ich sehnte mich danach, in diesen Naturclub aufgenommen zu werden. Im Lager galten alle Kinder ungeachtet von Herkunft und Geschlecht als Naturforscher, weshalb ich zum ersten Mal im Leben engere Beziehungen zu Jungen (und Mädchen) knüpfte. Die meisten wurden zu Freund:innen fürs Leben, viele wurden Biolog:innen, und wir gehen auch als Erwachsene noch gemeinsam zur Vogelbeobachtung oder zum Botanisieren.
Jeder im Lager hatte sein eigenes Forschungsprojekt, und ich beschloss, die Moose eines Waldes in West Virginia zu bestimmen. Nachdem ich Wildblumen und Bäume im Staat New York abgehakt hatte, fühlte ich mich bereit für eine neue Herausforderung – Pflanzen ohne Blüten. Außerdem suchte ich einen Vorwand, um das fabelhafte Mikroskop zu benutzen, das man zur Bestimmung der Moose brauchte. Harriet Tubman hatte sich dank der Moose im Wald in ihrem Schleusernetzwerk zurechtgefunden, und ich war entschlossen, als Lager-Bryologin (Moos-Expertin) in ihre Fußstapfen zu treten. Meine Begeisterung für diese kleinen Fussel Grün war so groß, dass die Trotts mich, nachdem ich eine detaillierte Moossammlung zusammengestellt hatte, fragten, ob ich im nächsten Sommer als Teammitglied wiederkommen wolle. Eine Dreizehnjährige im Team? Ich war sprachlos. Die Campleiter waren absolut überzeugt, dass das Modell »Kinder lehren Kinder« das Lernen am effektivsten förderte, weshalb sie Teenager anstellten, die den Teilnehmenden etwas beibringen sollten. Finanziell belief sich der Lohn für diesen ersten Ferienjob auf schlappe 25 Dollar, aber ich fühlte mich reich entlohnt. Diese Summe konnte ich in Elmira mit nur einem langen Babysitting-Abend verdienen, aber das Lager entlohnte mich ja noch auf andere Weise. Dank eines einzigen Briefs an die National Audubon Society hatte ich jetzt eine Riege von Freunden, die genauso gern wie ich über Zugvögel und Baumbestimmung redeten, und außerdem lernte ich noch ein paar Grundbegriffe davon, wie man jüngeren Schülern etwas über die Natur beibringen konnte.
Bei meiner ersten Lehrprobe als Jugendleiterin ging es um Bäume (Dendrologie). Natürlich war ich wortkarg und unerfahren, aber die Lagerleiterin beruhigte mich: Gemeinsam mit den Schülern zu lernen, sei eine sehr viel effektivere Lehrmethode als in einem Klassenzimmer Fakten zu präsentieren. Trotzdem war ich extrem nervös. Im vorausgehenden Winter hatte ich einen dicken Stapel Bücher über Bäume in der Bibliothek ausgeliehen und Seite für Seite mehrmals gelesen. Mit Karteikarten in der Tasche kehrte ich im nächsten Sommer als offizielle Dendrologie-Lehrerin ins Camp zurück. Ich unterrichtete draußen unter einer grandiosen Rot-Eiche und versuchte, die Campteilnehmer zu Baumdetektiven zu machen, indem sie Eicheln sammelten, Stammumfänge maßen und Blätter nach Anzeichen von Insektenfraß untersuchten. Meine Liebe zu Bäumen, kombiniert mit der Unterstützung der Campleiter, verwandelte mich in eine begeisterte Lehrerin. Sechs Sommer arbeitete ich im Burgundy Wildlife Camp und leitete Workshops zu Spinnen (Arachnologie), Insekten (Entomologie) und Geologie. Dreißig Jahre später kam ich wieder ins Camp und baute einen Walkway in genau derselben grandiosen Eiche – jetzt können die Campteilnehmer:innen auch deren erhabene Geheimnisse lüften. Die nächste Generation Jungforscher:innen im Sommercamp meiner Kindheit sind jetzt Arbornaut:innen!
Zu Hause in der Highschool hatte ich zwar jede Menge Felder und Wälder zu erforschen, aber ich konnte am Wochenende nicht ins Naturkundemuseum gehen (wie die meisten meiner Campfreunde, die nahe Washington und der Smithsonian Institution wohnten) und bekam keine Schülerpraktika in Technologiefirmen oder Umweltorganisationen. In Elmira stellten die Schüler häufig auf dem Hügel hinter unserer Schule ein Bierfass auf, rauchten auf dem Parkplatz, prahlten mit schlechten Noten oder hingen im Keller eines verwahrlosten Ladens namens People’s Place herum, der Schlaghosen verkaufte und von einem wunderbar aufsässigen Schulkameraden namens Tommy Hilfiger betrieben wurde.
Ich war ein schmächtiger Sämling in nährstoffarmem Boden und begriff, dass Pflanzen mir sehr ähnelten, weil auch sie nicht sprachen. Ein umgängliches Kleinkind fühlt sich vielleicht zu verspielten Welpen hingezogen und baut für ein naturwissenschaftliches Experiment später einen Vulkan; ich aber war hingerissen von Wildblumen und untersuchte all ihre botanischen Bauteile einschließlich Stempel – die Eingeweide der Blüten und Spielstätte für den Pflanzensex. Statt Matchbox-Käfern sammelte ich sechsbeinige Käfer. Statt meine Nägel rosa zu lackieren oder auf Übernachtungspartys neue Frisuren zu diskutieren, fragte ich, ob jemand Lust hatte, früh aufzustehen und Vögel zu beobachten. Es galt als »cool«, die Schule zu schwänzen und Auszeichnungen für gute Leistungen zu verschmähen. Das waren die Sorgen von ganz normalen Highschool-Schülern in einer wirtschaftlich nicht sonderlich prosperierenden Stadt in den 1960er-Jahren. Der Norden des Staates New York gehörte zu den Landstrichen in Amerika, die immer weiter abgehängt wurden, wo Arbeitslosigkeit und Lebensmittelmarken grassierten, während andere Städte dank Innovation und Technologie zu dynamischen Wirtschaftsstandorten heranwuchsen. Eine Jugend in den USA ist eine Lotterie, bei der sich aus der Postleitzahl schon häufig die Zukunft prognostizieren lässt.
Als ich beschloss, mich am Williams College zu bewerben, meinte der Studienberater an meiner Schule, das gebe es nicht – ich meinte wohl das College of William and Mary. Doch ich wusste es besser, denn ich hatte mir ein paar College-Kataloge beschafft und gelesen, dass das Williams College in Massachusetts eine der wenigen kleinen Einrichtungen mit eigenem Wald war. Beim Bewerbungsgespräch war ich ein nervöses Wrack und zitterte wie Espenlaub. Der für die Immatrikulation zuständige Beamte entnahm meiner Bewerbung, dass ich bei einem Natur-Feriencamp Spinnen unterrichtet hatte. Er sah mich sehr ernsthaft an und fragte: »Margaret, was genau haben Sie da den Spinnen beigebracht?« Ganz offensichtlich machte er keine Witze. Ich war erschüttert, dass ich mich in meiner Bewerbung offenbar nicht vollkommen klar ausgedrückt hatte, und erklärte schnell, dass ich Kindern etwas über Spinnen beigebracht hatte und nicht den Spinnen. Dieses Missverständnis überzeugte mich, dass ich die Bewerbung ans Williams College vergessen konnte. Ein paar Monate später erhielt ich verblüffenderweise das Zulassungsschreiben.
Als der Schuldirektor verkündete, dass ich nicht als Jahrgangsbeste, sondern nur Zweitbeste abgeschnitten hatte, waren meine Klassenkameraden sehr aufgebracht – die Beste hatte nicht die anspruchsvollste Fächerkombination gewählt, was ihre guten Noten in ihren Augen schmälerte. Zu meiner großen Überraschung votierte die Klasse in einer gesonderten Abstimmung dafür, dass trotzdem ich die Abschiedsrede halten sollte. Plötzlich zahlten sich diese Jahre schulischen Fleißes doch aus. Die Abschlussfeier war in einer Kleinstadt eine große Sache, und alle zählten die Tage, bis es so weit war; mir dagegen raubte die Aussicht, vor einem vollen Saal eine Rede halten zu müssen, wochenlang den Schlaf. Ich probte in der Dusche, wachte schweißgebadet aus Träumen auf, in denen ich deklamierte, und hatte kurz vor der Feier beinahe einen Nervenzusammenbruch. Doch dann regnete es … und regnete und regnete. Das Hochwasser von 1972 ist in die Geschichte des Susquehanna-Tals eingegangen; der Fluss Chemung, der durch Elmira fließt, ist ein Zufluss des Susquehanna. Gegen 2 Uhr morgens am 23. Juni trat der Fluss über die Ufer. Viele Highschool-Absolventen wachten an einem ihrer letzten Schultage auf und stellten fest, dass in der Küche und im Wohnzimmer meterhoch das Wasser stand. Familien wurden evakuiert. Schulen geschlossen. Straßen überflutet. In der Schule wurde ein Notfallzentrum des Roten Kreuzes eingerichtet. Aus dem steigenden Flusswasser wurden Leichen geborgen. Der Schlamm in den Häusern und der Schimmel in den Wänden verströmten einen Gestank, den ich nie vergessen werde. Die trüben wirtschaftlichen Aussichten in unserer Stadt wurden noch trüber. Plötzlich meldeten sich meine Klassenkameradinnen und ich uns freiwillig zum Verabreichen von Tetanusspritzen, statt uns für eine Gala in Schale zu werfen. Was für ein bittersüßes Ende unserer Highschool-Zeit! Wir hatten nie eine offizielle Abschlussfeier, unsere Zeugnisse bekamen wir ein paar Monate später per Post. Elmira und Umgebung hat sich von dieser Hochwasserkatastrophe nie mehr wirklich erholt. Die Immobilienpreise fielen in den Keller, besonders für Häuser in Flussnähe. Durch den Wegzug von Familien sanken die Schülerzahlen; unsere frühere Highschool gibt es heute nicht mehr. Dads Bank verkleinerte sich, er wurde entlassen. Das Hochwasser war ein letzter Sargnagel für die schon wankende lokale Wirtschaft. Mutter Natur kennt kein Erbarmen. Damals galten solche Extremwetterlagen als Jahrhundertkatastrophe, für uns war das Hochwasser von 1972 eine Anomalie. Kaum zwanzig Jahre später sollte das rasche Fortschreiten des Klimawandels dafür sorgen, dass Hochwasserereignisse – wie auch Dürren, Waldbrände und Hitzewellen – in vielen Regionen normal wurden. Unser Hochwasser in Elmira war ein Vorbote für das, was uns noch bevorstand.