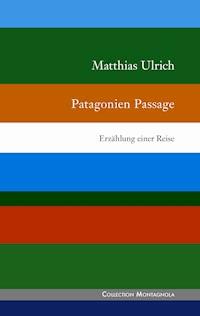7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erwachsen werden in einer Zeit der Verdunkelung, der politischen Bedrückung und Aufrüstung. Es ist die Zeit des Nationalsozialismus. Manuel Paul Schröder (»Mannu«) wächst in Korntal bei Stuttgart auf. Mit seinen Freunden treibt er Sport, macht Wanderungen und träumt von der Freiheit. Seine andere Seite ist nachdenklich und ernst. Mannus Vater war Missionar in Westafrika. Araber und Afrikaner sieht er als seine Brüder. Für alle in der Familie ist das beispielhaft. Nach dem Tod des Vaters und dem Schulabschluss in Korntal geht Mannu für eine Ausbildung als Fotograf nach München. Die Münchner Jahre erlebt er als völligen Kontrast zu seiner Korntaler Jugendzeit. Seiner Mutter schreibt er nach der Reichsprogromnacht auf einer Postkarte: »Dieses Reich wird untergehen.« Der Einberufung zum Kriegsdienst will Mannu nicht Folge leisten. Mutig stellt er sich dagegen und flieht. Einer verrät ihn. Mannu wird von der Gestapo festgenommen und nach kurzem Prozess hingerichtet. Eine Geschichte des stillen und wie selbstverständlichen Widerstands. Sie macht Mut, seinem Gewissen zu folgen und nicht einer falschen Ideologie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hey, Mr. Tambourine Man …
Bob Dylan
Aber der Gerechten Pfad glänzt
wie das Licht, das immer heller
leuchtet bis auf den vollen Tag.
Sprüche 4,18
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil II
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Teil III
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Teil IV
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
I
1
An einem himmelblauen Junitag beginnt meine Geschichte. Ich war spät dran und rannte in Richtung Schule. Ich wollte nicht der Letzte sein, der zum Spiel kam. Denn es war etwas Neues für uns. Ein Handballspiel zweier Mannschaften, und ich sollte der Spielführer der einen Mannschaft sein. Es war das erste Mal, dass wir Jungen der Höheren Knabenschule in Korntal in zwei Mannschaften Handball spielen durften. An dieses Spiel kann ich mich gut erinnern.
Zehn Schüler zwischen zwölf und dreizehn Jahren waren wir, und unser späteres Schicksal kam aus der Tiefe der Zeit. Einige fielen im Krieg, einige kehrten zurück, einige hatten ihren Glauben verloren, auch den an Deutschland, und den zuerst. Sie zeigten es nicht und gruben sich ein in Schweigen und Bitterkeit, einige verschwanden ganz, man weiß nicht, was aus ihnen wurde. Aber einige kehrten auch zurück und dankten Gott für die Bewahrung. Sie dachten vielleicht noch zurück an jenen Tag und das unbekümmerte Spiel, das sie das erste Mal gespielt hatten. Und dass einer der Ihren fast zu spät gekommen war. Ich – ihr Spielführer: Manuel Paul Schröder, genannt Mannu.
Mein Weg war anders. Und wo ich schreibe, bin ich fern, sehr fern, durchsichtig wie die Luft an einem Frühlingstag. Auf Weisung der Nationalsozialisten bin ich als Kriegsgegner von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt worden. Mein Weg, so hoffe ich, war nicht vergeblich. Und das ist meine Geschichte.
Rösle sah zu mir hin und winkte mit den Armen.
»Da bist du ja!«, rief sie. »Nach vorn! Nach vorn!« Und Dorothee guckte zu ihr, als sei Rösle nicht ganz bei Trost. Aber ja doch! Sie wollte mich anfeuern, ich rang nach Atem. Aber ich hatte ja den Ball und sprang um zwei Spieler herum.
»Vor! Vor!«
Ja, ich hörte es! Umkurvte den großen Pieter, behielt den Ball, prallte ihn am Boden ab und brachte ihn ins Tor. Rösle war begeistert, Dorothee klatschte Beifall, Bruno tanzte wie ein Indianer um die Bänke.
Schwer atmend blieb ich stehen, und die Anderen aus meiner Mannschaft klopften mir auf die Schulter. Pieter knurrte:
»Glück gehabt! Obwohl du zu spät gekommen bist.«
»Ja, Glück – aber gib zu, dass ich schneller war.«
Breitner, der Sportlehrer, pfiff ab.
»Keine Streitereien! Das Spiel geht – weiter!«
In der Mitte wurde der kleine dunkle Lederball hochgeworfen und ging weiter von Hand zu Hand. Er flog durch die Luft, und ich folgte ihm mit den Augen hoch ins Blaue und wie er eine vollendete Kurve in den Himmel schrieb. Heute war ein schöner Tag und das Himmelsblau tief und von ganz wenigen weißen fedrigen Wolken durchzogen.
»He!«, rief Breitner.
Ja, ja, ich sollte nicht gucken, nicht Zeit schinden, ich sollte weiterspielen, bekam den Ball gerade noch zu fassen, ließ ihn am Boden abprallen und gab ihn an Georg weiter. Kurz sah ich zu Rösle hinüber, sie winkte mir zu. Dann war der Ball wieder bei mir und ging weiter an Roman. Roman griff daneben und so kam der Ball Gottfried von der anderen Mannschaft in die Hände, der ihn gleich an Pieter weitergab. Pieter lachte, als wollte er sagen: Siehste! Sein Wurf mit der rechten Hand – unhaltbar ins Tor.
Breitner: »Ausgleich!«
Jetzt jubelten die Anderen.
»Das ist Handball!«
Breitner klatschte in die Hände. Ihm gefiel das Tempo des Spiels. Und er rief:
»Weiter! Weiter!«
Pieter dachte wohl, die Mädchen und der Himmel lenkten ab, Quatsch. Ich griff den Ball, prallte ihn zwei-, dreimal am Boden ab und hob ihn mit einem schönen Wurf ins Tor, dass Mark nur noch das ausgebeulte Tornetz sah. Dort hing der Ball, als gehörte er genau dort hin.
»Führung!«
Meine Jungen trumpften auf. Prompt kam die Strafe. Der große Pieter umzirkelte uns und zack! Der nächste Ball im Tor. Ausgleich.
»Ach, Pieter!«, rief Dorothee.
Pieter lachte. Der Schweiß lief ihm über die Stirn und in die Augen. Er blinzelte und rempelte mich an, hob aber gleichzeitig beide Hände und murmelte »Entschuldigung!«
Breitner pfiff ab.
»Den Ball noch!« Ich bekam ihn, verfehlte aber das Tor, ich hatte Seitenstechen. Aber das sollte niemand merken.
Wieder flog der Ball, und ich gab ihn gleich weiter. Roman versuchte noch, an Markus vorbeizukommen, aber der wehrte den Ball ab.
Breitner trat vom Spielfeldrand auf das Feld, fing den Ball auf und sagte:
»Genug für heute!«
Das Ergebnis? Weder Pieter noch ich waren stolz darauf, kein Punkt mehr, aber das ging durch. Pieter schwitzte stark, ich hatte Seitenstechen. Bruno sagte zu mir:
»Dein Hemd ist ganz nass.«
Die Schweißtropfen perlten mir den Rücken hinab wie aus dem Sprudelglas.
Also ab in die Umkleidekabinen.
Das Handballspiel hatten wir Schüler der Klasse acht sofort kapiert, Schnelligkeit und gute Hände. Breitner hatte uns den Ball gezeigt und schmunzelnd gefragt:
»Wisst Ihr, was man damit machen kann?«
Ein paar Regeln an der Tafel, dann hatte er zwei Mannschaften bestimmt und je fünf Spieler aufgeschrieben: Roman, Georg, Karl, Martin und Mannu. Auf der Gegenseite: Pieter, Gottfried, Markus, Karl und Eduard. Spielführer in der einen Gruppe der große Pieter; ich, Mannu, in der anderen.
Breitner wollte vom Fußball nichts wissen.
»Fußball, das spielen sie jetzt auf dem Wasen, das machen alle, aber wir, wir sind die Korntaler Handballer.«
Damit traf er den Nagel auf den Kopf. Wir – die Handballer!
»Zum Spiel pünktlich sein!«, rief Breitner.
Meiner Mutter hatte ich noch geholfen, die Nähmaschine in Gang zu setzen. Der Treibriemen war gerissen und ein neuer musste aufgezogen werden. Na ja und darum … Ich war aber nicht der Junge, der sich dafür entschuldigte.
Das Handballfeld lag neben der Schule quasi bereit, als hätten die Bauherren das so gewollt. Handball statt Fußball.
Die Umkleidekabinen neben dem Platz waren eng und dunkel. Es roch nach Schweiß und Schweißfüßen, Gottfried rief: »Zehn Pfund Stinkekaas!«
Wir lachten. Gottfried wischte sich das Gesicht mit einem Waschlappen ab. Ich spritzte mir das Wasser auf die Haut und an den Hals. Den Rücken trocknete ich mit einem Handtuch. Gedränge um Wasserhahn und um zwei Sitzbänke. Die Netze der Kleiderbügel waren mit den Hemden und Hosen vollgestopft. Roman hielt seinen Kopf unter den Wasserhahn, Pieter zog sein Sporthemd aus und ließ seine Muskeln sehen; unter den Achseln sprossen schon blonde Härchen.
Als ich mich draußen an die Hauswand lehnte und meine Haare kämmte, kam Pieter heraus. Er sah zu mir und zog die Augenbrauen hoch. Er hob die Fäuste, als ginge es nun so weiter – , dann lachte er und umarmte mich, was mir gut tat, denn ich wollte nicht, dass wir wie Gegner standen. Spiel ist Spiel. Pieter war einer wie ich, und auch wenn er stärker war und andere Sachen mochte, hatten wir außer im Handball fast nichts zum Streiten.
Pieter hatte von seinem Onkel eine Hantel aus Holland bekommen. »5 kg« stand in schwarzen Lettern auf der Hantel. Liegestützen machte Pieter übrigens auch, jeden Tag zwanzig.
Und Klimmzüge an Ästen. Rösle stand daneben und sagte:
»Lass mich mal!«
Drei Züge.
Pieter: »Rösle, du Äffle!«
Mir war’s zum Schmunzeln, weil Pieter eben die Mädchen für schwach hielt. Tja, Irrtum mein Lieber, dachte ich.
Auf dem Heimweg waren dann Rösle und Dorothee neben mir.
Rösle sagte: »Du bist so rasch gesprungen!«
Und Dorothee: »Noch ein, zwei Würfe – und es wäre nicht mehr eins zu eins gewesen.«
Meine Haare waren nass. Ich glättete sie sorgsam mit dem Kamm. Alle Welt hatte ja gesagt, ich wäre in letzter Zeit stark gewachsen und dem Gesicht meiner Mutter ähnlicher geworden als dem des Vaters. Ich konnte das nicht erkennen. Breitner hatte jeden von uns gemessen, einsneunundsiebzig bei mir; für den Handball könnte ich noch zulegen, meinte Breitner. Den Vater hatte ich bereits überholt.
Dorothee sagte: »Bild dir bloß nichts ein.«
Das Zimmer zu Hause teilte ich mir mit Stefan, meinem älteren Bruder. Der wusste schon das Ergebnis und wischte mit der Hand durch die Luft. Sein Kommentar: »Unentschieden ist eigentlich – na ja. Aber eh besser als verloren.« Er hätte das Spiel sehen sollen, dann wär’s ein Wort gewesen, aber so?
Stefan gab sich gern souverän, ich sollt’s nicht so ernst nehmen. Mit meinen vier Jahren weniger war ich halt noch »das Kind«. Stefan war der »Große«, obwohl ich nicht mehr weit davon entfernt war, ihn einzuholen. Größenmäßig. Ich glaube, er nahm das schon wahr. Er war der ruhigere von uns beiden, der gemächlichere, er ließ sich Zeit, während mich oft ein Unruhegefühl packte. Das Ball-Abprallen war sehr gut dagegen. Mir ging so viel durch den Kopf, wie ein Schwarm Glühwürmchen. Halt an, halt an – Stefan brauchte sich das nicht zu sagen
Stefan war im ersten Jahr der Schlosserlehre bei Meister Küng unten am Dorfrand und machte technische Zeichnungen. Meister Küng hatte die große Schmiede und drei Gesellen. Rechtschaffene Arbeit, keine Worte, keine unnützen Reden. Stefan war der Vierte, aber net der letzte, wie Meister Küng sagte, Stefan wollte weiterkommen, Eisen- und Schmiedeschlosser und dann Mechaniker werden vielleicht, etwas mit den neuen Automobilmotoren.
Meister Küng hatte ihm gesagt: »Fang du erst mal richtig mit dem Feilen an, dann zeigt sich’s.«
Und Stefan hatte Blasen und blutige Risse an den Fingern. Rechtschaffene Arbeit? Das klang wie nach stundenlangem Feilen.
Auf seine Zeichnungen ließ er nichts kommen, diesmal ein schwarzer Schmiedewinkel.
»Das hab ich heut’ schmieden müssen. Aus dem Glühend-Heißen heraus.«
Er erklärte mir, wozu das Teil gut war. Um Federn an den Achsen zu halten. »Das muss fest geschmiedet sein, sonst kracht es und die Achs war die Achs. Des kommt wie der Blitz vom heiteren Himmel.«
»Jetzt fang nicht auch noch an damit«, sagte ich. Es ging um den »Ernst des Lebens«, von dem die Erwachsenen gerne sprachen, und ich wusste nicht, was daran so erstrebenswert war. Ich kümmerte mich nicht darum. Stefan hatte ja auch schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel als ich und neidete mir meine »Schonfrist«. Eine Lehre machen – etwas »Rechtschaffenes«?
Dorothee platzte ins Zimmer und rief: »Du hättest mal sehen sollen, wie Mannu spielte. So fix mit dem Ball, abprallen und dann um die Anderen herum, geschickt wie ein geborener Handballer.«
Stefan lachte. »Für’s Unentschieden!«
Die Zeichnung legte er auf den Tisch und schrieb die Maße in Zentimeter in ein kleines Notizbüchlein, das er stets bei sich trug.
Stefan nannte mich manchmal »Traumeule« oder »Philosopherle«. Mit ihm war über Anderes als die Winkel und Motoren nicht zu reden, da schlief er ein.
Dorothee war so dazwischen, sie mochte Stefan und mich natürlich, aber das übertriebene Nachfragen war auch ihre Sache nicht. Ich solle nicht übertreiben, hatte sie mir einmal gesagt.
Wolfgang, unser Jüngster, war gerade einmal drei Jahre alt und sagte zu mir gern »NaNu«. Mein Handballspiel fand er klasse, bei meinen Würfen sah er genau hin und in meinen Büchern stiebitzte er das Lesezeichen. Wenn ich schimpfte, flüchtete er zur Mutter. Er war es auch, der den Eltern die seltsamen Namen gegeben hatte, der Mutter Mo min und dem Vater Duz; warum, keiner wusste es. Mama und Papa konnte er auch sagen, aber Momin und Duz war interessanter – und so hatte er uns Geschwister angesteckt: Duz & Momin. Wolfgang juchzte, wenn ich ihm einen Ball zuwarf und er ihn mit seinen kleinen Fäusten wegboxen konnte, was er besonders gern tat.
»NaNu!, NaNu!«
Niemand in der Schule hatte etwas gegen das Handballspiel, obwohl es auch Eltern gab, denen das Spiel zu wild vorkam und die es gerne gesehen hätten, wenn die Jungen etwas Gescheiteres gemacht hätten, den Platz säubern oder die Wiesen mähen zum Beispiel. Breitner ganz ernst:
»Bestimmt nicht!« Und knapp: »Gehört zum Schulprogramm, ist im Lehrplan.«
Breitner forderte eine größere Umkleidekabine und wir Jungen sagten: »Wir brauchen den Platz!«
Mir kamen solche Bedenken wie von gestern vor.
Später beim Abendessen und nach dem Gebet las Vater noch einen Psalm, er fragte uns Geschwister immer: »Wollt ihr noch?«
Vater mochte keinen Zwang und sagte: »Das Wort soll überzeugen.«
Außerdem wusste er, wie rasch Kinder ermüden, deshalb las er sehr geschickt, modulierte die Stimme, lachte, bis wir auch lachten – ha so und ha so – und las mit heller Stimme fort. Aus dem 92. Psalm dieses Mal:
»Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die gepflanzt sind in dem Hause des Herrn, werden an den Vorhöfen unseres Gottes grünen.«
Den Psalm mochte ich wegen dieser Worte, die so anders waren als das übliche Reden, es gab immer etwas zum Besonderen hin: »Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum.« Das Grün, das Pflanzengrün, das Frische der Psalm- und Palmbäume – und nicht das andere Grün, das Neidgrün, das jeder kannte und das ins Gesicht kam, weil die Anderen etwas konnten oder hatten und man selber nicht.
»Ach, Rösle«, sagte ich und versteckte meine Schultasche hinter dem Rücken, so als könnte ich fortgehen, irgendwohin.
Rösle hatte mich vor der Haustür abgeholt. Auf dem Weg erzählte ich ihr von dem fernen Palmbaum, der in einem Psalm vorkam.
Am Abend hatte mich noch Stefan gefragt, wo denn genau dieser Libanon sei. Den Namen habe er sich gemerkt. Ich wusste es nicht.
»Vielleicht in der Nähe des Heiligen Landes; in der Bibel habe ich schon von der Zeder gelesen. Aber wie die aussieht? Vielleicht so?«
Und ich breitete die Arme im Zimmer aus. Stefan nickte: »Ja, schon gut.«
Dorothee sagte mir später: »Rösle hat für zwei gerufen.«
Ich musste lachen, Rösle war immer so. Etwas Halbes gab’s bei ihr nicht, sie war ganz dabei. Sie ließ nicht locker, sie wollte ja auch selbst Handball spielen, aber Breitner hielt wenig davon. Handball sei doch für die Jungen. Vielleicht eines Tages eine Mannschaft aus Mädchen? Rösle musste sich einfach noch gedulden.
»Frauschaft!«, rief Rösle und selbst Breitner lachte.
Zu Hause war Besuch, Onkel Karl, der Bruder von Mama, war da. Handball zählte für ihn nicht, er sprach immer von »Körperertüchtigung« und vom Marschieren. Er zitierte den Turnvater Jahn, dass sogar Papa lachen musste. Angeblich war er in jungen Jahren ein guter Turner gewesen. Jetzt hatte er eine Wamme rund wie ein Reifen um den Bauch oder schlappig wie ein Blasebalg. Er klatschte in die Hände und rief: »Auf! Auf!«, als wollte er uns Beine machen.
Was nun die Zeit anging, so war er ein Anhänger der Hitlerpartei. Von dem sprach er mit raunenden Worten: Vorsehung! Reichswehr! Verschwörung gegen ihn! Vom Ausland!
Vater widersprach und sagte. »Von dem kannst du nur die Aufrüstung haben.«
Aber Onkel Karl kam es doch genau darauf an: Militär, schimmernde Panzer, Stärke in Waffen, Stahl.
Ich wusste, dass Onkel Karl, er war Prokurist in Esslingen, mein Klavierspiel nicht mochte. Gerade darum. Also fing ich an zu spielen: Tonleitern, Triller, Triller, Tonleitern, lautes Dissonantes –
»Oh, Mannu!«, schimpfte er und zog mit Tante Elise im Schlepptau davon.
Niemand sagte: »Ach, bleibt doch!«
»Ballon, Reifen, Blasebalg – uuh, nee … uuh nee …« Stefan lachte und Mama schüttelte den Kopf.
*
2
An einem der nächsten Tage wartete Pieter auf der Straße auf mich. Es regnete, die Tropfen waren klein wie wuselige Ameisen, sie liefen da und liefen dorthin. Im Nu war ich am Kopf und an den Schultern nass.
»Pah, Regenschirm!«
Pieter lachte. Er trug eine holländische Seejacke mit einem Kragen, an dem die Tropfen abrollten. Ich schaute auf all die anderen, die mit ihrem Regenschirm bewaffnet das Schlimmste darin sahen, dass die Haare nass wurden.
»Blaue Flecken?«, fragte Pieter, als wollte er sagen »Entschuldigung«, aber zugleich hören: »Ja, schon.«
»Hab nix gemerkt.« Und ich sah, dass die Regenwalzen davon gingen und blaue Streifen über den Himmel zogen. Pieter hatte von seinem Vater eine neue Schultasche bekommen, die kein Tornister mehr war, sondern eine Art Sack, den er an einem hellen Lederriemen über der Schulter trug. Das passte. Tropfen besprenkelten den Riemen. Der ganze Sack war aus Leder; ein Seemannsack, den alle Schüler am Wasser trugen und besonders die, die auf die Schiffe gingen. Der Sack roch gut nach frischem Leder und war dunkler als der Riemen. Sein Vater habe ihm erklärt, sagte Pieter, er sei kein Bub mehr, ein Stück darüber hinaus und der alte Tornister zu kindisch. Den Seesack hatte sein Vater sich sogar aus Holland schicken lassen. Echt? Echt holländisch.
Ja, Holland war ein Land mit vielen neuen Dingen, zum Beispiel Eisenhanteln und guten Seesäcken, die jedem einen Schlag gaben und jedem Sturm trotzten.
Die Jongens lebten schon lange in Korntal. Josten, sein Vater, war Schiffszimmermann gewesen, aber auf einer Fahrt mit einem Zweimaster, der Getreide geladen hatte, war ihm Gott erschienen, so erzählte er augenzwinkernd, und er hatte erkannt, »wie een Mohlwurff« gelebt zu haben. Korntal gefiel ihm, er hatte nichts gegen die Hügel und die Wälder. Es war ja so, dass Holland sehr, sehr flach war und Korntal deshalb eine echte Alternative.
Dennoch hing Josten, ja die ganze Familie, mit ihren Dingen und Sachen immer noch an Holland, das Geschirr, das Besteck, die Stühle, die Kissen, der Seesack, die Bücher, die Bibeln und die Stoffe – alles aus Holland. Wenn die Verwandten kamen, wurde holländisch gesprochen und gesungen. Das klang lustig.
Die Geschichten vom Klabautermann waren so holländisch wie der große Seesack. Josten erzählte sie uns Kindern mit Vergnügen. Nachts auf dem Schiff, da ist das Klabautermännchen eine Ratte oder ein schwarzer Vogel. Wenn du ihn fangen willst, gehst du über Bord. Da hilft kein Rettungsring. Und wenn der will, hat er das Sagen, nicht der Kapitän. Er streicht über den Kai, hüpft über das Kopfsteinpflaster, das nass vom Regen ist, und winkt den müden Schiffs jungen zu, erzählt ihnen etwas von lieben Mädels, die nur eine Planke brauchen und schon auf dem Schiff sind – die Ratten nämlich und an den Tauen hoch. Es knistert und knarrt, flüstert und schabt, es ächzt und wimmert, die Schiffsjungen bekommen einen heillosen Schreck und stürzen sich ins Meer. Es gibt kein Paradies für sie, keinen Garten Eden. Der Klabautermann ist schuld.
Josten hatte noch andere Geschichten parat. Etwa, wie er bei dem Ort Suez über Bord ging und wie eine Koralle ihn rettete, an der er hängenblieb, sonst hätte ihn das Meer tausend Klafter tief gezogen. Eine Koralle rot wie ein reifer Apfel am Baum, einem Unterseebaum, ja, so sei üs, sagte er dann, so sei üs und wir sollten Mariechen, seine Frau, fragen, die würde ihnen die schöne Koralle zeigen.
Also Pieter musste wissen, wo der Libanon war, jetzt, wo auch der Regen nachließ und die letzten Tropfen über die Stirn und Wangen kullerten, auf die Jacken, den Schulsack und meinen Kopf. Bruno kam dazu, seine Haare hingen in Strähnen herab, aber es machte ihm nichts aus. Die Regentropfen schlabberte er wie links von den Lippen.
Im Schulraum dampften die Regenjacken. Herr Täubner, der Rechenlehrer, befahl, alle Fenster zu öffnen. Der Regen hatte aufgehört und die Amseln sangen mit einer Inbrunst, dass Täubner rief:
»Die freuen sich auf die Würmer, die sie aus dem Boden ziehen werden. Regenwürmer mögen gar keinen Regen. Deshalb kommen sie auch heraus, weil sie sonst in ihren Gängen ertrinken würden.«
Libanon, Libanon? Nun also. Pieter war zu stolz, er schwieg darüber, also fragte ich Täubner.
Täubner war etwas ratlos. »Ha ja, ja klar, ein Land der Bibel. Aber wo genau?«
Da meldete sich Bruno, als hätte er nur auf den Moment gewartet. Li-ba-non. Endlich. Bruno, der sonst neben ihnen herlief und beim Handball gar nicht mitspielte, weil, wie er sagte, einen Fuß mit »Schrägstrich« hatte, also einem schiefen Knochen. Man sah aber nichts. Am meisten liebte er Kirschkuchen, besonders den Kirschkuchen, den Momin backte, und so war er oft bei uns zu Gast.
»Ja, gerne«, sagte er, wenn Momin ihn einlud, weil sie Bruno mochte und wusste, dass die Eltern viele Schwierigkeiten hatten. Bruno war ehrgeizig, im Rechnen war er einer der besten, so ehrgeizig wie ein kirschkuchenabmessender Junge nur ehrgeizig sein kann.
Bruno war der Briefmarken-Bruno, denn mit Begeisterung sammelte er Briefmarken. Oft schleppte er in seinem Schulranzen ein Album mit sich herum oder einige Steckkarten, in denen die Marken sauber aufgereiht saßen. Die Mädchen lachten darüber, aber ein, zwei, drei Jungen schauten doch wie Kiebitze darauf, bereit, die eine oder andere Marke für ihre Sammlung zu schnappen.
Wir erfuhren nun, dass der Libanon ein Gebirge im Nahen Osten war, nicht weit vom Heiligen Land entfernt. Bruno holte aus seinem Album eine Marke, als hätte er gewusst, dass es heute morgen genau darum ging, und zeigte sie allen. Ein grüner Baum mit hängenden mächtigen Ästen. Die Zeder. Auf einer Briefmarke mit französischer Schrift und französischem Porto.
»Hab ich gefunden«, erklärte er, »in einer der Sammeltüten, die die Poststelle der Brüdergemeinde an die Kinder verteilt.«
Gestempelt mit einem dicken schwarzen Stempel, aber deutlich, eine Zeder wie ein Glückspfand darauf. Mit grünen hängenden Ästen, wie eine Pyramide gebaut, solche Pyramiden gehörten zum Heiligen Land und spendeten auf den Bergen die Schatten, ja, so grünen wie eine Zeder! So kraftvoll wie die! Übrigens war ich überzeugt, dass Brunos Vater ihm die Briefmarke mitgegeben hatte, weil er am Abend zuvor oder am Morgen die gleiche Psalmstelle gelesen hatte. Auch damit Bruno allen zeigen konnte, was für ein biblischer Baum die Zeder war. Die grüne Zeder, die starke Zeder. Und dass die Gerechten grünen konnten wie eine solche Zeder.
Bruno freute sich, dass alle die Zeder auf der Marke bestaunten. Täubner lobte ihn. Die Zeder war ein guter Baum, stark, und ein gutes Bild für die Menschen, wenn sie verzagt waren. Den Schrägstrichfuß hatte Bruno von Geburt an, und dass er beim Handballspiel nur zusah, war völlig o. k. Er mochte das Spiel und tanzte wie ein Indianer, wenn unsere Mannschaft ein Tor machte oder sogar siegte.
Seine Schwester Jana-Maria hatte es auch mit dem Fuß, sogar mit beiden. Die Eltern wussten nicht warum.
»Das ist unsere Aufgabe«, erklärten sie Momin. »Die Kinder. Es gibt keinen Arzt für solche Füße.«
Und stolz waren sie auf Bruno, weil er im Rechnen und auch sonst ein Musterknabe der Korntaler war.
Bruno aber wusste: »Das geht alles vorüber.«
Und schenkte sein Briefmarkenalbum seiner Schwester.
Köhnlein aus der Bibelstunde bot ihm an, mit ihm Schach zu spielen, denn Bruno redete neben den Briefmarken gern vom königlichen Spiel.
»In fünf Zügen schachmatt!«, rief Bruno, als wollte er alle warnen, es mit ihm aufzunehmen. Aber niemand wollte das. Auch ich nicht.
Denn mit Bruno war es nicht so leicht, er konnte auch furchtbar eingeschnappt sein, wie ein Bär in der Falle. Dann tobte er. Einmal hatte er mit Viktor gespielt. Und das war schon genug gewesen. Viktors Angebot für ein zweites Spiel schlug er aus. Er müsse es sich überlegen, er zierte sich. Aber Briefmarken-Bruno konnte man nicht gram sei, er hatte zu tragen.
Dorothee sagte zu mir:
»Jana-Maria geht auf Krücken. Ihr Onkel hilft ihr und will, dass sie nach Wildbad im Schwarzwald fährt. Zu Bädern, Wassergüssen, Massagen. Momin hatte ihr erzählt, dass dann sogar eine Heilung möglich sei. Das Wasser könne Wunder wirken, na – halbe auf jeden Fall. Heilwasser wie in der Bibel. Als ob Jesus ihr sage: Steh auf und wandle.«
Onkel Karl: »Wunderg’schichtle für alte Weiber«. Und er lachte. »Die deutsche Medizin, die neue Medizin im Reich, Weltspitze!«
Ich fand’s doooof – mit vier o.
Aber Hilfe hatte Jana-Maria echt verdient. Ja, ein Wunder sogar! Dass sie wieder ohne Krücken laufen konnte, und wenn’s mit den Wassern geschah, wunderbar!
Momin: »Brunos Eltern haben so viel mit Jana-Maria zu tun, dass Bruno manchmal allein ist. Darum muss jeder auf Brunos Seite sein.« Und deshalb lud sie ihn immer wieder zum Mittagessen ein.
»Und zu Kirschkuchen!«, rief Dorothee am Tisch. Korntaler Kirschkuchen – mit oder ohne Schlag. Gut gebacken, ganz frisch vom Blech weg.
Im Wald gab es Spielplätze und Ausgucke, die wir uns als Kinder erobert hatten. Mit Stecken als Schwerter und Tannenzapfen zum Werfen. Christen gegen Türken – mit geheimen Zeichen und Hinterhalten. Wer einen Zapfen an die Brust oder an den Rücken gepfeffert bekam, war tot und draußen.
Heute war ich allein hergekommen, oberhalb von Korntal am Lotterberg. Bäume gefielen mir, sie waren die Säulen am Berg, mal mit dem Moos am Stamm, mal mit dicken Harztropfen und Fuchslöchern an den Wurzeln. Ein, zwei Stecken von den Haselnusssträuchern geholt, gut geschnitten, die Rinde mit dem Taschenmesser geschält, einen sauberen Stecken, ein echtes Schwert für den Kampf um den Sieg. Den Sieg gegen die Feinde, die Münchinger Jungen, die Türken, die Mamelucken, die Sarazenen; gegen die Eroberer gleich welchen Landes und für Jerusalem, da wo die Zedern stehen, die unverrückbaren grünenden Zedern.
Das Sich-Prügeln fürs Heilige Land, so wie es in den Büchern stand, die wir im Dutzend aus der Bücherei geholt hatten. Mir kam das nicht mehr überzeugend vor.
Plötzlich war etwas da, das anders war. Ich fand solche Sachen auf einmal kindisch, ich spürte ein Anderssein in mir. Gänsehaut, es kribbelte. Meinen Kopf legte ich an einen Baumstamm wie zur Beruhigung. »Wachse nur, Baum«, flüsterte ich und fühlte eine tiefe Sehnsucht.
Momin hatte gesagt: »Du bist ja wieder gewachsen!«
Die Schuhe passten nicht mehr, waren zu schmal und zu klein. Wie bei vielen Familien in Korntal, gab es jetzt einen Ringtausch, die Schuhe des Onkels gegen die Jacken des Vaters, die der nicht mehr tragen mochte, weil sie an den Schultern zu breit waren. Auch der Duz hatte sich verändert, er war schmaler geworden. Onkel Karls ausgelatschte Supertreter (aus Leder, handvernäht) mochte er nicht nehmen. Ich auch nicht. (Fand sie affig und dann die Putzerei …) Aber Stefan fand nix dagegen. Ich hatte darum neue Schuhe im Schuhhaus Schmidt aussuchen dürfen, Schuhe mit Schnallen, das sah chic aus.
Zum Glück herrschte heute ein trockenes Wetter, so dass die neuen Schuhe blank blieben; auch wenn ich Steine wegkickte oder hoch nahm und in die Wiesen schleuderte. Ich kämpfte mit Heiserkeit. Wenn ich morgens mal sprach (viel mehr als ein Hallooo war’s nicht), kicherte Dorothee und rief: »Stimmbruch, Bruder!« Ich tat, als sei das nur ein Hüsteln gewesen. Vieles hatte sich verändert, die Kinderspiele zogen nicht mehr; so ein Gefühl wie überflüssig, nebenbei gestellt zu sein; zugleich das Gefühl, nur der, der ich war, zu sein und niemand anderes sonst, Träume gingen weiter.
Die alten Geschichten gingen mir durch den Kopf. Damals hatten sie gekämpft als Christen gegen die Türken. Und Türken waren die Bösewichter gewesen oder die wilden Bürschlein, die sie mit den Stecken nieder machten. Jetzt kam mir die Geschichte zweifelhaft vor. Man »kämpfte«, obwohl die Gegner nicht anders waren als man selbst. Warum für das Heilige Land Blut vergießen?
Vom Duz hatte ich gehört, dass wer zum Schwert greift, durchs Schwert umkommt. Das Schwert hilft nicht, das Schwert schafft Leid. Und die Rede war, dass die Gründer der Brüdergemeinde an den König geschrieben hatten: »Christen ist es nicht gestattet, das Schwert in die Hand zu nehmen.« Das hat seinen Grund in der Bibel, so der Duz. Zu allererst: »Du sollst nicht töten.«
Ich betrachtete die Bäume, die biegsamen schmalen Buchen mit ihren dunkelgrünen Blättern, der glatten Rinde, die herrischen Ahornstämme mit ihrer großen Krone, die breiten Eichen am Wegrand. Die Bäume waren wie Krieger gewesen, gegen die sie mit ihren Stecken gekämpft hatten, aber es waren doch Bäume und ihre blöde Kämpferei nur ein Hirngespinst.
Als kleine Jungen hatten sie gedacht, sie stürmten gegen den Feind, das war etwas Selbstverständliches gewesen, sie überwänden ihn mit ihrem Schwert. Sie hatten es doch aus einer Ballade heraus. »Schwäbische Kunde« von Ludwig Uhland – auswendig sogar: »Als Kaiser Rotbart Lobesam zum Heiligen Land gezogen kam – durchs Gebirge wüst und leer – und fast musst der Reiter die Mähre tragen, so schwach und krank die Rößlein waren – da fünfzig türkische Reiter sprengten heran – der wackere Schwabe forcht sich nit und nahm sein Schwert mit Macht – und zur Rechten sieht man wie zur Linken – ’n halben Türken niedersinken …« Ja, sie hatten alle gelacht, weil das so komisch war, wie die zwei Hälften … gespalten wie bei einer Holzfigur. Als Kinder war uns das nicht so grausam vorgekommen, eher witzig.
Aber Baldinger, der Lehrer in Deutsch und Singen, hatte abgewunken, obwohl er selbst auch gelacht hatte. Einen halben Türken, einen halben Mohren, je einen rechts, je einen links … eigentlich ginge das nicht. Das sei grausam.
Ich warf einen Stecken hoch in die Luft, das alte Schwert, das mir nun lächerlich vorkam. Ja, nun, dachte ich, davon nichts mehr. Als Kinder hatten wir ja nicht danach gefragt. Es war das Handballspiel jetzt oder irgendwelche Wettkämpfe (die Hanteln! die Klimmzüge! Wer wieviel! Wie oft!) Am liebsten aber war ich draußen, stromerte herum, lag im Gras und sah auf die Wolken. Wolken wie Zigarren, grau und dunkel, Wolken wie Schmetterlinge, verweht und dünn mit ihren lichten Flügeln und auch Wolken wie kleine runde Bälle, kompakt und schneeweiß, mit denen jeder sich unterm Himmel gut fühlte. Sie bewegten sich, sie schoben dahin, sie blieben keinen Augenblick stehen und folgten dem Wind, der in den Zweigen rauschte.
Momin und Duz hatten gemerkt, dass ich mich verändert hatte. Duz nahm meine Fragen gelassen auf und hielt mir nichts vor. Er war nicht erstaunt, als ich ihn fragte. Ja, das Wort »rechtschaffen«, so der Duz, sei ein deutsches Wort, vielleicht meine es Anderes, als ich denke, es gebe ja meist mehrere Verständnisformen. Immerhin, der Duz hatte dann gelächelt; er wusste, was mich beschäftigte. Das klinge für einen jungen Menschen so festgefügt und bürgerlich, meinte er. Im Wort »rechtschaffen« stecke ja auch das Wort Recht schaffen – und das Recht sei doch wichtig für das Leben miteinander.
Der Vater hatte am Fenster gestanden, hinausgeschaut und auf die Waldhöhen im Osten gezeigt.
»Übrigens, Mannu, da waren wir schon lange nicht mehr.«
Auf unseren Wanderungen zum Roten Berg oder auf die Fildern hinauf. Dann hatte er gesagt, dass man nicht alles miteinander verflechten dürfe, die eigenen Einschätzungen, die Wünsche, ja die Kritik, das Unbehagen an den Bibelstellen. Und wenn einen etwas ärgere, dann müsse man sich auch fragen, ob der Ärger angemessen sei. Nicht alles miteinander verflechten, die Kritik, die Fragen, die eigenen Gedanken mit dem, was in der Bibel das Wort sage. Eine gewisse Distanz (auch sich selbst gegenüber) sei die Voraussetzung, um die Wahrheit zu finden.
Das Wort »Wahrheit« hatte er betont. Aber mir war es vorgekommen, als sei der Vater fast müde darüber. Nicht so wie früher, als ich vor dem großen Zelt die Faltblätter für den Gottesdienst verteilt, Lieder und Bibelstellen, und dann hinten im Zelt der Predigt Vaters zugehört hatte. Seinen Worten im Zelt, am Rand der Stadt, und das Gefühl gehabt, dass alles etwas abgehoben war, was er da predigte, und ich schläfrig wurde. Dann wieder wünschte ich mir seine Worte fest und ohne Zweifel, da konnte der Wind noch so sehr am Zelt rütteln oder der Regen auf die Zeltplane platschen. Tage zuvor hatte ich Plakate mit Vaters Namen geklebt, das war nicht schlecht gewesen. Etwas Praktisches.
»Hans-Robert Schröder, Missionar und Prediger, spricht über die Bibel.«
Manchmal kamen über hundert Besucher, manchmal nur gerade mal zwanzig, worüber der Duz aber hinwegging. Manchmal war der Kirchenchor dabei, der einige Lieder gab: »Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt« … Melodie und Text kannte ich auswendig, dass ich dieses kitschige Lied fast leierte. Der Duz fand es überhaupt nicht kitschig. Aber wenn man’s so oft zu singen bekam? Auch ein Kanon ging, das war besser, da mussten wir genau auf die Einsätze und die Stimmen achten. Der Diakon dirigierte. Dann las er die Bibelstelle vor, über die der Vater sprechen wollte, und die Predigt begann. Manchmal sah ich den Vater vor der Predigt hinter dem Vorhang knien und ein Gebet sprechen. Manchmal war’s Überdruss, manchmal Langeweile, manchmal ein leerer Kopf, ich rückte weg von ihm. Aber manchmal überzeugte mich Vater, gerade weil er so wahrhaftig und ohne Getue war, so ohne Zögern, ganz überzeugt, und die Müdigkeit war weg. Die Menschen gaben ihm die Hand und er schlug fest ein. Vater war ein Mann, der glaubte, dass die Menschen ihn und sein Wort brauchten. Und dieses Bewusstsein gab ihm viel Kraft und Festigkeit.
Vaters Leben und auch das der Eltern war völlig anders als bei den Jongens, wo es viel mehr um die Dinge ging – die holländischen oder die korntaler Dinge, den Seesack für Pieter, das gute Leder, das Holz der Werkstatt. Josten kniete nicht, er stand in der Kirchenbank, prüfte das Holz und sang brummend die Lieder.
Dann hatte mich der Duz gefragt, was ich denn so lese. Und ich hatte geantwortet, die alten Kreuzritterbücher nicht mehr. Da hatte der Duz mit dem Kopf genickt, klar, das Alter. Und er schien grad froh darum, dass die alten Schwarten für mich keine Rolle mehr spielten. Der Duz hatte die Arme untergeschlagen und schaute, wenn er zu Hause war, oft ziemlich müde drein.
*
3
Hätte ich gewusst, dass mir Pieter folgte, hätte ich mich versteckt und ihn überraschen können, aber so war’s grad anders herum. Ich lag in der Wiese, beobachtete die Wolken am Himmel und sah, wohin sie zogen. Pieter warf einen Schatten dazwischen:
»Frösche, Zikaden, Eidechsen?«
»Wolken und sonst nichts.«
Pieter wusste, wo er mich finden konnte. Hier draußen am Waldeck, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten, aber auch Frösche und Zikaden. Sie gaben ihr Abendkonzert. Die Feuersalamander waren dabei und bewegten sich mit ihrer schwarz-gelben Zeichnung ruckhaft auf dem Weg und verschwanden unter dem Moos.
Wenn ich einen auf die Hand nahm, rieb er an der Haut und es brannte. Pieter sagte:
»Die haben eine Drüse, die wie ein Gift abwehrt und für Vögel gefährlich ist.«
Frösche fingen sich viel leichter. Es gab sie in großer Zahl an den Teichen, den Pfützen und in den Wiesen. An den Köpfen saßen die gelben oder braunen Schallblasen, die sich blähten, wenn sie losquakten. Laich schwamm als heller Gallert auf dem Wasser. Grüne, braune und fast gelbliche Frösche hatte ich schon gefangen und sie Pieter mitgebracht. Die grünen glänzenden hatte er am liebsten. Pieter bugsierte sie in sein Terrarium, wo sie verdutzt saßen und dann hin und her sprangen oder an der Glaswand festklebten. Wie lange die bei Pieter im Terrarium lebten? Pieter fütterte sie mit frischen Salatblättern und Fliegen, die er vom Fenster wegfing. Von Fröschen hatte ich genug und sie taten mir jetzt leid, dass sie in Pieters Terrarium hausen mussten und nicht mehr hinaus ins Freie kamen. Und Pieters Schwester sie im Garten vergrub. Feuersalamander fing ich sowieso nicht. Pieter hatte mal zwei Salamander in seinem Terrarium gehabt, die Schaum vor das Maul bekamen, wenn sie miteinander kämpften, so dass er sie wieder aussetzte.
Josten hatte gegrinst.
»Ja, jetzt, wo sie sich immer gestritten haben, haben sie ihr Ziel erreicht: die Freiheit.«
Neue Salamander holte sich Pieter nicht mehr.
In Pieters Terrarium verkümmerten die Tiere, weil er sich zu wenig um sie kümmerte. Das Terrarium war zu trocken, hatte nur Sand, trockenes Moos und ein paar verwitterte Holzkanten. Hin und wieder sprühte Pieters Mutter mit einem Zerstäuber Wasser in das Terrarium, aber die Frösche hockten apathisch da und waren still wie traurige Gesellen.
Zikaden konnten nicht ins Terrarium, die Frösche hätten sie sofort gefressen. Aber die Zikaden waren liebe Tiere, wenn man das so sagen kann. Sie waren leicht zu fangen; wir setzten sie in ein Glas und sofort zirpten sie, als wäre nichts geschehen und als wollten sie verkünden: Wir bleiben wach, bis wir umfallen. Und tatsächlich, am nächsten oder übernächsten Tag lagen die Zikaden am Boden des Glases und sahen wie verhutzelte Apfelbutzen aus. Die Salatblätter im Glas hatten sie nicht angerührt.
Mittlerweile hatte Pieters Mutter das Terrarium übernommen, sie sorgte ja sowieso dafür und Josten hatte gesagt: »Pieter, du bist nicht verlässlich damit.« Die Frösche hatten ihren Dienst quittiert und alle Glieder von sich gestreckt.
Wir trafen auf unserem Rückweg Viktor, den Sohn des Kantors. Er begrüßte uns wie gute Freunde. Viktor neigte zu einer gewissen Überheblichkeit, als hätte er in allem einen Vorteil. Freundschaftlich wollte er wissen, ob wir einen Frosch dabei hatten.
Ich schüttelte den Kopf und ging weiter. Um Viktor machte ich am liebsten einen großen Bogen. Er war spillerig und ein Stänkerer; sein spitzmausiges Gesicht mit den grünen stechenden Augen schien immer auf etwas zu lauern.
»Die Tiere sind ja nur in der Bibel paradiesisch«, sagte er, »sonst herrschen Mord und Totschlag.«
Ich schubste Viktor, dass er stolperte.
»Au!«, rief der, »die Frucht des Geistes ist Gelassenheit, mein Lieber.«
Ich stand neben dem Weg, sah zu den Häusern hinüber und überlegte, was ich antworten sollte.
Pieter murmelte: »Macht lieber etwas Klu-u-u-ges« und lachte, »zum Beispiel Schach spielen oder Gräser bestimmen.«
Beim Gräserbestimmen war Viktor blind. Naturkunde als Fach hielt er für vollkommen überflüssig und ob er einen Frosch von einem Salamander unterscheiden konnte, war ihm egal. Viktor ekelte sich vor lebendigen Tieren, insbesondere solchen aus dem Wald und den Tümpeln. Andererseits war er neugierig und sah gerne zu beim »tote Tiere verbuddeln«. Aber Schach spielen, das war etwas Anderes. Im Schach steckte er in einer Haut, an der fast jeder Versuch ihm beizukommen, abprallte.
Viktor brach in ein leicht hüstelndes Gelächter aus, als wollte er sagen »Du, Pieter, mit dir?«
Pieter schaute zur Seite.
Viktors Vater hatte sich von Josten eine neue Orgelbank bauen lassen; die erste Bank, wie er sagte, mit der er zufrieden war. Etwas Handfestes also. Wie Viktor über die Pfarrer dachte, das war klar. Der Kantor mochte die Pfarrer und Prediger nicht, sein Sohn spottete. Pfaffen und so.
Viktor war ein Rechen- und Musikgenie. Drei Instrumente spielte er, und vertrat schon den Vater an der Orgel, aber auch Geige war dabei und sogar Akkordeon, wenn sie Lieder sangen. Mit der Naturkunde fing er nichts an, mit dem Handball auch nichts, obwohl er gerne mitgespielt hätte. Er war zu schwächlich und wusste das. Bei den Anderen beliebt zu sein, das hätte ihm gefallen. Viktor allein wie ein Specht unter Meisen. Pfeifend strebte er zur Schultür hinaus und tat so, als sähe er niemanden, denn er konzentrierte sich auf seine Melodien. Bach und Mozart und was Neues, von dem er sprach. Telemann war ihm zu spießig. Viktor hatte Allüren wie sein Vater. Der schwebte wolkengleich und hoch erhaben durch Korntal. Mit weißen Haaren, die wie die Stoppel eines Igels aussahen, war er ein Musikus wie aus dem Bilderbuch. Und wenn er mit jemandem sprach, schaute er immer ein wenig von oben herab, selbst wenn er kleiner war. Als hätte er die Füße in den Wolken statt auf dem Boden. Das mit den »Pfaffen« kam wohl von ihm, weil er sich mit den Pfarrern und Diakonen immer stritt; der Kantor fühlte sich nicht verstanden. Wenn der Pfarrer nicht in der Kirche war, kam Viktor manchmal laut singend zur Tür hinein und tanzte durch die Sitzreihen, was mich ansteckte; er tanzte, ich tanzte, bis der Diakon kam und uns hinausscheuchte.
Viktor verkleidete sich gern mit dem Barrett und der alten Frackjacke seines Vaters oder mit dem Sommerhut der Mutter. Dorothee und Rösle behaupteten, dass er sogar Lippenrot aufschmiere. Rote Schminke. Aber das stimmte nicht. Viktor hatte wirklich so rote Lippen, eigentlich immer, auch in der Schule. Zum Schminken war er viel zu hochnäsig. Seine Mutter, die Isolde hieß, war aber auch so und kaufte dem Sohn die teuersten Hosen in Stuttgart und machte auch beim Ringtausch in der Gemeinde nicht mit.
Im Erdkundeunterricht erzählte Herr Mahle etwas von Holland und zeigte uns Aufnahmen, die er von Josten persönlich bekommen hatte. Vor allem die Segelboote gefielen mir, große Schiffe (mit oder ohne Klabautermann) und Schiffe nach Südamerika und Fernostasien, China und Japan. Schiffe für Wind und Wetter und jeden Tag Regen, den es in Holland ja hatte. Die holländischen Jungen und Mädchen sind groß und stark, so Mahle, damit sie nicht weggeweht werden – vom Deich in die blanke See hinein. Wir in der Klasse lachten. Und ich dachte, nix mit der Sonne.
Viktor war natürlich dabei, wenn im Unterricht gefurzt wurde. Dann hielt er sich die Nase zu und rief:
»Hier stinkt’s.«
Mahle lief am Pult hin und her und sagte: »Ich riech’ nichts.«
Viktor machte Handbewegungen, als wollte er den Mief nach vorne treiben. Wir Jungen feixten und Viktor schien froh darum. Er liebte es beachtet zu werden, egal aus welchem Grund.
Bei Köhnlein später die Geschichte vom Verlorenen Sohn. Lukas 15.
Köhnlein mit pastoral-strenger Miene:
»Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an fröhlich zu sein.«
Alle Jungen saßen still da, Köhnleins Miene entspannte sich: »Ja, so war dieses Heimkommen des Sohnes.«
Viktor meldete sich:
»Aber vielleicht wollte der Sohn gar nicht gefunden und wieder aufgenommen werden. Neue Länder, neue Städte, neue Abenteuer«, sagte Viktor ganz weltmännisch.
»Dann hat das Gleichnis keinen Sinn.«
Er drohte Viktor mit dem Finger. Seine Jacke rutschte ihm etwas von der Schulter herab und alle sahen, wie er unter den Achseln Schwitzflecke hatte. Unwirsch zog er die Jacke wieder hoch, fasste an seinen Ledergürtel und zog ein rotes Büchlein aus der Tasche.
»Viktor verwarnt!«
Vorne ging er auf und ab, dass seine Schuhe lustig knarrten. Seine Hose hing etwas, der Gürtel saß nicht genau und war alt und abgegriffen.
Viktor malte Wellenlinien und Kringel in sein Heft, das dünn war und fleckig am Umschlag. Im Heft stand nichts von dem, was Köhnlein uns diktiert hatte.
Pieter hielt den Ball in der Hand, prallte ihn ab und warf ihn mir zu, ich fing ihn auf, schlug ebenfalls ab und wieder ab, diesmal von weit oben. Pieter konnte den Ball sogar mit dem Fuß aufnehmen und weiterkicken. Hinter uns schlurfte Bruno vorbei und rief heiser:
»Das machst du demnächst!«
Aber den Fuß zu benützen war im Handball außerhalb der Regel.
Später nahm mich Pieter zum Essen bei den Jongens mit. Es gab Pankeke mit Kaas. Die Jongens sprachen kein Tischgebet, aber das störte mich nicht. Es war ja so, es sollte nicht ein Zwang sein. Oder ein müdes Gemurmele.
Über das Gleichnis sprach Pieter nicht, obwohl Josten ihn gefragt hatte, was sie denn in der Schule gehört hätten. Pieter hatte vielleicht nicht zugehört oder alles schon vergessen. Wenn man ihn fragte, antwortete Pieter gern:
»Steht doch alles im Heft.«
Es stimmte, die Hefte führte Pieter wie ein Mustergeselle, sehr genau und sauber, mit dem Lineal gezogen, da war kein Strich schräg, keine Zeile hatte Tintenflecke, alles sorgfältig in Reih und Glied. Pieters Schwestern sahen mich groß an. Sie waren noch sehr klein, vier und sechs Jahre alt. Sie hießen Barbara und Jolande. Jolande wollte mir unbedingt durch das Haar fahren, das dunkel und braun war und nicht blond wie bei Pieter. Ich musste lachten, als ich Jolandes Hand am Kopf spürte, Barbaras Finger natürlich auch; es kitzelte, dass ich lachen musste.
Nach dem Essen ging ich hinaus und Pieter rief:
»Hab genug für heute.«
Er wollte sich hinlegen. Eene Mütze Schlaf. So wie der alte Josten.
»Eene Mütz voll.«