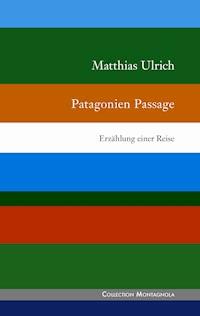
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Collection Montagnola
- Sprache: Deutsch
Impressionen einer Landreise durch die Weiten Patagoniens mit vielen Bezügen zu Werken der Weltliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SAMMLUNG ISE LE
Band 746
INHALT
Aus den Notizen
Bis ans Ende der Welt
Zwischen Tango und San Telmo
Fähr- und Flugstationen
Die Stadt im Landmeer
Beim Hüter der Robben
Moby Dicks Urenkel
Eine Erzählung aus der Steppe
Auf dem Patagonien-Express
Im Land der letzten Eiszeit
Gruß vom Gondwana-Land
Boomtown auf der Winterinsel
Der Platz der Belgrano-Toten
Auf Indianersuche
Abschied vom Ende der Welt
Kleines Patagonien-Glossar
Meine Patagonien-Bibliothek
Aus den Notizen
Als erstes das Licht. Ein schwebend kaltes Licht wie durch Milchglas hindurch. Es ist Winter, als ich ankomme. Der Himmel ohne Farbe, fedrige Wolken darüber. Das Licht erinnert an die Tage der Zwischenzeit: Wachtraumtage zwischen Silvester und Dreikönig, Fenstertage im Februar, Tage für Reisen nach innen; hier finde ich mich draußen.
Vom Flugzeugfenster aus trägt die flache Landschaft eine genarbte Lederhaut. Grün, braun und grau geschabt der Grund, darauf Linien, Furchen, Striche und runde, noppenartige Narben. Am Boden lerne ich diese Zeichen zu lesen: Straßen, Weiden, Wasserstellen und Pisten.
Ein trockener, kühl durchwehter Tag. Schon lässt der blanke Lichtschein den Frühling ahnen. Was wird hier blühen? Ginster blüht weiß, die Farbe, die dem Nichts am nächsten ist (Jaccottet).
Gehen in Patagonien. Entweder der Straße nach auf ausgebleichten Kieseln oder querfeldein über den trügerischen Sand und zwischen Dorngestrüpp hindurch. Das Gehen zerstört die Illusion der Flachheit. Die Ebene ist durchzogen von unzähligen Rinnen, Kuhlen, Abbrüchen, Windungen und Kammern. Sie sind nicht tief, bereiten den Füßen aber Mühe, wie auch die braunen verfilzten Graspolster, die kleinen spitzen Dornen an den Sträuchern. Zäune versperren den Weg. Sie kommen vom Horizont hoch und verschwinden auf der anderen Seite. Was die Welt teilt, ist ein Zaun. Wo sich Himmel und Erde berühren, steht ein Zaun. Ich kann sie überklettern, sie sind nicht hoch, und an ihren straffen Drähten hängen Wollbüschel. Auf der anderen Seite des Zaunes geht es weiter: Gestrüpp, Grasbüschel, Sandrinnen, Wollfäden an Dornen. Auch die Überreste von Schafen finde ich: grau und schwarz verkrustet im Sand. Unsichtbar und allgegenwärtig die Aasvögel, die Andenkondore.
Die Romantiker wanderten durch die Landschaften ihrer inneren Welt und schrieben davon, am schönsten und am tiefsten in Versen. Chatwin wanderte durch ein Weltenbuch, ein traumhaft geführtes Buch. Er besaß es schon, bevor er es überhaupt niederschrieb. Patagonien ist nur der äußere Anlass einer Geschichte, die längst in seinem Kopf war. Den Text musste er nur noch auf hin und her wandernde Weise zusammenfügen.
Bald sind die Schuhe voller Sand, die Strümpfe von Dornen zerrissen. Ab und an fliegt ein stiller Vogel auf; er gibt keinen Laut von sich. Noch einmal die Landschaft: anscheinend flach und waagrecht, manchmal liegt der Horizont ein wenig höher als die eigene Position, manchmal ein wenig tiefer. Die Straßen laufen schnurgerade in einem so weiter und überspringen Horizontlinie um Horizontlinie. Kommen Autos entgegen, wirken sie wie die rastlosen Boten einer hinter dem Horizont versunkenen Zivilisation. Blechtiere, die das Land durchhasten. Straßen werden zu Pisten. Ein rötlicher, feiner Staub bedeckt sie. Überall sind diese Lehm- und Staubspuren zu finden – an den Blättern, den Büschen, am Lack der Autos, an den Reifen, die wenigen Schilder mit Staub überzogen und die Plastikflaschen am Straßenrand. Im Wind rollen sie hin und her.
Der Wind bläst Sandschlieren auf, Staubwolken; aber so schnell, wie sie aufsteigen, sinken sie wieder hinab. Alles andere hat sich dem patagonischen Staub ergeben, kein Regen, der ihn fortwäscht. Einzig die Zeit, die ihn Schicht um Schicht über dem Land verfestigt.
Ich will mir Notizen machen, aber was soll ich hier schreiben? Nur Horizont, Piste, Horizontfläche, der blasse Schirm des Himmels. Mathematisch klar. Der Wind ist die einzige Gegenwart. Er fährt ins Haar, streicht an den Ohren vorbei und erzeugt eine Gegenkraft in der Luft.
Fenster ins Grenzenlose.
Neben der Staubpiste das Aluminiumwerk. Auch hier hat sich der Staub über alles gelegt. Manche Gebäudeteile wirken wie jüngst hingestellt, andere nehmen sich aus, als sänken sie in die Erde; einem fortwährenden Aufbauen auf der einen Seite entspricht das Versinken und Verstauben auf der anderen.
Das leere Land gibt jedem und niemandem eine Chance. Nicht weit vom Aluminiumwerk stehen kleine Arbeiterhäuschen direkt am Meer. Die Fenster starren blind und staubüberzogen aufs Wasser und scheinen wie in einer rätselhaften Erwartung gebaut. Niemand wohnt hier, ein Vorhang steht bewegungslos, als wären helle Steinplatten ins Fenster gestellt.
Vom Rand der Ebene der Blick nach Puerto Madryn hinab. Weil vorher alles horizontal, leer und unveränderbar war, wirkt die Stadt nun wie das Gegenteil: vertikal, pulsierend und vertraut. Aber beim Näherkommen verschwindet dieser Eindruck. Auch hier der unbesiegbare Staub, rötlich und grau. Die Gebäude an der Uferpromenade stehen halbfertig: leere Rohbauten, Stahlträger, die rosten, Fensterhöhlen, durch die der Wind pfeift. Draußen auf dem Meer die Umrisse einer Ölplattform.
Später ein Stromausfall. Der Staubgeschmack wieder, die Dunkelheit, Schattenfiguren vor flackerndem Kerzenlicht. Vor dem Haus ein überwältigender Sternenhimmel und wie ein Kranz silberner Distelblüten die Milchstraße. Loerke: Der Silberdistelwald. Ich suche nach dem Kreuz des Südens. Habe ich es gefunden, dann bin ich, so bilde ich mir ein, nun wirklich auf der Südhemisphäre der Erde. Mein Reisegefährte schüttelt den Kopf, das Sternbild, es bleibt im Staub diffus.
Im grünlich schimmernden Dunkel der Wal. Bevor ich ihn sehe, ahne ich ihn. Ein Schatten, der in der Tiefe schwebt. Der Schatten wird größer und erhält im helleren Grün der oberen Wasserschicht eine Kontur, einen riesigen Kopf, einen dunklen runden Leib und die geschwungene kraftvolle Flosse. Gleich wird er das Boot, in dem wir sitzen, in die Luft heben, und wir fallen vom Buckel des Wals ins eiskalte Wasser. Im Zwielicht tanzen die Schatten. Der Wal dreht sich wie mit leichter Hand zur Seite und durchstößt die Wasseroberfläche. Sofort bläst er eine Wolke aus Gischt und Wasser aus dem Atemloch, und mich treffen einige Tropfen. Andere Wale tauchen auf. Ihre schwarzen, wie mit Muscheln übersäten Köpfe strecken sie aus dem Wasser. Weiß ist die Farbe der Stirn, Sterne und Inseln zugleich. Ist das ein Auge, das da so funkelt, oder sind es Wassertropfen in einer Hautfalte? Ihr Schwimmen und Drehen, ihr Spritzen und Prusten zeigt ihre Lebenslust. Was macht sie so unbekümmert? Wir folgen mit unserem Boot ihren großen wasserglänzenden Leibern. Welle um Welle.
Auf der Piste weht wieder der Staub. An manchen Stellen breite, die Piste unterbrechende Wasserlachen. Ein trübes, graues Wasser. Woher es kommt, weiß niemand. In der Nacht, wie auch Tage zuvor, hat es nicht geregnet. Das Wasser bleibt über Wochen dort stehen, versickert nicht, und die Wintersonne ist zu schwach, Staub weht darüber hin. Manchmal haucht der Frost eine dünne Eishaut darauf. Erst im Sommer trocknen die Löcher aus. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss auf der Hut sein. Bleibt er im Schlick eines Wasserlochs stecken, holt ihn niemand heraus.
Wieder gehe ich und spüre den Sand und die Grasbüschel unter den Füßen. Ich gehe unbekümmert, wie ich als Kind gegangen bin. Ich schmecke den Staub und lasse mich treiben. Ich stolpere, ich balanciere, ich drehe mich, gehe ein wenig rückwärts und wieder vorwärts, mache ein paar Sprünge und gehe lange wieder über den Sand. Nichts lenkt mich ab. Ich betrachte den fernen Horizontsaum, aber es spielt keine Rolle, dorthin zu kommen. Ich bewege mich, als hätten sich alle Gedanken im Land aufgelöst und einzig eine klare, nüchterne Linien- und Flächenhaftigkeit sei geblieben: die Piste, das flach gelagerte Stück Land, der dünne Faden des Horizonts, das Glas des Himmels.
›Doch in jenen Tagen geschah es selten, dass mir überhaupt ein Gedanke durch den Kopf ging… mein Kopf hatte sich plötzlich von einer Denkmaschine in eine Maschine mit einem anderen, unbekannten Zweck verwandelt… Mein Zustand war ganz Spannung und Wachsamkeit: doch ich erwartete nicht, ein Abenteuer zu erleben.‹ So H. W. Hudson in seinem Buch »Idle days in Patagonia«. Hudson, dessen Romane fast alle in Patagonien spielen, lebte dort als Kind und junger Mann. Später ging er nach England und schrieb über sein Orplid: Patagonien.
Ich fand diese Beschreibung, nein, Bestimmung meines patagonischen Gehens, in dem Buch von Chatwin und Theroux: »Wiedersehen mit Patagonien«. Hudson spricht hier jenen seltsamen, wie aufgebrochen und entleerten Denkzustand an, in den der Patagonienwanderer fallen kann. Einen Schritt vor dem Tagtraum, ein helles, intensives Wachsein, auf nichts hingespannt als darauf, da zu sein.
Im Schnee bei Esperanza entdecke ich die eigene Fußspur wieder. Ich sehe die Tritte, die in den Schnee gefrästen Spuren des Autobusses und über dem Horizont glitzernde Punkte im abendlich verfärbten Himmel. Fingerlange Raureifnadeln an den Ästen von Ginster und Birke. Ich spüre den weichen Schnee, während die Kälte im Gesicht und an den Händen beißt. Ich gehe die Straße entlang, die unter einer dünnen Schneedecke liegt. Gelb und blau schimmert das Licht an den Wolkenrändern. Später im Bus höre ich das gleichmäßige Surren der Reifen im Schnee, sonst ist es still zwischen Weltall und Erde.
Wieder zu Fuß. Die Piste ist mit Eis bedeckt, an manchen Stellen ist das Eis durchbrochen. Die dunkle Erde verhilft zu einem sicheren Tritt. Dazwischen die Gräben der Reifenspuren, in denen das Wasser zu milchigem Eis gefror.
Meinen Reisegefährten sehe ich weit vor mir. Wir müssen einen straff gespannten Drahtzaun überklettern, dann stehen wir im Steppengras an einem Hang. Die Felsen haben eine rote und manchmal eine graue Färbung, sie sind rund wie Buckel. Wirkten sie aus der Ferne eher klein, so wachsen sie beim Näherkommen ins Riesenhafte. Alles verliert sich in dem flachen Land. Aber aus der Nahperspektive weist es den Menschen ab. Trotzdem, ich will auf jenen Berg, der den Horizont versperrt und die Ebene überragt. Ich stelle mir vor, davon könnte ich erzählen.
Alles war geschaffen vom winterlichen Licht und der Stille des Raumes: die Grasbüschel, die Zäune, die Sandrinnen, die sich hier und da durch den Boden zogen, die Felswände, die zum Horizont hin absperrten, und die Felswand vor uns, die einer Klippe glich. Hatte Borges für seinen »Unsterblichen« solche Felsen im Sinn gehabt? Grabstollen, Nischen aus Stein, Steilhänge, von der Zeit geglättet?
An einem trockenen Bachlauf fanden wir schließlich den Einstieg. Ein kalter Wind fuhr plötzlich in die Kleider, ich schwitzte und fror in einem. Aber kein Empfinden von Schwere oder Überdruss, nicht einmal Mühe, nur eine leichte, windumtoste Müdigkeit. Ich kletterte über Schutthalden und steile Felskegel. Im Westen sah ich den Lago Argentino zu Füßen der Anden. Das kühle Graugrün des Wassers kontrastierte mit dem Schneeweiß der Andengipfel, und die Wolken rollten über den Himmel.
Manchmal ruhte die Luft, aber dann, von einem Augenblick auf den anderen, sprang der Wind über die Felsabsätze und bog alles in die andere Richtung. Aber die Wolken zogen nicht zu, das Licht schien blass auf das Land. Mitunter, als flatterten riesige, türkisfarbene Fahnen, öffnete sich der Himmel, die Wolken verschwanden und die Sonne brach durch.
Wir hatten den Berg erklommen und sahen weit über das Land. Hier war niemand; niemand, der hierher gehörte. Das Land war flach und ohne Menschen, auch ein paar Häuser bewiesen nicht das Gegenteil. Ich dachte an die Zeit nach den großen Gletschern, als Europa noch leer lag. Hier bot sich so ein Bild, der Anblick eines zeitenfernen Augenblicks. Ein Wind, der tobte und alle Spuren verwehte. Ich ging; nirgendwo hinterließ ich eine Spur.
Bis ans Ende der Welt
Aber warum war ich in Patagonien? Was lockte mich aus dem mitteleuropäischen Sommer in den patagonischen Winter? Warum Tausende von Kilometern fliegen, um in ein Gebiet zu kommen, das aus Steppengräsern, Sand, Wind, Schafen und flachen Horizonten besteht? Keine Sehenswürdigkeiten der üblichen Art, keine Kulturplätze oder pittoresken Städte, nur Wind, Sand und Sterne. Und da beginnt es schon – die seltsame Magie der Worte, die mich als Kind fesselte. Zum Beispiel: »Wind, Sand und Sterne«, ein Buchtitel von Antoine de Saint-Exupéry, dessen Dreiklang ein schönes Synonym für die Sehnsucht ist. Die Kapitel des Buches tragen Überschriften wie: Die Strecke. Die Kameraden. Das Flugzeug. Die Naturgewalten. Das Flugzeug und der Planet. Die Oase. Die Wüste. Der Durst. Die Menschen. Wer hat je so bündig das Planetarische in neun Kapiteln benannt und der Vorstellung allen Raum gelassen? Ich hatte als Kind das Buch in der Bibliothek meines Großvaters entdeckt. Es war die alte Taschenbuchausgabe aus dem Karl Rauch Verlag, auf dessen Umschlag die Worte Wind, Sand und Sterne fast eine Einheit bildeten.
Mein Großvater war ein Freidenker, der sich mit Fragen der Botanik, der Geologie, der Planetenkunde, wie er es nannte, beschäftigte. Von Beruf war er Arzt in einem kleinen Dorf im Kärtner Katschtal, und ich war als Kind immer wieder dort, um mein Asthma auszukurieren, das ich mir im grauen Nachkriegs-Braunschweig und in einem Kindergarten mit prügelnden Kindergärtnerinnen und schreienden Kindern als Unterster in der Hackordnung geholt hatte. Einige Wochen ging ich in den Kindergarten, dann nicht mehr. Hartnäckig blieb mein Asthma. So kam ich nach Kärnten, wo die Luft besser, die Berge hoch und die Täler eng waren. Mein Großvater ließ sich aber davon den Horizont nicht begrenzen. Mit siebzig praktizierte er noch, lernte nebenbei Französisch, pflanzte hinter seinem Haus Bäume und träumte von einer Weltreise. Er wollte Sibirien noch einmal (als kriegsgefangener Arzt der K.u.K-Armee war er sechs Jahre lang in Lagern bei Dauria und Kansk gewesen) und Südamerika, insbesondere Patagonien, bereisen. Ich begleitete ihn auf seinen Wanderungen zu den Patienten, und wenn er von den düsteren Krankheiten sprach, schwang in seinen Worten Selbstbewusstsein, dass er, trotz seines Alters, diese Krankheiten nicht hatte. Ich war stolz, neben ihm zu gehen, die Gatter für ihn zu öffnen und an den Quellen zu trinken, die er mir zeigte. Zum Beispiel am Fuß eines Lärchenwaldes hoch über dem Tal – fast aus dem Wurzelwerk heraus sprang das Wasser. Er setzte sich neben mich, packte die Jause aus und reichte mir eine von den Käse-Ecken, die er auf seinen Wanderungen immer dabei hatte. Mit ihm wollte ich gehen, auch wenn es mir nicht leicht fiel, ich müde oder durstig wurde und Seitenstechen bekam.
Er erzählte von Südamerika und Patagonien, als sei er dort gewesen. Später wurde mir klar, dass es wohl Saint- Exupéry war, der ihn zu seinen patagonischen Träumen inspiriert hatte. Ich konnte mir weder unter Patagonien noch unter Sibirien etwas vorstellen, allerdings verglich ich die Worte meines Großvaters mit der Landschaft, die mich umgab, also mit Bergen, steilen Bergflanken, Geröllwiesen, Bergbächen und Hochwäldern. Ich dachte mir, so in etwa muss es in Sibirien oder auch in Patagonien aussehen, so wie hier in den Bergen. Aber vielleicht größer, unbewohnter und so, dass man freier atmen und leben konnte.
Einmal sprach mein Großvater über die Reise ans ›Ende der Welt‹, die nach seinen Worten nur nach Patagonien führen konnte. Ich stellte mir das Ende der Welt etwa dort vor, wo sich im hinteren Bereich des Tales die Berge zusammenschoben, ein Talschluss, in dessen Richtung wir oft zu Fuß unterwegs waren. Nie sah ich das Talende selbst, hörte aber das Rauschen des Wassers, das von dort kam. Es war das Quellgebiet des Bergbaches, an dem meine Großeltern wohnten. Und wenn ich im Bett noch einige Minuten wachlag, das Wasser gurgeln und rauschen hörte, dann kam mir das ›Ende der Welt‹ in den Sinn. Dort, zwischen den Felsflanken, lag es. Für Großvater war es ein anderer Ort, und der trug einen ganz bestimmten Namen: Patagonien. Meine Vorstellung von Patagonien entstand halb im Schlaf und in der Abgeschiedenheit eines Kärtner Dorfes. Und mit dem Rauschen des Baches ging ich auf Reisen zu der Region des Windes, dorthin, wo er herkommt und um die Welt weht, zur Region des Sandes, der sich uferlos von einem Horizont zum anderen erstreckt, zur Region der Sterne, die einen Kranz aus Distelblüten um die Welt legen, dorthin – und ans ›Ende der Welt‹. Das war ein magisches Wort für mich. Patagonien lockte. Und wenn ich mir so die Worte zurechtlegte, verschwand das Asthma, verschwand die Angst, verschwand, was mich bedrückte.
In der Schulzeit erzählte ich niemandem davon. Patagonien, so lernte ich, war ein Teil Südamerikas. Das Wissen machte die Sache allgemeiner, und ich begann, mich für andere Dinge zu begeistern. Aber immer hatte es mit Reisen zu tun. Ich kann mich entsinnen, dass ich, als ich zehn oder elf Jahre alt war, mit meinem kleinen Bruder eine Fahrradtour um die Welt geplant und im Diercke-Atlas Station für Station abgezirkelt hatte. Selbstverständlich führte meine Route auch durch Patagonien, denn ich wollte keinen Teil der Welt auslassen.
Patagonien verschwand nie ganz aus meinem Gedächtnis. Es blieb die Vorstellung vom ›Ende der Welt‹ und dass es etwas ganz Besonderes sein musste, dorthin zu kommen. Mein Großvater starb, ohne die Weltreise gemacht zu haben, und hinterließ mir ein paar Bücher: Paustowskis »Erzählungen vom Leben« und Saint-Exupérys »Wind, Sand und Sterne«. Ich stieß bei meiner erneuten Lektüre auf Patagonien, und sofort war wieder die Neugier geweckt, und ich erinnerte mich an die Vorstellung meiner Kindertage, als das ›Ende der Welt‹ ein Talschluss in Kärnten gewesen war. Und ich auf einer Schotterstraße an der Hand meines Großvaters gewandert war und die Welt in Anfänge und Enden eingeteilt hatte. Der Anfang war natürlich das Haus und der Garten meiner Großeltern gewesen, und das Ende lag zwischen den blauen Gipfeln, welche das Tal umgaben. Später erschien das Buch »In Patagonien« von Bruce Chatwin, das mich in der Vorstellung bestärkte, dass es dieses ›Ende der Welt‹, das Patagonien offenbar darstellte, tatsächlich gab. Es lohnte sich, dorthin zu fahren und davon zu erzählen. Meine Neugier, meine Sehnsucht war erst dann gestillt, wenn ich selbst dort war und selbst von allem erzählen konnte.
Ich fand Walter, den freundlichen Reisegefährten, der Lust hatte mitzufahren und der mir mit seinen guten Spanischkenntnissen zur Seite stand.
Zwischen Tango und San Telmo
Unsere Reise begann in Buenos Aires – im Büro des staatlichen Nationalparks. Ein weißhaariger Mann mit beweglichen hellen Augen breitete Karten vor uns aus und zeigte, wo die Nationalparks lagen. Valdés, Punta Tombo, Los Glaciares weiter im Süden, die Magellanstraße und Feuerland. Aus einer Schublade zog er einige Merkblätter hervor, die weniger für Touristen als für Mitarbeiter oder Forscher gedacht waren. Zwischen den Blättern fischte er nach einem Bleistift und zeichnete Schraffuren dorthin, wo es sich seiner Meinung nach lohnen könnte: lobos (Seehunde), pingüinos (die im Winter jedoch die Küste verließen), elephantos marinos (die er auch senores nannte) und ballenas (Wale) – vielleicht beim Liebesspiel. Er zwinkerte uns zu.
Immer, wenn jemand den Raum betrat, stand er auf, begrüßte ihn mit einer Umarmung und klopfte ihm kräftig auf den Rücken. Mit der Zeit füllte sich der Raum, und das laute Rückenklopfen dröhnte in meinen Ohren. Es waren Freiwillige, die sich bei ihm versammelten. Junge Männer mit traurigen Augen und dichten schwarzen Bärten. Er stellte einige mit Vornamen vor: Julio, Elias, Raimundo und Hector. Ihre ›profession‹, wie der Weißhaarige uns auf Englisch erklärte, hatte mit romantischer Naturverbundenheit wenig zu tun. Oft mussten sie monatelang allein in Feldhütten oder feuchten Zelten leben. Das hielten nicht alle aus. Manche wurden ›loco, crazy‹, wie er sagte.
Ein junger Mann drehte sich zu mir um. Seinen Bart trug er gestutzt, die dunklen Augen hatten die Farbe von Basalt, und er sah mich an, als hätte er eine Überraschung für mich. Er sprach deutsch, anfangs leise und ein wenig zögernd, so dass ich genau hinhören musste, zumal der Weißhaarige nicht aufhörte, lautstark auf weitere Rücken zu klopfen. Der junge Mann lächelte beim Sprechen.
In Clausthal-Zellerfeld im Harz habe er studiert, sagte er, und sein Lächeln blieb, als er vom Brocken sprach und der Wanderung, die er mit deutschen Freunden dort hinauf gemacht habe – kurz nach dem Fall der Mauer.
»Wir waren die Ersten, die das militärische Sperrgebiet betreten durften: Unterstände und Bunker mit Antennen und Radaranlagen. Als ob jeden Moment der Krieg losgehen könnte. Zwei Soldaten haben uns herumgeführt und uns alles gezeigt.« Dann wurden seine Augen schmal, sein Lächeln verschwand, und er rief: »Aber das Waldsterben!« Jeder im Raum verstand das Wort, und alle waren still. Ich rührte mich nicht vom Fleck und sah an seinem Gesicht vorbei auf die kahle Wand.
»Ich war noch nicht auf dem Brocken und im Harz auch nicht«, sagte ich wie zur Entschuldigung. Aber unangenehm war es mir schon. Ich hatte den Eindruck, er wollte mir sagen, wie unachtsam man bei uns mit dem Wald umging, ganz anders als hier im Umkreis des Nationalparks.
Die Karten und Blätter steckten wir ein und verabschiedeten uns. Der junge Mann rief noch auf Deutsch: »Tschüß – und Hals- und Beinbruch.«
Draußen die Riesenstadt. Das Schachbrettmuster, nach dem sie angelegt ist, erzeugt eine Art Labyrinth aus stets gleichartig wirkenden Kreuzungen und Straßenzügen. Ich ging die langen Avenidas hinauf und hinab und betrat die Straßen, wenn mir Fußgänger entgegenkamen, denn die Trottoirs waren schmal und oft mit zerbrochenen Platten bedeckt. Am Abend brannten die Fußsohlen von den langen Märschen durch die Straßen. Das kühle Winterlicht dämpfte die Schatten, Staub und Dieselgestank waren in der Luft. Die Portenos, die Bewohner von Buenos Aires, trugen dicke Schals und altmodische Hüte. Sie flanierten nicht, sie hasteten durch die Straßen. Hier im Zentrum, nicht weit von der Plaza de Mayo entfernt, glich die Stadt Paris oder Rom. Chatwin fand sogar Ähnlichkeiten mit Moskau, aber schon die Lage am Meer zeigt den Unterschied. Die Straßen führen vom Ufer hügelaufwärts, und die Stadt scheint wie mit dem Rücken zum Meer gebaut. Eng stehen die Hochhäuser, es gibt Straßenschluchten wie in New York. Den Hochhäusern fehlt aber der New Yorker Glas- und Geldglanz, viele sind grau und alt, vor vierzig oder fünfzig Jahren gebaut und nie renoviert worden, Taubendreck türmt sich auf den Simsen.
Aber hier? War das nicht der Boul’ Mich, wenigstens eine Ecke davon, oder dort, die Rue de Rivoli? Und diese breite Prachtstraße, Avenida 9 de Julio, woran erinnert sie, an welche Aufmarsch-Avenue, Champs-Elysée oder Roter Platz? Und doch ist wieder alles ganz anders.
Don Quijote wurde ein Denkmal errichtet, und ein Stadtviertel heißt Palermo, es gibt den Englischen Uhrenturm, aber auch die Straßen Tucúman, Bolivar, Maipú und Cochabamba. Eine Stadt aus spanischen, italienischen, englischen und lateinamerikanischen Versatzstücken. Eine Stadt wie aus der Erinnerung an Europa in den Steppensand der Pampa gesetzt.
In der Calle Florida, einer Fußgängerpassage im Herzen der Stadt, tippte mir jemand auf die Schulter. Ich drehte mich um, und ein älterer Herr mit Baskenmütze und einem schwarz-roten Schal grüßte mich. Er lächelte, als würden wir uns kennen. Ich nickte zurück, gerade wie zu einem Nachbarn. Später entdeckte ich ihn, als er sich die schwarzen Lederschuhe von einem Schuhputzer wienern ließ. Aber da war ich Luft für ihn.
In einem Straßencafé im Tangoviertel La Boca deutete der Wirt auf das Bild von König Juan Carlos, das über der Theke hing und sagte: »Ich bin Spanier.« Dabei hatte er zuvor erzählt, dass er aus dem Süden in die Stadt gekommen war und hier schon über vierzig Jahre lebte. Bei dem Wort Patagonien zog er die Schultern hoch.




























