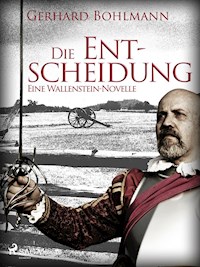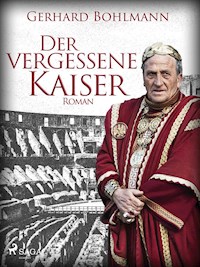
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Farbiger historischer Roman über Kaiser Diokletian. Diokletian stammte aus einfachsten Verhältnissen und hatte sich in der Armee bis zum Befehlshaber der Prätorianer-Garde hochgedient, die ihn 284 zum römischen Kaiser ausrief. Mit Entschlossenheit und Tatkraft konnte er weitreichende Reformen durchsetzen, rund 20 Jahre lang die Grenzen des aus den Fugen geratenen Reichs sichern und Usurpatoren niederschlagen. Im Jahr 303 leitete Diokletian die letzte und brutalste Welle der römischen Christenverfolgung ein. Aber der Kampf mit gefährlichen Rivalen im eigenen Lager blieb ihm nicht erspart.Gerhard Bohlmann (1878–1944) war ein deutscher Schriftsteller und Journalist. Er war der Sohn des Direktors der Königsberger Union-Giesserei, studierte in Berlin und Königsberg Philologie und Germanistik. Nach Ende des Krieges arbeitete er zunächst als Feuilleton-Redakteur bei der Königsberger Allgemeinen Zeitung. 1924 ging er von Königsberg nach Berlin zur Telegraphen-Union. Später arbeitete er bis zu seinem Tod 1944 beim Deutschen Nachrichtenbüro. Bohlmann verfasste seinen ersten Roman erst mit über 50 Jahren. In seinen Büchern wandte er sich vor allem historischen Themen zu – vom Frühmittelalter (Der vergessene Kaiser) bis zum Dreißigjährigen Krieg (Wallenstein ringt um das Reich). -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Bohlmann
Der vergessene Kaiser
Roman
Saga
Für Waldemar Bonsels
I.
Der römische Rand
Die römischen Heere hatten sich in der Ebene von Alexandria an der ägyptischen Küste versammelt. Dort erstreckten sich ihre drei Lager durch die gelbe Wüste, mächtige Rechtecke mit Toren, Wachttürmen und Wällen, in denen sich die Zeltgassen aus weisser Leinwand hinzogen. Es kamen die letzten Tage des Hochsommers, der Boden war eingeglüht, aus wolkenlosem Blau wölbte sich heiss der Himmel, eine gläserne Kuppel, unter der die Luft brütete, und es gab die kochenden afrikanischen Nächte auf brennendem Sand und unter Sternen, die in ihrem Feuer zerschmelzen wollten.
Aber über den Lagern erhob sich das Kastell des Kaisers Carus, in dem er mit der Leibwache der Prätorianer hauste; sie hatten sich auf den Dünen befestigt und eingerichtet, dort waren die Wälle angeschüttet, dort hatten sie die Türme mit polierten Eisenplatten gesichert, in denen die Sonne gleisste, und auf den Plattformen standen immer die Posten, spähten in die drei Lager hinab, und jeder hatte die kupferne Tuba neben sich, als halte er sich stets bereit, die Prätorianer zum Überfall auf die Legionen aufzurufen: von solchen Vorkehrungen kam eine dunkle Erregung unter den Soldaten auf. Dazu wurde die Haltung des Kaisers und seiner Wache täglich feindseliger; die auf der Düne hatten aus Alexandria Torflügel aus dicken Bohlen angefahren und sie im Angesicht des Heeres mit Bronze beschlagen: auch dieses Metall stach den Legionären giftig in die Augen, und ihre Empörung wuchs.
In den letzten Tagen öffneten die Kaiserlichen die Tore nicht mehr. Eingeschlossen verharrten sie in ihrer Hochburg über den Lagern, hielten Wache und hatten die Tuba bereit: da begann unten der Aufruhr zu gären. In den Zeltgassen sammelten sich die Soldaten und deuteten zornig gegen das Kastell hinauf, haufenweis zogen sie vor die Tore und riefen zu den Posten auf Türmen und Wällen empor: was bedeutet er, dieser trotzige und feindliche Abschluss der Prätorianer gegen die Hauptmacht des Heeres? Was werde da hinter verschlossenen Türen ausgebrütet? Wollten die Kaiserlichen allein über die Zukunft des römischen Reichs bestimmen? Das ist noch niemals geschehen, das wird das Heer nicht dulden, die Legionen werden die Prätorianer überrennen! So riefen sie hinauf, hämmerten an den Bronzeflügeln und schlugen sich die Fäuste wund, sie tobten und heulten — droben aber blieben die Wachen gleichgültig und blickten auf die Haufen hinunter. Starr stand die Burg auf den Dünen, funkelnd schnitten sich ihre Türme in das heisse Blau des Himmels, und in den Nächten lohten auf den Plattformen die Fackeln steil himmelan, wie die feierlichen Leuchten über einem grossen Sarkophag.
Also durfte sich das Heer empören, denn seit dem Selbstmord des rothaarigen Nero beherrschten die Legionen das Reich. Nicht mehr wurde das Geschick des Staates in den grossen Städten entschieden; in einem Lager, am Rhein, an der Donau oder in Asien, wurden die Kaiser ausgerufen, die Günstlinge der Soldaten, und in einer andern Zeltgasse, in Persien oder in Italien, wurden sie erschlagen und verscharrt, aber immer war das Rechteck des römischen Lagers Thron und Tod der Kaiser gewesen, und darum fühlten sich die Legionäre als Herren der Welt: das war Recht und Gesetz geworden. Aber was sollte sich jetzt in der Ebene von Alexandria ereignen? Sie fühlten ihre Allmacht bedroht, hart lag die Hochburg des Kaisers Carus über ihnen, und wenn auf ihren vier Türmen vor dem nächtlichen Himmel die steilen Fackeln brannten, erglühten die eisernen Zinnen des Kastells, die Rüstungen der Wächter wurden rot überloht, und die Kronen der Wälle schimmerten: so leuchtete das Kastell über den Soldaten der Tiefe.
An einem grellen Morgen — noch nie hatte die Wüste dieses stechende Flimmern gehabt — waren an den Toren der drei Lager von Unbekannten Pergamente mit schwarzer und roter Schrift angeheftet, die abgelöst und durch die Zeltreihen getragen wurden. Die Legionsschreiber deuteten die Worte. Das sind, sagten sie, die sechsunddreissig Namen der Kaiser, die das Reich seit Augustus verbraucht hat. Sechsunddreissig Kaiser in zweihundertachtzig Jahren: welch ein fressendes Tier ist das Reich geworden! Sie erhoben die Stimme: Seht die roten Namen, das sind die Kaiser, die ermordet wurden, es sind fünfundzwanzig; vergleicht damit die schwarzen, es bleiben nur elf, die in ihren Betten sterben durften: so verderblich ist’s, Kaiser des Reichs zu werden, überlegt das, Soldaten! Sie schwenkten die Blätter und hoben sie hoch: Seht weiter, hier steht als letzter Name mit roter Tinte der Kaiser Carus!
Starr standen die Legionäre. Sie liebten den alten Carus nicht, den weichherzigen und gutmütigen Narren, aber sie hassten die Prätorianer, die Eigenmächtigen, die dem Gericht des Heeres vorgegriffen hatten, und mit einem Aufschrei, der die Ebene erfüllte, wollte der Aufstand ausbrechen: da erhoben die Wächter auf der Hochburg die Tuben, ihr Kupfer klirrte und klang, schon waren die Wälle des Kastells von den Prätorianern besetzt, knarrend flogen die Tore auf, und heraus stampften die Züge der Elefanten und entwickelten sich in breiter Front über dem Hang der Dünen zur Schlacht; sie hatten die Stachelkränze um die Füsse geschnallt, sie trugen die silbernen Schabracken aus Panzermaschen, und auf ihren Rücken schwankten die stählernen Schlachttürme, und alles funkelte, floss und flog hinter der flimmernden Glut des Tages — dennoch erkannte man unter dem Dach Tiburs, des grössten Elefanten, das kupferfarbene Gesicht des Prätorianerführers Diokles; mit gekreuzten Beinen sass er im Schatten des Turms, hatte die Lanze aufs Knie gestemmt, das blanke Schwert über die Schenkel gelegt, und vom Helm floss der rote Straussenfedernschweif über den gelben Panzer wie ein Strom Blut: diese Erscheinung ernüchterte die Legionen und dämpfte.
Die Elefanten waren wieder abgerückt, und die Tore des Kastells hatten sich geschlossen, da ging der Name des Prätorianerführers noch immer unter den Soldaten um. Diokles war etwa vierzig Jahre alt damals, aber schon wurde seine Gestalt von Gerüchten verdunkelt, schon kannte man seine Herkunft kaum noch, aus so trüben Tiefen war er aufgestiegen; er sei, sagte man, Sohn eines dalmatinischen Fischers oder Piraten, mit zwanzig Jahren nach Rom gekommen und zu den Gladiatoren gegangen, und dort mochte er die übliche Ausbildung erlitten haben; sie hatten ihm die Haut mit Ruten gestriemt, um sein Fell zu härten, und Bohnenbrei eingeflösst, der Blut bildet, denn der Pöbel will Blut sehen: so war er in den Arenen aufgetreten, der johlenden Menge ein starkes Schaustück und in den Betten vornehmer Weiber ein kräftiger Renner. Vielleicht hatte ihn eine von denen zu den Prätorianern gebracht, die er jetzt seit zehn Jahren führte — dieser Diokles, lachten die Soldaten sich an, welch ein Schurke ist das, aber sie hatten in ihren Herzen die heimliche Ehrfurcht vor diesem Mann des Glücks und des Erfolgs. Fünf Kaiser waren in diesen zehn Jahren gekommen und beseitigt worden; jetzt schien es den Soldaten, als habe Diokles selbst gegen alle das Eisen geschwungen. Er konnte Kaiser machen und verschwinden lassen, er allein besass die höchste Macht dieser Welt.
Aber was war aus ihm selbst in diesen zehn Jahren geworden: manche Soldaten kannten ihn noch aus der Zeit, als er zu den Prätorianern gekommen war, damals schon ein Mann von mächtigem Körper und unter den kleinen Römern ein breitschultriger Riese. Damals hatte er noch den offenen Blick seiner grossen braunen Augen, das unbekümmerte Lachen mit prallen roten Lippen und weissen Zähnen, und er trug damals noch das volle schwarze Haupthaar, eine dichte Mähne, die ihm der Wind um den Kopf wehte. Aber bald nach seinem Eintritt in die Prätorianertruppe verwandelte er sich. Er liess die Mähne schneiden, und seitdem schimmerte sein runder Schädel von glattrasiertem Haar bläulich, und zugleich erschienen die Zeichen dieses Kopfes schärfer, die leicht gewölbte Stirn prägte sich eckiger über den starken Strichen der Brauen aus, stumpfer und wie abgerissen erschien die Nase, das Kinn offenbarte seine Härte, und auf dem freigelegten Nacken wurden die schwellenden Muskeln des Ringkämpfers sichtbar. Damals auch verlor er das gute offene Auge, die Lider senkten sich, und er beobachtete unter seinen langen Wimpern hervor, ein spähendes Blinzeln voll Abschätzung oder Verachtung, das bisweilen vor Argwohn stechend wurde. Wie gemeisselt wurde da dieser Kopf, die gebräunte Haut straffte und spannte sich über den harten Backenknochen, wo sie kupferrot anfgebrannt war; das Gesicht des Diokles war eine Maske aus getriebenem Erz geworden.
Und so wirkt dieser Mensch fortan überall: wenn er in eine Stube der Prätorianerkaserne tritt, ist es, als verdunkele er das Licht, so ganz füllt er den Raum aus; an den Schenktischen verstummen die Gespräche, wenn er sich dazusetzt; wo Diokles ins Zelt kommt, ist nur er allein da; immer fliessen Schatten von ihm ab und trüben die Luft, er geht in einem Schein von Grauen, das ist die Witterung, die ihn umgibt. — Er hat in diesen zehn Jahren die Prätorianer zu einem ehernen Block im Gewoge der Legionen geschmiedet, er selbst ist darüber noch unzugänglicher und unsichtbarer geworden, er tritt nicht mehr hervor, die Front der Prätorianer verdeckt ihn, aber manchmal scheint man seine Wirkung zu spüren: die Tatze des Diokles, sagen die Soldaten dann.
Jetzt wollten sie es alle gewusst haben: der da über ihnen lag im Dünenkastell und das Heer bewachte, war nicht der Kaiser Carus, der gutherzige Narr — Diokles war es, er hatte die Legionen hier vereinigt, er hatte den Kaiser in dieser Hochburg festgesetzt und hinter ihren erzenen Toren sass er in seiner Wolke und düsterte aus trägen Lidern vor sich hin. Da waren nun die Verzeichnisse der römischen Kaiser erschienen, auf denen als letzter Kaiser Carus mit roter Tinte eingetragen war, und jetzt überstürzten sich die Rufe und Fragen in den Zelten: Diokles zeigt uns den Tod des Kaisers an, er hat ihn ermordet, wer ist der nächste, was wird geschehen? — Die Erregung der Soldaten brauste und brandete die Dünen hinauf. Droben gleissten die Eisenplatten der Türme, auf deren Plattformen die Wächter standen, über ihren gelben Helmen flammten die roten Rosshaarschweife, und die schlanken Röhren der Tuben blinkten im grellen Licht.
Am Nachmittag kamen schwere Wolken das Niltal herauf und schoben hinter Alexandria bis zum Zenit eine dunkle Mauer hoch, unter der die Kuppeldächer und Türme der Stadt in bläulicher Fahlheit sich duckten, da ritt eine Prätorianerabteilung durch die Lager, ihr Trompeter stiess klirrend in die Posaune und verkündete, dass der Kaiser Carus die Präfekten seiner Heere zum Empfang befehle — und neue Erregung kam in den Lagern auf: war denn der Kaiser nicht ermordet worden, lebte er noch? Die Präfekten lächelten, als sie sich zum Aufbruch versammelten: o wie kannten sie die Posse, die schlaffen Glieder der toten Führer auf Sesseln festzubinden und sie den empörten Truppen vorbeizutragen, aber dieses lächerliche Spiel verfing nun nicht mehr.
So wurden sie ins Prätorianerkastell gelassen, schritten zwischen einem Spalier von Soldaten hindurch und hatten vor dem Zelt des Kaisers zu warten. Tiefer hatten sich die Wolken am Himmel verschwärzt, aus ihrer Mauer fuhren die ersten Blitze, kreidig und grell zuckten die Häuser von Alexandria auf, die Donner murrten über die Ebene, und der Raum war von bleiernem Licht erfüllt: da wurde der Vorhang des kaiserlichen Zeltes zurückgerissen, und der Kaiser stand da.
Er war es und er schien noch zu leben, und wie auch die Präfekten nach den Drähten suchten, in denen er hing, sie fanden nichts, dieser Mensch stand frei da, er hatte das zackige Diadem aufgesetzt, und das Goldbrokat des Kaisermantels umgab ihn wie eine Glocke steif, aber im bleiernen Schein dieser Gewitterstunde hatte das verbrauchte Greisengesicht mit der gefälteten Haut das Abgestorbene und Elende eines Leichnams. Dennoch zuckten die verfallenen Lippen über den zahnlosen Kiefern, in tiefen Höhlen irrten die müden Augen hilflos umher und flackerten ängstlich. Da ein Blitz niederfuhr, bebte die Erscheinung vor der Blendung zurück und zuckte unter dem Donner zusammen; starr standen die Präfekten. Dieser Mensch war aufgestanden von den Toten. Aber dann bewegte er sich und schleppte sich vorwärts Schritt um Schritt, und seine Sandalen schleiften im Sand, er bewegte sich an der Reihe der Präfekten entlang und hielt vor einigen an: „Mein guter Aurelius“, murmelte er, „alter Freund.“ Oder: „Gajus Valerius, tüchtiger Führer, ich weiss.“ Aber er wusste nichts mehr, er verwechselte die Namen, seine Stimme war ein Lallen geworden und seine Haltung so schwankend und plump, als seien ihm unter dem Mantel die Arme an den Leib geschnürt, und dann das Flehen und Flackern seiner Augen, und dazu das Grollen der Lüfte und die blendenden Blitze —
Der Kaiser Carus schob sich rückwärts und stand wieder im Eingang des Zelts, er richtete sich auf, heiser und brüchig rief er es noch hinaus: „Meine Freunde, ich soll abdanken — Diokles — die Prätorianer — helft!“ Zwei Hände griffen da aus dem Dunkel des Zeltes auf seine Schultern und zogen ihn rückwärts, klirrend flog der Vorhang zu, und unter einem Ausbruch des Donners lachte eine Stimme schneidend auf: „Das ist der Herr des römischen Reiches!“
Unentschlossen zerstreuten sich die Präfekten im Lager, und man liess sie gehen, aber überall warteten ihrer die Posten mit gelockerten Schwertern und auf die Lanzen gestützt, wie durch feindliches Volk gingen sie hin. Sie suchten nach Diokles, er blieb wieder unsichtbar, und als einige vor sein Zelt kamen, standen auch da die Wachen, und unter dem Sonnensegel des Eingangs hockte der Diener Markus in schwarzem Kittel, ein verdrossener Gesell mit brandigem Schopf und dem bleichen Sommersprossengesicht der Rothaarigen, und seine grossen Augen hatten den schleimigen Ausdruck eines Fischs; mürrisch sah er zu den Gästen anf und knackte Nüsse mit seinem Gebiss. Als sie ihn heranwinkten, erhob er sich endlich und kam abseits mit, er liess sich Denare in die Hände drücken und ausfragen, aber dann näselte er missmutig: „Ich weiss es nicht, beim heiligen Kreuz, ich weiss nichts, aber die Götter werden es gewiss wohl machen.“
Nach den toten Tagen brach wieder das Meer auf; als gegen Abend von Westen der heisse Wind kam, der sich an der Wüste erwärmt hatte, liefen Schauder über das Wasser und kräuselten es auf, bald begann die Brandung und rollte gegen den Sandstrand, unter der Dunkelheit wogte sie bleifarben, und der Gischt schäumte trüb auf: da legte die schnelle Galeere an dem Landungssteg an, den die Prätorianer hinter der Düne ins Meer gebaut hatten, ein Bote lief den Hang hinauf und verschwand im Zelt des Diokles.
Stärker wehte von Westen der Wind in der Stunde der Dämmerung, schon stöberte er die ersten Sandwolken auf, er kam von weit her und fegte abgerissene Blätter und Dornen mit sich; die Schakale kläfften, über Alexandria knatterten die Wolken, dann pfiff der Sturm an den Zeltpflöcken und umheulte die Wachttürme, und aus der fallenden Dunkelheit rollten die Sandtromben heran, brachen sich an den Lagerwällen und stürzten trommelnd über die Leinwand der Zelte; da entzündeten die Wächter in der Höhe die Fackeln, die sogleich ostwärts geweht wurden; da trat Diokles aus seinem Zelt, und die Prätorianer blickten ihm nach, wie er dahinging, einsam durch die Lagergassen, nur mit dem rotwollenen Unterwams bekleidet, und die Riemen seiner Sandalen verschmolzen im Braun seiner Haut: so schritt er durch das Küstentor und stieg durch die Dünentäler zum Strand nieder. Er blickte sich um.
Im Osten stand noch immer die Mauer einer verzweifelten Schwärze, im Westen war die Sonne im Sinken und glühte hinter Wolkenbänken noch einmal auf, und zu seinen Häupten trieb ein Hauf weisser Wolken, vom Gewitter gejagt, dem Untergang zu, und Diokles verfolgte seinen Weg: das Gewölk glich einer Schar fliehender Gestalten in wehenden Togen — das waren die Götter, die ausgestossenen Götter einer alten Zeit, sie flüchteten aus der Welt, und aus ihren wallenden Mänteln kam noch ein letztes Licht in die Dämmerung; so zogen sie nach Westen hin, wo ihre Gewänder vor rotem Licht verwehten, und in breitem Strom floss das Blut der Götter ins Meer — Nacht.
Nacht ohne Glauben und ohne Gott. Diokles blickte ostwärts, wo Jerusalem und Golgatha lagen — auch dort Dunkel ohn’ Ende: die Schuld des feigen Juden Jesus war das. „Dir war’s noch einmal gegeben“, murmelte Diokles, „in der Welt das Reich aufzurichten, nach dem die Menschheit sich sehnt, und deine Stunde war da, als das Volk dir Palmen streute, aber da erschrakst du vor dir und hast vor Pilatus gestammelt: ‚Mein Reich ist nicht von dieser Welt‘. Du hast deine Stunde versäumt, Nazarener. Ich werd’ sie ergreifen.“
Er warf sich auf den heissen Sand und barg den Kopf im Arm; der Wind fuhr über ihn hin, und die Spritzer der Brandung fielen über seine nackten Beine, er spürte nichts, er hatte die Augen geschlossen und schaute.
Der Bote, der am Abend mit der Galeere kam, brachte die Nachricht vom Aufstand der Bagauden, der gallischen Bauern, die sich gegen erpresserische Beamte und Pächter empört hatten. Nun durchstreiften sie das Land und verwüsteten, und sie hatten wieder die Insel am Zusammenfluss von Marne und Seine befestigt, dort brannten in dieser Nacht die Dörfer, und unter ihrem Schein färbte die Seine sich rot und rot die Marne; die Glut ergriff auch die Rhone, sie lag da, eine feurige Schlange, und spie einen feurigen Schwall in das dunkle Wasser des Mittelmeers; unter der nächtlichen Wölbung brannten die Küsten Galliens und Britanniens, dort landeten die nordischen Piraten und zogen landeinwärts, und die Fackeln angesteckter Gehöfte erleuchteten ihre Strasse rot; aber die Rhone wand sich und gurgelte Blut, das trieb in öligen Schichten gen Korsika und gärte an seiner Küste und entzündete sich dort, es wälzte sich weiter an Sardinien hin, auch dort zischte es auf und wütete: die Inseln brannten. Höher schwillt nun die Glut unter der Kuppel der Nacht und rötet die Gletscher der Alpen, die glühen und werfen ihren Schein über die nördliche Welt: am römischen Ufer des Rheins, am linken, qualmen die Lagerfeuer der feindlichen Franken; Germanen berennen den römischen Grenzwall; auf seiner Brüstung stehen in dieser Nacht die Legionäre und stossen ihnen brennende Fackeln in die Gesichter; Markomannen brechen aus den Wäldern der Donau und überschreiten den Strom auf Flössen, und auf jedem qualmen die Kienbrände, der gerötete Fluss stürzt ins Schwarze Meer, das loht auf; vom Schwarzen Meer bis zum Kaspischen türmen sich die armenischen Berge, auch ihre Schroffen erglühen von den Feuern des persischen Aufstandes; es brausen die Städte in dieser Nacht, Redner stehen auf und hetzen gegen das Reich, durch die maurische Wüste ziehen Reiter, auf ihren Burnussen liegt die Röte vom Brand der Welt, es brennt der römische Rand um das Mittelmeer lichterloh. Rot ragt die Akropolis über Athen, rot der Tarpejische Fels über Rom im Westen, im Osten die Tempel über Pergamon und im Süden die Trümmer Karthagos rot, die riesigen Leuchttürme dieser Nacht, und ihre Feuer kreisen; sie stöbern giftig zwischen den Säulen der Paläste, sie stechen durch die Fenster der Katen und stossen zerrissene Träume in verstörten Schlaf, Millionen winden sich in dieser Nacht in Angst vor dem nächsten Tag, Millionen stöhnen in Kissen und Stroh. Die Leuchtfeuer kreisen, sie durchschneiden die Säle der Bibliotheken und fahren über die Reihen der Bücher, da schwelt’s in den Pergamenten, schon züngeln die Flammen, da brennen die Schriften, und ihre Scheiterhaufen sprengen die Hallen, dass sie zerbersten, befreit lodern sie nun zur Nacht empor. Was die Weisen lehrten, die Forscher schrieben, die Verse der Dichter, die Regeln des Rechts, die Gesetze der Sitte, alles ein Brand, alles stäubende Funken, ein Wirbel von Asche und Schutt — nichts.
Von einer Berührung erwachte Diokles, eine Hand hatte sich auf seine Schulter gelegt, und als er auffuhr und verworren sich umsah, sass neben ihm im Sande ein weissgekleideter Mann. Aus der nächtlichen Dämmerung kam ein bärtiges Gesicht an das seine, und eine Stimme fragte: „Du leidest, Soldat? Kann ich dir helfen? Ich bin Legionsarzt. Es war mir, als hörte ich Keuchen und schweren Atem, und als ich dem nachging, fand ich dich, wie du unter einem quälenden Traum lagst.“
Sie erhoben sich und sahen einander an, und Diokles fand hinter dem dunklen Bart ein Gesicht, dessen Bleiche aus der Dunkelheit schimmerte, und die Augen schienen von einem grossen innerlichen Leuchten auch in dieser Stunde strahlend, und diesem begeisterten Blick antwortete er: „Quälend. Du sagst es, Arzt. Aber es ist Wirklichkeit und kein Traum. Ich sah den Brand des Reichs.“ Sogleich wurde das Gesicht finster: „Das Brennende soll man brennen lassen, Hauptmann oder was du bist, damit der Brand in sich erlösche und der ewige Atem aus der heissen Asche das neue Dasein erwecke. Aber da gebärden sich die Legionen in den Lagern gross, sie schreien wieder ein neues Reich aus und beraten den nächsten Kaiser schon, während der alte noch lebt — vor diesen Toren kam ich hier ans Meer hinab. Was dünken sich diese Soldaten und was bedeuten sie vor der Ewigkeit? Übergang eines Augenblicks!“ Diokles verweilte noch: „Wie soll das Reich werden, wenn nicht durch das Mühen der Menschen?“ und ging an dem Arzt vorbei, der ihm mit einer leuchtenden Stimme nachrief: „Das Reich naht niemals, es ist die ewige Verheissung, die Gott den Menschen gesetzt hat, dass sie nach ihm streben durch alle Zeit hin!“
Aber Diokles hörte ihn nicht mehr, er stieg die Dünen hinan, wo ihn sogleich der Wind angriff, im Gefält seines roten Wamses knatterte und ihm die Haut mit Sandkörnern peitschte. Dann kam er ins Kastell und ging in die Lagergassen: jetzt hatte sich der Sturm bis zu der Höhe der Dünen erhoben, immer wieder rollte er aus der Wüste die Sandsäulen her, die zischend aus der Nacht anstoben, an den Wällen sich brachen und über dem Kastell zusammenstürzten; das Lager wachte, aus den Zelten schimmerten Lichter, und dazwischen wandelten schattenhaft, in ihre Mäntel vermummt, die Posten; aber die Elefanten im Kral fühlten sich als die Herren der Nacht, an ihren Pflöcken stampften sie und rasselten mit den Ketten, sie schwangen die Rüssel und trompeteten jauchzend. Über Alexandria verflammten die letzten Blitze, die Nacht war mit Staub erfüllt, aber es schien, als habe sich die Wolkenwand von der Stadt aus über den ganzen Himmel gestülpt. Lauter Dunkel und Raum. Nacht ohne Gott und Gestirn.
Als Diokles in sein Zelt trat, erwarteten ihn zwei Prätorianerführer, die einzigen näheren Menschen, die er besass. Den kleinen feingliedrigen Constantius hatten die Soldaten Chlorus getauft, den Bleichen, weil er blond war und seine empfindliche Haut sich rötete, ohne braun zu werden; er trug das helle Haar gekräuselt, schliff die Fingernägel mit seltsamen Steinen, bis sie glänzten, und sollte in seinem Gepäck Bücher mit sich führen. Er war einer von den wenigen adligen Römern im Heer, galt als verschlossen und stolz, und wenn er die Soldaten von seinem Zelt weisen liess, sagten sie: er hat sich abgeriegelt und studiert. — Den andern, Maximinian, hiessen die Legionäre den Mischling, denn er hatte vom Neger die drahtige Perücke aus kurzen Locken, auf der Haut den gelblichen Schein und die wulstig aufgeworfenen Lippen, und in seinen Augen schimmerte dumpf eine tierische Demut, aber dem widersetzte sich seine aufbrausende und jähzornige Art; denn da er nun der Vertraute des grossen Diokles geworden war — „der grosse Diokles“, rief er immer und prahlte mit ihm — litt er noch jetzt unter seiner armseligen Herkunft, überall witterte er Nichtachtung und entlud dann seinen Argwohn in Ausbrüchen des Jähzorns.
In schweigsamer Erwartung standen sie im Zelt, das vom Licht einer flackernden Ampel trübe durchzuckt wurde. Unter der Leinwand befand sich nur das Lager des Diokles, ein mit Leinwand überspanntes Gestell, auf dem Decken lagen. Constantius Chlorus trug sich adlig, über seinem Goldpanzer hielt er den roten Samtmantel sorgsam gefaltet, aber Maximinian hatte um sein zerhauenes Lederkoller das schwarze Soldatenmäntelchen der Legionäre geworfen, das fettig und voller Flecken war; der Mischling verbreitete immer einen Dunst von Schenken und Knoblauch um sich.
Als Diokles ins Zelt trat, setzte er sich auf sein Bett und faltete zwischen den braunen Knien die Hände. „Den Rufus“, sagte er leise, „holt ihn.“ Chlorus atmete schwer auf; Maximinian knurrte zufrieden, ein gesättigtes Tier.
Der Gepäckknecht Rufus kam, ein vierschrötiger Kerl, auf seinem kurzen Halse sass das Gesicht des Verderbten. Über die freche Fratze war ein Messer gefahren, hatte die Braue gespalten und ein Auge geschlossen, die stumpfe Nase schräg aufgerissen und ihm die Backe mit einem roten Strich gezeichnet.
Diokles sah ihn nicht an, träge blinzelte er auf seine Hände nieder. „Das Besprochene“, flüsterte er endlich, „tu es nun.“ Der Knecht lockerte sein Schwert, ein gestohlenes kostbares Stück — der Elfenbeingriff war mit dicken Golddrähten umschnürt — stiess es zurück, drehte sich auf dem Absatz und ging hinaus.
Diokles, in unveränderter Haltung, rang zwischen seinen Knien die nervigen Finger ineinander, dass sie knackten, reglos standen die Führer am Eingang, es schlich die Zeit. Endlich fuhr Maximinian auf: „Warum schweigt ihr so stark, he? Was ist schon dabei, wenn ein Kaiser stirbt? Wer wird schweigen, wenn ich einmal falle? Ist der Alte denn mehr als wir? Die Kaiser haben damit zu rechnen — soll er’s erfahren!“
Draussen dauerte der Sturm an, immer wieder jagten die Sandsäulen heran, immer wieder stürzten sie über den Wällen zusammen und rollten prasselnd an den Zeltdächern ab.
Constantius Chlorus hob lauschend die Hand: „Hört, wie das trommelt und stürzt. Wir halten das Ohr an die Riesensanduhr des Geschehens. In diesen Augenblicken der rinnenden Körner fällt ein Kaiser. Ein Tor schlägt zu.“
Krampfhaft hielt Diokles die Hände gefaltet: „Aber morgen werden auch diese Körner unter den zahllosen liegen, und du wirst sie nicht mehr erkennen. Der Schwall dieses Sandes wird nicht gezeichnet, er wird sich nicht röten. Zeit ist nichts, wie wir sie erfüllen, ist alles.“
Draussen knirschten Schritte im Sand, der Vorhang flog auf, Rufus trat ein; er warf die leere Scheide in die Mitte: „Da.“ Seine Brust flog, sein Atem ging keuchend: „Der wird nicht mehr schaden — nur sein Gesicht tut noch was — er hat die Lippen verzogen — er hat im Oberkiefer noch einen Zahn — den streckt er heraus, er lacht uns aus!“ Träge blinzelte Diokles auf seine gefalteten Hände.
„Das ist soweit“, fuhr der Knecht ruhiger fort, „und da es nun soweit ist: dieser Carus, etwas war er doch wohl noch wert — eine Statthalterschaft, denk’ ich —“ Unsicher sah er sich um.
Diokles stand auf, ein schwarzes Tuch flog durch die Luft und fiel dem Knecht über den Kopf, Maximinian hatte ihm seinen Mantel übergeworfen, warf ihn rücklings um, kniete nieder und fesselte ihn.
„Weil er es wagte, den Staat anzutasten“, befahl Diokles, „auf die Galeere mit ihm.“ Er pfiff. Zwei Prätorianer schleiften das Bündel Mensch durch den Sand in die Nacht hinaus.
Das Zelt war mit dreifacher Leinwand überspannt, und zwischen zwei Wänden lag, in seine Decke gewickelt, der rothaarige Diener Markus, behorchte im Halbschlaf Worte und Vorgänge und lächelte bös vor sich hin: „Was verachtest du die Zeit, du Kluger, wo doch geschrieben steht, dass vor Gott tausend Jahre sind wie ein Tag und wie eine Nachtwache; oder das andere: dass wir dahingehen wie ein Strom und sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das doch bald welk wird — so wird es gelehrt: dennoch bald welk wird, obwohl das Gras sich um langes Leben mühet und sich anklammert mit allen Fäserchen in der Erde.“ Er richtete sich auf, als drinnen das Ringen anhob, kroch zum Eingang, als die Soldaten den geknebelten Knecht hinausschleiften, und seine Fischaugen glotzten: „Der grosse Ketzer wird nun Kaiser von Rom.“ Er warf sich zurück, nahm die Decke um und wühlte sich in den warmen Sand. Kaiser, dachte er im Einschlafen, Kaiser der Welt und Herr von Rom — Herr der Welt und Kaiser von Rom — der da frühe blühet und bald welk wird — wie geschrieben steht — und des Abends abgehauen wird und verdorret — warum des Abends? — immer gehet der Mäher um — vor Sonnenaufgang und um Mitternacht — immer hörst du das Dengeln von Sichel und Sense —
Es war nach Mitternacht, der Sturm begann sich zu legen, aber noch immer durchfuhren die Sandschauer das Dunkel, da öffnete sich das Südtor des Dünenkastells, und von Fackelträgern begleitet, bewegte sich ein langer Zug feierlich in die Ebene hinab: voran schritten die Bläser der Prätorianer, immer nach dreissig Schritten erhoben sie die Hörner und jagten einen dumpf summenden Ton in den Raum; von Soldaten eingefasst, schwankte über den Köpfen ein roter Baldachin, an dessen vier Pfosten Windlichter brannten; den aufgebahrten Kaiser beleuchteten sie. So kamen sie in die Wüste, und ausserhalb der Lager stemmten sie den Baldachin in die Erde und schoben die Leiche unter sein Dach. Noch einmal dröhnten die Hörner über dem Toten, dann setzten die hellen Klänge der Tuben ein, vom Wind zerrissen, flogen sie durch die Nacht. Die Prätorianer rückten in ihr Kastell zurück, langsam und knarrend schloss sich das Tor.
Aber aus den Lagern zogen die Legionäre reihenweis an dem Schauspiel vorüber; noch war es nicht ausgemacht, wie sie das Ereignis hinnehmen wollten, noch grollten sie und verfluchten Diokles und die Prätorianer, aber sie wurden stiller, wenn sie der Bahre sich näherten. Die ersten, die vorbeikamen, sahen ihn noch, wie er gefällt worden war: in seinem Herzen das Schwert mit dem golddrahtumschnürten Elfenbeingriff stak bis zum Knauf im Stoff einer weissen Toga, die von geronnenem Blut überkrustet wurde; darunter die gefalteten Hände, knöcherne Greisenhände, wächserne Haut, die erstarrt war; ein weisses Tuch, über dem kahlen Schädel zusammengebunden, hielt den Kiefer, und unter den zugedrückten Augen hatte das verwitterte Gesicht nun noch den verklärenden Schein der Erlösung erhalten: so fanden die ersten ihn. Aber da noch immer die Sandwolken stoben, wehten sie auch über den Toten und deckten ihn zu, und da auch die Stunden dieser Nacht glühend waren wie an den Tagen zuvor, begann in dem Leib das Wirken der Verwesung; Schaum trat aus seinen Lippen, Nässe troff aus den Nüstern, Eiter sickerte aus den Augenwinkeln über das ergrauende Fleisch, und mit allem Feuchten vermengte sich der Sand zu schmutzigem Brei — da zogen die Präfekten eine Leinwand über ihn und stellten sich mit ihren Lanzen neben ihm auf. Dennoch stürzten vom nächtlichen Himmel Schreie nieder, und dunkles Flügelflattern strich über den Baldachin hin: die Aasgeier hatten den Duft des Todes gewittert und balgten sich, und dort, wo der Kreis der Laternen sich gegen die Finsternis abschloss, funkelten die Lichter der Schakale, die heulten und scharrten. — Dann, als der Sturm nachlässt und die Schauer des Sandes sich legen, bricht aus der Nacht ein Wehen, überstreicht das Mündungsland des Nils und hat sich mit dem Dunst seiner Sümpfe und Wasser getränkt; über der Leiche des Kaisers verschmelzen Fruchtbarkeit und Verwesung. Darüber Dunkel und Raum. Dann teilen die Wolken sich. Sterne sind da.
Wer mag in dieser Nacht schlafen — von Fackeln und Feuern glühen die Lager rot, und auf den Wachttürmen der Prätorianer lodern wieder die Leuchten, die flammenden Posaunen des Todes. Gegen Morgen — die Windlichter an der Bahre sind ausgebrannt und die Sterne verblassen am erbleichenden Himmel — öffnet sich wieder das Tor des Kastells und lässt den grossen Elefanten aus, auf dessen Rücken ein Mann steht, der in der Ferne nackt scheint: Diokles. Ohne Waffen und Rüstung, nur mit den hochgeschnürten Sandalen und dem roten Unterwams bekleidet, lenkt er Tibur durch einen schwarzen Stab, der in einen Eisenhaken ausläuft. Vom Zwielicht werden Reiter und Tier geschwärzt, und das Gesicht des Führers gleicht einer eisernen Maske, durch deren Schlitze manchmal die Augen funkeln. Tibur brüllt auf, als er sich durch die gedrängten Soldaten den Weg bahnt, am Baldachin schwingt ihm Diokles den Haken ins Ohr, der Elefant hält an und peitscht mit dem Rüssel die dichte Schar der Legionäre, und der Führer blinzelt aus seiner Höhe über die Menschen: alle haben die Rüstungen abgelegt und umstehen ihn in ihren roten Röcken, die dunklen Gesichter glänzen vor Schweiss, übernächtigte Augen funkeln zu ihm empor. Als er den rechten Arm grüssend über das Heer erhebt, wird Stille, und seine Stimme rollt durch den grauenden Tag:
„Soldaten des römischen Reichs! Um mich euerm Gericht zu stellen, bin ich hier. Darum stehe ich da, wie es dem Angeklagten ziemt, ohne Wache und Waffe. Die Prätorianer sind weit, und wenn ihr mich auch herunterzerrt und zerstampft, sie werden sich nicht rühren: so befahl ich’s, weil um meinetwillen kein Blut fliessen soll. Aber das Recht, mich zu rechtfertigen, beanspruche auch ich, darum hört mich an, Soldaten —
Legionäre Roms! Seit zehn Jahren führe ich die Prätorianer, in diesen zehn Jahren sah ich fünf Kaiser kommen und schwinden. Ich liess es geschehen. Ich vertraute dem einen, weil er stark, dem andern, weil er besonnen und klug, einem dritten, weil er würdig und weise schien — ich bin immer enttäuscht worden, denn es ist furchtbar, wie grausam Macht und Verantwortung den Menschen verwandeln: da wird die Stärke zur Roheit, der Besonnene zum Schwächling, der Würdige zum hilflosen Greis — darum sind diese Kaiser gestürzt, darum die fünfundzwanzig Toten, deren Namen ihr auf den Listen gelesen habt, und es war immer das Schicksal, das sie gefällt hat: da fuhr aus dem Dunkel ein Messer und stach ihnen das Herz, da war es das empörte Schicksal selbst, das durch die Nacht des Reichs blitzte. Alle diese Kaiser sind durch sich selbst gefallen — ein schlechter Komödiant wird ausgelacht, aber ein schlechter Kaiser rennt in das Schwert seines Mörders — das ist Gesetz!
Soldaten des römischen Reichs! In dieser Stunde, die über den Bestand des Staates entscheidet, schwöre ich euch: das Blut der Toten wird nicht über mich kommen, meine Hände sind rein. Aber diesen letzten“, er schwang den Stab über dem Baldachin, „habe ich töten lassen, weil er nicht gehen wollte. Ich habe gemordet, und ein Kaisermord kann nur durch Erfolg gerechtfertigt werden — was aber bedeutet Erfolg? Der Erfolg heisst: das Reich. Er heisst: Friede und Sicherheit, Arbeit und Brot. Weil ich die Kraft fühle, dieses Reich zu schaffen und den Brand des römischen Randes zu löschen, darum stehe ich vor euch: als neuer Kaiser. So wie an diesem Morgen hätt’ ich mich schon vor Jahren euch darstellen können; es geschah nicht, denn ich strebe nicht nach Ruhm und Macht, und ich verlange nichts für mich, ich will nur das Reich — der Schild dieses reinen Bewusstseins, er ist der einzige, den ich vor mich halten kann.“
Er schwieg, sah ihre höhnischen Fratzen, hörte den Zuruf: „Sag uns, Diokles, warum sind Kaiser da, wenn nicht aus Selbstsucht?“
Auf jenen Rufer deutete er mit dem Stab: „Seht, Soldaten, so tief haben die Kaiser den Thron schon entwürdigt, dass er ein Sitz für Schurken geworden ist! — Aber es ist feig, Tote zu beschimpfen, denen ich gleiche: auch ich bin wie sie, auch ich ein Kaiser, emporgetrieben durch Blut und Brand, auch ich ein Kaiser aus Not — Soldaten, was bleibt einem solchen? Wenn ich das Reich erbaue, ist mein Mord gerechtfertigt, ist mein Dasein hundertfach bestätigt durch das Dasein des Reichs, und ich schwöre bei den Göttern —“
„Nicht bei den Göttern“, rief einer hinauf, „die gelten nichts mehr. Schwör bei dem Schicksal, das du angerufen hast!“
„Sie gelten nichts mehr“, lächelte er bitter, „als Kinder beteten wir noch zu ihnen, heute darf man sie nicht mehr nennen, so fürchterlich wütet die Zeit mit Irdischem und Ewigem in diesem Jahrhundert.“ Er hob den Arm mit den gestreckten Fingern in die Dämmerung des Tages: „So schwör’ ich beim Schicksal und allem dunklen Geheimnis: niemals werde ich für mich fordern, ich will nur dienen; ich werde den Thron, wenn ich das Reich baute, freiwillig verlassen, ich will, was noch kein Kaiser vermochte, auf Diadem und Brokat verzichten, wenn das Reich vollendet ist. Das schwöre ich euch, Soldaten, der Welt und der Sonne, die eben emporsteigt.“ Er senkte den Arm. „Und es bleibt mir das andere noch“, fuhr er leiser fort, „dass ich scheitere. Aber dann, Legionäre, kenn’ ich mein Schicksal: ein Eisen fährt mir ins Herz — ich warte darauf.“
Er stand auf dem Rücken des Elefanten, er hatte die linke Hand in die Hüfte gestemmt und hielt mit der rechten den Stab, den er auf seinen Schenkel stützte. Er wartete, und das Volk umgab ihn wie ein Meer; nichts geschah. Da holte Diokles aus und schlug Tibur das Eisen in das Ohr, dass er den Rüssel gegen die Soldaten schwang und losstampfte. Sie öffneten ihm die Gasse, murrend und gärend schloss sich das Heer hinter dem Ungetüm wieder zusammen.
Diokles stieg mit Constantius Chlorus und Maximinian auf den Turm. Aus dem Mündungsland des Nils ging die Sonne auf, und schon erhellten sich da die Wasserläufe und Sumpfflächen zu mattem Silber; aber unten in der Ebene lagen noch die Schatten der Nacht, dort drängte das Gewimmel der Soldaten zusammen und floss auseinander, Redner begannen zu sprechen, Haufen strömten ihnen zu und schwenkten zu anderen ab, die Völker wirbelten durcheinander, das Brodeln ihres Aufruhrs drang zu den drei Männern hinauf: wenn das Heer den neuen Kaiser verwarf, wenn die Legionen angriffen und die Prätorianer zu ihnen übergingen, blieb den dreien nur der Tod.
„Wir stehen hier“, sagte Constantius Chlorus schwer und legte die Falten seines Mantels zurecht, „allein gegen die Welt.“
„Sie sollen sich endlich entscheiden, die Fratzen“, knurrte Maximinian und nestelte am Gurt.
Diokles schwieg, seine Augen waren verhängt, und starr hing die Haut vor seinem Gesicht, eine braune Maske, aber über den verschränkten Armen waren die Muskeln bis zu den Schultern gespannt. „Die Tuba“, stiess er rauh hervor.
Maximinian ergriff die glänzende Röhre und schwenkte sie gegen die Türme des Kastells hin: vierfach erklangen da die uralten Töne, die seit Jahrhunderten dem Heer den Aufbruch befohlen hatten, dumpfe, drohende Rufe, die in einem spitzen, klirrenden Schrei über die Ebene hallten, wie zerrissen; da stand die Sonne schon höher, die Wasser des Nillandes färbten sich von mattem Rot, und Licht sprühte aus den blanken Gestängen der Trompeten: starr stand und schwarz wie eine Mauer die gedrängte Menge unten im Tal. Wieder fuhr die Tuba auf sie hinab.
Auf der Plattform des Turms stach die Sonne schon und trieb Schwärme von Heuschrecken vor sich her; um sich ihrer zu erwehren, schlug Diokles ein rotes Tuch um den Kopf, eine Bewegung, von der er nichts wusste, dann stand er wieder und rührte sich nicht. Gebannt schauten die Soldaten zu ihm empor. Abermals rief die Tuba sie an.
Da erhoben sich unten im Tal die Arme zum Gruss; zuerst waren es zehn, dann hundert, Hunderte um Hunderte dann, Tausende um Tausende wurden es bald. Constantius, der Bleiche, blickte Diokles in der Erschütterung dieses Augenblicks an: wie aus Holz geschnitzt das gebräunte Gesicht — aber wie er jetzt das Tuch umgeschlungen hatte, wie er den Arm grüssend über die Zinnen streckte, glich er wohl seinen Ahnen, den dalmatinischen Piraten auf den Schiffsbrücken, so dass Chlorus erschrak: die Götter mögen das Reich schützen, wenn in diesem Enkel das Blut ihrer Raublust erwacht. — Schwer legte Maximinian dem Führer die Hand auf die Schulter: „Jetzt bist du Kaiser, Dio.“
Aber der schüttelte ihn ab und stand allein da; das auffahrende Licht überströmte ihn und flammte im roten Tuch und im rotwollenen Wams. Wie mit Blut wurde sein Schädel überlaufen, wie aus Blut gezogen waren Brust und Leib, und unter ihm glühten die Eisenplatten des Wachtturms: Kaiser aus Feuer und Nacht.
*
In der gleichen Nacht hatten die Leuchtturmwärter im Hafen von Alexandria die Fackeln geschwungen, Kreise und Striche hatten sie mit den Leuchten gezogen, hatten Worte und Sätze gebildet und verkündet, dass sich Diokles, der Prätorianerführer, zum Kaiser gemacht habe. Diese Nachricht lief von einem Feuerkastell zum andern, sie züngelte an den Küsten entlang, sie flammte über die Inseln, glühte in den Nächten landeinwärts und erfüllte die Welt.
Verödet blieben die Lager in der Ebene zurück. In den Herbststürmen wogte das Meer über die Böschung der Dünen und unterspülte die Wälle des Kastells; das grosse Küstentor mit dem Bronzebeschlag fiel aus dem Rahmen, seine Flügel klatschten aufs Wasser und schwammen hinaus; die Wälle versanken in sich, windschief standen die Türme, neigten sich und stürzten. An anderen Tagen kam der Wind ans der Wüste und trieb Sand an, der stieg an den Lagern des Heeres hoch und füllte die Tiefen aus, dann nahten die Monate der Regen, die spülten die Anschüttungen ab und wuschen an ihnen. Draussen in der Ebene hatten sie den toten Kaiser verscharrt, in den Hügel sein Schwert gesteckt und den Helm darübergestülpt, auch da kam der Sand und wehte die Waffen zu. Nach den langen Regen schwoll der Nil und gurgelte aus seinen braunen Fluten neue Bänke von Erde, Gras, morschen Hölzern und totem Getier an; dann trat er zurück, und unter der Sonnenglut wurde der Schlamm wie kochend, seine Fäulnis brodelte und schimmerte in den Nächten silbrig, aus dem Stromland quollen giftige Dämpfe, und in Alexandria verbreiteten sich die Fieber des Sommers wie in jedem Jahr.
Indessen marschieren die römischen Heere an den verwitterten Meilensteinen vorbei, in die die Köpfe alter Kaiser gemeisselt sind: Cäsar, Augustus, Tiberius, Vespasian, Trajan: Jahrzehnt um Jahrzehnt gleitet an den Legionen dahin. Einmal schlagen sie die Lager an der Mündung der Rhone auf und einmal an der nebligen Küste, wo sich die Ströme des Rheins zwischen Inselgestrüpp und Sümpfen träge ins Meer wälzen; einmal steht das Zelt des Kaisers Diokletian auf der Steilküste Englands und einmal am schottischen Strande: überall ist das Meer, das brandende Wasser ist überall. In manchen Nächten geht der Kaiser hinab und horcht seinem Tönen: das ist die Zeit, der Herzschlag der Ewigkeit donnert da an. In seiner Heimat, an der dalmatinischen Küste, steigen die Felsen steil aus der Adria und spiegeln sich in ihrem Grunde; da gibt es die Inseln und Klippen aus porigem, bröckligem Stein, in dem das Meer Grotten und Schlünde ausgewaschen hat; wenn dort die Brandung anschlägt und das Wasser sich in die Klüftungen saugt, entsteht ein Gurgeln und Schmatzen, als lecke ein grosses Wesen seine Lefzen im Schlaf, und dazu das Tosen der Spritzer an Riff und Vorsprung — in diesen Stunden hört der einsame Kaiser wieder den Ton der dalmatinischen Heimat, das Schluchzen des Meers.
An jedem Abend werfen die Heere das Lager auf und befestigen es mit Türmen und Toren nach dem alten Gesetz der römischen Kriegskunst. Constantius, der bleiche, feingekräuselte Römer, bricht jetzt von der Donaumündung nordwärts in die Provinz Dazien auf. Er führt einen Krieg der Vorsicht, kurze, langsame Tagesmärsche, die er nach allen Seiten gegen Überfall sichert; vor Gefechten und Schlachten benimmt er sich sorgsam und peinlich, es gibt nichts Regelwidriges, alles muss sich aus der Ordnung der Kriegskunst belegen lassen.
Anders verfährt Maximinian in der mesopotamischen Wüste. Das schwarze Blut des Mischlings bricht aus, und es ist, als reite er allein über die afrikanische Steppe: so hetzt er seine Truppen über die heissen Lehmwege, bis die glühenden Sonnenuntergänge im Dunkel verbluten; es ist Nacht geworden, wenn seine Legionen das Lager befestigen. Im Morgengrauen bricht er hervor, überrascht die parthischen Schwärme und schlägt sie vernichtend, dann wieder wartet er schwüle Tage, als hole er Atem, und hält sich in den Wällen zurück wie ein tückisches Tier, das nach neuer Beute späht. Ein stossartiger, krampfhafter Krieg zuckt da über die Wüste.
Mit eiserner Beharrlichkeit schiebt der Kaiser Diokletian sein Heer am Lauf der Ems entlang. An jedem Abend senden Constantius und Maximinian ihre reitenden Boten mit Nachrichten ab. In jeder Nacht schwingen die Feuerwärter ihre Fackeln vom höchsten Turm der byzantinischen Hofburg, sie beschreiben Zeichen und Worte, Feuertürme fangen sie auf und schwenken sie weiter, die Meldungen züngeln an den Küsten entlang, sie flammen über den Inseln auf, sie werden von Stafetten aufgenommen und landeinwärts getragen, sie eilen durch Raum und Zeit und erreichen den Kaiser.
Jetzt steht sein Zelt auf dem weichen Moosboden Germaniens, es ist noch das alte, in dem nur sein Lager aufgeschlagen wird, es ist mit dreifachem Tuch umspannt, und zwischen zwei Wänden verkriecht sich in jeder Nacht der rothaarige Diener Markus, steckt sein sommersprossiges Gesicht unter die Decken, spricht zum christlichen Heiland ein Gebet und schliesst die schleimigen Fischaugen. Er ist nicht beliebt unter den Sklaven des Heeres, er hat eine blutarme und missgünstige Art, mit ihnen zu verkehren, aber in dieser Zeit wurde er mit einem Menschen namens Galata bekannt. Der bot sich damals dem Kaiser an, als Geschichtsschreiber, wie er sagte, nahm eine unwillige Bewegung Diokletians als Zustimmung, und seitdem zieht er unter dem Gesinde mit, ein buckliges Männchen mit schwarzem Schopf, vogelartiger Nase, neidisch verkniffenem Mund, und seine Haut ist so zerknittert und schmutzfarben wie die vielen Pergamentzettelchen, die er in seiner ledernen Gürteltasche aufbewahrt. Die Soldaten schimpfen ihn die Krähe, weil seine Stimme schrill ist und weil er beim Sprechen mit seiner Nase loshackt wie die Krähe beim Frass. Galata ist ausgestossen und nirgends im Lager heimisch; ein Trosskutscher erlaubt ihm, unter dem Wagen zu schlafen, dort hängt er alte Leinwand um die Räder und hockt in den Nächten bei Windlicht und Tintenfass und malt Zeichen auf seine Papiere.
Die Legionen Diokletians arbeiteten am Aufbau des zerstörten germanischen Grenzwalls. Es war Sommer, aber auch diese Monate wurden in den Wäldern immer feucht, und ob auch die Sonne schien, sie entband dem schwammigen Boden den Geruch von Moder und faulenden Hölzern; früh kam die Dämmerung, kalt und windzerfahren wurden die Nächte.
An einem Abend gingen Markus und Galata zusammen. Zur einen Seite ragte über ihnen der Grenzwall, auf der andern wucherte starres Schilf in breiten Feldern, durch das sich der Strom scheuerte und gurgelte, und jenseits stand die schwarze Mauer des Moorwaldes; die Bleiche des Himmels wölbte sich darüber, fahl und verzehrt. Das Männchen Galata sprach mit fahrigen Gebärden seiner spinnigen Finger: „Ich habe die grossen Geschichtsschreiber gelesen“, flüsterte er hastig, „darum kam ich ins Lager. Ich kenne die Vergangenheit, darum weiss ich die Zukunft. Ich will dabei sein, wenn das Grosse geschieht. Es geschieht bald.“ — „Eine Neuigkeit also“, maulte Markus, „und keine angenehme, was?“
„O ihr Götter“, rief Galata und zuckte schmerzhaft am Körper, „in welchen Begriffen steckst du, Mann! Angenehm, unerfreulich: danach fragen die Krämer. Ein Schauspiel wird sich vollziehen, Mann“, er ergriff Markus am Arm, „ein Schauspiel über all Urteil und Wertung. Nur die Menschen werden dabei klein oder erhaben sein.“ Er reckte sich und deutete mit der knöchrigen Hand über Schilf und Strom und gegen den düstern Wald: „Hörst du das Rauschen?“ — „Das sind“, näselte Markus mürrisch, „die Blätter im Wind.“ — „Das ist“, kicherte Galata hell, „das germanische Meer. Nicht das wirkliche mein’ ich, das den Bernstein auswirft — die Völker branden hinter den Wäldern an. Davon rauscht es so.“
Er zog Markus ins Gras nieder, und sie sassen an der Böschung des Grenzgrabens. Hinter sich hatten sie den Wall mit seinen Türmen und den einsamen Schritt des Postens, vor sich die starre Mauer des Schilfs mit dem Röcheln des Stroms und dem feuchten Dunst seiner Dumpfheit, und schon quollen die Nebel, während sich am bleichen Himmel die Wolkenränder am Widerschein der sinkenden Sonne entzündeten. „Das Wogen der germanischen Völker“, flüsterte Galata, „da hören wir es rauschen und murren. Wenn ich nachts unter meinem Wagen liege und es rollt durch die Decken in mein Gehör, dann sehe ich sie: immer das Knarren der Räder und das Stampfen der Pferde auf den hohlen Bohlendämmen unter den Wäldern — das ist das ewige Fluten ihrer Züge, das sind die Strömungen, die sich schneiden und queren, vermischen und ausscheiden. Oder sie prallen zusammen, schäumen aneinander hoch und fallen zurück: von solchem Schwall läuft dann ein Beben durch das germanische Meer und zittert noch lange nach. Auch ist es bisweilen, als erschauere das grosse Wasser der Stämme, es zuckt zusammen und braust gewaltig: dann kommt eine Springflut und schleudert Völkerfetzen davon, die spritzen über den Rhein, nach Gallien, über die Alpen und ins Donautal. Davon erzittert das römische Reich im Mark. So geschah es, solange Menschen Bücher geschrieben haben, und jetzt —“
Galata sträubte den Buckel, aus der fallenden Dämmerung funkelten seine Augen, und sein Krähenschnabel stiess gegen Markus vor: „Jetzt ist es wieder so weit. Bald, bald bäumt sich wieder das germanische Meer. O wer die grossen Blätter der Geschichte las und einsog, was zwischen ihren Worten Geheimes steht, wer einmal die Luft atmete, die um jeden Satz der Meister schwebt, der empfängt davon ein unsterbliches Gefühl in sein Herz, der hat das Spüren in jedem Nerv, der wittert aus allen Zeichen die Schwingung des Ewigen, die ewige Wiederkehr. Denn das lehren die Bücher: das alles war schon einmal und das geschieht wieder. Und das andere: das alles bist du.“
Markus, ergriffen im Augenblick, hatte ein böses Glimmen im bleichen Gesicht: „Das ist sehr gut, was du sagst. Ich verstehe. Es werden wieder Germanen ins Reich fallen — wohin, weisst du es nicht?“ Aber Galata hastete weiter: „Auch du bist alles, Mann, auch du Aufgang und Ankunft, Sterben und Sturz, und wie in dir, so vollzieht es sich in den Völkern. Dieser Kaiser Diokletian! Das hat alles ein grosses Ansehen: da lässt er den Constantius Chlorus an der Donau marschieren, da setzt er den wütenden Maximinian in die parthische Wüste, der schlägt nun mit seinen Tatzen um sich, und manchmal trifft er hundert parthische Panzerreiter, und manchmal haut er in den Sand, dass es aufspritzt. Und der Kaiser stösst hier und da in die germanischen Wälder, und an guten Tagen erwischt er Gefangene, aber an vielen schlechten marschiert er nur gegen Stamm und Stumpf.“ Seine knöcherne Hand hieb in die dämmrige Luft: „Das ist alles vergeblich. Das sind lauter Schläge in den leeren Raum. Alles Tappen und Tasten in der Unendlichkeit.“
Noch kein Mensch hatte den mürrischen Markus so gesehen, wie ihn an diesem Abend der Geschichtsschreiber Galata wahrnahm: der kaiserliche Diener war freundlich geworden, und als er sich auf dem Grabenrand hintüberwarf und am ergrauenden Himmel das zwitschernde Flattern der Fledermäuse beobachtete, lächelte er träumerisch: „Da tappen wir also in die Unendlichkeit, da schlagen wir in die Leere und wissen von nichts, das ist sehr gut, wie ja ähnlich auch geschrieben steht: wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf alle unsre Sünde auf den Heiland.“ Doch Galata fuhr dazwischen: „Was sprichst du von eurer kleinen Sekte, wenn ich das Gesetz der Welten meine!“
Es fiel feucht, stärker quollen die Nebel aus Schilf und Rohr, der Strom rauschte vor dem schwarzen Grunde der Wälder, und Markus lächelte: „Das ist noch gar nicht entschieden, das ist sehr dunkel.“ Er heuchelte eine wehleidige Besorgnis: „Aber unterwerfen sich die Länder nicht, haben wir nicht Gräben, Grenzwall und Grenzmark?“ Doch Galata schlug sich die kurzen Schenkel: „Graben und Grenzmark“, kicherte er, „was bedeuten Zeit und Raum, Turm und Wall einem Volk, das sich empört? Ich sag’ dir: bald wird das germanische Meer wieder aufschäumen und branden, das muss jetzt geschehen, das ist das Gesetz von der Wiederkunft des Ewigen und von der Schwingung des Daseins: ich bestehe auf diesem Gesetz, darum bin ich beim Kaiser.“ Seine Augen leuchteten gross und begeistert, seine Krähennase stiess zu: „Jetzt werden die germanischen Fetzen über die Alpen spritzen oder sonstwo hin, dass die Luft pfeift, sie werden an den römischen Turm klatschen, und er wird schwanken.“ Er schob sein Vogelgesicht dichter an Markus, seine Augen glommen: „In manchen Stunden treten mir Gehör und Blick ins Gehirn, dann schaue ich diese funkelnden Bilder der Zukunft, die sagen die Wahrheit, denn sie kommen aus Gnade, und die Gnade trügt nicht: die Zeit ist erfüllt.“
Auf dem moorigen Boden näherten sich Schritte und klirrten dumpf: Soldaten marschierten vorüber und bezogen zur Nacht ihre Posten an den Schneisen, die durch das Schilf gehauen waren. Galata sah ihnen nach: „Das hat ein Ansehen“, flüsterte er, „das scheint alles Stärke und Macht, Überlieferung und Ehrfurcht. Aber in den Büchern kannst du es lesen, Mann: seitdem die Soldaten die Kaiser wählen, seit zweihundert Jahren, sind sie immer üppiger und weichlicher geworden, sie wollen ihr Gepäck nicht mehr schleppen, daher haben wir den ungeheuren Tross, der die Heere schwerfällig macht; sie sind heut die grossen Herren, darum wurden Schild und Helm immer leichter, immer kürzer Schwert und Lanze; am Rhein haben die Legionen die Rosshaarschweife vom Helm gerissen und sich wallende Federn aufgesteckt, damit sie nun wie die Gockel stolzieren, und in den venezianischen Kasernen hat es Meutereien gegeben, weil sie Mäntel aus orientalischen Stoffen tragen wollten — das sind grosse Zeichen, Mann, die muss man deuten, da werden Jahrhunderte umgestürzt, da sinken uralte Ordnungen und Gebräuche, die Vergangenheit stirbt dahin, und aus ihrer Verwesung wuchert im Zwielicht eine neue Zeit.“
Da war es dunkel geworden, hoch wogte der Nebel über dem Strom, und Rufe der Tuba fuhren darein, dass die Tore im Wall geschlossen würden. Als sie zurückgingen, blieb der Bucklige noch einmal stehen und beschrieb mit dem Arm einen Kreis vor sich her: „Wie eine Insel schwimmt dieses Reich auf einem Meer von Schwärze, und eine Kuppel von Finsternis hat sich darüber gewölbt. An ihren Rändern wachen die Feldherren mit ihren Legionen und manchmal schlagen sie zu; sie glauben etwas getan zu haben und verkünden einen Sieg, die Narren! Sie wühlen im unendlichen Raum und merken es nicht. So wacht der Kaiser im Zelt, so Constantius an der dazischen Grenze, so äugt Maximinian in die parthische Wüste hinaus. Dazien, Mann, an diesem Lande ermisst du den Verfall des Reichs: Trajan konnte es noch unterwerfen, dann vermochten die Römer es nicht zu halten, und endlich wurde es wieder zurückgegeben, um Frieden zu haben — und was geschieht jetzt? Einmal noch marschieren die Legionen in den Raum, einmal noch zeigt sich Rom an den Grenzen gross und gebärdet sich mit ehernem Tritt, noch einmal richtet es sich auf, aber ich sehe dahinter nur den letzten Ausbruch des Sterbenden: das ist der Sinn dieser Kriege.“
Als sie sich im Lager trennen sollten, hielt Markus den Kleinen zurück: „Wenn Rom stürzt, fallen die Kaiser zuerst — so wird es sein, das ist gut.“ Er deutete nach dem erleuchteten Zelt Diokletians: „Dieser Mensch, der sich jetzt Diokletian nennt“, flüsterte er gehässig, „hat mich halb verhungert aus einer Gosse geholt, und seitdem bin ich bei ihm. Ich war dabei, wenn er als Gladiator in der Arena auftrat, und habe zum Heiland um die Siege des Ketzers gebetet, und der Heiland hat mich erhört — er aber hat für mich nie einen Blick gehabt. Ich ging mit ihm zu den Prätorianern und diente ihm weiter aus Liebe und Dankbarkeit, aber ich bleibe immer der Schemel für seine Füsse, und mein Kittel ist das Tuch, an dem er die Sandalen abwischt. Dafür hab’ ich ihn hassen gelernt, dafür soll der Heiland ihn strafen, darum will ich beten.“
Abermals dröhnte die Tuba durch die Nacht, und sie gingen auseinander; Galata kroch unter seinen Trosswagen, Markus streckte sich zwischen den Wänden des Zeltes aus und spähte durch das erleuchtete Tuch. Drinnen Schatten und Umriss: der Kaiser sass auf seinem Lager, an dessen Seiten zwei kleine Basalttiger standen, die er aus mesopotamischen Trümmern mitgenommen hatte; sie trugen auf ihren ausgehöhlten Köpfen blakende Dochte auf Öl und blickten aus gläsernen Augen grimmig und grün. Markus hörte das Rascheln und Knittern der Pergamente, die die letzten Nachrichten aus dem Reich enthielten, Bett und Boden waren davon bedeckt. Er vernahm die heftige Bewegung, mit der Diokletian die Blätter fortscharrte, und dann geschah, was in jeder Nacht: der Kaiser legte die hölzernen Tafeln auf der Erde zusammen.
Das waren die grossen Platten aus Ebenholz, auf denen in bunten Wachsfarben das Bild der Welt gemalt war. Augustus, sagte man, habe sie anfertigen lassen, und seitdem hätten sie alle römischen Kaiser auf ihren Feldzügen begleitet. — Diokletian beugte sich darüber. Da lag, inmitten der schwarzen Flächen, eingebettet in das Dunkel des Holzes, das römische Reich, das die Welt bedeutete, und die blakenden Dochte warfen Schatten und zuckende Helle über das Bild. Der Kaiser sah nordwärts, dort war alles grün gemalt von Wäldern und Sumpf, dort schlängelte sich der blaue Lauf der Ems, dort befand er sich jetzt, aber jenseits des Flusses versickerte die grüne Farbe allmählich und lief in der Schwärze der Tafel aus; und so überall im Norden, Süden, Osten und Westen: hinter Spanien und den Umrissen der afrikanischen Küste versank das blaue Meer ins Unbekannte, die Wüsten im Süden zerflatterten mit ihren braunen Sandsteppen in die Weite, und im Osten, wo die Umrisse des indischen Landes mit zitternder Hand eingetragen waren, als sei der Maler vor der Unendlichkeit dieser Linien zurückgebebt, brach das nebelhafte Grau plötzlich ab und stürzte ins Nichts.
Markus kannte die Tafeln und ihre Bilder, und seit dieser Nacht wusste er auch zu deuten, was jetzt geschah: Diokletian kniete neben der Karte, mit den kurzen Fingern seiner nervigen Gladiatorenhand überstrich er die Grenzen des Reichs und tastete in dem Dunkel, das sich um das Reich schlang, und seine Nägel kratzten an der Schwärze des Holzes: da lauerten überall Dunkel und Raum, da hausten die unermesslichen Völker in Steppen und Wüsten, unter Gletschern, in Moorwäldern und Pfahldörfern über Seen und Sümpfen, da gähnten ringsum die ungeheuren Weiten, jenseits des Reichs brach die grosse Ewigkeit an, und wenn nun die Schatten über das Bild der römischen Welt flackerten, war es, als wölbe sich die Schwärze, von allen Seiten sich aufbäumend, um das Becken des Mittelmeers und rausche über ihm zusammen.
Aufrecht sass Markus hinter der Leinwand und horchte; seine schleimigen Augen glänzten böse im Licht, das durch das Tuch schien, sein rotes Haar leuchtete, und er sass da und hatte einen höhnischen Zug im sommersprossigen Gesicht, ein brandiger Dämon der Niedertracht. Jetzt verstand er den schweren Atem des Kaisers und die Laute des grimmigen Knurrens, des verzweifelten Stöhnens: Diokletian fürchtete die Nacht, die um das Reich wogte. Das waren die Stunden, in denen er seine Armseligkeit schmerzhaft fühlte, er kniete noch immer vor den Tafeln, hatte die leeren Hände auf den Knien und starrte auf den dunklen Raum, an dem seine Macht zerbrach. Knisternd erlosch ein Docht, dann der andere, Dunkel erfüllte das Zelt, der Kaiser warf sich endlich mit einer Bewegung des Überdrusses auf sein Lager, und draussen hüllte sich Markus in seine Decken: „Steht auch so geschrieben“, lächelte er, „die Ersten werden die Letzten sein.“
*
Weiter schüttet die Sanduhr der Wüste ihre Körner aus, begräbt die Trümmer der römischen Lager in der Ebene von Alexandria, und an den Wällen des Prätorianerkastells wuchern Disteln und Strandhafer. Im Grab des Kaisers Carus vermorschte das Sargholz über dem verwesenden Leichnam, der Hügel stürzte zusammen, Schwert und Helm, die man ihm draufgesteckt hatte, sanken um, und die Sandwehen trieben glättend darüber hin: über dem vergessenen Kaiser die schweigsame Weite, das Flirren der Körner, die flimmernde Glut.
Vom Turm der byzantinischen Hofburg schwenkten in den Nächten die Feuerwärter ihre Fackeln, sie beschrieben Kreise und Striche, sie schleudern die Nachrichten durch den Raum, die werden aufgefangen, züngeln an den Küsten entlang, auf den Inseln sprühen sie auf und erfüllen die Welt: der Kaiser Diokletian und seine Feldherren Constantius Chlorus und Maximinian sichern die Grenzen des Reichs, langsam wird der zerstörte Grenzwall gegen die Germanen wieder befestigt, schon zieht er sich von der Ems zur Donau hinüber, und in ihrem Tal schiebt sich das Heer des Kaisers nach Osten vor; die dazische Grenzmark ist ruhig, vom Schwarzen Meer bewegen sich die Legionen des Constantius dem Kaiser entgegen, sie werden sich vereinigen und der Welt beweisen, dass die germanische Gefahr gebannt ist.
Noch immer schlief Markus zwischen den Wänden des kaiserlichen Zelts, noch immer liess ein Trosskutscher den geschichtskundigen Galata unter seinem Wagen hansen, und an manchem Abend, wenn sie sich ausserhalb des Lagers ergingen — unter bleich verdämmerndem Himmel schäumte der braune Strom über Felsen und gurgelte am Ufer unter Weiden und verholztem Kraut — schalt ihn der Diener einen falschen Propheten: wo der verkündete Einbruch der Stämme sei, wo der Sturz Diokletians und des Reichs; gehe nicht alles nach des Kaisers Willen, erlöschen nicht die Aufstände im Innern, erhebe sich nicht Rom aus Nacht und Brand herrlicher als zuvor? Dann deutete Galata mit knöchernem Finger über die Donau, dort starrte am hintern Ufer die Mauer des Moorwalds dunkel, aber im Unterholz blinkerten Lichter und huschten. „Da leuchten Sumpf und modernde Stämme“, murrte Markus, aber Galata kicherte: „Wachtfeuer sind das, dahinter sie sich sammeln und lauern.“
Als auch diese Zeichen ausblieben, wandte sich Galata und fegte mit dünnen Ärmchen durch die Luft: „Willst du die ewige Wiederkehr zwingen“, schalt er, „wohl steht das Gesetz immer zu unseren Häupten, doch lässt es sich nicht beschwören auf Tag und Stunde.“ — So sprach er im dritten Jahr des germanischen Feldzugs, aber im vierten gebärdete er sich ratlos, sträubte den Buckel, schüttelte den schwarzen