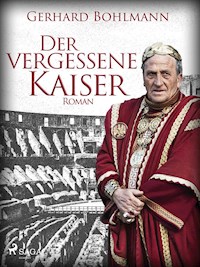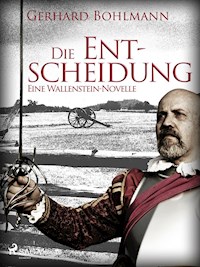Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Passion der Jeanne d'Arc bewegt die Gemüter der Menschen bis heute. Orléans war 1429 seit einem halben Jahr von den Engländern belagert, die Lage der Bewohner der Stadt verzweifelt. Schon vor ihrem Eintreffen wurde Jeanne d'Arc als Retterin gefeiert. Tatsächlich gelang ihr der Sieg. Ihr Ruhm als "Jungfrau von Orléans" verbreitete sich rasch im ganzen Königreich. Nach Jahren der Erniedrigungen und Niederlagen führte ihr Sieg eine entscheidende Wende im Hundertjährigen Krieg herbei. Aber ihr Kampf endete tragisch. In Rouen wurde ihr der Prozess gemacht, man klagte sie der Hexerei an, die 19-Jährige musste auf dem Scheiterhaufen ihr Leben lassen.Gerhard Bohlmann (1878–1944) war ein deutscher Schriftsteller und Journalist. Er war der Sohn des Direktors der Königsberger Union-Giesserei, studierte in Berlin und Königsberg Philologie und Germanistik. Nach Ende des Krieges arbeitete er zunächst als Feuilleton-Redakteur bei der Königsberger Allgemeinen Zeitung. 1924 ging er von Königsberg nach Berlin zur Telegraphen-Union. Später arbeitete er bis zu seinem Tod 1944 beim Deutschen Nachrichtenbüro. Bohlmann verfasste seinen ersten Roman erst mit über 50 Jahren. In seinen Büchern wandte er sich vor allem historischen Themen zu – vom Frühmittelalter (Der vergessene Kaiser) bis zum Dreißigjährigen Krieg (Wallenstein ringt um das Reich). -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Bohlmann
Die silberne Jungfrau
Roman
Saga
Für meine frau
Weg nach Frankreich
Sie wurden die Darcs von draussen genannt, denn ihr Haus lag ausserhalb von Domremi am Fuss des Ketzerbergs. Seine glatten Steilhänge stossen unvermittelt über dem Fluss und seinem sanften Tal aus der Ebene, und an heissen Tagen schält sich die schwefelfarbene Sandkuppe flimmernd aus grüner Haut und brütet frevelhaft über der Landschaft, ein richtiges Teufelsglied. Der Berg ist verrufen, das Haus und seine Menschen und alles Land in seinem Schatten sind verwünscht; scheu drücken sich die Bauern von Domremi daran vorbei und bekreuzigen sich. Die Schnitter und Mägde auf den Feldern murmeln Gebete und netzen die Stirnen aus ihren Tonkrügen, noch immer wittern Gerüchte dort dunkel umher.
Vor hundert Jahren, als die Ketzerei in der Welt zu wühlen begann, war auch Domremi mit gesegnetem Tal und freundlichem Fluss in Gefahr, von der Seuche des Unglaubens erfasst zu werden. Da Gott es aber gnädig meinte, fuhren an einem Sommertage die Väter der heiligen Inquisition mit Knechten, Karren und Geräten an und verbreiteten einen Geruch nach gesengtem Talg und Holzbrand, damit ihre Talare, Blöcke und Pritschen getränkt waren. Die Väter rochen den Unrat und hatten es bald heraus, sie begaben sich nach dem abgelegenen Haus, in dem heute die Darcs wohnen, kamen mit leuchtenden Gesichtern wieder und verkündeten frohlockend: „Legt eure Gewänder an und versammelt euch unter dem hohen Berg, das Gericht beginnt!“ So geschah es, die Ketzer wurden auf die Sandkuppe geschleift, und das Tal war schwarz von Menschen; sie hatten ihre Betten mitgebracht, denn das Verhör dauerte vier Tage, und sie starrten hinauf.
Oben war ein Gewimmel von Talaren, Geräten, Stangen und Feuern, und manchmal umwirbelten Rauchschwaden die Spitze und verhüllten alles. Weithin schallten die Stimmen der Väter über Tal und Fluss, ob die vier Ketzer, zwei Männer und ihre Frauen, bekennen wollten, in ihren Herzen der abscheulichen Lehre des Petrus Waldus angehangen zu haben, ob sie ihrem Aberglauben abschwören, bereuen und Busse tun wollten. Die vier sanken in die Knie und streckten die Arme himmelwärts: Ja, bekannten sie, sie glaubten jener Lehre als dem wahren Evangelium, würden es sich nicht aus dem Herzen reissen lassen, sondern an ihm festhalten und es bewahren bis zum Ende — da gerieten die Knechte, die starr und riesenhaft gestanden hatten, in Bewegung, und die Väter schritten in schwarzem Zuge um die Kuppe und richteten ihre Posaunen nach Norden, Süden, Osten und Westen; schmetternde Töne verkündeten das Gericht.
Es waren heisse Tage unter einem blau verschwebenden Himmel, und um die Niederungen des Bergs gärte die Glut der Sonne. Die mächtigen Knechte sind bis zum Gürtel entkleidet und schleppen kienige Scheiter zur Kuppe hinauf. Die Sohlen der Ketzer werden mit Fett beschmiert und an Feuern geröstet, der Brodem schmorender Haut, Schreien und Winseln sinkt ins Tal, dort seufzen die Menschen in lüsterner Erregung. Aber die heiligen Väter sind gross und geduldig, wieder dämpfen sie die Flammen und halten den Ketzern Kreuze über die Stirnen, ob sie bereuen wollen. Die Menge heult, wenn die Knechte mit langen Stangen die Brände von neuem schüren, und die Hitze drückt die Rauchschwaden auf die Zuschauer, deren Gesichter vor Spannung ganz hell geworden sind. Die Knechte werden es bald müde, am zweiten Tage wischen sie den Schweiss, stellen sich vor das Volk und deuten mit dicken Daumen über die Schultern rückwärts: „Wir haben kein Holz, vorwärts, Gerechte von Domremi und Umgebung, schafft uns welches, der Himmel will’s!“ Die Bauern von Domremi waren gottbeflissene Menschen und eifrig am Werk, und als ihre Karren mit Ladungen starker Stämme heranknarrten, stöhnen die Knechte vor Behagen und grinsen aus breiten Mäulern: Ihr seid die gerechtesten Bauern des Landes, Gott wird’s euerm hübschen Tälchen noch einmal vergelten! — Aus jener Zeit hat sich ein Wort erhalten, auf das die im Dorf stolz sind: Gerecht wie einer aus Domremi.
Am dritten Tage sind die Feuer erloschen, klar liegt die fleischfarbene Kuppe auf hohem Glast. Heute sind die Ketzer über die Pritschen gespannt, damit ihnen die Gelenke ausgerenkt würden; die Knochen knacken, die Stricke ächzen, die Knebel scheuern, aber die Waldenser sind stille geworden. Gegen Abend, die Sonne färbt den Gipfel mit hitzigem Rot, wird Schwefel unter ihren Nasen verbrannt, damit sie erwachen und bereuen. Sie sehen sich an, ihre Augen haben den Glanz höherer Welten, in ihrem erschöpften Fleisch liegt der Schein der Ewigkeit, und verneinen. Sie bleiben zäh und begeistert; darum müssen sie am vierten Tage brennen. Nach Norden, Süden, Osten und Westen gebunden, brannten sie bis spät in die Nacht; unter stillen Sternen stürzten die vier Fackeln prasselnd zusammen. Am fünften Tage packten die Knechte ihr Gerät auf die Karren, schliffen die Schrauben, scheuerten die Pritschen und hieben das schorfige Geisselleder an Bäumen weich, putzten die beschlagenen Silberheilande und schüttelten die Asche aus den Muttergottesfahnen. Andere zerstörten das Ketzerhaus, und die Väter beschrieben einen Bann um alles Land, das im Schatten des Ketzerbergs liegt. Seitdem ruht der Fluch auf ihm, gelb und geil brütet er über dem Lande.
Das war vor hundert Jahren, aber es ist unvergessen, denn die Kuppe trägt noch immer die schwarzen Flecke, die verkohlten Stämme der Scheiter und die Aschenhaufen von damals, dunkel liegen sie in ihrem Fleisch wie die Beulen der Pest, und wenn die Sonne schräge steht, dass die Überbleibsel Schatten werfen, sieht es aus, als wollten sie schwären. Seit hundert Jahren ist kein Mensch auf dem Berg gewesen, niemand hat das buschige Wäldchen an seinem Fuss betreten, dort wuchert es verschlungen über Modergrund, Bocksbärte wehen aus den Tannen.
Viele wussten noch, wie der alte Jakob Darc an einem stürmischen Regenabend im Dorfkrug von Domremi erschienen war. Damals ein behendes Kerlchen mit schwarzen rastlosen Augen, und stak in einem gelben Lederwams, das mit grellroten Bändern und Quasten nach der Sitte der Schausteller verziert war. Er wirbelte sein gewichstes Bärtchen, dass es wie ein Spiess unterm Kinn stand, liess Wein kommen und machte sich an den Tischen reihum. Er meckerte und zog den verdutzten Bauern Goldketten und Dukaten aus den Röcken, klapperte damit und lächelte überlegen: Wo sie das gestohlen hätten? Sein grosses Kunststück aber war, dass er seine knöchernen Hände rieb und plötzlich eine Taube hielt, eine lebende Taube, der er mit einem Ruck den Kopf abriss. Das Blut spritzte und sprudelte zur Erde, er gluckste heiser: „Grosse Kunst, meine Freunde, kann nur noch einer in der Welt, der Grieche Thanatos auf Kreta!“ Höhnisch und stechend blickte er sich um. Schon damals hatte er diese gelenken Finger, die Gauklerhände, die den Bauern beim Würfeln das Geld fortfegten. Sie schnupperten an seinen Troddeln und Schleifen, er roch nach scharfen, fremden Gewürzen. „Der Balsam des Südens“, kicherte er; seine Haut, die von Sonne und Lastern gegerbt war, faltete sich zahllos, glänzend zuckte das steife Bärtchen. Aber man glaubte ihm nicht, der Geruch kam aus Haut und Schweiss, die anders rochen als hierzulande. Doch etwas Gebrochenes und Unstetes lag schon immer um diesen Jakob Darc, mitten am Tisch starrte er abwesend und war nicht zu erwecken, oder er blickte ängstlich nach der Tür, als erwarte er einen Feind. Er trank gerne und redete dann lauter, aber immer mit einer heisern, brüchigen Stimme; nach einem Krug bekam er hochfahrende Gebärden, nach dem zweiten schalt er die Bauern Tölpel, nach dem dritten flüsterte er von seinen Schätzen und der herrlichen Frau, die er nachholen werde, und beschrieb die Pracht ihres hohen Leibes und den Schimmer ihrer Haut gegen das Grün der Wälder, unter dem Licht der Sterne. Dann verfiel er und alterte um Jahrzehnte, seine stechenden Augen erloschen, und seine Stimme erhielt das Trotzig-Weinerliche und Demütig-Bettelhafte, das man heute an ihm kannte. Lieber Gott, flüsterte er, lass es genug sein, mach ein Ende; er sah die am Tisch wie Fremde an, lächelte verlegen und wankte mit kleinbürgerlichem Trippeln in seine Kammer. Sie hatten ihn durch das Fenster beobachtet, als er sich entkleidete: zwischen seinen Schulterblättern stand ein Kreuz, das Brandmal des Henkers.
Nach einigen solcher Nächte sah man ihn in den Trümmern des Ketzerhauses wühlen; er richtete es sich her, er wagte es, er wollte dort wohnen. Wenn er jetzt ins Dorf kam, wichen sie zeternd zurück, er solle ihnen nicht nahen, er bringe Unheil über die Gerechten von Domremi. Er wurde der Darc von draussen. Es kümmerte ihn wenig. In jenem Herbst war wirklich eine Frau bei ihm, eine hohe Erscheinung im schwarzen Mantel, mit totenbleichem Gesicht, die Augen tief in schwarzen Löchern. So stand sie düster und unbeweglich am Strassenrand und sah an den Menschen vorbei die Senke des Flusses hinab, über dem Nebel dampften. In den frühen Dämmerungen sah man sie einsam, gross und gewölbten Leibes auf der Kuppe des Ketzerbergs zwischen verkohlten Scheitern, dunkel verschwebend im Dunkeln, sie starrte den Fluss hinauf, der unter der sinkenden Nacht nach Norden rann. Aber vielleicht war diese Frau eins der dunklen Spukgesichte, die noch immer unter den Bocksbärten geisterten. Niemand ahnte, woher die Fremde kam, sie schrumpfte wohl wieder in die Erde zurück, nachdem der Unehrliche sie genossen und mit ihr ein Kind gezeugt hatte, die Johanna Darc. Dies Mädchen war ganz aus dem Blut der Rätselhaften; so düster und wie mit Pech gesträhnt ihr Haar, so bleich ihre Haut, so unheimlich die Augen in tiefen Höhlen, und so hoch die ganze Gestalt.
Nach einigen Jahren war wieder ein Weib im Ketzerhaus, eine derbe Rothaarige, mit den leichtfertigen Blicken und fremdartigen Lockerheiten des fahrenden Volks; so war die auch zu dem Vaganten Darc gekommen, er hatte sie geraubt oder gekauft, denn er war reich. Man wollte ihn vor einem Tisch mit Goldstücken gesehen haben, über die er seine gespreizten Krallen hielt, Strahlen flogen nieder und zuckten gegen das Geld. Oder die Rote wimmerte nächtlich vor seiner Tür, und er zog sie zu sich ins Bett, weil ihn ihr kerniges Fleisch reizte, und behielt sie, weil sie ihm so lag; das Blut der Unehrlichen findet sich immer. Diese Rote war ein fester Mensch wie wir alle, anders als die verschwebende Fremde und ihre Johanna, und sie hatte vom Darc wirkliche Kinder, die Therese, den Lucien, die Marion, bei deren Geburt sie gestorben war. Niemals wich der Fluch von dem Haus, immer war dort die Hölle. Schreiend schwirrte das rote Weib aus der Diele über die Stiege durch die Dachkammern, stob wieder hinab, stiess auf die kleine Johanna, zerrte sie an den Haaren und trieb sie in die Winkel: das haben die Gerechten von Domremi oft mit Zufriedenheit beobachtet. Indessen strich der Mann Darc ruhelos auf der Strasse zwischen Haus und Ketzerberg, seine scharfen Augen hatten einen sehnsüchtigen Glanz, mit geblähten Nüstern zog er die Weite ein, er starrte die Strasse hinauf, murmelte Namen: „Vaucouleurs, St. Mihiel, Verdun, Montmédy“, zerrte am Bärtchen und keuchte. Im Haus traf er die Rote, von Rastlosigkeit umgetrieben wie er selbst, sie geisselten sich die Rücken blutig und stürzten entfesselt übereinander. Die kleine Johanna stand im Garten und horchte, an einen Baum gelehnt, auf das wollüstige Gebell; ihre Augen waren geschlossen, sie zitterte. Solche Greuel mussten die gerechten Bauern ansehen, wenn sie am Hause vorbeigingen.
Jahre und Jahre. Die beiden ältesten Darcs, Johanna und Therese, bauten Hütten aus Zweigen unter den bärtigen Tannen, sie kletterten auf die Kuppe des Berges und stöberten in den verwaschenen Resten der Ketzer, fanden gebleichte Knochen und legten sie auf dem Aschengrunde zu Gestalten aneinander. Jahre und Jahre. Das scharfe Gewürz aus dem Schweiss des jungen Darc ging auf seine Brut über, noch heute riechen die Darcs anders als die aus Domremi. Der Junge von damals ist weiss und kahl geworden, über seinen zahnlosen Gaumen liegen die Lippen faltig, und in seinen Mundwinkeln hängt Speichel. Aber das Böse schwelt noch immer um die Darcs von draussen. Man kann es sehen, der Alte hat seinen Garten in einer verfluchten Ordnung bepflanzt, und wer ihm da eingeht, wird von Blattern befallen. Im Herbst bilden die kahlen Sträucher Fratzen und unflätige Gebilde, den Teufelsbann, von dem man erblinden kann. Immer noch werden die unartigen Kinder bedroht: „Der Satan wird euch holen wie die Darcs von draussen!“
So ist es auch heute. Wenn der Alte einmal ins Dorf kommt, schliessen sie die Läden und nehmen die Kinder aus seinem Wege. Er will nichts von ihnen, ein alter Mann tastet durch den Morast zum Gasthaus, im Kittel hütet er die Karaffe, und der Schweiss der Schwäche perlt auf seiner Stirn. Bettelhaft, mit geflüsterten Worten wird er das Gefäss über den Schanktisch geben und ergeben dienern, wenn sie es ihm gefüllt haben; das ist alles. Wenn er aber zurückgeht so erloschen, wie er kam, und er stürzte im Strassenschlamm, niemand würde ihm helfen; das wäre nur seine Heuchelei, mit der er sich anschmeicheln möchte. Die aus Domremi wissen es anders: In diesem Greis wohnen teuflische Kräfte, noch ist seine Geilheit nicht erloschen, er sinnt auf blutschänderischen Zeitvertreib. Höllischer Segen waltet über seinem Eigen. Was fressen seine Ziegen unterm Ketzerberg? Keine anderen Euter stehen so prall unter strotzenden Adern. Was geschieht mit seinen Feldern? An Sonnenwenden sprenkelt der Teufel sie.
Eine Veränderung geschah, als dieser Abbé Carron ins Dorf kam, so ein hagerer Finsterling mit Habichtsnase im harten Gesicht, ein Zürner im Wort, ein Fanatiker auf der Kanzel, von wo seine Kohlenaugen die neue Gemeinde überflogen, die sich grollend unter ihm duckte. Bald hatte er sie erkannt, am dritten Sonntag peitschten seine Worte ihre fette Gerechtigkeit: „Ziemt’s euch zu richten, ihr Frösche?“ Er schüttelte sich, dass seine dunkle Mähne mit den weissen Strähnen stob, seine grossen Hände rüttelten die Kanzelbrüstung; dann ging er, von erbitterten Augen verfolgt, zum alten Darc hinaus und wanderte mit ihm lange im Schatten des Ketzerbergs, der Komödiant mag gewimmert haben, und dann erhielten die Darcs ihren Platz in der Kirche, ein Bänklein am Pfeiler, darin sie sich drängen, man braucht sie nicht zu berühren, auch dort sind sie ausgestossen, da können sie ihren Unflat im himmlischen Gnadenglanz bereuen. Sie neigen die Köpfe und beten heuchlerisch an Rosenkränzen; nur Johanna beugt sich nicht, ihre Gedanken dunkeln schwer dahin.
Nach dem Gottesdienst, wenn die Bauern vor der Kirchentür zusammenstehen, gehen die Darcs als die letzten hinaus, und jetzt kann man sehen, dass sie nicht aus einem Blut und Guss sind. Die Johanna ist grösser und schlanker als alle, höher auch als Therese, neben der sie daherkommt; ihr schwarzes Haar hängt straff und stumpf wie ein Tuch auf die Schultern, aber die Köpfe der anderen Darcs schimmern in rötlichem Braun. Sie haben graue, etwas quellende Augen, diese aber besitzt einen weitgestellten Blick voll Düsternis, als erfasse sie Süden und Norden in einem Zug; die anderen haben die Lippen sinnlicher Hoffnung, der Mund dieser einen verschliesst sich bleich, wie ein Strich steht die Nase im blassen Gesicht; die Kinder der Roten sind von der Sonne gebrannt, Johannas Haut ist wie entleert, an den Schläfen und unter den Augen treten Adergeflechte bläulich hervor — und so kommen die Darcs heran, zwischen feindseligen Gesichtern gehen sie einsam zur Kirche hinaus, zum Schluss der alte Schausteller, erloschen gegen die Sonne blinzelnd, herausfordernd grinsend, Schweiss auf der Glatze. Die Sonne flimmert, die Röcke rauschen und stäuben den Geruch der Darcs, die scharfen Würzen des Südens, in die Luft. Wo die Dorfstrasse beginnt, haben sich die Burschen zusammengerottet und zischeln ihren lüsternen Chor: „Kss, Hanne, kss, übermorgen, wenn’s dreizehn schlägt —“
Der Abbé Carron weht in seiner schäbigen Soutane über den Friedhof und beobachtet das Treiben seiner gerechten Gemeinde. Er möchte toben, sein Gesicht flackert, grimmig zuckt seine Habichtsnase. „Einsam“, murmelt er verbissen, „wir alle einsam, im Dunkel schläft die Welt, wann kommt ihr das Licht, Herrgott, woher soll es kommen, alles ist ohne Trost und Aussicht, überall die Nacht dieser Ewigkeit!“ Mit einem verzehrenden Blick sieht er Johanna nach, über seinem Gesicht schmilzt die Härte, er ist traurig geworden. So verlassen die Darcs das Dorf und kehren in die Einöde zurück, wo über ihrem Strohdach das Teufelsglied steht.
Aber die Bauern sind wieder unter sich, lassen die Kinder spielen und schwatzen. Die Unehrlichen sind ausgestossen, und drei Kreuze hinter ihnen drein! Gott erlöse uns von dem hundertjährigen Krieg, er schlage alle englischen Heere und den grauen Talbot, den Landverwüster, er vernichte unsere Feinde und segne sein gerechtes Dorf in Zeit und Ewigkeit! Amen!
In dieser Winternacht drehte plötzlich der Wind von Nord nach Süd und rollte und sauste warm über das Tal, er brachte das Schmelzen. Da zerfiel der letzte Schnee, die Strohdächer rannen und troffen, in den Talmulden begann das Rieseln. Der Fluss ächzte, ruckte an und zerbrach sein Eis, feucht dünsteten die fetten Ufer aus schwarzer Erde; treibende Schollen knirschten nordwärts, über nassen Gründen rauschte und klang die Nacht, und die Kirche von Domremi kläffte heiser drei Schläge über das Tal. Im Stroh raschelten Tiere; das klagende Schafblöken, das Krippennagen der Pferde, das Winseln laufender Hunde. Sie ahnten Brunst, sie quollen vor Fülle und schrien in die Frühlingsnacht von Domremi, in der das Schicksal der Johanna Darc und ihres Landes aus Nacht und Not gezeugt wurde.
Nach Stunden sickerte Regen, und seine nieselnde Nässe hing noch lange in der Luft; der Fluss rauschte, auf die Kuppe des Ketzerbergs legte sich ein grauer Schimmer, trübe begann der feuchte Tag. Schon erhellten sich die Wolken, träge Lichter zwinkerten auf den Strohdächern, langsam rollte die Dunkelheit fort und enthüllte das Dorf. Seine Häuser lagen wie die Zahnreihen eines vermorschten Gebisses mit Lücken und fauligen Schäden; dazwischen die Strasse wie ein schleimiger Speichel, mit schwarzem Auswurf durchsetzt. Bleierne Lichter erschienen in trüben Lachen, Regen rieselte auf Brandstätten und Trümmerhaufen; das hatte der Krieg gemacht.
Der Krieg, der jetzt ins hundertste Jahr dauerte. Immer wieder fielen versprengte Abteilungen in die Dörfer, meuternde Landsknechte zogen umher, Söldner ohne Sold warfen sich wütend auf die Bauern. Ihnen folgten die Ausgespienen der Städte; auf nächtlichen Schlachtfeldern plünderten sie die toten Soldaten, rotteten sich mit ihren Waffen zusammen und führten einen wilden Krieg auf eigene Faust; die Marketender, die bei den verarmten Regimentern nichts verkauften, drängten den Dörfern ihren Kram gewaltsam auf; aus Morgennebeln tauchten die Schnapphähne, hatten einen Ort umzingelt und die Menschen in den Betten geknebelt. Im Winter waren Karren mit Lagerdirnen erschienen, geführt von ihren Hurenweibeln, deren Lederkoller vor Bolzen strotzten; auf dem Blachfeld hinter der Kirche schlugen sie ein Zeltlager auf, viele Bauern schlichen sich hin und fanden für einen Brotlaib den Genuss der fremden Frauen, die tagsüber mit Seidenschleppen auf der Dorfstrasse trippelten und schreiende Federn wallen liessen; diese Neugierigen büssten es schon, eitriger Ausbruch entstand auf ihrer Haut. Keiner dachte daran, die zerstörten Häuser aufzubauen, es lohnte sich nicht, mit dem Lachen des Stumpfsinns sahen sie eins nach dem andern brennen und pferchten sich in den übrigen zusammen unter zerrissenen Dächern, hinter lumpenverstopften Fenstern, zwischen triefenden Mauern. Im bittern Geruch dieser Höhlen waren Glaube und Scham verkümmert, verzweifelt und wahllos ergriffen sich Mann und Weib, und aus diesen Augenblicken tierischer Betäubung entstanden die Kinder, die in Fetzen vor den Türen sassen und die Gesichter mit Strassenkot beschmierten, magere Geschöpfe mit hohlgeränderten Augen und Schorfkrusten auf Nasen und Stirnen.
Aus grauen Wolken regnete der Tag, die Häuser von Domremi, fest und winterlich verschlossen, brüteten über Schweiss und Schnarchen. Im Haus unterm Ketzerberg stand die Dachkammer voll Rauch und Qualm. In dem einen Bett wollte ein Mensch erwachen, er kam nicht dazu, die Luft erstickte ihn, er unterlag. Therese bäumte sich unter den Wehen des Todes, zerrte an der Decke, zerriss das Hemd und streckte sich stöhnend aus. Ihr Gesicht war gedunsen und von Qualm verzerrt, wütend fletschte sie die weissen Zähne.
In dem andern Bett wand sich Johanna unter Träumen der Angst. Sie steht nackt im grauen Raum, vor ihr kniet der Abbé Carron mit der Habichtsnase im harten Gesicht, und seine schwarzen Augen glänzten fanatisch. „Seht, sie ist keine Jungfrau“, flüsterte er entzückt, „ich wusste es! Seht, sie hat’s mit dem Teufel getrieben, wo ist das Zeichen ihrer Unschuld?“ Schweigende Köpfe schwanken im Rauch und betrachten sie lodernd. Johanna möchte schreien: Es ist nicht wahr! Aber alle Augen deuten hämisch auf ihre Nacktheit, denn auf ihrer Brust über dem Herzen entfaltet sich ein schwarzes Mal, die Gestalt einer Ratte. „Das Teufelszeichen!“ donnerte der Abbé und dröhnt wie unter den Wölbungen der Kirche, „sie hat vom Satan empfangen!“ Wieder möchte sie schreien: Ich kenne keinen Mann! Da bläht sich ihr Leib, dass der Nabel in seiner Schwellung versinkt. Ihre Klage vergeht im Sturm über nächtlichen Feldern, Wolkenfetzen flattern um ihre Stirn. Sie steht auf dem Scheiterhaufen, und er ist bis in die Sterne getürmt. Gottes Wehen fährt über die Ebene, schwelgt im Lecken der Flammen und heult im Prasseln der Hölzer, unterm Horizont brandet ein Donnerschlag, und die Sonne geht auf wie ein Blitz. Es rauscht, pfeift und flattert aus ihren Strahlen, dann nähert es sich gross und getragen und ist eine weisse Taube, die sich auf Johannas Haar niederlässt. Gott rettet mich noch, denkt sie und stammelt zu den blutigen Wolken, aber unten tosen die Feuer, fressen sich durch die harzigen Stämme, Rauchwolken züngeln, sie atmet den Qualm, er beisst die Augen. Ernst und behutsam senkt die Taube die Flügel vor ihrem Blick, und so kommt das Ende, dunkel, leicht und im schwarzen Fall.
Johanna erwachte in einem erstickten Schrei, als sie aus dem Bett stürzte, aber der Traum dauerte an, sie roch noch den Rauch, und ihre Augen waren von Tränen verklebt. Ohne von sich zu wissen, zog sie sich über den Lehmboden, weinte und winselte, tastete mit letztem Willen nach dem Fensterriegel, stiess die Läden auf und schlug lang hin. So lag sie, während draussen die Dämmerung über das Tal regnete; die Läden knarrten in ihre Betäubung, die Fenster knirschten in den Angeln und klirrten, tief erschrocken zuckte sie bei jedem Geräusch. Als sie zu sich kam, hatte der Regen aufgehört, unter einem grauen Himmel war die Luft schwer und warm geworden, schwarz und fett dünstete die Erde, die kahlen Sträucher rochen nach nasser Rinde, frisch atmete das Land, und in seinem Duft erwachte Johanna. O die Laute des Lebens, das Streichen des Windes, das Rucken der zärtlichen Tauben im Dachverschlag. Als sie sich mit wehen Gliedern erhob, lag auf ihrem Gesicht ein unscheinbares, schmerzhaftes Lächeln.
Johanna erinnerte sich, während der Nacht, bemerkte sie nun, war die kleine Rauchklappe des Schornsteins aufgesprungen, der vom Kamin der Diele kam, noch immer kräuselte leichter Rauch dorther. Sie sah nach dem Bett der Schwester hinüber: „Therese“, sagte sie mit einer brüchigen Stimme. Die antwortete mit einem Seufzer und streckte sich lang aus. Johanna kämmte gedankenlos ihr Haar und sah auf das Tal, dessen Wiesen nach einem harten Winter vergilbt und zerfressen waren, zwischen ihnen rauschte der Fluss, und sie erschrak, weil sie der Nacht gedenken musste. Als sie das Hemd anhob, fand sie die kleinen festen Brüste und den hohen knabenhaften Leib unversehrt, aber sie erschauerte unter der Morgenkühle: der dröhnende Aufgang der Sonne, sie hatte den mächtigen Klang noch im Ohr, das war wieder vom Krieg geträumt, immer hatte sie jetzt diese eisernen Träume über klirrenden Ebenen. Aber das andere. Der Abbé, das Gericht, der Scheiterhaufen — zwischen den zusammengewachsenen Augenbrauen stand eine Falte, während sie ihr blaues Kleid überstreifte, das ihren Wuchs bis zur Hüfte fest umschloss und abwärts in bauschigen Falten auslief. Draussen kam der Himmel in rasche Bewegung, die Sonne flimmerte auf feuchten Wiesen, und das perlende Astwerk der Sträucher wurde von silbernem Licht durchwirkt; Johanna betrachtete ihr Tal mit einer scheuen Zärtlichkeit, sie wollte etwas sagen, aber es schien, als schäme sie sich vor der Schwester, die immer noch schlief. Unter sommerlicher Bläue wanderten weisse Wolken vom Süden herauf.
„Therese“, sagte Johanna. Sie beugte sich über das Bett, die Schwester fletschte aus gedunsenem Gesicht die Zähne. „Erstickt“, stammelte Johanna, „wie siehst du aus?“ Sie stand hoch und starr neben der Leiche, die Finger verkrampften sich vor der Brust, ihre Gedanken flogen und stoben davon, bis dieser blieb: Warum sie, warum nicht ich? Als eine Taube am Fenster flatterte, kam der Traum mit allen Schrecknissen wieder, dass sie aufschrie, einmal, wieder und wieder, bis sie wimmernd niedersank und ihre Stirn gegen das Bettholz drückte.
Als die anderen schlafzerfahren heraufkamen, hatte Johanna die Tote abgedeckt, dass sie unter dem aufgerissenen Hemd beinahe nackt lag. Die vierzehnjährige Marion zeigte Abscheu, und der zwölfjährige Lucien kehrte sich fort, er war ein Feigling; während sie niederknieten, um krampfhaft und unvermittelt loszuheulen, sah Johanna noch immer in das entstellte Gesicht: Warum du, warum nicht ich? Durch eine fremde Nähe fühlte sie sich gestört, der alte Darc stand in der Tür, hatte lüsterne Äuglein im faltigen Gesicht, Speichel lag in seinen Mundwinkeln, lange hatte er sich an der Blösse der Leiche geweidet. Da er sich ertappt sah, trippelte er mit weichen Knien ängstlich auf der Stelle und faltete rasch die Hände. „Welch ein Schlag, Kindchen“, kicherte er ablenkend, „ein grosses Unglück“, aber Johanna stellte sich schützend vor die Leiche, und ihre Augen wurden vor Hass und Verachtung stechend, dass er sich duckte und alsbald leise hinauswand. „So“, flüsterte sie heiser hinterdrein, wie immer, wenn sie etwas beendet hatte, und zog die Decke über die Schwester. „Ich geh’ ins Dorf, den Abbé holen.“ Lucien betete eifriger, um nichts zu hören, aber Marion blickte ängstlich auf: „Es ist Sonntag, sie werden es nicht dulden, du kennst sie doch.“
„Ja“, antwortete sie ohne Ton und Gedanken; noch einmal beugte sie sich über die Tote, die ganz geheimnisvoll geworden war, und über die Kinder, denen sie die Hände über die gesenkten Köpfe legte. „Ihr“, sagte sie leise in scheuer Liebe.
Die Dorfstrasse von Domremi war zu Morast aufgeweicht, aber über seiner Brühe spielte in Silberflimmern das Licht. In den Häusern waren Türen und Fenster geöffnet, hemdsärmelige Männer und Frauen mit zerwühlten Haaren lehnten hinaus, und auf ihrer Haut lag noch der fettige Glanz nach dumpfer Nacht. Über die Strasse, von Haus zu Haus schwatzte man über den plötzlichen Frühling; Worte gingen nörgelnd hin und her: „Nun geht die Schinderei wieder los; und man bringt es doch zu nichts, es ist alles umsonst; alles für die Soldaten, alles für den Krieg; der Herr König sollte wissen, wie es hier aussieht; ja, und so ist es überall im Lande“ — solche Reden liefen die Häuser entlang, allenthalben standen sie in den Türen und fühlten sich verschlafen und träge. Frauen schüttelten die nächtlichen Kübel auf die Strasse: So ein Dreck ist das ganze Leben! Da erschien Johanna.
Die Bauern waren starr: „Seht, die Darc kommt, die Älteste, sie ist es wirklich. Die Darc“, zischelten sie, „sie wagt es, wir wollen ihr’s besorgen!“ Johanna trat in ein bedrohliches Schweigen. „Nehmt die Kinder fort!“ wimmerte plötzlich ein Weib. „Rettet die Kinder“, schrie es von Haus zu Haus. Johanna ging vorwärts. Keifte ein Greis: „Du denkst wohl, heut ist Sonntag? Der liebe Gott hat deinen Verstand verwirrt.“ Brüllte ein Mann: „Der liebe Gott? Der Teufel!“ Die jungen Leute näherten sich der Strasse und begannen den zischelnden Chor: „Kss, Hanne, kss! Übermorgen, wenn’s dreizehn schlägt, und der Alraun wächst, hinterm linken Grab am Kirchhofszaun, da treffen wir uns, da machen wir was! Kss, Hanne, kss!“ Schrill zeterte eine Weiberstimme: „Rettet die Kinder!“ Dann entstand ein Schweigen, ein Krähenschwarm liess sich in einem Baum nieder, man hörte es, Johanna ging mit geschlossenen Augen und legte die Lippen so fest zusammen, dass sie weiss wurden, die Flügel der feinen Nase zitterten. „Sag uns doch“, schmeichelte einer sanft, „warum beehrst du uns heute, ist es denn wohl ein Sonntag?“
Johanna sah geradeaus über den flimmernden Morast der Strasse. „Therese ist tot“, antwortete sie hart.
„Tot“, fragte die schmeichelnde Stimme, „so plötzlich wohl in der Nacht, wie denn?“
„Im Bett erstickt“, sagte sie kalt und wollte vorwärts, aber sie wurde festgehalten.
„Warum denn erstickt?“
„Von dem Rauch des Kamins.“
Die Leute schwiegen und dachten nach. „Durch den Kamin“, donnerte ein Mann, „ist der Satan gefahren, hat sie beschlafen zur Nacht!“ Er sprach den allgemeinen Verdacht aus, und das Dorf begann zu toben: „Gebt’s ihr, zeigt’s der Teufelsbrut — alles Unglück kommt von den Darcs!“ Schon griffen sie nach Scherben, rissen Holz aus den Zäunen und hielten Erdklumpen in erhobenen Händen. Gebeugten Hauptes, mit schlaffen Armen wartete Johanna in ihrer Mitte.
Indessen stand der Abbé Carron in der Stube seines Pfarrhauses, auf dem immer der Schatten der Kirche ruhte. Das Fenster war offen, um die Moderluft auszulassen. Die Nässe zeichnete ihre Bahnen auf die kahlen Lehmwände, und in den Ecken gedieh grüner Schimmel. Ein Stehpult mit dem Chronikband des Dorfes, das Maul des Kamins, ein stöckeriger Tisch und eine schmale Bank an der Mauer hin: zwischen diesen Dingen stand er hoch und hager in seiner schäbigen Soutane wie ein verkohlter Docht und horchte auf das Geschwätz seiner Gemeinde. Gebärde des Ekels, er kannte die Fettheit dieser Stimmen von Haus zu Haus, ihr frevelhaftes Sichgehenlassen, ihren feigen Verzicht. Er schüttelte sich; durch das Fenster wehte der Aasgeruch des toten Pferdes, das seit dem Herbst an der Strasse verweste; man liess es liegen. Dieses Volk wurde immer tierischer; anfangs ging es unmerkbar, aber jetzt dauerte der Krieg hundert Jahre; hundert Jahre hatte dieses Land den Krieg getragen, zuerst mit Heldenmut, dann mit Ergebung, jetzt mit Stumpfsinn, in entsetzlicher Schnelligkeit stürzte es dem Verfall entgegen. Da vernahm der Abbé das Toben des Dorfes und eilte hinaus.
Erkannte, was vorging, und donnerte die Strasse hinab: „Habt ihr wieder ein Opfer gefunden?“ Als er sie im Weitergehen nacheinander ansah, zogen sie sich in die Häuser zurück und kläfften aus dem Hinterhalt: Bei den Darcs sei wieder der Teufel los gewesen und habe die Therese gedrosselt; erstickt, lüge die Hanne, man werde ja sehen. Die Jungen zischten ihren Chor: „Die Hanne hat einen schwarzen Freund, wenn es dreizehn schlägt, wenn der Mondschein scheint.“ Man werde ja sehen, zeterten die Männer, der Bischof von Verdun sei ja nicht so weit, auch der Herr Dauphin solle es erfahren — unbeirrt, ernst und hager schritt der Abbé vorwärts. Verzerrte Gesichter, tükkische Augen sahen ihm nach, als er mit Johanna zum Ketzerberg hinausging.
Als der Abbé die Tote gesegnet hatte, stand Johanna inmitten des geöffneten Fensters, vor einem blauen Himmel, über den weisse Wolken wanderten. Er sah sie streng an: „Und du? Ich finde dich kalt und teilnahmslos wie immer. So sehe ich dich jeden Sonntag unter meiner Kanzel, so stehst du hier, mit müssigen Schultern und abwesenden Gedanken.“
Johanna sah auf die Schornsteinklappe, die noch immer offenstand, und stiess sie mit dem Fuss zu. „Sagt, Herr“, begann sie endlich, „wo wir beide gleich nahe daran waren, warum traf’s Therese? Warum nicht mich?“
Er horchte auf: „Woher hast du diesen Gedanken?“
„Er kam. Er war da, gleich zuerst. Gott meint damit etwas. Er hat mich aufgespart. Wozu? Wisst Ihr’s nicht?“ Sie sprach stockend, stossweise, mit der belegten Stimme von Menschen, die viel allein sind.
„Bin ich in Domremi“, staunte Carron, „im Hause der Darcs? Dieser Gedanke, wer vermag ihn hier zu fassen. Er ist zu weit und hoch für dieses Volk. So denken die Weisen, die Weltmüden oder die Toren, die sich zu einer Berufung aufgespart glauben — du bist schwer zu durchschauen, Johanna. Deine Kälte, was bedeutet sie? Hochmut, dahinter Eitelkeit? Überhebung, die glaubt, ihr sei ein besonderes Schicksal beschieden?“
Sie verneinte, müde und unerregt, ihre Teilnahmslosigkeit brachte ihn auf: „Wie du immer dastehst. Mit hängenden Schultern, schlaffen Armen, offenen Händen. Was, denkst du, wird Gott darein legen? Das Schicksal einer Heiligen etwa, die Berufung einer heiligen Colette oder Katharina? Rühre nicht an die Zukunft, Mädchen, sie gehört Gott. Oh, ich weiss, die Jugend geht ohnehin mit gewaltigen Einbildungen schwanger und rühmt sich ihrer, als seien sie ein Verdienst. Aber sie sind nur Jugend.“ Er stand hager und dürr im Raum, auf der Soutane glänzten blanke Flecke. „Solche Fragen vermessen sich an der göttlichen Undurchdringlichkeit, man soll sie wegwischen — fort — dahin!“ Er holte zu einer grossen kanzelhaften Geste aus, die plötzlich abbrach; forschend betrachtete er Johanna.
Gegen den lichten Wolkenhimmel befand sich ihr dunkler Umriss in heller Erregung, vor dem Licht erschien ihr bleiches Gesicht grau im Schatten und scharf und herb vor Zweifel und Ratlosigkeit, ihre Schultern zuckten, ihr Leib wand sich unter den Worten.
„Hat Gott sich also geirrt“, flüsterte sie mit einem Blick auf die Tote, „meint Ihr das, Herr?“
Carron erbitterte sich: „Gott irrt nicht. Er sparte dich, aber zu welchem Ende? Du bist zu jung, du kennst seinen Hohn nicht.“
Sie bejahte heftig: „Gott ist furchtbar, ich weiss. Dieses Leben hier draussen, so verstossen. Aber er darf nicht höhnisch sein, dann wäre er klein und gehässig wie diese Menschen — sagt das nicht, Herr!“
„Du wirst es erleben“, unterbrach er sie mit kalter Überzeugung, „du wirst unter seinem spöttischen Lächeln leiden, wie wir alle. Ich war in den Peststädten, jahrelang, alle bekamen sie die schwarzen Beulen, ich aber kam rein heraus und jubelte: Er hat mich zu Grossem bestimmt! Und wieder war ich im Krieg jahrelang, ich schonte mich nicht, aber ich entging ihm, und wieder jauchzte mein Herz: Er hat seine gewaltigen Absichten mit mir! Und wieder vergingen Jahre, und ich lebte immer im Rausch der Erwartung, ihm aber beliebte es, mit mir zu spielen — so zerren Katzen sterbende Mäuse —, und er senkte mich tiefer von Jahr zu Jahr, bis er mich in dieses Dorf ausgespien hat. Da liege ich nun mit meinem verzweifelten Wissen, dass ich hier bleibe bis zum Ende. Kein junger Mensch kann das ermessen, ihr habt ja noch eure Hoffnungen. Wir aber, die wir nicht mehr Mann und noch nicht Greis sind, fühlen die Leere und das Erlahmen und wissen: Das ist nun das Letzte.“
Johannas Augen waren vor Misstrauen stechend geworden: „Darum, Herr, werdet Ihr in der Kirche erbittert, wenn Ihr Gottes Liebe verkündet.“
Der Abbé, der schon die Tür geöffnet hatte, trat noch einmal zurück: „Solche Gedanken hast du, Mädchen, im Tal von Domremi und im Hause der Darcs. Mir ist, als rede von fernher ein dunkles Blut aus fremder grosser Welt. Aber bau nicht darauf, Johanna. Höre. Jedem Geschöpf misst der Schöpfer das Öl seiner Unsterblichkeit zu, aber der Mensch, der sich der Gabe bewusst wird, wähnt, dass ihre Fülle unendlich sei, er gibt sich aus, und dann kommen die Enttäuschungen und Verzweiflungen und mästen sich daran, und einmal fühlst du, dass die Kräfte deiner Seele längst ausgebrannt sind; aber du bist dazu verdammt, weiterzuleben, ein Stück Fleisch ohne Liebe und Hoffnung. Siehe, Johanna, so leben die Dörfer hier im Tal, so keucht das Land, das heute noch Frankreich heisst, in den letzten Zügen; ein gestorbener Leib, und aus seinen Röhren gurgelt die Verwesung. Denn der am ärgsten von dem Öl der göttlichen Begeisterung frisst, der Krieg ist es, Mädchen. Ihm zu dienen, unter ihm zu leiden, das ist das Los dieses Landes und seiner Menschen, dazu sind wir da. So antwortet Gott auf deine Frage, Johanna. So schlägt uns ihre Kralle, so zerrt sie uns Aas, so spielt sie mit uns, die grausame höhnische Katze Gott.“ Als Carron hinausging, war sein Gesicht von Erbitterung verzerrt.
Sogleich atmete Johanna auf, ihre Starrheit fiel, und sie hatte sichere, behende Bewegungen, als sie sich auf den Rand des Totenbetts setzte und sich über die tote Schwester beugte: „Du hast das gehört, Therese“, nickte sie ihr zu, „sollen wir es glauben, du weisst ja nun alles.“ Als sich Johanna tiefer hinabneigte, wurde sie von der Kälte des Todes angeweht, dass sie zurückfuhr und ans Fenster trat. Es war ein stiller Mittag geworden, mit bellenden Schlägen schellte die Glocke von Domremi ihn herüber, und unter diesen Tönen entschlief aller menschliche Laut. Als Johanna den Kopf senkte und die Augen schloss, rauschte der Fluss lauter, drängender gurrten die Tauben, die schwarze Erde brach auf, der Duft des atmenden Tals umstrich ihre Haut. So stand sie lange, die Sonne stieg und traf in ihr Fenster. Johanna war tief in sich versunken. Sie wusste nicht, dass sie sich der Wärme entgegenschob, dass sie Tränen zwischen den Lidern hatte und dass ihr Gesicht in einer herben Seligkeit strahlte. Auf dem Fluss trieb krachend ein Rudel Eisschollen, und er rauschte empört dagegen, das dunkle Blut einer fremden grossen Welt. —
Der Frühling, geschwinde von weissen Wolken überflogen, erstickte in der Glut des Sommers. Der Lehmgrund der Strassen klaffte vor Trockenheit. Das Land dörrte. Geil und unfruchtbar schossen die Halme und sengten. Lähmung lag über den Strohdächern, die Dorfstrasse war menschenleer. Schwitzend wälzten sie sich auf den zerwühlten Betten und keuchten vor sich hin. Dann versiegten die Brunnen, die Erde schlürfte sie ein, bald enthielten sie nur einen fauligen Bodensatz. Sie schleppten ihre Kübel zum Fluss; darin schwammen tote Pferde und Maultiere, zersplitterte Lanzenschäfte und abgesprengte Kolben, Bretter von Marketenderwagen und Lederriemen und ein toter Mann: die Überbleibsel eines Gefechts. Von diesem Wasser erkrankten viele und fielen in Fieber, das ansteckend war. Man schleppte sie aus dem Ort auf ein Brachfeld, dort lagen sie auf dem rissigen Boden, unfähig, sich zu erheben, unter der brennenden Sonne und winselten nach Wasser. Heisse Windstösse trieben Wolken über sie und bedeckten ihre durchschwitzten Fetzen mit Sand; Staub sass in ihren Haaren und Augen, sie bissen Staub. Manchen gaben Verzweiflung oder Wahnsinn Kraft, sich aufzuraffen, ihre ausgemergelten Gestalten schwankten im grauen Glast; mit aufgerissenen Augen, die nichts sahen, stürzten sie zum Dorf, kratzten an den Türen, schlugen unterwegs hin und reckten sich aus. Wenn die Lüfte der Nacht ihre Sandtromben über das Feld wehten, war das Krankenlager ein einziger Schrei; manche sahen in der letzten Verzückung die heilige Jungfrau auf ihrem Wolkenwagen und taumelten der Erscheinung entgegen, jubelnd, sie gingen in die schmerzlose Herrlichkeit ein; andere glaubten, das Höllenreich komme über sie, und wühlten ihre Gesichter in die gedörrte Erde, gruben sich ein, prusteten, schnauften und erstickten.
Ausserhalb des Dorfs, am Fuss des Ketzerbergs, lag Johanna in einem Hain von Eichen und grünen Büschen und kaute Gräser. Einige Schafe und Ziegen weideten um sie, müde und besinnlich. Sie nahm ein Blatt zwischen die Finger und blies einige Töne. Sie sah den Berg hinauf, wo Lucien die Kühe trieb. Sie hörte, wie sich der Fluss an den Ufern rieb. Sie gähnte und schlief ein. Zerschlagen schleppte sie sich am Abend zum Hause hinan, verschlossen sass sie am Tisch, ging in ihre Kammer und dachte auf ihrem Kissen: Noch nie habe ich so sehr geschlafen, und schlief ein. Heiss und trübe wachte sie auf, wunderte sich oft: Warum fehlt mir Therese gar nicht? und freute sich auf das Gras und die Gebüsche, weiterzuschlafen. Das Tal des Flusses erweiterte sich hier zu einer flachen Mulde, und von seinen Rändern kam oft ein brennendes Auffahren: es klirrte und rasselte, die Kriegszüge marschierten, über dem quellenden Staub blitzten die Reihen der Helme, Pferderücken glänzten, hoch wimpelten die Fähnlein. Die Ketten der Planwagen schaukelten, alles trieb dahin, ferner dröhnte die Trommel, der Gesang brach ab, und in der Leere flimmerte das Licht. Johanna sah hinauf, wo über ihr die schweflige Kuppe stand, sie strich über ihre Lenden, die manchmal so schwer waren. So müssen schwangere Frauen fühlen, dachte sie und lächelte schmerzlich. Ihr Kopf wurde schwer, sie sank hin und schlief. In den Augenblicken, wenn die Wachheit verlöschte, hörte sie noch einmal einen Trommelwirbel, Lanzen blitzten in ihren Augen, ein Pferd wieherte, und ein Schrei scholl über die Welt, in dem sie sich schauernd verbarg.
Nach diesen trägen Tagen musste sie wandern. Es kamen die Nächte, die von schlagenden Schwertern zerspalten wurden, dass sie plötzlich aufstand und ging, hin und her am Fluss, Gräser strichen um ihre Schuhe, an den Rändern gurgelte das Wasser; der Eichenhain hielt die Wärme, und durch seine Blätter brach der erste Fall der Sonne. Johanna ging die Strasse hinauf, erschrak vor der Weite, die verführte, und kehrte um; den Ketzerberg hinauf, an dessen Hang Lucien die Kühe weidete, aber sie sah ihn nicht, einsam und kühl in der steigenden Glut sass sie auf der gelben Kuppe und liess Sand durch die Finger rinnen. Wieder schritt sie hinab, die Strasse umfing sie und zog sie ins Dorf, wo auf einem Trümmerhaufen eine wüste Kutte stampfte und sprang, der rothaarige Bruder Richard, von einem Menschenklumpen umgeben. Sie wichen vor ihr, aber schmähten sie nicht mehr, auch dazu waren sie zu schwach. Johanna stand mitten im Haufen und hatte eine Leere um sich. Der Frater klappte einen Kasten auf und wühlte in seiner Erde: „Der Boden des Heiligen Landes“, zeterte er, „leibhaft kommt er zu euch, dass ihr ihn küsst und büsst!“ Er zog eine Flasche aus seiner Wolle: „Wasser aus dem Bach Kidron, dem Tal der Tränen! Noch sind nicht genug von euren geflossen, und ehe nicht jeder von euch soviel wie dieses geweint hat“, er schüttelte das Glas, „eher nicht kommt die Erlösung! Weint, büsst, küsst den Staub, auf dem der Erlöser wandelte!“ Unter seinen struppigen Brauen sprühte der Wahnsinn rot, er löste vom Gürtel die Geissel. „Vermaledeite Pestbeulen“, schrie er und stampfte zornig, „was fallt ihr nicht nieder, sehe ich nicht den Geifer eurer Gedanken und die Ratten der Gier in euren Schläfen?“ Er musterte sie drohend und schwang die Peitsche: „Nieder, nieder!“ Köpfe senkten sich, Schultern bebten, und schon kniete die Greisin Dussac und beugte sich gierig über den heiligen Trog. Als sie sich erhob — Erde klebte an ihrem Mund —, kam von ihren Runzeln ein Leuchten, Röte lag auf dem welken Fleisch, sie hob die Schenkel zum Tanz: „Ewige Seligkeit“, sang sie und hüpfte davon, „sterben will ich nun, da ich den heiligen Boden geküsst!“ Sie sahen ihr alle nach. „Nieder, nieder“, knatterte die Geissel. „Sterben, sterben“, heulte das Weiblein und breitete die Arme gegen die Sonne, „ich habe des Heilands Erde berührt“, und drehte und wiegte sich. „Demütigt, demütigt euch“, donnerte der Bruder und stampfte ungeduldig. „Demütigt euch“, lachte die Greisin hell und albern. Frauen schluchzten, die Männer schüttelten sich, dann sank alles in den Staub. „Auf die Knie auch du“, eiferte der Bruder und liess die Peitsche gegen Johanna kreisen. Wortlos blickte sie ihn aus ihren schmalen Augen an, lange stand sie wie im Traum, dann drehte sie sich und ging weiter.
Wohin, wohin? Den Ketzerberg hinauf, Sand durch die Finger laufen lassen und unter ihr dörrte das Land weit und flimmernd über Mittag; alles war tot und leer. Sie fühlte nichts, ungekühlt und nicht erhitzt wanderte sie durch die rastlosen Tage, dunkel verschwebend im Dunkeln stand sie auf der Kuppe und starrte den Fluss entlang. Unvermutet erschien sie im Haus, ging in die Kammer hinauf, begann ihr Kleid zu öffnen, liess die Hände sinken und ging wieder hinaus. Der Vater gluckste, Marion sah sie scheu an, Lucien zog den Kopf zwischen die Schultern, aber Johanna trat unter dem Vollmond auf den Weg zum Dorfe und ging zwischen den Häusern hin. „Die Sünden der Darcs gehen um“, murmelten die Bauern; manchmal wurde sie von einem Stein getroffen und zuckte nicht, Küsse kamen aus den Gärten, und hinter Büschen erschienen Burschen, wollten sie ins Dunkle ziehen oder Zoten flüstern, aber sie wagten es nicht, denn sie trieb wie eine Wolke vor dem Mond dahin, bis der Morgen graute und sie am Fluss vor Müdigkeit hingestreckt wurde.
An einem Abend, als sie vor der Haustür stand, kam ein staubiges Gefährt die Strasse gehumpelt. Johanna betrachtete den Karren, während zwei Männer vom Bock kletterten und Nachtlager forderten, ihre Gäule könnten nicht mehr, im Namen des Königs. Der eine ein würdiger Greis mit schlohweissem Bart, den man rauschen hörte, wenn er ihn strich; der andere ein kecker Junge mit blondem Schnauzbart und lustigen Augen. Sie lachten, als der alte Darc hinaustrippelte und die hohe Ehre meckerte, die ihm die Herren erwiesen, und schlugen dem Männlein wohlwollend die Schulter. Silbern klirrten ihre Sporen, und Johanna sah aufmerksam auf die blauen Pluderhosen, die seitwärts mit Seide und Troddeln verschnürt waren. Auf ihrer Brust prangten goldgestickt die Lilien Frankreichs, und ärmellose gelbe Westen hingen über ihren blauen Wämsern. Sie wischten die Stirnen und warfen die wallenden Schlapphüte ab, auf deren Krempen blaue Federn von Goldagraffen gehalten wurden: heiss sind die Tage. Sie reichten Johanna ihre Wehrgehenke und zogen die Dolche aus den Seidenschärpen: „Man erleichtere uns und gebe uns zu essen.“ Sie schienen sehr fröhlich.
Nach dem Imbiss — sie sassen im kühlen Hof — begannen sie zu schimpfen, als sie die Einrichtung ihres Karrens erläuterten: Man klappte ihn auf und besteckte ihn mit einem Gestänge, so war flugs die schmuckste Tribüne unter einem prächtigen Baldachin errichtet, mit den Wappen der Grafschaften, Fahnen und bunten Bildern wilder Getümmel lustig behangen. Diese Schlachten hatte der Rauschebart dem Volk zu preisen: „Seht die Gefangennahme des Papstes Bonifatius, der Achte geheissen, zu Amagni, durch unsern König Philipp, der Siebente seines Namens im glorreichen Geschlecht der Capetinger, zubenannt der Schöne! Hier besiegt der Siebente Karl aus der Hause der Valois, das Gott erhalten möge, die aufständischen flandrischen Bürger auf dem Gefild von Roosebeeke im Jahre des Heils eintausenddreihundertundzweiundachtzig — ach, ihr Lieben!“ Sie steckten ihren Kram ärgerlich zusammen, kein Geschäft mehr mit der Werberei. Sie redeten sich in gallige Laune. Aus der Falltür des Hofs tauchte der alte Darc. „Ein Krüglein Wein“, gluckste er, „aus dem Versteck, sehr kühl und sehr alt, und, Marion, für die Herren das alte Zinn aus der Truhe.“ Dankbar lachten die Soldaten, als sie die Becher streichelten: „Man dörrt auf den Strassen aus, ihr Freunde.“ „Die Laternen, Marion, vor die Herren gestellt, ein Krüglein noch aus dem Keller, die Herren mögen heimisch sein und erzählen.“ Jakob Dark strahlte, als er von den Strassen hörte. Die Kinder gingen zu Bett, die Lichter brannten, über dem Haus flimmerten heiss und südlich die Sterne. Unter dem Schatten der Linde leuchtete Johannas bleiches Gesicht.
Ach, ihr Guten! Die Werber klagten. Zehn Jahre Krieg, noch zehn und noch zehn, fast hundert Jahre ein einziger Krieg. Der Alte war in den Krieg geboren, er hatte sein Leben lang nur die Werbetrommel gerührt, immer schon blickte er würdig und gediegen aus seinem Rauschebart, der jetzt weiss geworden war, der Bart war eine Empfehlung, Soldat zu werden, ganz gewiss. Er liebkoste ihn. Der Junge wirbelte sein keckes Bärtlein und machte fröhliche Augen: Lustig ist’s Soldatenleben, sollte das heissen. „Vor vierzig Jahren, meine Freunde, war’s eine Freude zu werben, als noch Mut und Kraft im Volk waren. Damals rauschte es in den Dörfern, wenn sie ihren Karren aufschlugen, es war ein gutes Geschäft; sie strömten aus den Gilden und Zünften, die Gesellen und Lehrlinge, die Studenten und Scholaren. Ja, damals. Oh, meine Freunde, Tränen hatten sie in den Augen, wenn wir den Händedruck wechselten, schluchzend und jauchzend haben sie den Vertrag unterzeichnet, und wie oft hat’s mich Abgebrühten ergriffen. Sagt, wo ist alles hin? Ausgesaugt ist das Mark der Menschen, wie sollen ihre Kinder Kraft haben, auch nur den Sattelgurt anzuziehen? Seht, das hat der hundertjährige Krieg gemacht. Kämet ihr heute in die Stadt: ein Gerümpel von Häusern. Die Welt von damals versank, Abfall blieb. Da kamen nur die Galgenvögel, die Gesellen, die vor Angst schlottern, die Kerls mit den geschorenen Köpfen und grindigen Augen. Auch die fehlen jetzt. Wir haben das Handgeld nicht mehr“ — der Rauschebart schlug den Tisch, dass die Becher klapperten —, „wer kommt ohne Geld, jedermann will heut Geld sehen. Und so gehen die Jahre, erst langsam, dann hurtiger, und dann bist du auf einmal so alt wie der Krieg. Jeden Tag hast du auf den Strassen gelegen und den Karren aufgeklappt und deine Bilder vorgezeigt — und du möchtest einen Tag erleben, wo du die Gäule nicht mehr anzuschirren hast, du liegst in deinem Bett und lächelst in die liebe Sonne durchs Fenster hinaus. Bitten wir zuviel, ihr Heiligen, so versagt uns alle Fürsprache an Gottes Thron. So aber nicht, hört uns: Man wird es müde, man wundert sich, dass man noch lebt, und mancher hat’s schon in der Jugend so sehr satt!“ Der Rauschebart sah den Jungen an. Der Junge nickte und hatte kleine verschwommene Augen. Der alte Darc meckerte melancholisch.
„Sagt doch“, begehrte eine Stimme etwas atemlos, „wo schlagen sie sich jetzt?“
Sie sahen sich um: da sass Johanna im Schatten mit leuchtendem Gesicht. Der Vater gluckste, der weisse Bart zuckte, der Junge lachte erbittert: Wo man sich schlüge, seltsam gefragt. Langsam und verlegen trat Johanna an den Tisch.
Ja, die Jungfrau war noch sehr unerfahren in dieser Zeit. Der Blonde nahm eine Holzkohle und zeichnete auf die weisse Wand. In die Ecke, unten rechts, ein D, das bedeutete Domremi, hoch oben links, angefangen unterm Dachstroh, einen Strich, die Küste gegen England, den hundertjährigen Feind. Hier ein C, das heisst Calais, dahin schäumt der Bug ihrer Schiffe, dort steigen sie über die Landungsbrücken und stampfen den fremden Boden, dass die Beinschienen rasselten. Der Werber trat gewaltig das Hofpflaster, rollte die Augen und warf den Kopf in den Nacken: So schritten sie daher, die englischen Erbfeinde. Der Blonde war oft in Calais gewesen, zu horchen, was es Neues gäbe; wenn man einen Bauernkittel anlegte und eine dummes Gesicht machte, ging es so hin. Es kommen auch andere Schiffe, solche mit geblähten Bäuchen, die sich masslos entleerten: Säcke mit Korn und Mehl, die Weinfässer, die verpichten Tonnen mit Gesalzenem, Paraden von geräucherten Schinken und Speckschwarten; marschierten herbei die Packen von Zeltleinwand, die Ballen Stoffe für die Röcke, Seide für die Schärpen, Häute für die Stiefel und Koller, die Bündel Lanzen und Stangen, die Feldschlangen, Musketen, Armbrüste. Oh, Calais! Er schlug drei schwarze Kreuze hinter das Zeichen: Dort aus dem Norden brach alles Unheil über das Land. Weiter schlängelte die Kohle über die Wand: das die Somme, das die Oise, die Marne, die Seine, lauter breite, schwellende Ströme, grüne Weiten, liebliche Hügel, fette Erde von grosser Fruchtbarkeit, hohe Halme, von französischem Blute schwankend. Aber alles vergebens, aus Calais strömt sie und verbreitert sich, die Sintflut der Feinde; sie ist nicht zu dämmen, alles Land ist ersoffen.
Wo man sich schlüge, begehre die Jungfrau? Die Kohle markierte einen Winkel, das Knie der Loire, und an seiner Spitze ein O: die Festung Orleans, die letzte Hoffnung, das letzte Bollwerk. Betet, ihr Guten, dass es nicht falle, dann kann der Dauphin nach Spanien wandern, wir sind am Ende. Seht, das Land, wie es ruht, aber vielleicht landen in dieser Nacht die Belagerungsgeschütze, die sie schon lange erwarten; die vierzehn kupfernen Zweipfünder kamen erst neulich, auch die grossen Achtzehnzöller, sie montierten eben ihren Langen Tommy, der Steine von vierundzwanzig Pfund schleudern werde, und waren dabei, das Lange Laster zusammenzusetzen, einen Kran aus Eichenbalken, damit sie die Rohre auf die Lafetten heben wollten. Hochgemut sind sie in Calais, sie protzen mit ihren neuen Batterien, fünfzig Geschützen, Tausenden von Steinkugeln, Hunderten von Schutzschildern, Metallgiessereien, Gehäusen für Pfeile und Bogen, und jetzt fange der gute Krieg erst an, lachten die frechen Fremden; man könnte vor Wut heulen. — Lange betrachtete der Soldat die Karte, dann zog er Striche vom Norden zur Loire, noch mehr und mehr, bis die Breite der Mauer eine schwarze Fläche wurde, in die von Süden das Dreieck des Flusses weiss hineinstiess. Dabei splitterte die Kohle, und er warf sie wütend gegen seine Zeichnung: „Gut getroffen, dort liegt Paris, die Pestbeule, die ungetreue Stadt.“ Der Werber atmete tief und trank: Auf die Gesundheit der Jungfrau und der Herren, und vielleicht habe sie jetzt den Krieg ein wenig begriffen.
Johannas Augen leuchteten über die Wand, ihre Haarwelle zitterte, als sie leicht verneinte. „Wer führt euch denn?“ fragte sie.
Verzweifelt lachte der Junge, und der Alte liess bedächtig den Bart rauschen. Ganz recht gefragt, lobte er, eigentlich führe Dunois, den man den Bastard nenne, ein prächtiger Kerl, eine dunkle Schönheit, und wenn er aus seinen weissen Zähnen die Front anlache, könne einem schon der Atem stocken. Aber er sei von einer spanischen Mutter, wiegte er bedenklich das weisse Haupt, und wie die da unten sich gäben, gross in Gesten und Worten, beweglich von Gemüt, leicht entflammt und leicht gerührt, aber, erhob er warnend den Finger, bald entmutigt, wankelmütig, ein Stück Schwefel, das rasch abbrennt. Aber wie sollte er diese Horden führen? Hatten sie kürzlich verstaubte Köpfe auf einem Brachfeld gesehen, waren es die Toulouser Musketiere, kampierten in Erdlöchern und stellten den Hasen und Vögeln Fallen; kamen heraus, Strohmatten um die Füsse, schämten sich und schimpften dann: „Stellt die Arbeit ein, ihr Werber, damit der Krieg endlich aufhört.“ Wir mussten die Pferde peitschen, sie warfen Steine.
„Ja“, sagte Johanna leise, „aber wo ist der König?“
Der König, fuhr der Junge auf, sei kein König, sondern ein ungekrönter Dauphin, auch als solcher achtenswert, verstände er, was der Augenblick fordert: sich aufs Pferd zu setzen und voranzureiten nach Orleans, die Besatzung erregen, dass sie aushalte; etwas beginnen, sei’s auch eine Torheit. So aber, wer rede noch von dem blonden Jungen mit dem welken Gesicht und den zerfahrenen Bewegungen? Herumgereicht werde er, abgeschoben von einem Bischof zum nächsten Herzog der Reihe nach. Liegen sie zum Beispiel dem Herzog von Ligny auf dem Schloss herum, sagt der eines Tages zum Kämmerer: „Pack deinen Sire ein und macht auch fort, ich brauche mein Haus“, dann wird der Hofkram auf die Wagen geladen und weitergefahren. Den König setzen sie in seine Karosse. Er hat noch drei ganz herrliche von früher, solche mit Silberglanz und blauen Lilien, in den anderen fahren seine beiden Weiber, die Schwarze und die Blonde. Die Kutschen sind mit weisser Seide gepolstert und mit silbernen Flächen ausgelegt, damit sie sich spiegeln können, und haben brokatene Vorhänge, damit sie die Fenster verhängen, wenn sie an den ausgebrannten Gehöften vorbeikommen oder sich an elenden Soldaten hinwinden; so sehr schämt sich der König. Auch die Landsknechte schämen sich, wenn ihre Scham nicht zu Wut umschlägt, und so brennt die Scham auf allen Gesichtern, keiner sieht dem andern ins Auge, sie gehen wie im Schlaf dahin. Aber die Kais von Calais sind auch in dieser Nacht mit Fackeln besteckt, und aus den Fettschiffen steigen jetzt wohl die Hammelherden, die Mastochsen, Schafe und Ziegen, alles Frass für den Feind. Die Strassen von Calais rasseln auch in dieser Nacht, die Fenster klirren, die Batterien fahren aus, Schwadronen kommen von nächtlichen Übungen, und die Pferde wiehern den Ställen zu und der Morgenfrische, die kühl vom Meere kommt.
Feierlich streckte der Weissbart den Arm zu den Sternen: „Und horcht, meine Freunde, Frankreich dagegen. Es schläft.“ Ein matter Wind durchfuhr die Bäume, am Hang des Ketzerbergs begann eine Nachtigall, und es war Zeit zum Schlafen.
Der Karren der Werber war in dem Staub der Strasse verweht, und Johanna räumte ihr Nachtlager aus der Diele, als ihr aus dem Stroh ein kleiner Dolch entgegensprang. Sie zog ihn aus der Lederscheide, strich über seine vier Schärfen und harkte mit dem Fingernagel in der ziselierten Inschrift. Der alte Darc beugte sich über ihre Schulter und deutete sie: Stich zu und triff — in ein Feindesherz — für dein armes Land. Abwesend steckte Johanna das Eisen in ihren Rockbund. Das Stroh roch nach Männern; Strassenstaub, Leder, durchschwitztem Linnen. Noch etwas war darin, und sie fand es jetzt, es war der Geruch von dem Fett, mit dem Waffen eingestrichen werden, auch der Dolch trug ihn. Sie wollte nach dem Ufer hinab, wo die Tiere warteten, kam durch den Hof und blieb vor der Karte stehen, die der Blonde auf die Mauer geworfen hatte; gestern flackerte die Zeichnung im Laternenschein, heute starrte sie nüchtern und hart. Sie blickte nach Calais unterm Dachstroh, sie sah nach Domremi hinunter und mass die Entfernung; dazwischen das verkohlte Land, das nach Holzbrand roch. Johanna ging zum Ufer, legte sich in die Büsche und hörte, wie sich der Fluss an den Ufern rieb. Sie nahm ein Blatt zwischen die Finger und blies, am Berghang weidete Lucien die Kühe, der Raum des Hofes öffnete sich gegen sie, und in seinem Hintergrunde dunkelte das schwarze Land, das überflutete.
Immer trug sie nun den Dolch bei sich. Wenn er sie im Liegen drückte, drehte sie ihn über die Augen, las seinen Befehl, und in ihren Blick traten die verkohlten Lande. Lasst mich doch, wand sie sich, legte die Waffe auf ihr Herz und schlief. Sie fuhr auf, über den Talrändern wirbelten die Strassen, eine Fanfare schmetterte nieder, Gäule trappelten, und aus dem Rauschen des Fussvolks fuhr ein Schrei über die Welt. Mit schmalen Augen starrte sie gegen die Hitze der Strassen, schaudernd barg sie sich an der kühlen Erde, biss in die Gräser und keuchte vor Furcht. Sie schwankte zum Hause hinauf, mit breiten weichen Schritten wie eine Frau, die gebären will. Oben standen immer die Fenster offen, aber der Geruch war in die Mauern geätzt: Staub der Strasse, durchschwitztes Leder, verbranntes Holz und Öl, mit dem man die Panzer schmiert.
Es kam kein Regen. Noch dürstete das Land bis zu dem Tage, den der Abbé Carron in der Chronik beschrieb: da entluden sich wohl ein halb Dutzend Gewitter auf das Tal, ihre Wasser sammelten sich in den Becken der überlagernden Hochebenen, stürzten giessbachartig über die Ackerhänge, schwemmten die Saaten aus, brachen ins Dorf, unterspülten Fundamente, Häuser krachten ein. Als sich die Wasser verlaufen hatten, waren die Hügel des Kirchhofs glatt gewaschen und auf dem Blachfeld der Fieberkranken die meisten ertrunken; die Flut hatte die zerschundenen Leichen über die Gräber verstreut, gleich zum Einscharren. Einige hatten sich in die Kirche geschleppt und stammelten vor dem Altar ihren Dank für das Wasser, das sie wiedergeboren habe, im Fleisch und Geist, da erhitzten sich ihre Fieber von neuem, und an der geweihten Stätte wurden sie von dem Wahnsinnstrieb nach Heilung befallen; sie kletterten auf den Altar. Einer stand auf der Kanzel predigend, bis er die Treppe hinabkollerte und mit zerbrochenem Genick auf dem Grabstein der alten Grafen von Domremi liegenblieb. Einer sprang gegen die Tafel der Jungfrau Maria an und rang sie aus ihrem Rahmen, einer berauschte sich an dem Messwein und frass die Oblaten, bis sie beide herabgewischt wurden und auf die Kanten der Altarstufen schmetterten. So endete dieser Tag.
Als die Darcs an diesem Morgen erwachten, merkten sie am Flussufer, dort unten halbwegs zwischen ihrem Haus und dem Dorf, ein kleines Getümmel. Aus einem grausam vergitterten Planwagen schleppten Leute Bretter und Stangen, bauten eine kleine Bühne vor einem bunten Vorhang, rammten Bänklein in die Erde und umgaben alles mit einem Zaun, durch den eine Art Tor führte, das sie mit Inschriften, Tafeln und Fahnen behängten. Johanna schlief schon bei den Tieren zwischen den Büschen, aber der alte Darc gluckste, während er das Treiben beobachtete, und die Kinder brannten vor Neugier. Sie kamen zurück und stammelten: Wolfsmenschen, echte Wolfsmenschen, die da unten hatten es ihnen erzählt. Der Vater trippelte erregt auf der Stelle, doch wiegte er zweifelnd den Kopf, sie seien wohl nicht echt, er kenne das Gewerbe.
Noch an keinem Tage lag so dichtes Silber in der Luft, der Lauf des Flusses spiegelte es in die schmerzenden Augen, und unerträglich spannte es sich am Nachmittag. Reglos standen die Gräser, die Sträucher starrten. Marion kam hinab; am Abend würden sie Wolfsmenschen sehen, echte aus den türkischen Wäldern, erzählte sie und molk die Ziegen. Matt lag Johanna, hatte ihr Kleid geöffnet, das Hemd klebte auf den Brüsten, die mühsam atmeten, sie konnte ihren Blick nicht vom Wasser wenden, zwischen ihren zusammengekniffenen Wimpern standen Tränen, so sehr stach der Glanz des Gewoges. Als sie auf einem Halm blasend lockte, kam es wieder, hinter ihrem Weinen und aus dem silbernen Dunst trieb es auf sie zu, die Fusssohlen zuerst, kam er herangeschwommen, auf dem Rücken ausruhend, der tote König, und ihr Herz stürmte, als sie ihn erkannte. Von seinen Knöcheln über die Knie bis in die Mitte der Brust reichte die Silberschneide des Schwertes, und unter dem Kinn hielten seine bleichen Hände den Griff von Gold, der in einem rubinenen Kranz endete. Ganz langsam kam er, sie sah die Panzermaschen fest um die Schienenbeine gewunden; blau schimmerte, leicht einsinkend in den Spalt der Schenkel, das Gewand um seine Schlankheit, nicht mehr welkte die Haut seines Gesichts, der feine Rücken der Nase stand umkräuselt und teilte die Flut, leises Wasser trieb über seine geschlossenen Augen, und das blonde Haar hing streng gescheitelt auf die Schultern. Als er neben ihr war, rang er mit seinem Tode, die Finger zitterten, die Lippen bewegten sich schmal und schmekkend, und jetzt gingen seine Augen auf und sahen sie an. Da weinte sie in die Gräser.