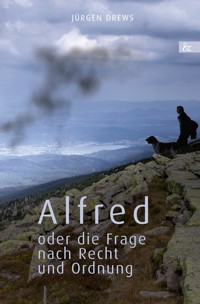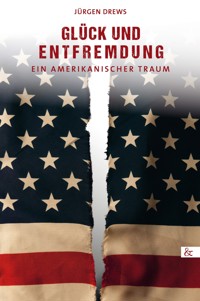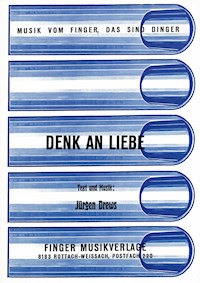Jürgen Drews, 1933 in Berlin geboren, studierte Medizin, habilitierte sich und wurde Professor für Innere Medizin in Heidelberg und Molekulare Genetik in New Jersey, USA. Von 1970 bis 1998 leitete er die weltweite Forschung und Entwicklung großer international tätiger Pharma-Firmen, zuletzt als Mitglied der Konzernleitung bei Hoffmann-La Roche. Er ist heute freiberuflich tätig und lebt in der Nähe von München und in Naples, USA. 2004 erhielt er den Beckmann Preis der American Laboratory Association für bedeutende Beiträge zur Arzneimittelforschung. Drews veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Artikel und ist Autor und Herausgeber vieler Fachbücher, z.B. »In Quest of Tomorrow’s Medicines« (Springer, New York, 2000). Daneben publizierte er mehrere Romane, u.a. »El Mundo oder die Leugnung der Vergänglichkeit« (2003), »Menschengedenken« (2005), »Der Spiegelmord im Mörderspiel« (2006), »Wie wir den Krieg gewannen« (2007), »Jahresringe« (2008) sowie Erzählungen und Gedichtbände.
Jürgen Drews
Der verschwundenePianist
Roman
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter www.buchmedia.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
März 2010
© 2010 Buch&media GmbH, München
Umschlaggestaltung: Kay Fretwurst, Freienbrink
Umschlagbild: Alexander Raths
Herstellung: Books on Demand GmbH, Norderstedt
Printed in Germany · ISBN 978-3-86520-365-6
Einige handelnde Personen dieses Romans haben in dem fraglichen Zeitraum wirklich gelebt. Ihre Verwicklung in die hier erzählte Geschichte ist jedoch ebenso fiktiv wie die Geschichte selbst.
Inhalt
____________________
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
1
____________________
Hin und wieder gerate ich in Situationen, die mir unwirklich erscheinen. Dann ist mir, als hätte ich mich in ein fremdes Dasein verlaufen, in dem ich eigentlich nichts zu suchen habe. Jemand hat mein Leben mit einer anderen Existenz verwechselt. Für eine kurze Zeit bin ich ein anderer, nicht Klaus Mosbacher aus München, sondern eine andere, nicht näher zu benennende Person, die meinen Lebenslauf zwar genau kennt, ihn aber nicht selbst erlebt hat. Solche Zustände zeichnen sich durch ein Gefühl der Leere aus. Ich befinde mich an einem Ort, der mir vielleicht nicht ganz fremd, aber doch unbekannt ist. Jedenfalls erlebe ich ihn als unbekannt. Ich weiß nicht, wie ich an diesen Ort gekommen bin. Natürlich ließe sich mein Weg hierher, in diese alte Wohnung im obersten Stockwerk eines stattlichen Mietshauses am Stubenring in Wien, rekonstruieren. Ich weiß das. Aber es würde mich eine Anstrengung kosten, und ich bin zu müde oder einfach zu träge, um eine solche Anstrengung jetzt zu unternehmen. In gewissem Sinn genieße ich dieses Gefühl der Leere und die damit verbundene Orientierungslosigkeit. Warum? Weil plötzlich alles neu ist. Jamais vu. Ich habe das hier noch nie gesehen.
Ich sitze in einem tiefen Sessel, Fauteuil sagen sie hier in Wien dazu, und bewundere die reichen bunten Jugendstilornamente an den Fenstern. Im schräg einfallenden Nachmittagslicht glühen sie auf, rubinrot, gelb oder grün, leuchten zwischendurch in unergründlichem Blau und werfen dabei farbige Reflexe auf die helle Seidentapete des Zimmers, in dem ich mich befinde. Auch an die weiße Decke, die von einem breiten Band von Stuckverzierungen eingerahmt wird, Putten, die einander Trauben reichen und sich von Girlande zu Girlande schwingen, fallen einige der farbigen Lichtbahnen. Und drüben, an der den Fenstern gegenüberliegenden Wand, schimmern Schalltrichter und Kurbel aus Messing, Kästen aus rotem Holz, Palisander oder Mahagoni, im Nachmittagslicht. Mein Blick wandert an den geräumigen Etagen eines Regals entlang, auf denen diese Gegenstände aufgereiht stehen. Phonographen, Plattenspieler würde man heute sagen, auf denen man Schellackplatten, die Tonträger einer schon viele Jahrzehnte zurückliegenden Zeit, zum Klingen brachte. Diese ersten, besonders prächtigen Modelle mussten nach einigen Läufen immer aufgezogen werden wie Spieluhren. Neben ihnen stehen Plattenspieler, wie ich sie in meiner Jugend kannte, flache Geräte mit Plastikhauben zur Wiedergabe der auf Langspielplatten gespeicherten Musik: 33 1/3 oder 45 Umdrehungen pro Minute fällt mir dazu ein. Auch Studiogeräte befinden sich darunter, Geräte mit schweren Drehtellern, einige Kilogramm wiegen sie, die einen besonders ruhigen Lauf ermöglichen. Sie sind mit Tonarmen ausgestattet, deren Neigung, den Diamanten oder Saphir beim Abspielen einer Platte immer stärker an die Innenseite einer Tonrille zu pressen, je enger die Kreise werden, durch kleine Gewichte ausgeglichen wird. Diese Gewichte ziehen den Tonarm beständig nach außen. Antiscating nannte man das früher. Je weiter nach rechts und nach unten mein Blick wandert, desto neuzeitlicher werden die Apparate und desto vertrauter wird mir der Ort, an dem ich mich befinde. Auf dem Parkett vor dem Regal steht eine Plattenschneidemaschine: ein Aufnahmegerät, mit dem man die über Mikrophone empfangenen Tonsignale direkt auf eine Polyvinyloder Polyacetatplatte übertragen kann. Im unteren Teil des Regals stehen Tonbandgeräte und Abspielvorrichtungen für CDs. Lautsprecher, die aussehen wie kleine Würfel mit einer Kantenlänge von sieben oder acht Zentimetern, sind so im Raum verteilt, dass überall, vor allem aber an der Stelle, an der ich sitze, ein perfekter Raumklang entstehen kann.
»Wie im Goldenen Saal des Musikvereins«, hat mir Anton Muxeneder versichert.
Anton Muxeneder. Dies ist seine Wohnung. Einige Male war ich schon hier. Der Raum mit den bunten Glasfenstern und den vielen alten und neuen Geräten ist sein Tonstudio. Sein Arbeitsraum, in dem er große Musiksendungen des Österreichischen Rundfunks oder auch benachbarter deutscher oder anderer europäischer Sender aufnimmt, entweder auf Tonbändern oder gelegentlich gleich auf Polyvinylplatten. Hier, in dem großen Schrank hinter mir und in einem »Archiv«, das er sich in einer ehemaligen Dienstbotenkammer seiner Riesenwohnung eingerichtet hat, liegen die Schätze, die Muxeneder gesammelt hat – durch Jahre und Jahrzehnte hindurch. Vor mir, auf einem niedrigen Tisch, liegen Bücher, stehen Karteikästen. Drei Kataloge hat Anton angelegt, um seine Aufnahmen jederzeit auffinden und abspielen zu können: ein Verzeichnis der Konzerte, die er aufgenommen hat, ein Personalregister, in dem alle Künstler vermerkt oder aufgeführt sind, die bei den Konzerten mitgewirkt haben, und ein weiterer Katalog mit allen Werken, die hier in dem großen Schrank und drüben im Archiv auf Platten, Magnetbändern oder neuerdings auf CDs festgehalten sind.
»Am besten wäre es, wenn du dir einmal ein paar Tage Zeit nimmst, dich ins Studio setzt und dir ein Bild davon machst, was vorhanden ist«, riet mir Anton, nachdem er sich entschlossen hatte, seine Wohnung aufzugeben und in ein Heim für betreutes Wohnen zu wechseln. »Wenn du die Sammlung nicht haben möchtest, finden wir zusammen vielleicht ein Musikinstitut, einen Sender oder ein Musikarchiv, irgendjemanden halt, der sich dafür interessiert.«
Ich blättere in den Katalogen. Das zuletzt aufgenommene Konzert trägt die Nummer 2156. Mehr als zweitausend Konzerte in vierzig Jahren. Ein Konzert pro Woche.
»Was hat dich dazu getrieben, das alles aufzunehmen und aufzubewahren?«, fragte ich Anton einmal, als unsere langjährige Bekanntschaft schon freundschaftliche Züge angenommen hatte.
»Verrückt, was?«, fragte er zurück.
Nein, nicht verrückt, aber merkwürdig, versuchte ich ihm zu erklären, denn wer sollte das alles hören? Gab es nicht umfangreiche und technisch gut betreute Archive in den großen Sendeanstalten, wollte er mit denen konkurrieren?
Nein, das nicht. Dies hier sei viel persönlicher, nicht so historisch, keineswegs als Dokumentation zusammengestellt.
»Es ist so etwas wie ein musikalisches Tagebuch«, entgegnete Anton. »Musik, das war für mich immer das Höchste, der Inbegriff menschlichen Ausdrucks.«
Ich erinnere mich an dieses Gespräch. Wir saßen in einem Kaffeehaus in Salzburg, vor einem Symphoniekonzert, und tranken Kaffee. Einige Orchestermusiker, die bereits für das bevorstehende Konzert gekleidet waren, saßen an den Nachbartischen und unterhielten sich oder lasen Zeitung.
»Wenn ich dieses Konzert von heute Abend aufnehme, dann wird der Tag, den wir heute zusammen verlebt haben, das Gespräch, das wir jetzt führen, das alles, was wir heute gesehen und erlebt haben, mit aufgenommen. Der Blick vom Kalvarienberg hinunter auf die Salzach zum Beispiel, die weißen Silhouetten der unter uns flussaufwärts fliegenden Schwäne, diese Frühlingsstimmung, die Anemonen an den Waldrändern, der kühle, zerrende Wind, das Gedränge in der Getreidegasse, der Marktplatz mit seinen verlockenden Angeboten, die man nicht wahrnehmen kann, wenn man, wie wir, in einem Hotel wohnt … Das alles, Klaus, wird wieder lebendig, wenn ich diese Aufnahme später einmal anhöre.«
Ich nickte. Ein musikalisches Tagebuch aus den doch zufälligen Verbindungen von gerade gespielter Musik und den sie umgebenden Ereignissen zusammenzustellen, erschien mir damals als ein etwas abwegiger Gedanke.
»Was spielen sie denn heute Abend?«, fragte ich Anton, der immer alle Programme im Kopf hatte.
»Bruckner, die Fünfte.« Er zog eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche und fing an zu rauchen. Später gab er diese Angewohnheit, die mich immer ein wenig an ihm gestört hatte, auf. Ein befrackter Herr, der am Nebentisch saß, fühlte sich durch den aufsteigenden Rauch offenbar animiert. Jedenfalls klopfte er seine Jackentaschen ab, als suche er nach seinen eigenen Zigaretten. Er fand keine und wandte sich ganz ungeniert an Anton: »Entschuldigen Sie, würden Sie mir eine von Ihren spendieren? Ich habe meine Schachtel irgendwo liegen lassen.«
Natürlich reagierte Anton sehr entgegenkommend. »Nehmen Sie die ganze Schachtel«, schlug er vor, »ich habe noch eine zweite.«
Aber der Philharmoniker, um einen solchen handelte es sich, wie wir eine halbe Stunde später herausfanden, wollte nur eine Zigarette. Er musste aus Sachsen stammen, denn seine Dankesformel: »Ich bin Ihnen wirklich sehr verbunden, wirklich, ganz außerordentlich«, klang nach Dresden oder Leipzig.
»Auch so etwas gehört dazu«, sagte Anton zu mir, als wir das Lokal verließen. Als ehemaliger Mitarbeiter des Österreichischen Rundfunks brachte er es immer fertig, sich von den Rohaufnahmen solcher Konzerte eine Kopie zu beschaffen, von der er dann hier in dem Studio, in dem ich jetzt sitze, Kassetten oder Schallplatten anfertigte.
Ein musikalisches Tagebuch, denke ich, während ich den Katalog mit den Künstlern, die in Antons Sammlung vertreten sind, durchblättere. Viele Namen kenne ich, aber längst nicht alle. Ich bin beim Buchstaben »K« angelangt. Karolyi, Julian von; Katchen, Julius. Mit diesen Namen verbinde auch ich Erinnerungen, musikalische und solche, die nicht unmittelbar mit der Musik zusammenhängen, sondern die sich in ihrem Umkreis bildeten. Karajan, Herbert von. Die Fünfte von Bruckner, die hatte Karajan dirigiert, damals, als Anton versucht hatte, mir den Sinn seiner Sammlung zu erklären. Jetzt erinnere ich mich an den wunderbar leisen Beginn des ersten Satzes, an die Pizzikati der Bässe, die der innigen, von den Streichern intonierten Melodie den Charakter einer schrittweisen Annäherung gaben. Mein Blick gleitet die Liste der »K’s« entlang. Keilberth, Josef; Klemperer, Otto; Kleiber, Carlos; Kleiber, Erich. Aber halt, da steht noch ein Name, den ich kenne, den ich nicht nur kenne, sondern mit dem sich für mich eine ganze Geschichte verbindet. Kepler, Florian, steht da mit Verweisen auf Konzerte im Jahre 1951 und 1952 in Berlin und in Salzburg. Es trifft mich wie ein Schlag. Florian Kepler, mein Freund Florian. Jedenfalls denke ich gern an diesen Menschen als einen Freund, obwohl wir uns nur wenige Male begegnet sind. Wie kam Anton an diese Aufnahmen? Ich weiß, es ist eine unsinnige Frage. Florians Konzerte wurden damals von RIAS Berlin und vom Österreichischen Rundfunk, vielleicht noch von weiteren Sendern übertragen. Immer war ich der Meinung gewesen, dass es kaum Aufnahmen von Florian gäbe – außer der b-Moll Sonate von Chopin und der a-Moll Suite von Bach habe ich nie etwas von Aufnahmen gehört. Doch, ein Werk fällt mir ein: Von Prokofjews Klavierkonzert Nummer drei gab es schon damals eine Aufnahme.
Ich lege das Namensregister zurück auf den Sofatisch und greife nach dem Verzeichnis der Konzerte. 1951 Berlin, Titania-Palast: Mozart, Klaviersonate a-Moll, Bach, Partita Nummer 2 in c-Moll, Beethovens As-Dur Sonate, Opus 110, und Schubert, die Sonate in B-Dur. Das war ja mein Konzert, fällt mir ein. Ebenfalls aus dem Jahre 1951 eine Aufnahme des Klavierkonzerts Nummer 24 c-Moll von Mozart, dann aus Salzburg vom Sommer 1952 das Konzert für Klavier und Orchester Nummer 3 von Béla Bartók. Ebenfalls 1952 die Diabelli-Variationen und die Goldberg-Variationen aus dem Großen Musikvereinssaal in Wien. Ich habe erst später davon erfahren. Und hinter »Kepler« stehen noch mehr Hinweise auf Konzerte in den Jahren 1950/51 und 1952. Es muss also noch weitere Aufnahmen in Antons Sammlung geben. Nicht jetzt, denke ich mir, ich brauche jetzt Ruhe, einen Augenblick wenigstens. Abstand. Ich stehe auf und gehe ans Fenster. Die Sonne ist hinter den Dächern der benachbarten Häuser verschwunden. Ich trete aus dem Tonstudio hinaus und gehe hinüber in das geräumige Wohnzimmer, dessen Fensterfront auf die Ringstraße hinausweist. Unten fahren die Straßenbahnen vorbei. Die Autos haben ihre Scheinwerfer eingeschaltet. Es herrscht Dämmerung, Zwielicht, die halbe Stunde zwischen Tag und Nacht. Ich will zurück in mein Hotel – unter Menschen. Das Parkhotel kann ich bequem zu Fuß erreichen, und ich kann ja morgen wiederkommen, um mir die Aufnahmen von Florian anzuhören. Was wird Anton dazu sagen, wenn ich ihm von meinem Fund berichte? Vielleicht hat er seine eigenen Erinnerungen an Florian Kepler, denke ich und bin immer noch ergriffen von meiner Entdeckung wie von der Wiederbegegnung mit einem Stück meines Lebens, das mir auf immer entglitten zu sein schien. Bis heute. Bis vor einer Stunde.
Während ich die Ringstraße entlanggehe, überlege ich mir, wie ich Anton am besten erreichen kann. Heute noch? Ich sehe auf die Uhr. Fast sieben. Ich werde ihn anrufen und ihn fragen, ob ich morgen zu einem kurzen Besuch in Klosterneuburg vorbeikommen dürfte.
Am nächsten Vormittag um neun Uhr mache ich mich auf den Weg. Ein Taxi bringt mich hinaus nach Klosterneuburg an den Rand des parkähnlichen Geländes, in dem das Wohnheim liegt, das Anton sich zum Aufenthalt erkoren hat. Ich betrete einen breiten, von alten Bäumen umstandenen Kiesweg, der in sanften Windungen durch Wiesen führt, auf denen jetzt im Frühling viele gelbe Primeln blühen. Im Geäst der alten Kastanien und Ulmen schweben die ersten grünen Schleier. Es riecht nach Erde, nach frischem Grün. Die gelegentlichen Windböen aus Nordwest treffen mich wie kleine Ermunterungen. Natürlich weiß Anton von meinem Besuch, ich habe ihn ja gestern Abend noch erreicht. Pünktlich wie er ist, wartet er wohl schon auf mich. Nein, nicht nur das: Er kommt mir sogar entgegen. Von Weitem sehe ich seine schlanke, mittelgroße Gestalt auf mich zukommen. Er trägt einen hellen Mantel. Sein silbergrauer Schopf und der etwas kleinschrittige Gang lassen keine Zweifel zu. Jetzt, als nur noch dreißig oder vierzig Meter uns trennen, winkt er mir zu. Dann stehen wir uns gegenüber.
»Du warst im Stubenring?«, fragt er mich, nachdem wir uns begrüßt haben.
Ich nicke. »Ja, und ich habe etwas Neues entdeckt, Anton.«
Er lächelt. Offenbar freut er sich, dass ich gleich auf Anhieb etwas in seiner Sammlung gefunden habe, was mich so beschäftigt, dass ich ihn besuche, um die Neuigkeit zu besprechen.
»Gehen wir ein Stück?«, schlägt er vor und zeigt mit der Hand auf einen Weg, der einige Meter von uns entfernt in freieres Gelände abzweigt.
Die Luft ist mild, ab und zu erinnert ein kühler Windstoß daran, dass wir uns erst im April befinden. Kleine weiße Wolken ziehen über einen Himmel, der wie frisch gewaschen wirkt. Von Zeit zu Zeit verschatten sie für Sekunden, allenfalls für ein oder zwei Minuten die Sonne.
»Einen der Künstler in deinem Katalog kenne ich persönlich.« Ich falle gleich mit der Tür ins Haus. »Es war fast eine Freundschaft zwischen uns damals, die ein plötzliches Ende nahm. Danach verschwand sein Name aus den Feuilletons, aus den Zeitungen, selbst aus den Musikzeitschriften. Diese gewaltsam beendete Freundschaft hat mich mein ganzes Leben lang begleitet wie etwas Unerledigtes, etwas, das irgendwann noch aufgelöst werden müsste. Und nun, nach fast einem halben Jahrhundert, entdecke ich Aufnahmen von ihm.« Ich bleibe stehen. »Ich war ganz bewegt gestern. Deshalb …«
»Deshalb hast du gestern Abend noch angerufen?«
»Ja, ich wollte hören, ob du noch etwas von Florian Kepler weißt, etwas, das mir mehr Klarheit über sein Leben geben könnte.«
»Der Pianist Florian Kepler«, antwortet Anton, wohl um zu bestätigen, dass wir dieselbe Person meinten.
»Ja, der.«
Anton nickt. Wir spazieren nebeneinander her. Anton überlegt sich etwas. Vermutlich legt er sich zurecht, was er mir über Florian Kepler mitteilen kann. Dann sagt er: »Kepler galt Ende der vierziger und zu Anfang der fünfziger Jahre als ein Vertreter einer neuen Generation amerikanischer Pianisten. Gary Graffmann gehörte auch dazu, Van Cliburn, Leon Fleisher und noch ein oder zwei andere.« Anton bleibt stehen und weist mit seinem Spazierstock auf eine etwa hundert Meter entfernte Bank, die vor einer aus Felssteinen errichteten Mauer steht und nach Süden blickt. »Gehen wir dorthin?« Er meint wohl, dass wir im Sitzen besser über meinen Freund sprechen könnten.
»Florian Kepler galt als der Begabteste in dieser Gruppe«, sagt Anton, »deshalb habe ich seine frühen Konzerte aufgenommen in der Hoffnung, sie eines Tages mit weiteren Einspielungen vergleichen zu können.«
»Du sprichst wie ein Kritiker.«
»So?« Anton scheint plötzlich reserviert.
»Kanntest du ihn persönlich?«
»Nein.« Anton schüttelt den Kopf. Es sieht aus, als dächte er nach – über etwas lange Zurückliegendes. »Aber du«, sagt er, »du kanntest ihn?«
»Ja, ich sagte es ja schon.«
Wir sind bei der Bank angekommen. An einem Tag wie heute ist es wirklich ein geeigneter Platz für ein ruhiges Gespräch. Die kleine Felssteinmauer in unserem Rücken schützt uns vor den gelegentlichen Windstößen. Die Frühlingssonne wärmt uns. Der Blick wandert über Wiesen, die immer noch braune Flecken aufweisen, aber dabei sind, sich mit jedem Tag dichter zu begrünen. Zu unseren Füßen blühen ein paar Veilchen und Primeln, und zweihundert Meter weiter südlich umschließt der Rand eines Wäldchens die Wiesen in einem anmutigen Halbkreis. Wir setzen uns.
»Ja, ich kannte Florian Kepler recht gut.« Ich zögere. »Eine Zeit lang meinte ich sogar, ihn sehr gut zu kennen.«
Anton, der rechts neben mir sitzt, blickt geradeaus über die Wiesen zu dem sanft geschwungenen Waldrand. Er wirkt nicht sehr teilnehmend, obwohl er doch darauf bestanden hat, dass ich in seine Wohnung gehe und mir dort seine Sammlung ansehe und anhöre. Aber vielleicht täusche ich mich.
»Erzähle«, sagt er, ohne seine Blickrichtung zu verändern.
»Es ist eine längere Geschichte.«
Jetzt lächelt Anton. »Umso besser – wir haben doch Zeit.«
Ja, denke ich. Zeit haben wir, aber verfügen wir auch über die Fähigkeit, etwas lange Zurückliegendes wieder in die Gegenwart zu holen, ohne es dabei zu verfälschen?
»Ich hoffe, dass ich alles richtig erzähle«, sage ich.
Anton rührt sich nicht. Komisch. Wie ich ihn kenne, hätte er mich in einer solchen Situation ermuntert, es einfach zu versuchen, hätte gesagt: »Nun fang schon an, ich bin neugierig.« Aber er sagt nichts dergleichen.
Ich beginne zu erzählen.
2
____________________
Es war im Hochsommer 1949. Wir, das heißt eine Gruppe von vielleicht fünfzig Studenten aus verschiedenen europäischen Ländern, waren zum Abschluss eines einjährigen Studienaufenthaltes in den USA in Washington zusammengekommen, um die Stadt anzusehen und um über unsere Erfahrungen zu berichten. Alles war sehr aufregend. Du musst wissen, dass wir die erste europäische Gruppe von Studenten darstellten, in der auch Angehörige der ehemaligen Kriegsgegner vertreten waren, also Deutsche, Österreicher, Italiener. Unsere Tutoren waren fähige junge Leute, nur einige Jahre älter als wir selbst. Sie behandelten uns alle als ihresgleichen und bemühten sich sehr, uns für die Vorstellung einer gemeinsamen Zukunft zu begeistern. Wir seien das junge Europa. Ob wir früher Freund oder Feind waren, sei jetzt unwichtig, heute seien wir alle Partner für eine gemeinsame Zukunft. So etwa.
Zum Abschluss unseres Besuches in der Hauptstadt veranstalteten sie für uns in der National Gallery of Art ein Konzert. Und der Künstler, der an diesem Nachmittag für uns spielte, war kein anderer als Florian Kepler. Er war damals schon eine Berühmtheit in den USA und befand sich auf dem Sprung in eine internationale Karriere.
Das Konzert fand in einem der oberen Stockwerke der Galerie statt. In einer Rotunde hatte man einen Konzertflügel aufgestellt und Stühle darum herum gruppiert. Auf jedem Sitz lag ein Programm. Eine Mozart-Sonate und die Chopin-Etüden aus Opus 10 waren angekündigt. Ein kurzes Programm, aber es war ja auch nur ein Konzert außer der Reihe, eine Art Gruß eines amerikanischen Künstlers an die Idee des Studentenaustausches und der neuen Partnerschaft, auf die man damals in Amerika baute.
Dann trat Steve neben das Klavier, Steve Pendergast, der unsere Reise nach Washington begleitet hatte und der alles für uns organisierte. Steve kündigte Florian Kepler an. Aus seiner kurzen Einführung erfuhr ich zum ersten Mal, dass Florian aus Europa, genauer aus Wien stammte. Als Kepler dann selbst erschien, jung, aber ernst, gesammelt und mehr auf sich selbst als auf uns konzentriert, dachte ich: Na, vielleicht ist da jemand, der Böses erfahren hat und der dieses Konzert nur mit Vorbehalten spielt. Jedenfalls wirkte er anfangs bei Mozart noch sehr reserviert. Die Akustik des Raumes war nicht gut – es hallte. Dennoch begriff ich sehr schnell, und auch die anderen Mitglieder unserer Gruppe schienen das zu verstehen, dass Florian Kepler hervorragend Klavier spielte. Er war ganz auf seine Musik konzentriert. Der Mozart, die späte Sonate in B-Dur aus dem Jahr 1789, erklang verspielt, heiter, fast belanglos. Aber die Reinheit und die Genauigkeit von Florians Spiel beeindruckten uns alle als außergewöhnlich, auch wenn die meisten von uns noch nicht viele Konzerte gehört hatten. Außerdem: Im Adagio dieser Sonate, einer innigen, auf dem Es-Dur-Dreiklang aufgebauten Melodie, hatte ich plötzlich das Gefühl, nach einem Jahr Amerika wieder nach Hause gekommen zu sein. Diese Musik erinnerte mich auf eine heitere und doch nachdrückliche Weise an München, an Salzburg, an Europa, an meine Heimat, die zwar noch in Trümmern lag, aber deren Musik unversehrt geblieben war. Die Anteilnahme wuchs. Man merkte es an der enormen Stille, mit der wir Florian Kepler zuhörten. Nach den Chopin-Etüden entlud sich die Spannung. Kepler wurde gefeiert, als hätte er ein Wunder vollbracht – und vielleicht hatte er das auch. Jetzt erst schien er Freude an diesem Konzert zu haben, und er spielte weiter mit Inbrunst und Konzentration: eine späte Beethoven-Sonate, die in As-Dur, Opus 110. Nachdem er geendet hatte, saßen wir alle da wie gebannt. Dann wurde geklatscht. Fünfzig Gesichter strahlten den Pianisten an. Viele drängten nach vorn, um ihm Fragen zu stellen, ihm die Hand zu drücken. Manche hielten ihm einen Programmzettel entgegen und baten um ein Autogramm. Kepler, der zunächst ein wenig steif auf mich gewirkt hatte, freute sich sichtlich über seinen Erfolg. Er lächelte, lachte sogar, sprach Englisch, Deutsch, dazwischen ein paar Brocken Spanisch oder Französisch. Für ihn war es ein Bad in der Menge, wie man sagt, aber eben in einer handverlesenen, kleinen Menge. Diese jungen Leute schlossen ihn in ihr Herz, und Florian erwiderte ihre Freude und wurde ebenfalls zutraulich. Ich wartete, bis der Ansturm vorüber war und er wieder allein an seinem Flügel stand und nach seiner Tasche suchte, die er an einer Balustrade abgestellt hatte. Da erst trat ich auf ihn zu und sprach ihn auf Deutsch an.
»Ich habe von Ihnen gelesen«, sagte ich und fügte hinzu: »Es wäre schön, wenn wir Sie auch in Europa hören könnten.«
»Ich weiß …«
Sie haben vielleicht etwas gegen Ihre Heimat, wollte ich sagen, aber die Menschen dort sehnen sich nach guter Musik und danach, dass jemand wie Sie, ein junger, berühmter Mann, der einmal einer der Ihren war, zurückkommt und ihnen nicht mehr grollt. Aber natürlich sagte ich das nicht. Nein, ich vermutete nur, dass er sehr beschäftigt sei hier in Amerika und verlor ein paar anerkennende Worte über das Museum, in dem wir uns befanden.
»Da bleiben Sie vielleicht lieber hier, wo Sie sind«, sagte ich und warf einen bewundernden Blick in die neoklassizistische Halle, auf die Säulen und auf den kleinen Springbrunnen, der aus dem unteren Stockwerk leise zu uns heraufplätscherte.
»Hat es dir also gefallen?«, sagte er halb fragend, halb nachdenklich. Er sprach Deutsch ohne Mühe, wie mir schien. Offenbar machte es ihm sogar Freude, denn er lächelte dabei. Dass er mich gleich duzte, wunderte mich nur eine Sekunde lang, denn wer war ich denn? Ein Student, der gerade angefangen hatte, Medizin zu studieren, ein bisschen Botanik, Zoologie, Chemie, Physik und Anatomie. Wie das eben so ist in den ersten vorklinischen Semestern. Er dagegen ein Pianist, noch jung zwar, aber auf dem Sprung ganz nach oben, ein Zögling von Rudolf Serkin, hatte im Programm gestanden.
»Darf ich ›du‹ sagen?«, fragte er, als hätte er meine Gedanken erraten.
Ich glaube, ich wurde rot wie ein Backfisch vor Freude. Er muss damals vierunddreißig Jahre alt gewesen sein, wenn das Geburtsdatum im Programm stimmte, aber er wirkte fast wie ein Vierundzwanzigjähriger – nur ernster, nachdenklicher. Wie jemand, der ständig mit seinen Gedanken woanders ist oder der einen geheimen Kummer hat. Wir standen immer noch an dem Steinway, auf dem er soeben gespielt hatte. Zwei Männer in blauen Drillichanzügen klappten den Deckel zu und rollten das große Instrument in einen Nebenraum.
»Ich bin allein heute Abend«, sagte Florian Kepler, »wollen wir etwas zusammen unternehmen?«
Vielleicht dachte ich zu lange über sein Angebot nach, denn er schränkte plötzlich ein: »Wenn du nicht etwas mit deiner Gruppe vorhast?«
»Nein oder vielmehr doch, aber wir wollten nur zusammen irgendwohin zum Essen gehen, ich kann mich freimachen.«
Er lächelte wieder, aber seine Augen blieben ernst dabei. »Sicher?«, fragte er.
»Ja, ganz sicher. Ich müsste nur Bescheid sagen – aus Höflichkeit.«
Er nickte. »Ich warte unten am Ausgang auf dich«, sagte er und griff nach seiner Tasche.
»Bis gleich«, rief ich und lief den Mitgliedern meiner Gruppe hinterher, die in den angrenzenden Räumen verschwunden waren. Ich sah einige rote und blaue Röcke, weiße Blusen, die mir bekannt vorkamen, und entdeckte endlich Rosemarie Pfaff an ihrer treuherzigen Frisur: Sie trug ihre langen blonden Zöpfe immer mehrfach um den Kopf gewickelt. Die Amerikaner mochten das. »Sind die echt?«, fragten sie Rosemarie jedes Mal, wenn sie mit ihr ins Gespräch kamen.
»Wo ist Steve?«, rief ich Rosemarie zu. Sie zeigte mit dem Finger in einen der Nebenräume. »Dutch Masters« war da auf einem Schild zu lesen. Ich folgte ihrem Hinweis und fand Steve vor einer holländischen Landschaft. Er stand einige Meter von dem Bild entfernt, den linken Arm angewinkelt, den rechten Ellenbogen in die linke Hand gestützt, mit den Fingerspitzen seiner rechten Hand sein Kinn betastend. Versunken wirkte er, nachdenklich. Vielleicht hatte er in Gedanken Eingang in diese Landschaft gefunden, war dreihundert Jahre und fünftausend Kilometer weit zurückgewandert und spürte den von der See kommenden Nordwestwind, wunderte sich über den fernen Horizont und über den unendlich weiten Wolkenhimmel. Ich störte ihn ungern, aber unten wartete Florian Kepler.
»Steve?« Ich hatte ihn zu leise angesprochen, noch dazu schräg von hinten. »He, Steve?«
Diesmal drehte er sich um, erkannte mich, lächelte und schob gleichzeitig seine Brille nach oben. Er sah mit seinem schmalen Gesicht und den blonden Haaren, die er offenbar nie kämmte, selbst noch aus wie ein Student. Dabei musste er den Aufpasser spielen. »Chaperone« hieß das hier. Ich berichtete Steve von meinem Gespräch mit Florian Kepler und dass Kepler mich eingeladen hätte, den Abend mit ihm zu verplaudern.
Steves Augen weiteten sich. »Tatsächlich?«, fragte er. Sein Lächeln verschwand. War er enttäuscht, dass ich mich absetzen wollte?
»Ist das in Ordnung?«, fragte ich.
»Natürlich gehst du«, sagte Steve. »Bessere Gesellschaft findest du heute Abend in ganz Washington nicht. Wir sind im Forum.« Er zog einen Zettel aus der Tasche und schrieb mir die Adresse des Restaurants auf. »Falls du noch Zeit hast. Später dann im Hotel. Du kennst dich doch aus?«
»Ich denke schon.«
»Viel Spaß«, sagte Steve und: »Pass schön auf, er ist ein interessanter Kerl.« Dann schüttelte er den Kopf. »Hätte ich nie gedacht.«
»Nie gedacht? Was?«
»Dass er einen von euch einlädt.«
Ich musste ein erstauntes Gesicht gemacht haben, denn Steve erwähnte plötzlich, dass Kepler zunächst überhaupt nicht für uns spielen wollte.
»Und warum nicht?«
Steve zuckte die Achseln. »Hat er nicht gesagt. Vielleicht erklärt er es dir. Also«, er wandte sich wieder seinem Bild zu und nahm dabei die gleiche Haltung ein, in der ich ihn angetroffen hatte.
Ich beeilte mich, nach unten zum Ausgang zu kommen. Das Hauptportal war noch geöffnet. Das Haus schloss um sechs, die Besucher schlenderten zum Ausgang und über die Freitreppe hinunter zur Mall. Kepler stand seitlich auf dem Treppenabsatz vor dem Portal. Er hatte sich an eine der Säulen gelehnt und kramte in seiner Aktentasche. Erst jetzt fiel mir auf, dass er sich für dieses Konzert nicht besonders gut angezogen hatte. Graue Hosen, ein Sportjackett, ein weißes Hemd, eine blaue Krawatte, braune Schuhe. Er schien jetzt gefunden zu haben, was er suchte. Er überflog das Blatt Papier, dann bemerkte er mich. »Da bist du ja schon.«
»Ich habe mich beeilt«, antwortete ich. Etwas Besseres fiel mir im Augenblick nicht ein.
Er lächelte, was ihm gut stand, auch wenn seine Augen dabei ganz ernst blieben. »Weißt du, ich habe nach einer Adresse gesucht«, erklärte er mir. »Ein Club, bei dem ich Mitglied bin. Sie haben überall ihre Niederlassungen, auch hier. Nur in Washington bin ich so selten, deswegen muss ich immer erst die Adresse wieder finden.«
Wir gingen nebeneinander die Treppe hinunter zur Mall, wo Taxis warteten.
»Ist es dir recht, dass wir in den Club gehen? Das Essen ist nur mittelmäßig, aber man ist dort ungestört.«
»Natürlich.«
»Ich bin sehr geräuschempfindlich, und die Restaurants hierzulande können sehr laut sein.«
Kepler öffnete die hintere Tür eines Taxis. »Sind Sie frei?«, fragte er den Fahrer. Der bejahte und legte den Hebel seines Streckenzählers um. Das Gerät fing an zu ticken.
»Georgetown«, sagte Kepler und nannte eine Straße und eine Hausnummer.
Der Fahrer nickte.
»Wie heißt du eigentlich?«, fragte Kepler mich. »Wir haben uns ja noch gar nicht bekannt gemacht.«
»Klaus Mosbacher«, stellte ich mich vor. In den USA hatte ich mit meinem bayerischen Namen immer Probleme. »Wie buchstabiert man das?«, wurde ich immer gefragt, und dann kam immer etwas heraus, das wie ›Masbäcker‹ klang. Kepler sagte nur: »Klingt österreichisch.«
»Oder bayerisch«, antwortete ich, denn mein Großvater stammte aus dem Allgäu. Florian Kepler nickte. Er machte auf mich einen etwas abwesenden Eindruck. Warum er mich eingeladen hatte, mit ihm in seinen Club zu gehen, war mir nicht klar. Warum hatte er überhaupt jemanden eingeladen? War er vielleicht nicht gern allein?
Wir fuhren jetzt durch stillere Straßen. Viele der Gebäude waren aus roten Ziegeln gebaut und hatten Treppen, die von der Straße gleich in ein etwas erhöhtes Parterre führten. Ich war damals noch nie in England gewesen, aber was ich von Bildern her kannte, ähnelte dem sehr.
»Hier ist es«, sagte Kepler und holte seine Börse aus der Hosentasche. Wir hielten vor einem mehrstöckigen Gebäude, das wie ein Mietshaus aussah. Vor der Eingangstür lag ein verstaubter roter Hanfteppich, der von einem Baldachin überdacht war. Er reichte über den Gehsteig fast bis an die Straße. Ein schwarzer Portier stand neben dem Eingang. Er trug einen Zylinder, einen langen lodengrünen Mantel mit Tressen an den Ärmeln, ebenso gefärbte Hosen und weiße Handschuhe. Als er bemerkte, dass wir es auf den von ihm bewachten Eingang abgesehen hatten, trat er an das Taxi und riss mir die Tür auf. Kepler war inzwischen schon auf der anderen Seite ausgestiegen.
»Willkommen im Vanderbilt Club«, rief der Portier und blitzte uns mit seinen weißen Zähnen so freundlich an, als seien wir liebe, lang entbehrte Verwandte von ihm.
Wir betraten die Halle, in der ein Kristallleuchter von der Decke hing. Der Portier begleitete uns. Kepler stellte ein paar Fragen, die ich nicht verstand, und der Portier nickte. Wir schienen angemeldet zu sein und stiegen eine etwas protzige Treppe empor, die zu einem in eine Wand eingelassenen Brunnen führte und sich an dieser Stelle nach links und rechts verzweigte. Die Räume, in die wir jetzt kamen, waren alle mit dunklem Holz getäfelt. Auch die Möbel, zumeist von Sesseln umstandene niedrige Tische, waren in dunklen Tönen gehalten. Obwohl Hochsommer war, flackerte Feuer in den Kaminen. Ich kam mir vor wie im Theater. Kepler schien meine Verwunderung nicht zu bemerken.
»Eine Marotte«, sagte er trocken. »Englischer Herrenclub, Frauen sind unerwünscht, Musik ebenso, außer bei besonderen Anlässen. Auf Ruhe wird Wert gelegt und darauf, dass sich nicht viel ändert. Alles muss so sein, wie es schon immer war. Die Kaminfeuer beweisen es. Sie sind eine Erinnerung an das kühle, feuchte Wetter auf der britischen Insel. Trinken und Zeitung lesen sind die Hauptbeschäftigungen«, fügte er hinzu und wies auf einen Stapel von Magazinen, die in einem Regal lagen, und auf die Tageszeitungen, die, eingespannt in lange Holzklammern, an den Wänden hingen wie Mäntel in einer Garderobe. Wir suchten uns eine entfernte Ecke des großen Aufenthaltsraumes und ließen uns in zwei Sessel fallen, die dort standen.
»Hier kann uns der Ober sehen, wenn unser Tisch fertig ist«, erklärte Florian.
Eine überflüssige Bemerkung, denn der Ober aus dem angrenzenden Speisesaal kam ohnehin ständig angerannt, um seine Gäste für das Abendessen zu finden, die sich unter den hohen Sessellehnen versteckt hatten. Er kam auch zu uns und fragte in antrainiertem Oxford-Englisch, ob wir einen Drink wollten.
Florian bestellte sich einen Gin Tonic. »Und was möchtest du?«, fragte er dann auf Deutsch, was zur Folge hatte, dass die Augenbrauen des Obers sich hoben. »Ungewohnte Klänge?«, fragte ich Florian Kepler.
»Also was? Coca Cola?«
Ich war einverstanden. Meine Alkoholtoleranz war damals noch wenig entwickelt, und ich wollte nichts riskieren. Der Ober nickte und ließ diese Bewegung seines Kopfes mit routiniertem Schwung in eine Kehrtwendung münden, in der ich eine gewisse Ablehnung zu spüren meinte. Ich war wohl der Einzige, der hier Coca Cola bestellte.
»Steve«, sagte ich, »Steve Pendergast, der uns hier herumführt …«
Florian nickte.
»Er meinte, Sie hätten zuerst gar nicht für uns spielen wollen?«
»Nein, wollte ich nicht. Da hat er recht.«
»Darf ich fragen …?«
Ich kam mit meiner Frage nicht bis ans Ende, denn der Kellner brachte unsere Getränke, Kepler seinen Gin Tonic, mir ein großes, mit Eiswürfeln gefülltes Glas mit einer noch leise vor sich hin prickelnden Coca Cola.
»Also.« Kepler hob sein Glas.
Ich tat ein Gleiches und kam mir dabei ein wenig unterbelichtet vor. Klaus Mosbacher aus München in der großen weiten Welt in Gesellschaft eines Sterns am Pianistenhimmel, der von Nacht zu Nacht heller schien.
»Du magst Musik?«
Ja, natürlich, wollte ich sagen. Ich bin vernarrt in Musik, vor allem in die Musik der Klassik und Romantik, in Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms. Von Bruckner und Mahler hatte ich damals noch nichts gehört. Aber ich nickte nur.
»Wenn du Musik magst, muss dir doch die Akustik in diesem Bildertempel aufgefallen sein. Der Nachhall. Es klingt wie in einer Bahnhofshalle. Das war der Grund.« Kepler trank noch einen Schluck. »Ich hätte gern in einem guten Saal für euch gespielt.«
»Also mit uns hatte es nichts zu tun – ich meine damit, dass viele Deutsche und Österreicher in unserer Gruppe sind?«
»Warum sollte mir das etwas ausmachen?« Dass ich überhaupt an so etwas dachte, schien Kepler zu ärgern. Er schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er, und einen Augenblick lang hatte ich den Eindruck, dass er die Unterhaltung mit mir am liebsten beendet hätte. Und vielleicht hätte er mich auch gebeten zu gehen, wenn ich nicht ganz plötzlich gesagt hätte: »Entschuldigen Sie, Mister Kepler, vielleicht war es dumm von mir, so etwas zu vermuten.«
»Was zu vermuten?«
»Na, vielleicht eine Gekränktheit über das Unrecht, das Ihnen zugefügt worden ist.« Ich redete jetzt mit größerer Selbstsicherheit als zuvor. Wenn aus dieser Bekanntschaft nichts würde, dann wollte ich wenigstens frei und offen gesprochen haben. »Uns, ich meine, den Deutschen in dieser Gruppe, sind die Menschen hier im Lande meistens genauso freundlich und offen begegnet wie den Norwegern, den Iren, den Schotten und wen wir sonst noch so in unserer Gruppe haben. Aber es gab auch Ausnahmen. Es gab auch Leute, die uns geschnitten haben, in New York zum Beispiel. Da war ein Geiger, der nicht für uns spielen wollte, weil wir aus den ehemaligen Feindländern kamen, oder ein jüdischer Professor für Geschichte, der erst so tat, als wollte er zu uns sprechen und sich dann mit dem Hinweis von uns verabschiedete, dass wir Kinder einer Generation von Mördern seien. Er könne nicht mit uns reden. Deutschland sei ein Paria unter den Ländern, ein ausgestoßenes, moralisch diskreditiertes Land. ›Sie sollten wissen, warum ich nicht Ihr Freund sein kann‹, sagte er und ließ uns einfach stehen – zum Entsetzen unserer Begleiter.«
Ich redete, wie mir ums Herz war, und erwähnte nur diese beiden Zwischenfälle. In Wirklichkeit hatten wir einzeln, während unserer individuellen Aufenthalte, noch ganz andere Dinge erlebt. Davon wollte ich ihm auch noch erzählen, aber Kepler winkte ab. Offenbar verstand er mich.
»Ich bewundere die Organisation, die euch hergebracht hat, den American Exchange Service«, sagte er. »Du kommst aus Deutschland – aus München, Klaus. Ich stamme aus Wien. Ich will wissen, wie die jungen Leute aus deiner Generation denken, wie sie die Welt sehen. Seid ihr kritisch oder einfach dankbar für die erwiesene Freundlichkeit? Was geschehen ist, das ist geschehen. Deine Generation hatte damit nichts zu tun. Aber wie soll es nun weitergehen mit Deutschland und auch mit meiner Heimat Österreich? Und überhaupt mit Europa? Das ist doch die Frage.«
Kepler saß jetzt ganz aufrecht, hatte die Ellenbogen auf seine Knie gestützt und die Hände zusammengelegt. So gesammelt hatte er vor zwei Stunden ausgesehen, als er für uns spielte. Die ernsten braunen Augen, das wellige braune Haar, das er nach einer damals in Europa aufkommenden, aber in den USA noch nicht weit verbreiteten Mode recht lang trug, sodass nicht nur sein Kopf, sondern auch die Schläfen von langen, nach hinten gekämmten Haaren bedeckt waren, die kräftigen Brauen, der feste Mund mit den wie im Trotz leicht aufgeworfenen Lippen, die wohlproportionierte Nase und das kräftige Kinn. Kepler sah gut aus, er hätte, so dachte ich, während er mit mir sprach, auch Filmschauspieler werden können. Aber dafür war er vielleicht zu »seriös«, zu »aufrichtig«. Zu »sincere«, wie man hier sagte.
»Du bist jung, Klaus, ihr alle seid so jung, ihr seid Anfänger im besten Sinne des Wortes. Du bist frei, frei von Schuld, also benimm dich auch wie ein freier Mensch.« Er musterte mich mit seinem ernsten Blick. Dann lächelte er. »Die Musik, um die es mir am meisten geht, kommt aus Europa: aus Wien, aus Salzburg, aus München, aus Thüringen und Sachsen – habe ich was vergessen?«
Wir hatten unsere Gläser leer getrunken. Der Ober kam und bedeutete Florian, dass der Tisch für uns bereitstünde. Florian nickte mir zu. Immer noch fühlte ich mich wie in einem nicht besonders gut gelungenen englischen Film, aber ich hatte meinem Herzen Luft gemacht, und Florian hatte freundlich darauf reagiert.
»Erzähl mir ein bisschen von dir«, forderte er mich auf, nachdem wir uns gesetzt hatten.
Ich fasste mein Leben kurz zusammen: 1930 in München geboren, der Vater Angestellter bei den Bayerischen Motorenwerken, die Mutter Hausfrau, eine zwei Jahre jüngere Schwester. Beide Eltern künstlerisch interessiert, dabei gut katholisch.
»Ich habe wohl eine typisch bayerische Kindheit verlebt«, sagte ich, obwohl ich für diese Vermutung kaum Beweise hatte. Zu einem erheblichen Teil schien unser Leben in ähnlichen Bahnen zu verlaufen wie das meiner Spielkameraden und Schulfreunde. Typisch? Das sagt man eben, wenn man neunzehn ist und gerade angefangen hat zu leben.
»Wir hatten unser Auskommen, sonntags gingen wir alle in die Kirche, wenn wir nicht, was später immer häufiger geschah, an den Wochenenden in die Berge fuhren. Zu Hause – wir wohnten in Schwabing – wurde viel musiziert, vorgelesen, später, als wir zur Schule gingen, auch diskutiert. Nein, mein Vater wurde nicht einberufen, er war in einem kriegswichtigen Betrieb beschäftigt. Dann kamen die Bombennächte. Mein Vater brachte uns hinaus aufs Land, ins Allgäu – sagt Ihnen das etwas?«
»Natürlich, das ist ja schon fast Österreich«, erwiderte Kepler und fragte: »Das kleine und das große Walsertal?«
»Die sind noch deutsch«, behauptete ich.
»Aber österreichisches Zollgebiet?«
»Oder umgekehrt?«, fragte ich. Plötzlich wusste ich es auch nicht mehr so genau.
Es gab zwar eine Speisekarte in diesem Club, aber sie diente lediglich der Information über das jeweilige Angebot. Man konnte entweder das ganze Menü essen oder nur ein oder zwei Gänge. Ich entschied mich für den Fisch und den Salat, Florian nahm ein Steak und eine Idaho Potato mit Sour Cream.
»Damit können sie nicht viel falsch machen«, begründete er seine Wahl.
»Das Konzert heute Nachmittag«, sagte ich. »War das so geplant, oder war da plötzlich Improvisation im Spiel?«
Kepler hatte wieder seine Lieblingshaltung angenommen: die Unterarme auf dem Tisch, leicht nach vorn gebeugt. Er schaute die meiste Zeit auf das Tischtuch, hob aber hin und wieder den Blick und sah mich aus seinen großen, ernsten Augen an.
»Die Mozart-Sonate und die Chopin-Etüden waren geplant.«
»Und dann?«
Er sah mich wieder an. Manchmal fand ich seinen Augenaufschlag fast mädchenhaft. »Dann geschah etwas mit mir«, sagte er, und dabei war wirklich eine Spur von Schwärmerei und Verträumtheit in seinen Augen.
»Und was war das?«
»Das wart ihr.« Kepler musste seine Lieblingshaltung einen Augenblick lang aufgeben, weil der Ober ihm seinen Salat brachte. Aber dann ignorierte er die grünen Blätter, die jetzt vor ihm standen. »Ich spürte plötzlich eine Anspannung, ein Mitgehen der Zuhörer.« Er fing an, einzelne Blätter mit der Gabel aufzuspießen und aß etwas von seinem Salat.
»Kennst du das?« Er legte seine Gabel wieder hin.
Ich nickte, obwohl ich keine Ahnung hatte, wovon er redete. Ich wollte nur, dass er weitersprach.
»Geht es dir manchmal auch so?«
»Wie?«
»Du spürst die Anteilnahme, die Empathie, das momentane Glück deiner Zuhörer, du spürst das wie ein Medium, das dich durchflutet, dem du dich nicht entziehen kannst. Es ist wie ein höheres Einverständnis, eine von Gott gestiftete Zusammengehörigkeit.«
Kepler wandte sich wieder seinem Salat zu und schob dann den abgegessenen Teller ein Stück von sich fort. »Oder von einem guten Geist gestiftet.« Er lächelte. »Aber du bist ja katholisch, du glaubst wohl eher an die Gegenwart Gottes.«
Ich zuckte mit den Achseln. »Ist ja egal«, sagte ich. »Jedenfalls …«
»Ja, jedenfalls war da plötzlich eine Gemeinschaft der Seelen oder der Erwartungen. Jetzt erst fing das Konzert an, mir Spaß zu machen. Danach habe ich so gespielt, wie ich eigentlich immer spielen sollte.«
»So gut?«
»So konzentriert, so aufmerksam für jede Einzelheit. Hast du es bemerkt?«
»Ich glaube, wir alle haben es bemerkt.«
Wieder kam der Ober, räumte die Salatteller ab und servierte das Hauptgericht.
»Trinkst du ein Glas Wein?«, fragte mich Kepler, aber ich blieb lieber bei dem leicht nach Chlor schmeckenden Wasser aus der Leitung.
Kepler fragte den Ober nach den vorhandenen Weinen und bestellte sich ein Glas Bordeaux.
»Ich habe so gut gespielt, weil ihr so gut zugehört habt. Plötzlich war alles wahnsinnig wichtig: die genaue Lautstärke des As-Dur-Motivs, mit dem die Sonate beginnt, das Lamentoso und dann die Fuge und ihre Umkehrung. Da ist keine Note überflüssig, aber es fehlt auch nichts. Es ist ein vollkommenes Stück, vollkommen auch da, wo sich Beethoven aus dem Fugato wieder löst, wenn nach der Umkehrung das Anfangsthema der Fuge in akkordischer Form wiederkehrt – das ist wie …«, Kepler suchte nach Worten, »… das ist, als wenn ein Mensch nach dem Eingebundensein in eine Gemeinschaft – an so etwas könnte man bei der Umkehrung des Themas denken – sich wieder findet. Und sich selbst, seine Gestalt, seine Bedeutung am Schluss zur vollen Geltung bringt.«
Kepler sprach diese Worte, die ihn innerlich wohl sehr bewegten, in unverkennbar wienerischem Tonfall. »Und das«, fuhr er fort, »geht nur, wenn die Zuhörer einem dabei folgen.« Er unterbrach sich, um einen Schluck Wein zu trinken. »Nicht nur folgen: recht geben müssen sie dir in ihrer Hingabe an diese Musik. Warum erzähle ich dir das alles? Weil ich ein Publikum brauche, wie ihr es heute Nachmittag wart. Menschen mit Erfahrung, mit einer Nähe zu dieser Musik. Ohne ein solches Publikum kann ich gar nicht werden, der ich sein möchte.«
Ich wunderte mich, dass er so offen zu mir war, obwohl wir uns kaum ein paar Stunden lang kannten.
»Ich glaube, Klaus, das wollte ich dir sagen, als du vorhin zu mir kamst und mich fragtest, ob ich nicht auch in Europa spielen will. Natürlich will ich in Europa spielen – in Wien im Musikverein oder im Konzerthaus, in München, in Berlin … wenn das nur alles schon wieder möglich wäre. Ich spüre, dass ich dort die Menschen finde, das Publikum, das mir nicht nur zuhört, sondern das mir gehört und dem ich gehöre.«
»Und wenn Sie hier sind, Mister Kepler? Wo spielen Sie am liebsten?«
»Nenn mich Florian. Dein Mister Kepler klingt so ehrerbietig, dass ich mir dabei alt vorkomme.«
»Also, Florian«, sagte ich, hatte aber vor lauter Hemmungen vergessen, was ich ihn fragen wollte. Ich musste mich erst an die Nähe gewöhnen, die er offenbar suchte. Einen Moment lang war ich verwirrt.
»Wo ich gern musiziere?«
»Ja.«
»In New York, aber auch in kleineren Orten. In Philadelphia bin ich gern. Neulich war ich in Princeton, die haben dort einen schönen Konzertsaal. Aber New York ist wichtig – schon wegen der Agenten, die alle dort sitzen, und wegen der Kritiker.«
Ich wollte wissen, wann er nach Amerika gekommen sei.
»Früh«, erwiderte Florian. »Gott sei Dank.«
Da wir mit unserer Mahlzeit am Ende waren – der Ober hatte uns bereits zweimal nach weiteren Wünschen gefragt und war abschlägig beschieden worden –, gingen wir wieder an unseren alten Platz im Lesesaal zurück. Florian trank noch ein Glas Rotwein, ich blieb bei Leitungswasser.