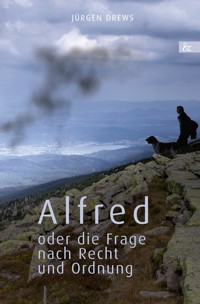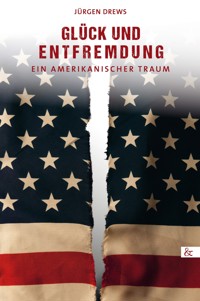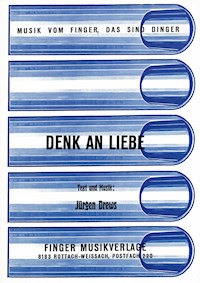JÜRGEN DREWS, 1933 in Berlin geboren, studierte Medizin, habilitierte sich und wurde Professor für Innere Medizin in Heidelberg und Molekulare Genetik in New Jersey, USA. Von 1970 bis 1998 leitete er die weltweite Forschung und Entwicklung großer international tätiger Pharma-Firmen, zuletzt als Mitglied der Konzernleitung bei Hoffmann-La Roche. Er ist heute freiberuflich tätig und lebt in der Nähe von München und im Tessin. 2004 erhielt er den Beckmann-Preis der American Laboratory Association für bedeutende Beiträge zur Arzneimittelforschung. Drews veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Artikel und ist Autor und Herausgeber vieler Fachbücher, z. B. »In Quest of Tomorrow’s Medicines« (Springer, New York, 2000). Daneben publizierte er mehrere Romane, u. a. »El Mundo oder die Leugnung der Vergänglichkeit« (2003), »Menschengedenken« (2005), »Der Spiegelmord im Mörderspiel« (2006), »Wie wir den Krieg gewannen« (2007), »Jahresringe« (2008), »Der verschwundene Pianist« (2009), »Unter der Himmelsuhr« (2010) sowie Erzählungen und Gedichtbände.
Jürgen Drews
Wendelins Traum
Roman
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unterwww.buchmedia.de
Februar 2012
© 2012 Buch&media GmbH, München
Umschlaggestaltung: Kay Fretwurst, Freienbrink
Printed in Germany · ISBN 978-3-86520-436-3
Inhalt
Prolog: Ärzte hoffen auf ein Wunder
ERSTER TEIL
1 Ein Unfall führt in eine andere Welt
2 Wolfgang Wendelin begegnet dem Tod
3 Monsignore Kastenbauer
4 Josef von Arimathia
5 Abschiede
6 Eine Reise nach Berlin
7 Der Unsinn der Offenbarung und der liebe Augustinus
8 Ungeziefer
9 Das Teltower Gymnasium
10 Wendelin und seine Freunde
11 Erzählen macht müde
12 Sybille
13 Wendelin lernt die Liebe kennen
14 Die Jenaer Seele
ZWEITER TEIL
15 In Bischof Kaulbachs Diensten
16 Sybille geht
17 Ecclesia semper reformanda?
18 In der Psychiatrie
19 Jochen Andres stellt die Weichen
20 Nicht in dieser Welt
21 Wendelin fasst einen Entschluss
22 Was er will, soll er auch dürfen
DRITTER TEIL
23 Haben nun alle, was sie wollen?
24 Jochen Andres verschläft eine Revolution
25 Wendelin schreibt einen Weihnachtsbrief
26 Eigentliches und Uneigentliches
27 Stulp bekommt Besuch und eine Einladung
28 Wendelins Diaspora
29 Wendelin und die Pessimisten
30 Der Besuch der älteren Herren
31 Wendelin eckt an und muss sich verändern
32 Ein Philosoph hat ausgedient
33 Das Klassentreffen
34 Jung und Alt und die späte Antwort auf eine Frage
35 Wendelin verläuft sich in der Vergangenheit
Epilog: Das Wunder wird bestätigt
Prolog
ÄRZTE HOFFEN AUF EIN WUNDER
Durch Sonnenblenden gefiltertes Licht fiel in ein sparsam möbliertes, aber reichlich mit medizinischen Geräten ausgestattetes Krankenzimmer. Auf dem einzigen Bett lag eine große, schlanke Gestalt, nur mit einem Laken bedeckt. Bei näherem Hinsehen erkannte man einen älteren Mann, der offenbar schlief. Die rötlich-blonden Haare waren über der linken Schädelhälfte vor geraumer Zeit abrasiert worden, danach aber wieder gewachsen, wenn auch nicht zu ihrer ursprünglichen Fülle und Länge. Herztätigkeit und Atmung des Patienten wurden durch Elektroden, die man an seinem Brustkorb befestigt hatte, fortlaufend überwacht und auf einem Bildschirm sichtbar gemacht. In der Luftröhre steckte eine gebogene Kanüle, durch die der Patient mithilfe eines Gerätes künstlich beatmet wurde. Links von seinem Bett befand sich ein Ständer mit Plastikflaschen. Aus einem dieser Behälter rann eine klare wässrige Flüssigkeit durch einen dünnen Schlauch in die Armvene des Bewusstlosen. Zwei Ärzte, der eine jung, dunkelhaarig und etwas angespannt wirkend, der andere schon älter, mit bereits stark ergrautem Haar, standen sich an den Seiten des Bettes gegenüber. Der jüngere Arzt schien den älteren Kollegen über den Zustand des bewusstlosen Mannes zu informieren. Zur Bekräftigung seiner Aussagen reichte er ihm von Zeit zu Zeit ein Dokument oder ein Röntgenbild über das Bett. Der Ältere legte die geprüften Unterlagen auf einen am Fußende des Bettes platzierten Stuhl. Zwischendurch fiel sein Blick auf eine elektrische Uhr mit Datumsanzeige, die an der Wand neben dem Fenster befestigt war. Dieses Gerät zeigte das Datum vom sechsten Juni 1993.
»Wie lange liegt er jetzt schon hier?«, fragte der ältere Arzt.
»Fast auf den Tag genau ein Jahr«, lautete die rasche und ein wenig beflissen klingende Antwort.
»Und verändert hat sich nichts«, stellte der Ältere fest, nachdem er den Worten seines jüngeren Kollegen eine Zeit lang zugehört und dabei die Befunde angesehen hatte, die ihm zugereicht wurden.
»Bis auf die Tatsache, dass die Hirnstromkurve sich seit drei Wochen weiter verschlechtert hat. Bis dahin konnte man über der rechten Hirnhälfte immer noch Potenziale ableiten, langsame Wellen freilich, ähnlich denen, die man in einem Schlaf-EEG findet.«
»Und jetzt?«
»Wir sehen eine Nulllinie, die nur noch selten von uncharakteristischen Ausschlägen unterbrochen wird.«
»Kreislauf und Nierenfunktion sind stabil«, resümierte der Ältere und fügte hinzu: »Wenn wir nur wüssten, ob während eines solchen Komas noch Bewusstseinsreste aktiv sind.«
»In den ersten Monaten hätte das vielleicht der Fall sein können, jedenfalls ist es nicht auszuschließen«, sagte der Jüngere. »Bis dahin hat er ja auch noch spontan geatmet, und es waren auch immer wieder einmal Hirnströme messbar. Aber damit ist es nun wohl vorbei.«
»Was tun wir?«
»Der Patient hat eine Verfügung hinterlassen. Danach möchte er nicht künstlich am Leben erhalten werden, wenn keine Aussicht mehr auf eine Wiederherstellung besteht.«
»Also?«
»Die Geräte abstellen.«
Der Ältere nickte. »Ich verstehe das schon, aber schauen Sie ihn doch einmal an, er sieht aus wie ein Schlafender. Ruhig und entspannt, dazu die gute Gesichtsfarbe. Wer ihn so sieht, von dem Trachealtubus einmal abgesehen, würde sich nicht wundern, wenn er plötzlich die Augen aufschlüge und ein paar Worte sagte.«
Sie schwiegen beide. Eine Zeit lang hörte man nur die ruhige Tätigkeit des Atemgeräts. Ein – aus, ein – aus, sechzehn Mal in der Minute.
»Warten wir noch ein paar Tage«, sagte der Ältere.
»Aber worauf?«, fragte sein jüngerer Kollege.
»Auf ein Wunder.«
ERSTER TEIL
1
EIN UNFALLFÜHRT IN EINE ANDERE WELT
Man sollte beim Autofahren nicht ins Träumen oder ins Erinnern geraten. Unter bestimmten Bedingungen werden Träume zu einer tödlichen Falle. Jedenfalls endete mein Traum von Freiheit und Weite, zu dem mich ein Streifen tiefblauen Himmels verführte, der zwischen den sich zueinander neigenden grünen Baumwipfeln einer brandenburgischen Allee aufleuchtete, am mächtigen Stamm eines alten Kastanienbaumes, an dem mein lächerliches kleines Auto zerschellte wie ein rohes Ei, das man zu Boden fallen lässt. An den Augenblick des Aufpralls erinnere ich mich nicht. Danach aber umgaben mich Helligkeit, Schwerelosigkeit und Stille sowie ein merkwürdiges Gefühl von Leere, und dann durfte ich mein turbulentes Ende noch einmal aus der Entfernung miterleben. Es vollzog sich in einer langsamen, an filmisches Zeitlupentempo erinnernden Abfolge von Bewegungen, die schließlich damit endeten, dass die Trümmer meines in tausend Stücke zersprungenen Opel Kadetts in weitem Umkreis herumlagen und der Körper, den ich ein Leben lang beseelt hatte, zusammengekrümmt wie ein Embryo vor dem Baumstamm zu liegen kam und sich noch im Tode an das aus der Lenksäule gerissene Steuerrad krallte. Dennoch zweifelte ich zu Anfang. War ich wirklich tot? Oder war dieser sich noch einige Male wiederholende Ablauf eines Filmstreifens ein Beweis dafür, dass noch Leben in meinem Körper steckte und dass mir die Bilder, die ich sah, von den Resten meines schnell schwindenden Bewusstseins vorgespielt wurden?
Doch die Bilder verblassten, verschwanden schließlich ganz und hinterließen das bereits erwähnte Gefühl der Leere bei erhaltenem oder wieder erwachtem Bewusstsein – wer will das entscheiden? Das Gefühl, zu einem Körper zu gehören, ging bald verloren, meine Existenz beschränkte sich zunehmend auf Gedanken, Erinnerungen und auf Fragen, die sich aus meinem irdischen Lebenswandel ergeben hatten, aber bisher unbeantwortet geblieben waren. Ich wurde zu einem Geist meiner selbst. Dass es trotz der Einsamkeit, die ich empfand, neben dem meinen noch andere Geister geben musste, spürte ich daran, dass gelegentlich fremde Ideen und Bilder in die mir aus Wolfgang Wendelins Leben vertrauten Vorstellungen einbrachen. Es war ein Gefühl, als ob Radiosender auf nahe beieinander liegenden Frequenzen sich für Augenblicke überlagerten und den Sinn der von ihnen übermittelten Botschaften schlagartig in Unsinn verwandelten. Jedenfalls war es keine angenehme Empfindung, und ich wich solchen zu fremden Existenzen gehörenden Kraftfeldern aus, so schnell ich konnte, und beschränkte mich darauf, über das eben zu Ende gegangene Leben nachzudenken. Hatte ich meine Aufgabe erfüllt? Hatte ich Wolfgang Wendelin, der jetzt irgendwo da unten lag, noch immer neben dem Baum oder in einer Notfallambulanz, im Krankenhaus, auf einer Intensivstation oder bereits auf dem Friedhof, gut durch sein Leben geführt?
Ich erwähnte bereits, dass mein Gefühl für den Körper, den ich beseelt hatte, mir bald nach meinem Übertritt ins Jenseits vollständig abhandengekommen war. Dieser Verlust trug zu dem Gefühl der Verlorenheit bei, das mich jetzt plagt. Aber hat dieser Zustand nicht auch sein Gutes? Endlich bin ich da, wo ich immer hinwollte. Jetzt würde ich hinter das Geheimnis kommen, das Wolfgang sein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Hunderte von Menschen habe ich während meines Daseins als katholischer Geistlicher auf dem letzten Stück ihres Weges begleitet, habe ihnen zugehört, ihnen die Hand gehalten, ihnen zugeredet, Trost gespendet, soweit ich dazu imstande war, aber nie konnte ich einen Blick hinter das Tor werfen, das sich im Augenblick ihres Todes für sie öffnete und sofort wieder schloss. Jetzt hat sich das Tor für mich selbst geöffnet und geschlossen.
Erst hier im Jenseits, von dem ich zuletzt angenommen hatte, dass es gar nicht existiert, von diesem Ort aus, an dem ich mich nun gegen alle Erwartungen wiederfinde, könnte ich die Unabhängigkeit gewinnen, die ich brauche, um Wolfgangs Leben, also auch das seiner Familie und Freunde, vielleicht sogar seine Zeit, mit dem nötigen Abstand zu beschreiben und damit ein Maß für meine eigene Rolle als Wendelins Seele zu gewinnen. Der Versuch, eine Lebensspanne, mithin einen nach subjektiven Maßstäben langen Zeitraum zu beschreiben, sollte meine erste Aufgabe sein, auch wenn ich mir sagen muss, dass diese Zeitspanne in den Kategorien des Jenseits nicht mehr sein kann als ein Wimpernschlag. Alles andere, was es noch zu entdecken gäbe, sollte warten oder nur da zu Wort kommen, wo es die Geschichte von Wolfgangs Leben ergänzt oder – so stelle ich mir das am Beginn dieser großen Arbeit vor – konterkariert, ohne von ihr abzulenken. Woran ich denke? Nun, wer hat während seines Lebens auf der Erde nicht von Menschen erfahren, die lange vor ihm lebten und starben und von denen ein solcher Zauber ausgegangen war, dass er oder sie viel dafür gegeben hätte, ihnen zu begegnen, und sei es nur für ein paar Minuten. Diese Art Neugier bezieht sich auch auf den einen oder anderen Zeitgenossen, der irgendwann starb oder noch sterben wird und zu dem wir auf der Erde nie Zugang fanden. Vielleicht, so denke ich, würde ich an diesem Ort, an dem die Unterschiede von Raum und Zeit nicht mehr gelten, Gelegenheit finden, große Dichter und Musiker, Religionsstifter und Philosophen, Feldherren oder Politiker kennenzulernen.
Mit dieser vielleicht existierenden Möglichkeit will ich gleichwohl vorsichtig umgehen, um mein Hauptanliegen nicht zu gefährden. Kehren wir also zurück zu Wolfgang, meinem Schützling, dessen Leben ich mit den feineren Qualitäten des Gefühls und des Verstandes ausstatten durfte und mit dessen Körper ich nach den anfänglichen Schwierigkeiten, die dem Säuglings- und Kleinkindalter zuzuordnen sind, zu einer Einheit verschmolz – einer Einheit, die erst vor Kurzem wieder zerfiel.
An seine Kindheit hat Wolfgang sich erst erinnert, als er schon in die Jahre gekommen war. Wir werden gegen Ende dieser Erzählung auf diese Erinnerungen zurückkommen. Ich, seine Seele, will meine Erzählung von Wolfgangs Leben da beginnen lassen, wo er zum ersten Mal begriff, dass sein Leben wie das aller anderen Geschöpfe einen Anfang und ein Ende hat. Während aber der Anfang für immer im Nebel des Unbewussten bleibt und aus diesem Grund kaum Anlass zu biografischen Nachforschungen oder gar Erörterungen bietet, wird der Gedanke an sein eigenes unausweichliches Ende für einen Heranwachsenden irgendwann zu einer Beunruhigung, die ihn erst im Augenblick seines Todes wieder verlässt. Der Tag oder die Stunde, in der ein Kind zum ersten Mal begreift, dass auch sein Leben einmal zu Ende sein wird, bezeichnet den Zeitpunkt, an dem sein Körper und seine Seele eine gemeinsame Identität herstellen. Hier also wird das Leben eines Menschen zu einem eigenen, unverwechselbaren Schicksal. Und hier soll meine Geschichte beginnen.
2
WOLFGANG WENDELIN BEGEGNET DEM TOD
Es herrschte Krieg. Soldaten starben an den Fronten, auf den Ozeanen und in der Luft. Zivilisten, Frauen, Kinder und ältere Menschen kamen im Bombenhagel um, der die Städte heimsuchte. In Lager gesperrte Verfolgte gingen an Hunger und Elend zugrunde, wenn nicht an Schlimmerem. Die kindliche Seele nahm von diesen Dingen, soweit sie überhaupt mitgeteilt wurden, nur in Ausschnitten Notiz.
Eines Tages aber trat der Tod nahe an dieses Kind heran. Ich sollte genau sein, denn wir Jenseitigen verfügen über eine enzyklopädische, nichts verschweigende Erinnerung. Es war also der 17. Januar 1943, abends gegen 20 Uhr, als die Royal Air Force bei einem schweren Luftangriff auf Berlin einen neuen Typ von Sprengbomben einsetzte, Luftminen genannt, die keine große Tiefenwirkung entfalteten, aber eine enorme Sprengwirkung nach den Seiten ausübten. Damals wurde die bescheidene Wohnung, die meine Eltern mit meinem Bruder Sebastian und mir bewohnten, weitgehend zerstört. Schlimmer jedoch: Bei dem Angriff kamen auch Menschen ums Leben, die ich kannte und lieb gewonnen hatte. Unter den Toten, die am späten Abend dieses Tages zu beklagen waren, befand sich ein Spielgefährte, mit dem ich viele meiner schulfreien Stunden verbracht hatte. Seine Eltern hatten ihn nicht zeitig genug in den Luftschutzkeller gebracht, was sicher daran lag, dass Fritzchen Tausendschön ein etwas verträumtes und daher auch vertrödeltes Kind war. Die Familie befand sich erst im Treppenhaus einer mehrstöckigen Mietskaserne, als eine der erwähnten Bomben in unmittelbarer Nähe einschlug, das Kind mit seiner gewaltigen Druckwelle erfasste, gegen eine Wand schleuderte und dadurch sofort tötete. Nun also hatte der Tod, der uns Kinder trotz seiner Allgegenwart noch nicht direkt betroffen hatte, sich eines von uns geholt. Eine Zeit lang geisterte dieser Tod durch unser Leben. In der Schule wurde Fritzchens gedacht, seine Eltern begruben ihn auf einem nahe gelegenen Friedhof, seine Schulkameraden, darunter auch mein jüngerer Bruder Sebastian und ich, standen an seinem Grab und mussten zum ersten Mal in ihrem Leben ansehen, wie Erwachsene die Fassung verlieren und weinen.
Auf den Ämtern, die wir zusammen mit unseren Eltern besuchten, um unseren Anspruch auf eine Ersatzwohnung geltend zu machen, in den Läden, in denen wir gegen Abschnitte unserer Lebensmittelkarten das Nötigste erstanden – überall sprach man von dem entsetzlichen Krieg, dem nun bereits Kinder zum Opfer fielen, und meinte damit auch unseren Freund Fritzchen. Natürlich wollte ich, damals neun Jahre alt, wissen, was nun aus Fritzchen werden würde. Käme er in den Himmel, wie meine Religionslehrerin, eine trotz der schlechten Ernährungslage immer noch rundliche ältere Dame, die unabhängig von der Jahreszeit knöchelhohe Stiefelchen und Strickkleider in gedämpften Farben trug, mir versicherte? Oder lagen die Dinge komplizierter? Musste ich mich von der Vorstellung trennen, Fritzchen noch einmal in seiner wahren körperlichen Gestalt zu begegnen, und mich damit trösten, dass seine Seele weiterleben würde, unter etwas vagen Umständen zwar, aber, nach Auskunft meiner Mutter, in einem Land, in dem es keinen Krieg, keinen Tod, keine Krankheit und keine Schmerzen, überhaupt, so hörte ich auf meine insistierenden Fragen, nichts Schlechtes mehr gab?
Würden Sebastian und ich, wenn uns eine Bombe tötete, auch dorthin kommen und unsere Freundschaft mit Fritzchen erneuern können? Der Gedanke, als Seele ganz allein in den Himmel zu kommen, wo ich niemanden kannte, außer meiner Oma, von der ich annahm, dass sie inzwischen durchs Fegefeuer hindurch und glücklich im Himmel angelangt sei, war mit sehr unangenehm. Dann wäre es doch besser, wenn uns alle zusammen eine Bombe träfe und wir uns sofort im Himmel wiederfänden. Meine Eltern, besonders meine katholische Mutter, gaben sich alle Mühe, mir die letzten Dinge, die wir nach unserem Tode zu erwarten hätten, begreiflich zu machen. Doch so genau, das schloss ich aus den mütterlichen Darstellungen, schien sie es auch nicht zu wissen. Einmal sagte sie, wir Kinder kämen gleich in den Himmel, die Älteren indes müssten sich, bevor sie diesen Schritt tun durften, einem Purgatorium unterziehen. Der deutsche Name für diese Aufnahmeformalität sei Fegefeuer, doch ich solle mir das nicht so bildlich vorstellen. Es sei ein Vorgang, der eher einer Gerichtsverhandlung oder einer Prüfung gleiche, bei der festgestellt würde, welche Bußen und Strafen noch zu bestehen seien, bevor eine Seele hinreichend frei von Sünden werde. Erst dann dürfe sie in den Himmel aufgenommen werden. Im Religionsunterricht bei Fräulein Rösler hatte ich gelernt, dass Jesus am Ende der Welt zu uns auf die Erde kommen und ein letztes Gericht halten würde. Auch in dieser Ankündigung sah ich einen Widerspruch zu den Versicherungen, dass mein Freund Fritz jetzt bereits im Himmel sei. Verwirrung also, Verwirrung und Unbehagen – in dieser kurzen Formel kann ich die Empfindungen zusammenfassen, die mich damals bedrängten.
Meine Mutter hatte andere Sorgen, als meine eschatologischen Fragen zu beantworten. »Das alles wirst du viel besser verstehen, wenn du älter wirst«, prophezeite sie. Schon während des Unterrichts zur Kommunion würde ich lernen, wie das, was uns die Kirche anböte, zu verstehen sei. »Du musst nur ein wenig Geduld haben.«
Nun, Geduld war schon damals nicht meine Stärke. Sie hat mir Zeit meines irdischen Lebens gefehlt und ist mir erst jetzt in der gleichförmigen und zeitlosen Welt zuteil geworden, in der meine Seele sich nach meinem irdischen Ende aufhalten darf. Hätte ich gewusst, dass ich im irdischen Leben keine Antwort auf die vielen Fragen finden würde, die mich bedrängten, nachdem Fritzchen Tausendschön sich am 17. Januar 1943 auf und davon gemacht hatte, dann wäre meine Berufswahl sicher anders ausgefallen. Doch ich hoffte, durch inständiges Nachdenken, durch das Studium der großen Theologen und Philosophen, die sich über meine und ähnliche Fragen Gedanken gemacht hatten, sowie durch göttliche Gnade schließlich in den Zustand des Wissens versetzt zu werden. Demgemäß beschloss ich bereits im Kindesalter, Theologie zu studieren. Den ersten Anstoß zu dieser Entscheidung gab zweifellos Fritzchens frühes Ende. Aber es vergingen noch fast zwei Jahre, bis ich meinen Plan auch anderen mitteilte, meinen Eltern zuerst. Meine Mutter reagierte auf meine Ankündigung mit gerührter Zustimmung. Mein Vater, der auf seinem letzten Kurzurlaub vor dem Ende des Krieges und vor seinem eigenen Ende von meiner Absicht erfuhr, meinte, dass derartig früh geäußerte Berufswünsche nur selten unverändert bestehen blieben. Er sei gespannt, was mir als Nächstes einfallen würde.
Doch da hatte er sich getäuscht. Nicht nur blieb ich meinem Vorhaben, Theologie zu studieren, treu, ich strebte auch ins Priesteramt, denn ich ahnte bereits, dass ich Antworten auf meine Fragen nicht finden würde, solange ich nicht eine Möglichkeit entdeckte, alle Widersprüche und Wissenslücken zu überbrücken. Und diese Möglichkeit, so vermutete ich, lag in dem, was man gemeinhin Glauben nennt.
Mein Vater fiel in den letzten Kriegstagen bei den Kämpfen um die Selower Höhen. Zum zweiten Mal, jetzt aber noch bedrohlicher und eindringlicher als beim gewaltsamen Ende meines Freundes Fritzchen Tausendschön, lehrte mich der Tod das Fürchten. Die Nachricht vom Ende des Unteroffiziers Frank Wendelin erreichte uns in Bayern, wohin wir nach der Zerstörung unserer Berliner Wohnung gezogen waren, weil mein Vater damit rechnete, dass die Rote Armee Berlin erobern würde und er uns die von dieser Seite zu erwartenden und dann ja auch verübten Gräuel unbedingt ersparen wollte. Außerdem war Bayern katholisch, was für meine aus Freising stammende Mutter der entscheidende Grund war, eine Wohngelegenheit in Bernried am Starnberger See anderen Möglichkeiten vorzuziehen, obwohl einige andere Städte, etwa das thüringische Eisenach, uns unter schulischen Gesichtspunkten bessere Möglichkeiten geboten hätten als Bernried.
Mein Vater war also tot. Ich erfuhr es, als ich am 18. Mai 1945 – der Krieg war offiziell seit zehn Tagen zu Ende – aus der Schule kam und die kleine Küche betrat, in der meine Mutter uns das Mittagessen zubereitete. An diesem Tag trug sie entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit ein schwarzes Kleid, schwarze Strümpfe und Schuhe. Auch hatte sie ihr schönes braunes Haar, das sich in seiner welligen Beschaffenheit ein Leben lang anmutig um ihr etwas grobknochiges Gesicht schmiegte, straff nach hinten gerafft und in einem fast großmütterlich zu nennenden Dutt zusammengebunden. Alles an ihr war mit einem Mal schwarz und streng.
»Ich muss mit dir sprechen, Wolfgang«, sagte sie zur Begrüßung und wies auf einen der klobigen Stühle, die den kleinen Küchentisch umstanden. Natürlich wusste ich sofort, was geschehen war. Ich spürte, wie sich etwas in meiner Magengrube zusammenzog. Mein Kopf wurde leicht, schwarze und weiße Flecken tanzten plötzlich in meinem Blickfeld, als liefe zwischen uns beiden der Vorspann eines Stummfilms ab. Mit knapper Not erreichte ich den Stuhl und ließ meinen Kopf auf die Tischplatte fallen. »Ich weiß«, soll ich noch gesagt haben, dann wurde es dunkel um mich. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Sofa unseres Wohn- und Schlafzimmers gleich neben der Küche und sah in das bleiche Gesicht meiner Mutter, das sich langsam gegen den nur verschwommen wahrgenommenen Hintergrund der bäuerlich eingerichteten Wohnstube abzeichnete.
»Mein armer Bub«, flüsterte sie leise, während ihr Tränen in die Augen stiegen, »du musst nun ohne ihn aufwachsen.«
Ja, das musste ich, so viel begriff ich. Aber wo war er? Merkwürdig, dass ich bei dieser Frage nicht an sein Grab dachte, das wir später, viel später, in Selow besuchen durften, sondern an ihn selbst, an seine blauen Augen, die buschigen blonden Brauen, das kräftige Kinn, an seine Stimme und an die ruhige, immer ein wenig nachdenklich wirkende Geste, mit der er mir manchmal übers Haar strich. Diese Berührung, dachte ich, als ich mich auf dem schäbigen, altmodischen Sofa von meiner Ohnmacht erholte, diese fast verschämte Zärtlichkeit, in der so viel Liebe steckte, aber auch ein wenig Zweifel, aufgewogen freilich durch seine Zuversicht, dass ich schon schaffen würde, was immer ich in Angriff nähme, die würde ich vermissen. Woran hatte er gedacht, wenn er mir mit seiner großen warmen Hand übers Haar fuhr? Wo lagen seine Bedenken, woher kam die Zuversicht, die ich dennoch spürte? Ich würde es nie erfahren, nie. Dieses »Nie« wurde mir in dieser Zeit zu einem furchtbaren Wort, einer zugeschlagenen Tür, hinter der nun alles lag, was gewesen war und nicht mehr sein würde, einem erratischen Block, der meinen Weg versperrte, einer bis ins Firmament reichenden Mauer, die mich von allen Seiten umschloss. Das konnte doch nicht sein. Es musste doch einen Ausweg geben. Wieder fing ich an zu fragen, wollte wissen, warum das geschehen musste, wo ich ihn doch noch brauchte, ganz zu schweigen von Sebastian, der ja jünger war als ich selbst. Auf dieses »Warum« und auf die besondere Bewandtnis, die es mit dem »Tod fürs Vaterland« auf sich hatte, auf den meine Mutter sich immer wieder bezog oder mit dem sie sich herausredete, will ich später zurückkommen.
3
MONSIGNORE KASTENBAUER
Wohin also gehen die Menschen, die uns verlassen und deren Überreste wir auf Friedhöfen oder in Krematorien deponieren? Wohin war der Unteroffizier Frank Wendelin, mein Vater, gegangen? Dieser persönliche Aspekt einer viel allgemeineren Frage beschäftigte mich besonders. Wo konnte ich ihn, der kurz vor Kriegsende auf den Selower Höhen den »Heldentod« gestorben war, suchen, ihn vielleicht sogar finden? Meine sehr katholische, Grübeleien allerdings wenig zugeneigte Mutter hatte auf meine Fragen die unterschiedlichsten Antworten, die sich in meiner Fantasie nicht zu einem Ganzen fügen wollten.
»Dein Vater ist für sein Vaterland gefallen. Er hat bis zum Ende seine Pflicht getan und ist jetzt im Himmel, von wo er auf uns hinunterschaut«, sagte sie während eines Spaziergangs, den wir bei schönstem Frühsommerwetter auf dem Parkgelände der Benediktinerabtei in Bernried unternahmen. Unwillkürlich sah ich hinauf in den Himmel, der in bayerischem Weiß-Blau glänzte, und wollte in den vorüberziehenden Wolken das Gesicht meines Vaters erkennen. Nein, das konnte nicht sein. Dort oben zogen Wolken und über den Wolken verdünnte sich die Luft zur Stratosphäre und darüber lag die Troposphäre, bis das All anfing, sich endlos zu dehnen. Wo, bitte schön, sollte da der Aufenthalt für die Toten sein, für Fritzchen Tausendschön und für meinen Vater?
»Du darfst dir den Himmel nicht als irdischen Ort vorstellen«, versuchte meine Mutter mir zu erklären. »Es ist nur ein Wort, das etwas besagen will.«
»Aber was?«, wollte ich wissen.
»Ewigkeit«, gab sie zur Antwort. »Das Wort Himmel steht für die Ewigkeit, für einen Ort, an dem die Seelen der Toten aufgehoben sind, bis sie alle am Jüngsten Tag wieder erweckt werden. Dann wird der Herr Gericht halten über Gerechte und Ungerechte.«
Jetzt hatte meine Mutter mir bereits vier endzeitliche Begriffe angeboten, die untereinander keine Beziehung aufzuweisen schienen: Himmel, Ewigkeit, Jüngster Tag und das Gericht, das am Ende der Welt gehalten werden soll. Und was kam danach? Warum sollten die Seelen erst am Jüngsten Tag wieder aufgeweckt werden, wenn sie doch bereits oder immer noch lebten?
Wir kamen nicht weiter, das heißt, ich kam immerhin zu dem Schluss, dass meine Mutter es eben auch nicht so genau wusste, wo wir unseren Vater suchen und vielleicht finden könnten.
»Bei Gott ist er«, meinte sie schließlich in einem Ton, der sich nach »Basta!« anhörte. Dabei kamen ihr die Tränen, die sie mit einem kleinen zerknüllten Taschentuch abtupfen musste, um mir gegenüber nicht das Ausmaß ihrer eigenen Fassungslosigkeit zu offenbaren. Mein armes Mütterlein, denke ich, wenn ich mich an diese schwere Zeit erinnere.
Der Geistliche in der schönen Benediktinerabtei, zu dem ich einmal in der Woche in den Religionsunterricht ging, um mich zusammen mit anderen Kindern auf die heilige Kommunion vorzubereiten, half mir da schon ein wenig weiter als meine Mutter. Allerdings tat er das nicht im Kreise der übrigen Eleven, die unter seiner Ägide mit den zehn Geboten, dem Glaubensbekenntnis und den Sakramenten unserer heiligen Kirche vertraut werden sollten. Monsignore Kastenbauer, so hieß dieser liebenswürdige ältere Mann, war ein wenig korpulent und hatte lebhaft gerötete Wangen, die mir allerdings nicht als Zeichen von Gesundheit, sondern eher als dessen Gegenteil erschienen. Später erfuhr ich, dass er an einem chronischen Herzleiden laborierte. Dazu passte auch eine gewisse Kurzatmigkeit, die immer dann in Erscheinung trat, wenn er ein paar Treppenstufen steigen musste oder sich anderweitig körperlich anstrengte, etwa durch das Hochheben eines Stuhls.
Sein augenfälligstes körperliches Merkmal war ein dichter silberner Haarschopf, den er mittels eines kleinen Taschenkamms, den er stets bei sich trug, alle halbe Stunde einmal striegelte. Monsignore Kastenbauer sprach zu uns auch über die sogenannten letzten Dinge, ganz so, wie es unsere Kirche damals vorschrieb. Zu mir aber, als ich ihn eines Nachmittags bat, mir doch einige Fragen zu beantworten, sagte er etwas ganz anderes.
Wir saßen in dem Klassenraum, in dem soeben der Religionsunterricht stattgefunden hatte. Durch die Fenster schimmerte der Starnberger See zu uns herein. Draußen zwitscherten die Vögel. Man hörte ihren Gesang deutlich, nachdem Monsignore die Fenster geöffnet hatte, was er gern nach dem Unterricht tat, um den »Mief«, wie er es nannte, nach draußen zu lassen. Ich hatte durch den von Monsignore erteilten Unterricht, mehr noch aber durch die erstarrte Religiosität meiner Mutter begonnen, mir ein Bild von der Kultur meiner Kirche zu machen, wenn ich diesen durchaus positiv besetzten Begriff im Zusammenhang mit den kirchlichen Beschränktheiten überhaupt gebrauchen darf. Ich meine nämlich ihre Unbeweglichkeit, den fehlenden Mut, sich kritischen Fragen der Zeit zu stellen, die Angst der Kirche vor dem Neuen, die ihre Vertreter wohl selbst empfanden und die sie auf Jüngere übertrugen. Mir war auch bewusst geworden, wie leicht man durch allzu forsches und respektloses Fragen Tabus verletzen und dadurch in Misskredit geraten kann. Ich war also einerseits von Schüchternheit, andererseits von brennender Neugier erfüllt, als ich Monsignore um wenige Minuten seiner Zeit bat: Ich hätte einige Fragen, die mich sehr beschäftigten.
Zunächst reagierte der Geistliche überrascht auf meinen Vorstoß. »Darüber haben wir doch schon ausführlich gesprochen«, sagte er, ging dann aber, als er merkte, wie ernst es mir war, recht willig auf meinen Wunsch ein, Näheres über die Unsterblichkeit der Seele zu erfahren. Er hatte bereits Anstalten gemacht, den Klassenraum zu verlassen. Jetzt legte er die Bibel, aus der er uns regelmäßig vorlas, und sein Schlüsselbund zurück auf das Pult und nahm erneut in dem Lehnstuhl Platz, in dem er auch während des Unterrichts saß. Mit einer Handbewegung bedeutete er mir, einen Stuhl an seine Seite zu ziehen und mich neben ihn zu setzen.
»Mein Vater«, begann ich, und bei diesen Worten stiegen mir bereits Tränen in die Augen.
»Ich weiß, Wolfgang, deine Mutter hat mir davon erzählt.«
Ich sah Monsignore von der Seite an. »Aber wo ist er jetzt«, fragte ich mit dünner Stimme, »wo kann ich ihn suchen?«
»Du hast deinen Vater sehr geliebt?«, fragte Monsignore teilnehmend, und als ich unter Tränen nickte, meinte er: »Ich verstehe, er wird dir jetzt sehr fehlen.«
Ich aber wollte, nachdem ich etwas Mut gefasst hatte, wissen, wo er sei, ob er nach seinem Tod in irgendeiner Form weiterlebe. »Meine Mutter spricht vom Himmel«, sagte ich, »von der Ewigkeit und davon, dass seine Seele unsterblich sei. Aber wenn sie lebt, die Seele, warum kann ich nicht mit ihr reden? Ich hätte so viele Fragen an meinen Vater.«
Monsignore betrachtete mich aus freundlichen, etwas wässrigen Augen, zog den Taschenkamm aus einer Tasche seines priesterlichen Habits und fuhr sich damit durch sein Silberhaar. Dann steckte er den Kamm wieder ein, nicht ohne vorher geprüft zu haben, ob sich darin Haare befanden.
»Zunächst einmal zur Unsterblichkeit«, sagte er. »Du darfst dir die Seele nicht vorstellen wie ein Abbild des Körpers, in dem sie wohnte. Was ist das eigentlich, die Seele?«, fragte er, als erwarte er eine Antwort, doch es handelte sich, wie ich gleich darauf erfuhr, um eine rhetorische Frage. »Die Seele umfasst das Denken eines Menschen, seine Empfindungen, seine Vorlieben und Abneigungen, alles das, was uns im Leben als ›die Persönlichkeit‹ begegnet. Einverstanden?«
So etwas hatte ich mir bereits gedacht, aber ich hätte es nicht so schön sagen können wie der Geistliche. »Ja, das verstehe ich.«
»Gut«, sagte Monsignore, »aber das ist noch nicht alles. Die Seele umfasst auch den Glauben, wenn er denn vorhanden ist, die Hoffnung auf ein Weiterleben und …«, er legte eine kleine Pause ein, »die Liebe. Erinnerst du dich an den schönen Vers? Wir haben ihn neulich gelesen. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber …?« Er sah mich an, und als ich schwieg, fragte er: »Wie geht’s weiter?«
»… aber die Liebe ist die größte unter ihnen«, fiel mir ein.
Er nickte zufrieden. »Die Liebe«, sinnierte er, »damit ist eine besondere Art der Liebe gemeint. Caritas nennen sie die Lateiner. Hast du das schon gehabt im Lateinunterricht?’«
»Caritas, caritatis, femininum, die Liebe.«
»Fürsorge, Selbstlosigkeit sind Eigenschaften, die in diesem Wort mitschwingen. Also das alles gehört zur Seele, und die wirkt weiter, auch wenn der Körper, den sie bewohnt hat, wieder in seine Bestandteile zerfällt. Und diese Seele, diese geheimnisvolle immaterielle Größe, die nennen wir Katholiken oder wir Christen insgesamt unsterblich.«
»Und woher kommt die Seele?«, fragte ich, durch Monsignore Kastenbauers Mitteilsamkeit mutig geworden.
Monsignore schaute durch eines der offenen Fenster in die Ferne. »Das weiß niemand so ganz genau«, antwortete er leise, als verriete er mir ein Geheimnis, und warf einen raschen Blick auf die Tür unseres Klassenzimmers, bevor er weitersprach. »Also einige, zum Beispiel Ärzte und Wissenschaftler, nehmen wohl an, die Seele sei ein Erzeugnis des menschlichen Gehirns. Wir Christen streiten diese These nicht unbedingt ab, aber da der Mensch in seiner Einmaligkeit von Gott kommt, so ist dies eben auch bei seiner Seele der Fall.« Er unterbrach sich: »Wie dem auch sei, das ist ein schwieriges Gebiet. Darüber musst du dir jetzt auch nicht den Kopf zerbrechen. Wichtiger ist, die Seele bleibt.« Er nickte wie zur Bestätigung ein paarmal mit seinem rot-silbernen Kopf. »Es bleibt etwas von uns.«
»Und wo ist die Seele?«, fragte ich. »Hat sie einen Ort?«
Er lächelte mich an, gutmütig, ein wenig gönnerhaft vielleicht, aber sehr Anteil nehmend. Dann wies er mit dem Zeigefinger auf die Gegend meines Herzens: »Dort vielleicht? Oder dort?« Er zeigte auf meinen Kopf. »Oder zwischen uns, in dem Gespräch, das wir gerade führen?«
Er stand auf und trat an eines der geöffneten Fenster. Draußen blühten die Kastanien. Der See erstrahlte in einem dunklen Blau, von überallher hörten wir Vogelstimmen, und ein warmer Hauch trug Blütendüfte zu uns herauf. »Schau dich doch um, Bub, ist das nicht eine schöne Welt, eine beseelte Welt, die zu uns spricht?«
Ich musste zugeben: Der Ausblick von unserem Fenster war wirklich schön. Ich hatte jedoch Mühe, diesen Eindruck mit dem üblichen Aufenthalt der Seelen zu verbinden.
»Überall ist Gottes Geist«, sagte Monsignore und wies mit der Hand hinaus in die sommerliche Pracht, als habe er das alles selbst inszeniert. »Mach dir nicht zu viele kleinliche Vorstellungen«, riet er mir. »Du findest die Seele deines Vaters überall, wo du selbst bist. Suche ihn in deiner Vorstellung, denke an ihn, und du wirst spüren, wie lebendig seine Seele für dich sein wird.«
Das war, wie ich bald einsah, ein Rat, der über das kirchliche Dogma hinaus- oder vielmehr besser an ihm vorbeiging. In Gegenwart seiner katholischen Ordensbrüder hätte sich Monsignore wohl nicht so frei ausdrücken dürfen. Mir jedoch tat sein Rat gut, weil ich spürte, dass ich meiner Fantasie keine Zügel anlegen musste.
»Worte wie Himmel oder Ewigkeit sind nur Schlüsselworte«, sagte er mir zum Abschied. »Jeder muss selbst herausfinden, welche Schlösser er damit öffnen kann und will.« Dann reichte er mir die Hand. »Komm wieder, wenn du Fragen hast, und bestell deiner Mutter einen schönen Gruß.«
Monsignores entspannter Umgang mit den Begriffen, die meine Mutter in so bestimmter, fast möchte ich sagen kategorischer, zugleich aber unklarer und ausweichender Form benutzte, tat mir wohl. Und, auch das muss der Gerechtigkeit halber gesagt werden, die Vorstellungen und Wunschbilder, die ich als Heranwachsender und später als Erwachsener, als Student der Theologie und danach als Priester entwickelte, hielten sich eher an die großzügigen Anweisungen meines ersten wirklichen Lehrers als an die katholische Exegese – ein Umstand, der meinem persönlichen Wohlbefinden bekömmlicher war als meiner Karriere innerhalb meiner Kirche. Fürs Erste besänftigten Monsignores freundliche Worte meine Unruhe, und da seine Erklärungen und Hilfen auch immer mit der Ermahnung zur Geduld verbunden waren, hörte ich auf, Fritzchen Tausendschöns Seele oder die Seele meines Vaters bis in den letzten Winkel der von der Kirche gepriesenen himmlischen Quartiere zu verfolgen. Ich grübelte den Seelen der Verstorbenen nicht mehr nach, sondern ließ sie zu mir kommen und fragte sie, wenn ich ihre Nähe spürte, nicht nach ihrem Verbleib, sondern nach dem, was sie sagen oder tun würden, wenn sie jetzt in corpore vor mir stünden.
Die Erinnerung, die mir Monsignore Kastenbauer besonders im Hinblick auf meinen Vater an Herz gelegt hatte, führte mich jedoch zu einer neuen, ganz auf die Konflikte im Diesseits bezogenen Frage. Den Spaziergang mit meiner Mutter, bei dem sie mir versicherte, dass mein Vater für sein Vaterland gefallen sei, erwähnte ich bereits. Wie das zu verstehen sei, fragte ich meine Mutter immer wieder. Warum tat ich das?
Aus der durch keinerlei irdische Teilhabe belasteten Existenz, in der sich meine Seele befindet, solange sie sich im Jenseits aufhält und ihr eine neue irdische Verpflichtung nicht ins Haus steht, kann ich diese Frage so beantworten: Ich wünschte mir von Herzen, das Andenken an meinen Vater, das Bild von ihm, die Erinnerungen an seine Stimme, sein Gesicht, die Berührung seiner Hände, alles, was er mir war, gut aufgehoben zu wissen. Er sollte auch in der Welt, in der ich damals lebte, einen Ehrenplatz einnehmen, ganz so, wie er dies in meiner Erinnerung tat. Dieser Wunsch aber stieß auf Widerstand. Das Deutschland, für das er gekämpft hatte, war zerstört, lag am Boden und wurde mit jedem der fast täglich durch die Presse gehenden Berichte von den Gräueln der deutschen Machthaber, von den Lagern, dem Mord und dem Massenelend, das diese Kriminellen über die Welt gebracht hatten, stärker diskreditiert. Deutschland – ein Paria unter den Nationen. Und jemand, der für ein so widerwärtiges Regime gekämpft und sein Leben hingegeben hatte, sollte ein Held gewesen sein? Und doch war er es! Ich wusste es und weiß es heute natürlich noch viel genauer, weil ich mir seine letzten Tage aus der Perspektive des Jenseits vergegenwärtigen kann.
Um der Peinlichkeit zu entgehen, durch das Gedenken an gefallene Soldaten auch das Regime zu ehren, das sie in einen gewissenlos angezettelten Krieg geschickt hatte, wurde in der Schule immer nur der Toten der beiden Weltkriege oder der Opfer des Faschismus gedacht. Nie wurde an die deutschen Soldaten erinnert, von denen ich damals annahm, sie hätten genau wie die Soldaten anderer Völker in dem Bewusstsein gekämpft und gelitten, damit eine vaterländische Pflicht zu erfüllen. Natürlich liegen die Dinge in Wahrheit komplizierter, was jenseits der Lebensgrenzen ohne Weiteres erkennbar ist, von einem zu jener Zeit Heranwachsenden allerdings keineswegs leicht verstanden werden konnte.
Sollten wir die Nazis hassen, weil sie Dinge taten, von denen wir Kinder damals nichts und unsere Eltern entgegen beliebter Vorhaltungen beileibe nicht alles wussten? Sollten wir den Sieg der Engländer und Amerikaner herbeiwünschen, die uns Nacht für Nacht und später auch tagsüber mit Bomben bewarfen und damit gezielt vorwiegend Frauen, Kinder und ältere Menschen zu Hunderttausenden umbrachten? Etwa in Köln, in Hamburg und Bremen, in Berlin, München, Dresden, in ungezählten kleinen und größeren Städten. Tagsüber arbeiteten die Deutschen für Hitler, nachts verfluchten sie ihn. Hat sich jemals ein Volk in einer schlimmeren Lage befunden? In einer Lage, die den Zwiespalt der Herzen und die Schizophrenie des Handelns geradezu erzwang …
Wie sollte sich ein Heranwachsender in einer solchen Welt und in dem Gefühlschaos, das sie hinterließ, zurechtfinden? Wie sollte er ein sicheres und ungetrübtes Bild von einem Vater entwerfen, den er geliebt hatte wie sonst niemanden auf der Welt? Wie viele Erdenjahre müssen vergehen, bevor man zu einer gerechten Einschätzung der Menschen kommt, die damals keinen aktiven Widerstand gegen das teuflische Regime leisteten und dennoch versuchten, Pflichten wahrzunehmen, wenn es ihnen schon verwehrt war, ihre Pflicht in einem umfassenderen Sinn zu tun? Allein der Übersiedlung meiner Seele ins Jenseits verdanke ich die Einsichten, die ich mitzuteilen versuche: Der Unteroffizier Frank Wendelin mochte die Nazis nicht. Zeitlebens hat er sich von ihnen ferngehalten, so gut es ging. Dennoch meinte er, zumal auf den Selower Höhen, gegen den Ansturm der Roten Armee Widerstand leisten zu müssen. Etwas anderes wäre ihm gar nicht in den Sinn gekommen. Was da von der Oder her anbrandete, war eine einzige blutrünstige, rachsüchtige Kampfmaschine. Dass er diesem Sturm nicht widerstehen konnte, wusste der Unteroffizier Wendelin. Aber vielleicht konnte er helfen, diesen Ansturm aufzuhalten, und damit Zeit gewinnen für Frauen und Kinder, sich aus dem Staub zu machen und ein rettendes Ufer zu erreichen. Jeder Tag zählte, vielleicht sogar Stunden, wenn es darum ging, sie dem Zugriff der plündernden, mordenden und vergewaltigenden Horden zu entziehen.
Für sein Vaterland gefallen? Nicht für das Vaterland der Nazis, wohl aber für die Zivilisten, vor allem für die Kinder, die sich damals auf der Flucht befanden und die inzwischen groß geworden sind und selbst Nachkommen in die Welt gesetzt haben, die Erwachsenen von heute. Zu diesen Kindern gehörten auch Sebastian und ich. Und obwohl kein direkter Zusammenhang bestand zwischen unserer Flucht aus dem zerstörten Berlin nach Bayern und dem Tod des Unteroffiziers Wendelin, so hat der Knabe, in dem ich damals steckte, sich ein Bild zu eigen gemacht, in dem ein Vater seiner Familie den Rücken frei hält, um ihnen die Flucht in ein halbwegs sicheres Land zu ermöglichen. Das Bild half ihm, dem schleichenden Gift der Selbstverachtung, das in seiner Zeit grassierte wie eine ansteckende Krankheit, zu widerstehen.
4
JOSEFVON ARIMATHIA
Beim Überdenken des soeben Erzählten wird mir deutlich, wie sehr ich mich durch die Vergegenwärtigung meines irdischen Aufenthalts auch wieder in die begriffliche Enge und die sprachliche Vereinfachung habe drängen lassen, die – von hier aus betrachtet – nun einmal Merkmale des irdischen Daseins sind. Diesen Mangel werde ich, da ich noch einiges aus dem Leben meines Schützlings zu berichten habe, wohl nicht ganz vermeiden können. Denn die Fragen des Kindes und später des Heranwachsenden Wolfgang Wendelin sind mit irdischen Maßstäben nicht zu beantworten. Und warum ist das so? Weil sie bereits im Ansatz falsch sind. Wie viele Menschen stellte sich Wolfgang die Welt als das Ergebnis eines großen Schöpfungsaktes vor. Natürlich verbinden sich mit dieser Ansicht auch die Qualitäten der Vollkommenheit. Meine jenseitigen Erfahrungen zwingen mich dazu, dieses lineare Denkmodell zu verwerfen. Könnte es nicht sein, so frage ich mich immer häufiger, dass unsere Welt in Wahrheit ein Experiment darstellt? Ein Experiment, durch das eine archaische Kraft, ein Wille, eine Intelligenz versucht, sich selbst zu verstehen? Spuren oder Zeichen, die auf ein solches absichtsvolles Experimentieren verweisen, existieren in großer Zahl. Wir finden sie in zahlreichen physikalischen Konstanten, die in ihrer Gesamtheit die Grenzen definieren, unter denen sich auf der Erde Leben entwickeln konnte, nein, entwickeln musste. Und ist nicht die Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten mit seinen Mechanismen von Mutation und Selektion eine einziges großes Experiment?
Die Mutmaßung, dass ein Schöpfer-Gott, der am Anfang Himmel und Erde schuf, auf die Intelligenz der Erdbewohner angewiesen sein sollte, um sich selbst zu verstehen, würde im Kreis vieler religiös gestimmter, vor allem katholischer Erdbewohner lebhaften, um nicht zu sagen empörten Widerspruch auslösen. Von Blasphemie wäre die Rede, und vor meinem inneren Auge sehe ich einige von ihnen verständnislos glotzen, sich an einem Kruzifix festhalten oder die Kugeln eines Rosenkranzes durch ihre von rauen Erdarbeiten verunstalteten Finger gleiten lassen. Ja, Selbsterkenntnis. Die höchste Intelligenz möchte wissen, wer sie ist und woher sie kommt. Kein Wesen kann sich selbst restlos verstehen, auch das höchste nicht. Also muss es sich Instanzen schaffen, die eigene, unabhängige Formen von Intelligenz hervorbringen, in denen es sein eigenes Wesen erkennen kann. Die Erde mit ihrer Menschenintelligenz stellt den bisher am weitesten gediehenen Versuch dieser Art dar. Allerdings steht zu befürchten, dass dieser Versuch in einem relativ späten Stadium scheitern wird. Doch selbst in seinem Misslingen, das sich nun überall abzeichnet, hat dieses Experiment seinen Wert gehabt, denn die aus seinem letztendlichen Scheitern zu ziehenden Lehren werden dazu dienen, anderen großen planetarischen Versuchen, die sich noch in frühen Stadien befinden, eine gedeihlichere Entwicklung zu ermöglichen.
»Gott würfelt nicht«, würden mir die Anhänger eines allwissenden und wenn auch unbekannten, dann wenigstens von guten Absichten geleiteten Gottes entgegenhalten und damit das Wort eines großen Physikers zitieren.
Darauf müsste ich antworten: »Er würfelt nicht nur, er veranstaltet auch eine große Zahl von Experimenten, bei deren Anblick oder gar Verständnis mancher schlicht konstruierten Seele die Haare zu Berge stehen würden. Gemeinsam ist allen seinen Versuchen, dass sie mit weitaus zahlreicheren Variablen arbeiten, als sie durch die Beschaffenheit einer Tischplatte und die physikalische Kraft des den Würfel bewegenden Armes gegeben sind, und dass die Zahl der möglichen Resultate ebenfalls viel größer ist als die Zahlen zwischen eins und sechs, die uns ein Würfel anbietet.«
Und um gleich bei diesem Physiker zu bleiben: »Raffiniert ist der Alte, aber nicht bösartig«, soll er gesagt haben. Auch da wäre ich nicht so sicher. Gewiss, Bösartigkeit im irdischen Sinne existiert im Jenseits nicht. Aber einiges, was der Höchste veranstaltet, um seinen Hunger nach Erkenntnis zu stillen, würde auf Erden, wenn man es dorthin übertragen könnte, wohl als die Moral verletzend angesehen werden. Das Jenseits als Ort reiner Glückseligkeit ist ein Hirngespinst im wahrsten Sinne des Wortes, genauso wie Gott, Allah, Jahwe oder wie immer die Titel für göttliche Allmacht lauten mögen, Erfindungen des menschlichen Gehirns sind. Es geschah unerwartet. Ein Zufall. Natürlich muss da am Anfang etwas gewesen sein, das kosmische Experimente, darunter eben auch das Erdexperiment, in Gang setzte. Doch war diese Kraft, diese noch sehr ungerichtete Absicht, die mehr Freude an der Bewegung selbst, am Poltern, Blitzen und Zündeln, am Schleudern, Kreisen und Kollidieren hatte als an irgendeinem Ziel, schon der, den wir heute in unserem wohnlich eingerichteten Jenseits als den Höchsten bezeichnen? Der ist er erst geworden, als das Leben auf der Erde Gehirne hervorbrachte, die ihrerseits Seelen erzeugen konnten, Seelen, die sich Bilder von ihm machten, die ihn anbeteten, ihn mit ihrem Dasein umhüllten und ihn schließlich zwangen, sich ihrer anzunehmen und von ihnen zu lernen.
Eine vielleicht archaisch zu nennende Kraft, die nicht weiß, was sie tut, erschafft das Sonnensystem als Teil vieler anderer und größerer Gebilde und, als Teil des Sonnensystems, auch die Erde. Durch einen Zufall entsteht bei diesem Schöpfungsakt Leben, das sich seiner eigenen Gesetzlichkeit folgend zu immer höheren Formen entwickelt und schließlich das Gehirn hervorbringt, das in seiner menschlichen Ausprägung Seelen erzeugt, die dem Leben eine neue Qualität geben: die Transzendenz. Die menschliche Seele erfindet sich einen Schöpfer-Gott, mithin ein Wesen, in das sich die archaische und absichtslose Kraft von einst, der Poltergott, der Blitzeschleuderer, Chaot und Feuerschlucker, allmählich verwandelt.
Ganz langsam nimmt diese Allgewalt Eigenschaften an, die ihr die Menschen in ihrer lieben Not angedichtet haben, und ebenso allmählich entspinnt sich ein Dialog zwischen den Seelen der Menschen und ihrem sogenannten Schöpfer.
Dass ich diese Dinge wohl nicht in der Deutlichkeit darstelle, die ich mir selbst wünsche, hängt damit zusammen, dass ich mich, gemessen an hiesigen Maßstäben, noch nicht lange im Jenseits aufhalte.
Wenn ich während meines Daseins als katholischer Geistlicher über das Leben nach dem Tode nachdachte, was ich beileibe nicht so oft tat, wie mancher glauben mag, dann begab ich mich auf ein unsicheres Terrain. Die Ungewissheit über die Abläufe endzeitlicher Vorgänge, die ich bereits als Kind oder als Heranwachsender empfunden hatte, blieb mir mein ganzes Leben lang erhalten. Eine Vorstellung jedoch gewann für mich inmitten der Unklarheiten über die Reihenfolge von Purgatorium, letztem Gericht, Erlösung oder Verdammnis, Eingang in die Ewigkeit – diese Aufzählung ist bewusst unvollständig – eine alle Unsicherheiten dominierende Glaubwürdigkeit, und das war mein Bild von der Gestalt Jesu.
Wolfgang Wendelin, mein »Alter Ego«, las zeitlebens gern in der Bibel und billigte den biblischen Texten, zumindest einigen von ihnen, auch eine historische Bedeutung zu. Vor allem faszinierten ihn die Texte, die sich mit dem Leben, den Wanderungen, dem Schicksal und der zentralen Stellung Jesu im christlichen Glauben befassen. Obwohl er sich mit zahlreichen dogmatischen Vorstellungen seiner Kirche nie so recht anfreunden konnte – er hielt es in dieser Hinsicht mit Monsignore Kastenbauer –, so hat er an der Existenz Jesu, an seinem von vielen voneinander unabhängigen Quellen bezeugten Lebenslauf, seinem Tod und seiner Auferstehung nie ernstlich gezweifelt. Seine Gestalt wurde für Wendelin zum Mittelpunkt aller Heilserwartungen, die er zunächst für sich hegen musste, um sie danach auch anderen Menschen vermitteln zu können.
Leise Zweifel befielen mich dann, als ich nach meinem Übertritt ins Jenseits nur selten von Seelen hörte, die ich mit bedeutenden irdischen Lebensläufen verbinden konnte. Dass die Prominenz der im Jenseits versammelten Seelen kein genaues Abbild der Verteilung von Ansehen und Ruhm auf der Erde ist, darf nicht verwundern. Erstens gelten hier andere Maßstäbe als auf Erden, und zweitens befinden sich die Seelen besonderer Menschen, gerade solcher, die sich durch philosophische, wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen oder einfach nur durch Selbstlosigkeit und Güte hervorgetan haben, häufig im »Umlauf«. Mit diesem Wort meine ich die Möglichkeit, dass sich manche Seelen gerade wieder im irdischen Bereich aufhalten, wenn man sie hier im Jenseits sucht. Die Ergebnislosigkeit solcher Anstrengungen kann vieles bedeuten. Sie verweist auf die unermessliche raumzeitliche Weite des Jenseits und auf die große Zahl der Seelen, die dort bereits Eingang gefunden haben. Sie kann aber auch bedeuten, dass viele von ihnen irgendwo ein neues irdisches Leben führen. Dass ich bisher nie auf Spuren meiner väterlichen Seele stieß, hat mich am Anfang meines hiesigen Aufenthalts sehr enttäuscht, erschien mir jedoch nach einigem Nachdenken ganz erklärlich. Es verhält sich mit vielen Seelen ebenso wie mit viel gelesenen Büchern in einer großen Bibliothek: Sie sind häufig ausgeliehen. Anders als Bücher aber haben sie sich bei ihrer Rückkehr möglicherweise auch verändert und figurieren sogar unter anderen Bezeichnungen. Trotzdem hatte ich keine Mühe, die Seele des von mir sehr verehrten Johannes XXIII. auch hier im Jenseits ausfindig zu machen und mit ihr zu kommunizieren. Allerdings stellte sich das als eine eher verwirrende Begegnung heraus, weil die Johannes-Seele alle jenseitigen Erscheinungen ganz im Sinne ihrer auf Erden gehegten Erwartungen interpretierte – eine Einstellung, die oft nur durch lange Aufenthalte im Jenseits zu beheben ist. Doch davon ein anderes Mal.
Was aber war mit Jesus? Dem volkstümlichsten aller jüdischen Prediger, dem Urbild des Menschen, der sich für andere opfert, dem Wort oder dem Sohn Gottes? Niemand, keine der für mich erreichbaren Seelen, wusste Genaues von dieser Seele, die doch in meiner Vorstellung ganz in der Nähe des Höchsten angesiedelt sein musste. Durch Zufall begegnete ich auf einem meiner blind schweifenden Ausflüge – man beachte, wie nahe das auf der Erde geprägte Wort »Ausflug« den Seelenbewegungen im Jenseits kommt – einer sehr freundlichen Seele, die mir auf mein Befragen eine ganze Reihe von Menschen nannte, die sie bereits bewohnt hatte, von denen ich allerdings niemanden kannte. Erst als mein schwebender Freund mir den Namen Josef von Arimathia nannte, wurde ich stutzig.
»Ach – habe ich richtig verstanden? Josef von Arimathia, der Hebräer, der Pontius Pilatus bat, ihm den Leichnam Jesu nach dessen Kreuzigung zu überlassen und der den Toten dann in einem für seine Familie frisch in den Felsen gehauenen Grab beisetzte, nicht ohne ihn zuvor in reine Tücher gehüllt zu haben?«
»Derselbe«, bestätigte mir die Josef-Seele, und ich spürte in dieser Antwort ihre Freude darüber, dass wenigstens einer in diesen riesigen Ausdehnungen und Zeiträumen den Josef von Arimathia einzuordnen wusste.
Ich war entzückt und verschmolz für kurze Zeit ganz mit der Josef-Seele, um alles von ihr zu erfahren, was ich über den Tod Jesu und seine Auferstehung vielleicht noch nicht gelernt hatte. Vor allem aber wollte ich wissen, warum Jesus hier, anders als auf der Erde, einen so geringen Grad von Bekanntheit erlangt hatte.
Trotz meines Entgegenkommens gestaltete sich unser Austausch zunächst schwierig. Zu viele Stationen, so ließ mich die Josef-Seele wissen, habe sie inzwischen durchlaufen müssen, darunter den Aufenthalt im Körper eines Kurienkardinals und davor in dem einer thüringischen Dorfschönheit, die als Hexe verbrannt wurde, weil sie dem Bürgermeister schöne Augen gemacht hatte und deshalb von dessen ältlicher Ehefrau angeklagt worden war. Diese Erlebnisse müssten zunächst an ihren rechtmäßigen banalen Platz verwiesen werden, um die Josef-Erlebnisse wieder deutlich hervortreten zu lassen. Allmählich aber erfuhr ich, weshalb die Jesus-Seele sich im Jenseits einiger Hochachtung und Zuneigung erfreue, aber eben nicht als ein singuläres Wesen gelte.
»Wenn du noch eine Vorstellung vom Kreuzigungstod hättest und dir die Evangelien in allen Einzelheiten vor Augen stünden, wärst du vielleicht selbst darauf gekommen«, vernahm ich, konnte mir aber zunächst keinen Reim darauf machen.
»Ich bat Pontius Pilatus, mir den Leichnam Jesu herauszugeben, daran erinnerst du dich?«
Ich bejahte.
»Nun, diese Bitte äußerte ich am Abend des Kreuzigungstages, noch vor Sonnenuntergang. Pilatus wunderte sich, dass Jesus, der erst ein paar Stunden am Kreuz hing, schon tot sei. Erst die Bestätigung durch einen römischen Hauptmann, einen Centurion, wie man die damals nannte, veranlasste ihn, meiner Bitte zu entsprechen. Du musst nämlich wissen«, fügte die Josef-Seele nach einer Pause hinzu, »dass der Tod am Kreuz langsam eintritt, sehr langsam sogar. Es kann viele Stunden, oft sogar Tage dauern, bis einer hinüber ist. Verzeih die direkte Ausdrucksweise.«
»Und was hat das mit Jesus zu tun?«, fragte ich.
»Na ja, Pontius Pilatus kannte sich aus. Er wusste, wie schwer es sich am Kreuz stirbt. Aber der Hauptmann hatte wohl nicht so genau hingeschaut. Als ich nach dem Gespräch des Pilatus mit dem Centurion zu den Kreuzen auf Golgatha kam, hingen alle drei am Kreuz. Die beiden Räuber bäumten sich hin und wieder auf, schrien und klagten und versanken dann wieder in Apathie. Um sie schneller sterben zu lassen, brach ihnen der Hauptmann die Schienbeine. Dazu nimmt man eine Eisenstange, mit der man kräftig gegen die Unterschenkel schlägt. Zu deinem Verständnis: Wenn die Schienbeine gebrochen sind, verblutet der Gekreuzigte sehr schnell. Ein rascher Kreislaufkollaps und der Tod sind die Folge. Und das wollte der Hauptmann ja erreichen, denn die Juden saßen ihm im Nacken, weil der Sabbat vor der Tür stand. Bis zum Sonnenuntergang musste reiner Tisch gemacht werden.«
»Und Jesus?«, fragte ich vorsichtig.
»Jesus, ach ja …« Die Worte kamen jetzt langsamer aus der Josef-Seele, als müsse sie sich erst besinnen – ein Verhalten, das ich von anderen Seelen, die sich an länger zurückliegende Lebensereignisse erinnern wollten, bereits kannte. »Also Jesus schien schon tot zu sein, und weil er dabei so friedlich aussah, nahm der Hauptmann davon Abstand, ihm ebenfalls die Beine zu brechen. Er legte das Kreuz um, überaus vorsichtig und geschickt, und zog darauf mit einer Zange die langen Nägel aus den Hand- und Fußgelenken. Dann, als Johannes und ich Jesus aufnahmen, um ihn in ein reines Laken zu hüllen, welches ich mir besorgt hatte, spürte ich, dass Jesus noch atmete. Es waren flache, unregelmäßige Atemzüge, aber ich nahm sie dennoch wahr, wenn ich mich über das Gesicht des Heilands beugte. Du kannst dir denken, wie sehr mich diese Entdeckung überraschte und erregte. Hatte auch Johannes etwas gemerkt? Einmal unterbrach er seine Tätigkeit für einen kurzen Moment und starrte mich an, als ob er mir etwas sagen wollte. Die Angehörigen Jesu, die im Hintergrund standen, verhüllten ihre Gesichter, als wir den leblos wirkenden Körper in frische Tücher einschlugen. Zwei Gedanken bewegten mich während dieser fast mechanisch ablaufenden Verrichtungen. Der eine: Gott, lass ihn jetzt nicht im Stich, erhalte ihn uns, lass ihn wieder genesen. Der andere: Wir müssen den Centurion loswerden. Er darf auf keinen Fall merken, dass Jesus noch lebt. Er würde ihm ebenfalls die Beine brechen wie den beiden anderen. Ich wusste, in unserer Grabkammer war ausreichend Platz. Außerdem war es dort kühl. Ich würde ihn pflegen können. Also trugen wir, Johannes und ich, den vermeintlichen Leichnam, in Leinentücher gehüllt, auf einer Trage zu der Grabstätte auf Golgatha, die meine Brüder und ich erst vor kurzer Zeit angelegt hatten. Sie bestand aus einem kleinen Vorraum, in dem man nur gebückt stehen konnte, in welchem ein liegender Mensch aber ohne Weiteres Platz finden würde. Von diesem Vorraum aus hatten wir drei Stollen in den Fels geschlagen. Jeder von ihnen war groß genug, um einen Menschen aufzunehmen. Um den sterbenskranken Jesus in die Grabkammer zu bekommen, mussten wir einen großen Stein, den meine Brüder und ich vor den Eingang des Grabes gewälzt hatten, zur Seite rollen. Der Stein war sehr schwer, doch nicht sehr groß. Er reichte mir nur bis zu den Hüften. Zu viert hatten wir den Stein leicht bewegen können. Jetzt mussten wir diese Aufgabe zu zweit lösen. Zu Hilfe kam uns die Form des Steins. Er war fast rund. Die leichte Abschüssigkeit des Geländes vor der Grabkammer trug ebenfalls dazu bei, uns diese Aufgabe zu erleichtern. Trotzdem –es gelang uns nicht, die Türöffnung zur Grabkammer freizulegen. Wir mussten uns mit einem schmalen Zugang begnügen, durch den wir die Trage mit dem reglosen Körper in die Höhle schieben konnten. Ich selbst zwängte mich in die kühle Dunkelheit des Vorraums und zog an den Griffen der Trage, während Johannes von draußen schob. Erst nachdem wir diese schwierige Operation glücklich bewältigt hatten, merkten wir, dass uns eine Gruppe von Menschen gefolgt war. Maria, die Mutter Jesu, Maria Magdalena, die er geliebt hatte, dazu die Jünger und Freunde, die das Kreuz umstanden hatten. Einige trugen Fackeln, weil es inzwischen dunkelte. Jetzt in der Finsternis der Höhle hörte ich plötzlich so etwas wie einen Seufzer und danach ein leises Stöhnen. Wieder durchfuhr mich ein Schrecken, wie du dir denken kannst. Ich hob das Tuch vom Gesicht Jesu und spürte dabei wie zuvor seinen Atem an meinen Fingern. Dann reichte mir Johannes eine brennende Fackel durch die schmale Öffnung, durch die wir die Trage geschoben hatten. Ich steckte sie in eine Halterung, die meine Brüder und ich im Inneren der Höhle angebracht hatten und die über einen Spalt im Fels einen Abzug nach draußen erhielt. Als ich damit fertig war und mich umwandte, um in das Gesicht meines Freundes zu sehen, hatte er die Augen geöffnet. Sie starrten ins Leere. Ich beugte mich über ihn, aber er blickte durch mich hindurch. Immer noch zweifelte ich, ob er die nächsten Stunden überstehen könnte, aber ich war entschlossen, alles zu versuchen, um ihn zu retten. Auf die schwache Möglichkeit hin, dass er mich verstünde, flüsterte ich ihm etwas ins Ohr und rief ihn bei seinem Namen Joshua, so nannten ihn seine Freunde. Ich erklärte ihm, dass ich wiederkommen würde, um ihm Wasser zu bringen, frische Binden, Kräuter und Salben für seine Wunden sowie Decken und Kissen. Als ich ›Wasser‹ sagte, schienen seine Lippen dieses Wort stumm zu wiederholen. Anscheinend quälte ihn der Durst mehr als der Schmerz, den seine Verletzungen ihm verursachen mussten. Durch die schmale Öffnung, die Johannes und ich geschaffen hatten, schlängelte ich mich nach draußen. Es war dunkel. Die Menschen, die uns gefolgt waren, hatten sich zerstreut. Mit dem Sonnenuntergang war ja der Sabbat angebrochen, der Festtag, den die Gläubigen in ihren Häusern oder in einem der Tempel zubrachten. Johannes hatte auf mich gewartet. Nun sah er mich im schwachen Lichtschein, der aus der Höhle auf uns fiel, fragend an, worauf ich nur nickte, ohne etwas zu sagen. Der Jünger musste meine Geste als die Bestätigung dafür aufgefasst haben, dass Jesus nun doch verschieden sei, denn er umarmte mich, verharrte einen Augenblick in dieser Haltung und entfernte sich rasch in die Dunkelheit. Ich hingegen beeilte mich, nach Hause zu kommen, um das Nötigste zu besorgen, und kehrte nach etwa einer Stunde zurück in die Grabkammer. Als ich dem todesmatten und nun auch fiebernden Kranken Wasser anbot, schlug er zum zweiten Mal die Augen auf. Diesmal schien er mich zu erkennen – vielleicht nahm er auch nur wahr, dass jemand sich um ihn kümmerte und ihm zu trinken gab, seine Wunden versorgte und ihm in regelmäßigen Abständen die Lippen befeuchtete und ihn auf eine weichere Unterlage bettete.«
Hier unterbrach die Josef-Seele ihren Bericht, und als ich fragte, was weiter geschah, zögerte sie einen Augenblick und fragte mich dann: »Willst du diese Geschichte wirklich zu Ende hören? Vielleicht wäre dir wohler, wenn wir es dabei bewenden ließen, dass Jesus die Kreuzigung überlebte, und wenn danach all das wieder zu seinem Recht käme, was du in deiner Kirche gelernt hast.«
Doch ich brannte darauf, auch den Rest der Geschichte zu hören. Wann würde ich je wieder so nahe an diesem unerhörten Ereignis sein, das für viele Menschen, auch für mich, das zentrale Ereignis überhaupt war, um das alle menschliche Existenz kreiste?
Die Josef-Seele fuhr fort: »Am frühen Morgen des dem Sabbat folgenden Tages, noch vor Sonnenaufgang, brachten meine Knechte Daniel, Benjamin und ich Jesus in unser Haus. Wir benutzten für diesen Transport einen Eselskarren, den mein Weib Rahel mit Kissen gepolstert und mit Decken versehen hatte. Es war noch dunkel, als wir den Kranken, von dem wir immer noch nicht wussten, ob er überleben würde, aus der Höhle trugen und ihn, so sanft es eben ging, auf den Karren betteten. Diese Bergung ging rasch vonstatten. Daniel und Benjamin waren kräftige Kerle. Zu dritt hatten wir keine Mühe, den Stein noch weiter aus dem Weg zu schaffen, damit wir unseren Kranken bequem und schonend ins Freie bringen konnten. Daniel, meinen Hausknecht, ließen wir zurück am Eingang des Grabes, weil wir damit rechneten, dass Maria und ihre Freundinnen versuchen würden, bei Tagesanbruch in die Höhle einzudringen, um den vermeintlichen Leichnam Jesu zu salben und ihn in duftende Kräuter zu wickeln. Daniel sollte alle Besucher mit energischen Worten fortschicken. Ich hatte ihn für diese Aufgabe ausgewählt, weil sein Äußeres ihn dafür prädestinierte. Vor vielen Jahren war er, fast noch ein Kind, mit den Römern in unser Land gekommen, fühlte sich bei den Legionären aber nicht wohl und lief einige Male weg. Sie waren schließlich froh, als ich ihnen anbot, den Jungen zu kaufen. Er wuchs zu einem blonden Hünen heran, der natürliche Autorität ausstrahlte und mit dem sich niemand gern anlegte. Ich hatte ihm aufgetragen, etwaigen Besuchern, die nach Jesus fragen sollten, nur wenige Worte zu sagen. ›Er ist nicht hier‹, sollte er sagen und hinzufügen: ›Er ist auferstanden. Wenn ihr ihn sehen wollt, geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn finden.‹ Kein Wort mehr. Der wahre Aufenthalt Jesu musste geheim bleiben.
Ich konnte mich auf Daniel verlassen, er setzte sich auf den Fels, den wir aus dem Wege geräumt hatten, und sagte seinen Spruch her, wann immer jemand kam. Niemand durfte die Grabkammer betreten. Nur Maria und ihren Begleiterinnen zeigte er das Innere der Kammer, in der Jesus gelegen hatte.«
»Ihr habt also …«, ich hatte Mühe, diesen Gedanken auszusprechen. »Ihr habt also so getan, als sei er aus eigener Kraft auferstanden?«