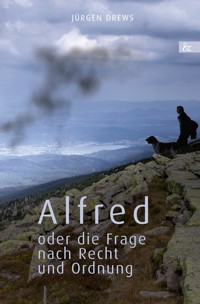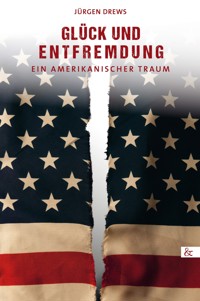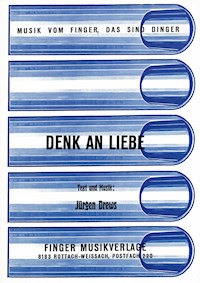Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Buch&media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Das Schwarze Meer war ihre einzige Chance: Um ihre Liebe leben zu können, entscheiden sich ein junger Mann aus Westdeutschland und eine junge Frau aus der DDR im Jahr 1968 zu einer dramatischen, lebensgefährlichen Flucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Drews, 1933 in Berlin geboren, studierte Medizin, habilitierte sich und wurde Professor für Innere Medizin in Heidelberg und für Molekulare Genetik in New Jersey, USA. Von 1970 bis 1998 leitete er die weltweite Forschung und Entwicklung großer international tätiger Pharma-Firmen, zuletzt als Mitglied der Konzernleitung bei Hoffmann-La Roche. Er ist heute freiberuflich tätig und lebt in der Nähe von München und im Tessin. 2004 erhielt er den Beckmann Preis der American Laboratory Association für bedeutende Beiträge zur Arzneimittelforschung. Drews veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Artikel und ist Autor und Herausgeber vieler Fachbücher, zum Beispiel »In Quest of Tomorrow’s Medicines« (Springer, New York, 2000). Daneben publizierte er mehrere Romane, unter anderem »El Mundo oder die Leugnung der Vergänglichkeit« (2003), »Menschengedenken« (2005), »Der Spiegelmord im Mörderspiel« (2006), »Wie wir den Krieg gewannen« (2007), »Jahresringe« (2008), »Der verschwundene Pianist« (2009) sowie Erzählungen und Gedichtbände.
Jürgen Drews
Unter der Himmelsuhr
Die Geschichte einer grenzenlosen Liebe
Roman
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter:
www.buchmedia.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet zu finden unter:
http://dnb.d-nb.de
Den Anstoß zu diesem Roman lieferte eine wahre Begebenheit. Dennoch ist die hier erzählte Geschichte frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten von Romanfiguren mit noch lebenden oder inzwischen verstorbenen Personen sind rein zufällig.
September 2010
© 2010 Buch&media GmbH, München
Umschlaggestaltung: Kay Fretwurst, Freienbrink
Herstellung: Books on Demand GmbH, Norderstedt
Printed in Germany
ISBN 978-3-86520-373-1
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Prolog
Sie waren getrennt gefahren. Zusammen in die S-Bahn zu steigen und dabei möglicherweise gesehen zu werden, wäre ihm unter den Umständen als zu riskant erschienen. Der vereinbarte Treffpunkt lag in der Nähe des Hellsees an einer Wegkreuzung im Wald, die sie von gemeinsamen Wanderungen her gut kannten. Der junge Mann stand schon dort, an einen Baum gelehnt, als Inge sich der Kreuzung näherte. Sie ging geradeaus, als hätte sie ihn gar nicht bemerkt. Als Inge an ihm vorübergegangen war, löste er sich aus seiner Wartestellung und kam mit ein paar raschen Schritten an ihre linke Seite. Dann gingen sie nebeneinander her, als befänden sie sich schon seit Stunden auf einem gemeinsamen Ausflug in die Umgebung Berlins.
»Also?«, fragte sie, ohne ihren Begleiter anzusehen. »Was hast du mir zu sagen?«
»Es muss Schluss sein«, sagte der junge Mann, »ich kann mich mit dir nicht mehr sehen lassen.«
Sie reagierte kaum. Nur ihr Gang wurde ein wenig schwerer.
»Jedenfalls vorläufig nicht«, fügte er hinzu.
»Was hat sich denn geändert?«
»Dein Bruder hat Republikflucht begangen, das hat sich geändert.«
»Aber Tinus«, das Mädchen blieb einen Augenblick lang stehen und sah dem jungen Mann ins Gesicht. »Das war allein seine Entscheidung. Ich hatte nichts damit zu tun, meine Eltern nicht, auch meine Geschwister nicht. Niemand von uns wusste etwas. Er hat das alleine ausgeheckt. Glaub mir das doch.«
Sie gingen weiter. Es war noch Spätsommer, aber der Tag war kühl, es hatte geregnet. Außerdem war heute Mittwoch. Sie trafen niemanden.
»Ob ich es glaube oder nicht, ist ziemlich gleichgültig. Die Stasi geht davon aus, dass zumindest deine Eltern etwas gewusst haben.«
Das Mädchen starrte beim Gehen geradeaus. Sie hatte die Hände in die Taschen ihres leichten Mantels gesteckt und den Kragen hochgeschlagen.
»Und das genügt dir, um mir den Laufpass zu geben! Weil die Stasi einen Verdacht hat, den sie nicht begründen können? Sie waren doch in unserer Wohnung, haben alles durchsucht und nichts Belastendes gefunden.« Sie schwieg ein paar Sekunden lang, dann brach es aus ihr heraus. »Nicht das Geringste haben sie gefunden. Als die bei uns auftauchten mit diesem Wisch, diesem Durchsuchungsbefehl, wusste keiner von uns, dass Helmuth abgehauen war. Wir waren völlig perplex.«
»Eben deswegen. Sie werden versuchen, Beweise zu finden. Sie werden euch beobachten, euer Telefon abhören, einige Leute auf euch ansetzen, auf deinen Vater, auf dich möglicherweise, um irgendeinen Hinweis zu bekommen.«
»Aber du?« Wieder blieb sie stehen. Etwas Flehentliches lag in ihrer Frage.
»Ich muss auf Distanz zu euch gehen, bis die Sache geklärt ist.« Er sagte es wie etwas Selbstverständliches.
»Auch zu mir?« Während sie langsam weiterging, hatte sie diese Frage fast geflüstert.
Eine Minute lang gingen sie schweigend nebeneinander her.
»Deswegen haben wir uns ja heute getroffen, hier im Wald, wo uns niemand sieht oder hört, damit ich dir das erkläre.«
Sie blieb stehen. »Und im Institut? In der Stadt?«
Er schüttelte den Kopf: »Wird man uns nicht mehr zusammen sehen.« Er wollte ihren Arm nehmen, um sie an sich zu ziehen, vielleicht, um ihr zu sagen, dass er sie immer noch liebe, dass wohl auch wieder bessere Zeiten kämen. Aber sie entzog sich und die Entschiedenheit, mit der sie das tat, zeigte ihm, dass er mit weiteren Erklärungsversuchen keinen Erfolg haben würde.
Sie setzten den Weg fort, ohne sich zu berühren. »Also hier im Wald, an einem Tag, an dem kein Mensch unterwegs ist, bist du noch mein Freund, willst mich sogar in den Arm nehmen, mich küssen, verstohlen natürlich, man muss ja sicher sein, dass einen wirklich niemand dabei beobachtet, was man mit dieser Bauer anstellt, die ja wohl Dreck am Stecken hat.« Ihre Stimme wurde lauter. »Man würde ja gern, im Bett war sie ja nicht schlecht, vielleicht wäre sie auch hier im Wald und auf der Heide …«
»Inge, bitte.« Er hatte sie laut unterbrochen.
»Verschone mich mit deinen Erklärungen. Hau ab jetzt. Ich habe genug.«
Aber der junge Mann geriet nicht aus der Fassung. Er hatte Inge Bauer noch etwas mitzuteilen. »Im Labor wird sich auch einiges ändern. Du kannst nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Ich habe Rehberger vorgeschlagen, dass du in die Gruppe von Elena eintrittst, sie wird dich unter ihre Fittiche nehmen.«
Inge schnaufte verächtlich durch die Nase. Aber ihr Begleiter ließ sich nicht beirren. »Wenn du dich mit Elena gut stellst, kannst du dich im Institut schnell rehabilitieren. Rehberger vertraut ihr.« Seine Stimme nahm einen persönlicheren Ton an: »Und dich mag er. Vermutlich würde er dir sogar glauben, was du mir eben erzählt hast.«
»Es reicht jetzt wirklich, Tinus. Bitte, geh.«
Er hatte gesagt, was er sagen musste. Nein, noch nicht alles. Etwas Versöhnliches zum Abschied. »Es kommen auch wieder bessere Tage.« Er tat einen Schritt auf sie zu, aber sie erstarrte sofort, als sei er ein Aussätziger.
»Na, dann.« Er wandte sich um und ging den Weg zurück, den sie gekommen waren. Zunächst noch langsam, als wartete er darauf, noch einmal gerufen zu werden, dann immer schneller und entschiedener. Inge ging in die entgegengesetzte Richtung. Dann blieb sie stehen und sah ihm nach. Aber da lag nur der leere, von Buschwerk und Kiefern umstandene Weg. Sie setzte sich auf einen Baumstumpf und vergrub den Kopf in ihren Armen. Aus, dachte sie, alles aus. Und selbst das, überlegte sie sich, selbst etwas so Ursprüngliches und Menschliches wie das Ende einer Liebesbeziehung musste in der Einöde vollzogen werden, zwischen Bäumen und Sträuchern, die keine Ohren hatten und die nichts weitersagen würden.
Lange saß sie so. Irgendwann am späten Nachmittag brach die Sonne durch eine Lücke in der Wolkendecke und ließ die Kiefernstämme, die sie umstanden, rot aufglühen. Sie erhob sich, sah auf die Uhr. Eine Stunde Fußmarsch hatte sie bis zur nächsten S-Bahn-Station. Sie musste jetzt gehen, wenn sie noch vor Einbruch der Dunkelheit dort ankommen wollte.
Tinus – sie kannte ihn schon so lange. Sie hatten zusammen studiert, Gefallen aneinander gefunden, er hatte sich ihr und ihrer Familie angeschlossen. Ihre Mutter hatte den dunklen, hoch aufgeschossenen Jungen fast wie ein eigenes Kind in die Familie aufgenommen, was nahe lag, denn Tinus hatte selbst kein richtiges Zuhause. Die Eltern waren geschieden, beide hatten wieder geheiratet, der Vater irgendwo im Westen, die Mutter hier in Berlin.
Während Inge den Weg zurückging, durchlief sie in Gedanken die lange Lebensstrecke, die sie zusammen mit Tinus zurückgelegt hatte. Die ersten verstohlenen Zärtlichkeiten, die sie ausprobiert hatten, nachdem Tinus von einem langen Ferienaufenthalt mit einer FDJ-Gruppe zurückgekehrt war. Sehnig und braun hatte er da auf einmal gewirkt, nicht mehr wie ein großer Junge, sondern fast schon wie ein Mann. Und der wollte natürlich auf die Dauer mehr von ihr als Händchenhalten und ein paar Küsse. Trotzdem hatte es von diesem Zeitpunkt an noch ein Jahr gedauert, bis sie zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten, in der Gartenlaube ihrer Eltern, draußen in Mahlsdorf. Danach hatten sie es immer wieder getan, so oft sich ihnen dazu eine Gelegenheit bot, in Mahlsdorf, auf Wanderungen, die sie unternahmen, oder in der Wohnung der Eltern, wenn niemand zu Hause war.
Durch die Kiefernstämme hindurch sah sie jetzt einige Häuser, dahinter lag die S-Bahn-Station. Tinus würde nun nicht mehr kommen. Bei dem Gedanken wurde ihr elend. Tinus hatte ihr gehört, aber auch der Familie. Für Werner und Helmuth war er fast wie ein Bruder, die Schwestern hatten Inge um Tinus beneidet und mit ihm gealbert und geflirtet, bis sie selbst Partner gefunden hatten, die diesen Spielen ein Ende setzten. Die Eltern hatten ihn fast als ihr sechstes Kind betrachtet. Sie selbst erlebte den Verlust doppelt. Sie hatte in Tinus ihren Freund verloren und die Familie einen Menschen, der einfach zu ihnen gehörte.
Wenn da nur nicht dieser Ehrgeiz gewesen wäre, dachte sie später, als sie schon im Zug saß. Der Ehrgeiz und dieser Opportunismus. In der FDJ musste er unbedingt Eindruck schinden, natürlich in die Partei eintreten. Vielleicht hatte er sich inzwischen auch mit der Stasi eingelassen. Lag das daran, dass er nie ein richtiges eigenes Zuhause gehabt hatte? Jetzt wunderte sie sich, dass es nicht schon früher zu Streit zwischen ihnen gekommen war, auch zwischen Tinus und den Eltern. Aber Tinus war immer liebenswürdig geblieben, auch wenn er und die Bauers in ihren Ansichten meilenweit auseinanderlagen.
Irgendetwas würde sie ihren Eltern ja sagen müssen, wenn Tinus plötzlich wegbliebe. Oder sollte er das selbst erledigen? Im Geist hörte sie ihn erklären: »Sie müssen das verstehen, Frau Bauer, Herr Professor. Dass der Helmuth abgehauen ist, das hat alle schockiert. Sie wissen ja, wie das bei uns läuft. Ich darf da nicht mit hineingezogen werden. Das kann ich mir einfach nicht leisten. Wenn sich alles beruhigt hat, komme ich wieder häufiger, wenn ich darf.« So wie sie ihren gutmütigen Vater einschätzte, hätte der sogar Verständnis für diese Einstellung. Und die Mutter? Die wohl nicht, jedenfalls nicht gleich. Allerdings: Auf lange Sicht tat sie ja immer, was ihr Mann wollte.
Der Zug näherte sich Berlin-Pankow. Sie musste aussteigen. Mit den Eltern könnte er dieses Spiel wohl treiben, dachte sie auf dem Weg nach Hause, aber mit ihr nicht.
Und dann stellte sie sich vor, wie der Mann sein müsste, dem sie sich ganz anvertrauen könnte. Aussehen dürfte er wie Tinus, ehrgeizig dürfte er auch sein. Aber Mut müsste er haben und einen starken Willen, sodass sie sich neben ihm geborgen fühlen konnte, geborgen und beschützt. So würde Tinus niemals sein.
»Nie«, sagte sie leise vor sich hin, als sie die Treppen zur elterlichen Wohnung emporstieg, »das steckt nicht in ihm drin.«
Nachts wurde sie wach. Ihre Mutter hatte sie so merkwürdig angesehen, als sie nach ihrem Ausflug in die Wohnung getreten war.
»Was ist mit dir?«
»Was soll sein?«
»Ich weiß nicht, du bist so blass.« Frau Bauer nahm ihre Tochter in den Arm. »Du siehst müde aus, Kind. Gehst du gleich ins Bett oder soll ich dir noch was zu Essen machen?«
»Nein, gleich ins Bett. Danke.«
Es war jetzt ganz still im Haus. Inge sah auf die Uhr. Ein Uhr früh. Sie hatte noch Zeit. Um sieben musste sie raus. Aber jetzt hatte sie Mühe mit dem Einschlafen. Ihre Gedanken fingen an zu kreisen. Was würde jetzt aus ihrer Westreise, die sie im Sommer beantragt hatte. Rehberger hatte sie fast dazu gedrängt. »Ich habe mir das Programm angesehen. Das wäre was für Sie. Da treten einige der besten Leukämieforscher auf. Franzosen, Amerikaner. Melden Sie sich, stellen Sie einen Antrag. Ich werde ihn unterstützen.«
Und nun? Nachdem Helmuth abgehauen war? Würde sie immer noch mit Rehbergers Unterstützung rechnen dürfen? Der Waldspaziergang von gestern ging ihr durch den Kopf. Elena Blumentritt sollte sie »unter ihre Fittiche nehmen.« Aber Elena hatte ganz andere Interessen. Musste sie ihr Gebiet jetzt aufgeben? Aber sie war die Einzige im Institut, die sich für chromosomale Abweichungen bei kindlichen Leukämien interessierte. Ich muss mit Rehberger sprechen, sagte sie sich.
Ausgerechnet Rehberger. In der Dunkelheit, die sie umgab, verstand sie sich selbst nicht mehr. Alle wussten, dass Rehberger ein eingefleischter Kommunist war. Nicht nur das: Er war auch ein Anhänger der DDR, und die Regierung benutzte ihn, den berühmten Biochemiker, als Aushängeschild, wo immer sich dazu eine Gelegenheit bot. Aber so war es nun einmal. Er war der einzige Mensch, der ihr helfen konnte. Hilfe, was war das? Etwas Klarheit, Schutz vor ungerechtfertigten Angriffen, die doch von den Organen des Staates kamen, in dem sie lebte und dem Rehberger loyal ergeben war. Ein Widerspruch, den sie sich nicht erklären konnte. Aber sie war ja auch müde und immer noch aufgewühlt von ihrem Gespräch am vergangenen Nachmittag. Helmuth fühlte sich jetzt hoffentlich besser als sie. Er war drüben, er hatte es hinter sich. Für ihn konnte es eigentlich nur noch besser werden. In diesem Augenblick beneidete sie ihn glühend. Gleichzeitig warf sie ihm vor, dass er die Familie weiter belastet hatte und dass er ihre eigenen Chancen, jemals aus diesem Gefängnis DDR herauszukommen, um irgendwo im Westen ganz neu anzufangen, durch seine Aktion fast unmöglich gemacht hatte. Auch so ein Widerspruch, der sie quälte.
Sie schaute wieder auf die Uhr. Fast zwei Uhr. Wenn sie so weitermachte, wäre sie morgen völlig erschöpft und zu nichts zu gebrauchen. Dabei musste sie ruhig wirken. Selbstsicher, wie jemand, der nichts zu verbergen hat. Sie stand auf, schlüpfte in ihre Sandalen und ging in die Küche. Vorhin, als sie nach Hause kam, hatte sie nichts gegessen. Jetzt hatte sie Hunger. Vielleicht würde es helfen, wenn sie etwas äße und dazu auch etwas tränke, ein Bier, das würde sie ein wenig beruhigen. Ihr Zimmer lag der Küche gegenüber. Sie machte Licht und sah auf dem Küchentisch einen Zettel liegen. Ihre Mutter hatte ihn geschrieben.
»Inge, mein Kind, du hast vielleicht doch irgendwann noch Hunger. In der Speisekammer steht ein Teller mit ein paar belegten Broten für Dich.« Sie setzte sich an den Küchentisch, öffnete eine Flasche Bier und aß die belegten Brote, die ihre Mutter für sie bereitgestellt hatte. Das Bier schmeckte gut. Es beruhigte sie, und der Gedanke, dass sie längst nicht so allein und verlassen war, wie sie sich eben noch gefühlt hatte, tat ein Übriges. Der Hunger verschwand, eine angenehme Ruhe durchströmte sie, und der Gedanke an ihre Eltern, die so viel Schlimmeres durchgestanden hatten als sie selbst, spendete ihr Trost. Kurz nachdem sie sich wieder hingelegt hatte, war sie eingeschlafen.
1
Er hatte das Haus der Wielanders an diesem Abend im Januar 1967 in einer Art Entweder-oder-Stimmung betreten. In seiner unterschwelligen Gereiztheit hatte er sich nicht einmal hingesetzt, nachdem Verena ihn begrüßt hatte und sie wie immer in ihr Zimmer gegangen waren.
»Ist was«, fragte sie, »willst du dich nicht setzen?«
Nein, das wollte er nicht. Nicht sesshaft werden in diesem Puppenheim, in dem Verena schlief, arbeitete, las, telefonierte, einfach alles tat, was ihr Leben ausmachte, wenn sie sich nicht im Kreise ihrer Familie aufhielt. Nicht wieder eingefangen werden von dieser biedermeierlichen Behaglichkeit, die Verena mit sündhaft teuren antiken Möbeln um sich errichtet hatte.
»Heute nicht«, sagte Tim Brandis, »heute will ich nur eine Entscheidung von dir.«
Und dann fing er an zu sprechen. Es klang, als habe er die Sätze so oft geprobt, dass er sie auswendig wusste. Unverblümt wie nie zuvor sagte Tim, was er von Verena erwartete, endlich nach so vielen Jahren, in denen er die Rolle des Hausfreundes gespielt hatte, der noch in der Ausbildung steckte, der »noch nicht so weit war«, »erst einmal etwas werden musste«, damit er eine Familie ernähren könne, »ernähren und nicht nur so schlecht und recht durchbringen.«
Da stand er also, hoch aufgeschossen, steif, das schmale Gesicht zu einer abweisenden Miene erstarrt. Nicht einmal seinen Mantel hatte er abgelegt. Kalte Winterluft drang aus seinen Kleidern. Er versuchte ihr klarzumachen, dass es keinen vernünftigen Grund gäbe, noch länger zu zögern. »Ich werde im nächsten Jahr dreißig, und du bist mir dicht auf den Fersen. Wenn wir eine Familie gründen wollen, wird es langsam Zeit.«
Natürlich spürte Verena etwas von der Spannung, unter die er sich selbst gesetzt hatte. Vielleicht wollte sie ihm helfen, sich zu entkrampfen. Jedenfalls fragte sie: »Aber Tim, warum hast du es denn plötzlich so eilig. Wir haben uns doch, oder?« Und dann mit einem Lächeln: »So dringend ist es doch auch wieder nicht.«
Sie trat nahe an ihn heran, strich ihm über die Arme und steckte ihre Hände unter seinen Pullover. »Warum bist du so störrisch? Soll ich morgen Abend zu dir kommen? Heute geht es nicht. Wir sind in der Stadt verabredet, meine Eltern, du weißt schon.«
Ja, das hatte er vergessen. Der alte Wielander, Verenas Vater, der einen schwunghaften und profitablen Handel mit medizinischen Geräten betrieb, feierte in diesen Tagen seinen Geburtstag.
»Du brauchst mal wieder etwas Zuwendung, Tim.« Sie ließ ihre Hände nach unten gleiten und berührte ihn dabei, als wollte sie prüfen, ob er auf ihre Nähe genauso empfindlich reagierte wie sonst.
Aber mit dem Versprechen, dass sie morgen Abend miteinander schlafen könnten, war Tim Brandis heute nicht abzuspeisen. Er hatte in den zurückliegenden Tagen viel nachgedacht. Über sich, seine Zukunft, über seine Beziehung zu Verena und über Verenas enge Verstrickung in ihre Familie. Plötzlich war ihm deutlich geworden, dass er als Anhängsel der Familie Wielander enden würde, wenn er nicht aufpasste. Und dieses eine Mal war Tim ehrlich mit sich selbst gewesen und hatte sich etwas vorgenommen. Er wollte nicht noch weiter in diesen neureichen und reaktionären Klüngel hineingezogen werden, dem die Wielanders angehörten. Der Alte mit seiner corpstudentischen Vergangenheit und seinem Elektrikerverstand, die national-konservative Frau Wielander, die allen Freunden der Familie die Bücher von Mathilde Ludendorff aufdrängte, und die beiden nassforschen jüngeren Brüder Ralph und Arne, die beide einer schlagenden Verbindung angehörten und trotzdem so taten, als gehöre ihnen dieselbe Zukunft, die ihr Vater und seine Freunde bereits verspielt hatten – das erschien ihm plötzlich unerträglich. Gewollt hatte er es nie. Aber er hatte sich selbst jahrelang mit dem Gedanken beschwichtigt, dass diese Dinge sich von selbst erledigen würden, wenn er Verena erst für sich hätte.
Wann aber sollte das sein? Verena schien den Status quo zu genießen, Tim hatte für sich entschieden, dass er nicht länger warten konnte. Er war gekommen, um Verena zu einer Entscheidung zu zwingen und wusste doch insgeheim, dass sie dazu nicht im Stande sein würde.
»Und was ist, wenn ich dir jetzt keine Antwort gebe?«
»Dann komme ich nicht wieder.«
Und das war es wohl, was er eigentlich beabsichtigte. Nicht mehr wiederkommen, mit Verena brechen. Hatte er nicht längst eingesehen, dass er mit Verena nur dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen würde, wenn ihre Zweisamkeit in der Familie Wielander eingebettet bliebe? Also forderte er etwas, das Verena ihm nicht geben konnte.
»Ich muss weg«, sagte sie und zog sich draußen in der Garderobe ihre Pelzstiefel und ihren Mantel an.
»Kommst du gleich mit nach unten?«
»Natürlich.«
Unten auf der Straße verabschiedeten sie sich voneinander. Verena tat so, als sei es ein ganz normaler, wenn auch leicht getrübter Abschied. Immerhin winkten sie einander zu, als sie sich trennten. Vielleicht glaubte sie wirklich, Tim würde sich wieder melden. Der aber war entschlossen, diesmal hart zu bleiben und nie mehr wiederzukommen. Sie stieg in ihr Auto, winkte noch einmal und war weg. Verschwunden aus seinem Leben. Wie banal das alles ist, dachte Tim und war doch gleichzeitig aufgewühlt und ergriffen von dem Gedanken, dass sein Leben plötzlich seine Richtung geändert hatte. Er fuhr zurück in seine Wohnung nach Ziegelhausen. Aber dort hielt es ihn nicht an diesem Abend. Er lief hinaus in die Winternacht, wanderte stundenlang am Fluss entlang durch Vorortsiedlungen, vorbei an Fenstern, durch die er hin und wieder noch erleuchtete Tannenbäume sah, und durch schütteren Wald, der von einer dünnen Schneedecke und spärlichem Mondlicht erhellt wurde. Je länger er ging und zwischendurch lief, desto sicherer wurde er, dass dies das Ende sei, dass er es wirklich und wahrhaftig fertig gebracht hatte, sich aus den Fängen von Verenas Familie zu befreien. Er befand sich in einer merkwürdigen Stimmung: Einerseits spürte er so etwas wie Bitterkeit. Er hatte nun den Beweis, dass Verena ihn nicht wirklich liebte, jedenfalls nicht als eigene, von ihrer Familie völlig abgetrennte Person. Andererseits fühlte er sich erleichtert und befreit von den Einengungen, die er jahrelang ertragen und vor sich selbst bagatellisiert hatte. Damit war nun Schluss. Plötzlich stand sein Leben wieder sperrangelweit offen.
Der Zorn über Verenas wirkliche Motive erwies sich als relativ flüchtige Empfindung. Schließlich war er es, der sich Illusionen gemacht hatte.
Anders verhielt es sich mit der Erleichterung über die wiedergewonnene Freiheit und die damit verbundenen Erwartungen. Die hielt so lange an, bis sie von einer anderen, viel stärkeren Empfindung abgelöst wurde.
Noch etwas kam in den folgenden Tagen und Wochen hinzu: Verena fehlte ihm. Er vermisste ihre Hand, die sich in die seine schmiegte, wenn sie nebeneinander hergingen, ihren Atem, ihre Stimme. Vor allem fehlten ihm ihre Berührung und die Wärme ihres Körpers, der so voller Zärtlichkeit sein konnte.
In einer so zwiespältigen, aus Erwartungen einerseits und dem Gefühl von Verlust andererseits zusammengesetzten Gemütslage befand sich Tim Brandis, als er im April Inge Bauer kennenlernte. Wie in fast jedem Jahr besuchte er den Internistenkongress in Wiesbaden und schlenderte – es war schon gegen Ende des Kongresses – etwas ziellos durch das Ausstellungsgelände in der Rhein-Main-Halle. Wie immer gab es auch in diesem Jahr viele Parallelveranstaltungen. Er geriet schließlich in eine Vortragsreihe, die in einem nur mittelgroßen, aber voll besetzten Saal stattfand. Nach seiner Schätzung saßen dort mindestens zweihundert Mediziner, um sich über »Neue Erkenntnisse in der Onkologie« unterrichten zu lassen. Weitere Zuhörer, die wie Tim während eines Vortrages gekommen waren, standen an den Ein- und Ausgängen oder lehnten an den Wänden.
Als er den Saal betrat, stand gerade jemand auf, der am Rand einer der vorderen Reihen gesessen hatte. Tim schnappte sich den frei gewordenen Platz, ohne auf die Leute zu achten, die sich noch am Eingang aufhielten oder an der Wand lehnten und schon länger gewartet hatten als er. Irgendjemand im Publikum sprach in ein Mikrofon, stellte eine Frage zu dem gerade beendeten Vortrag. Der Redner am Vortragspult nickte kurz und antwortete. Dann meldete sich niemand mehr zu Wort. Der Vortragende wurde mit Beifall verabschiedet, und der Vorsitzende der Sitzung, Professor Senckbusch aus München, ein gut aussehender älterer Mann mit frischer Gesichtsfarbe und sorgfältig gescheiteltem weißen Haar, zog sein Tischmikrofon näher zu sich heran.
»Das Wort hat nun Frau Inge Bauer aus dem Biochemischen Institut der Humboldt-Universität in Berlin«, kündigte er an, ganz beiläufig, so, als seien Vorträge aus Kliniken und Instituten der DDR bei Internistenkongressen alltägliche Ereignisse. Als Inge Bauer dann aufstand und energisch, wenn auch ein wenig unbeholfen, ans Podium trat und Zustimmung heischend ins Publikum lächelte, als säßen da überall alte Bekannte, hätte Senckbusch offenbar gern noch etwas hinzugefügt. Jedenfalls erstrahlte sein rosiges Gesicht in väterlich-kollegialer Zuneigung. Wie schön, hätte er gern gesagt, eine junge Kollegin aus dem »anderen Teil« unseres Vaterlandes unter uns zu haben. Inge Bauer aber hatte ihren Vortrag mit dem stereotypen »Herr Präsident, meine Damen und Herren«, bereits begonnen, und so beschränkte sich der alte Senckbusch auf ein wohlwollendes Lächeln, zu dem er »Bitte, Frau Kollegin« murmelte.
Was Inge Bauer damals vortrug, wusste Tim später nicht mehr. Sie hatte schöne Diapositive mitgebracht und sprach mit Verve und ohne Manuskript.
Er hörte ihr gern zu, konzentrierte sich dabei aber mehr auf den Klang und den Tonfall ihrer Stimme, als auf den Inhalt ihres Vortrages. Vor allem aber sah er sie an und verfolgte jede ihrer Bewegungen und Gesten mit einem wachsenden Gefühl von Einverständnis und Anteilnahme. Inge war groß, blond und schlank. Sie sah aus, als käme sie gerade aus den Ferien, so braun und glatt, so frisch. Dabei hatte sie zugleich eine kindliche Ausstrahlung. Sie trug an diesem Tag ein – offenbar selbst geschneidertes – erdbeerfarbenes Kostüm, dazu als einziges Schmuckstück einen mattgrünen Stein in einer schmalen goldenen Fassung an einer ebensolchen Kette. Beide Farbtöne harmonierten mit ihrem blonden Haar und der leicht gebräunten Haut. Was sie sagte, klang druckreif – sie hatte ihren Text auswendig gelernt, vermutete Tim. Viele Anfänger taten das.
Wie alle anderen Beiträge wurde auch der Vortrag von Inge Bauer zur Diskussion gestellt. An dieser Stelle hatte Senckbusch Gelegenheit, den eben gehörten Vortrag als »außerordentlich interessant, ja faszinierend« zu bezeichnen. Mit dieser Meinung stand Senckbusch entweder allein, oder Inge Bauer hatte die Zuhörer durch ihre Erscheinung so vom Inhalt ihrer Mitteilung abgelenkt, dass niemand eine Frage stellen wollte.
Senckbusch tat ungläubig. »Keine Frage zu diesem wichtigen Beitrag?« Das Schweigen bot Tim eine willkommene Gelegenheit, mit dieser Frau ins Gespräch zu kommen. Er meldete sich, wurde aufgerufen und fing an, zu fragen. Aber Herr Senckbusch unterbrach ihn gleich wieder. »Bitte Herr Kollege, nennen Sie uns Ihren Namen und Ihren Arbeitsplatz?«
»Tim Brandis, Medizinische Klinik der Universität Heidelberg.«
»Danke, Herr Kollege«, lächelte Senckbusch, und nun durfte Tim seine Frage zu Ende stellen. Ob man die Veränderungen, die Frau Bauer an den Chromosomen von an Leukämie erkrankten Kindern beobachtet hatte, auch diagnostisch nutzen könne?
Es war, als hätte er Inge Bauer das Stichwort zu einem zweiten Vortrag gegeben. Offenbar fühlte sie sich nach ihrem erfolgreichen, aber unter Spannung gehaltenen Vortrag erleichtert. Das Adrenalin zirkulierte noch in ihrem Blut, aber die Angst war weg. Also beantwortete Inge nicht nur die von Tim gestellte Frage, sondern holte zu einer eingehenden Beschreibung der Umstände aus, unter denen sie in Berlin tätig sei. Dass es sich bei der hier vorgetragenen Studie um ihre Doktorarbeit gehandelt habe, gab sie zu verstehen, dass allerdings der grundlegende Charakter der Arbeit den Rahmen einer Dissertation eindeutig überstiegen habe und sie auch in Zukunft über dieses wichtige Thema arbeiten wolle. Professor Rehberger, ihr Chef, habe dazu bereits sein Einverständnis gegeben.
An dieser Stelle hatte Senckbusch die Gelegenheit, die Diskussion zu beenden, ohne die Begeisterung der jungen Vortragenden zu beschädigen. »Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft von Ihnen zu hören«, sagte er ohne jede Ironie, und der abschließende herzliche und intensive Beifall schien Inge zu überraschen: Sie errötete und huschte zurück auf ihren Platz in der ersten Reihe.
Tim benutzte die erste längere Pause, um auf Inge Bauer zuzugehen, sich vorzustellen und seine Bewunderung für ihre Arbeit zum Ausdruck zu bringen. Er hatte den dringenden Wunsch, diese junge Frau kennenzulernen. Dazu musste er sie allerdings erst aus dem Gedränge des Vortagssaales herausbekommen. Zunächst versuchte er es mit einer Einladung zum Mittagessen, bekam aber gleich einen Korb. Mittags esse sie nie, ließ sie ihn wissen, aber sie könnten ja einen Spaziergang durch den Kurpark machen und ein paar Sonnenstrahlen einfangen. Bei diesen Worten sah sie blinzelnd in das Sonnenlicht, das durch eines der nicht mehr verdunkelten Fenster hereinströmte, und Tim verstand, woher sie ihre gesunde Hautfarbe hatte.
»Und abends?«, fragte er. »Essen Sie abends auch nichts?«
»Doch, abends esse ich.«
»Abends, wenn die Sonne tief steht oder wenn sie schon untergegangen ist?«
Zum ersten Mal musterte sie ihn genauer. Das schmale Gesicht mit den graublauen Augen, den etwas weichen Mund, der zu dem energischen Kinn nicht so recht passte, und das blonde, leicht wellige Haar, das ungekämmt wirkte und die Form des Kopfes dennoch betonte. »Das haben Sie schnell begriffen«, lachte sie dann und zeigte ihre schönen Zähne. »Sonne ist kostbar in unseren Breiten.«
Also gingen sie in der Mittagspause im Park spazieren, fanden auch eine von der Sonne beschienene Bank, auf der Inge »sich ausruhen und ein wenig die Sonne genießen« wollte. Tim erfuhr zu seinem Erschrecken, dass ihre Reiseerlaubnis mit dem Ende des Kongresses ablaufen würde, sie also übermorgen, nein, morgen, schon wieder nach Hause fahren müsste. Eine Verlängerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung käme nicht infrage, belehrte sie ihn, es sei schwer genug gewesen, eine Reisegenehmigung für sie zu erwirken, sie müsse also zurück. Schon um Rehberger nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Immerhin verdanke sie diese Reise seiner Fürsprache.
Tim hatte Mühe, seine Enttäuschung zu verbergen. Einige Monate nach jenem finsteren Januartag, an dem er schließlich den Mut aufgebracht hatte, sich von Verena zu trennen, war ganz unerwartet diese blonde Fee in sein Leben spaziert. Sie war anziehend, gescheit, sie hatte ihn durch ihre Naivität und ihren kindlichen Charme gerührt, und sie saß nun neben ihm und plauderte munter von ihrer Arbeit im Institut für Biochemie, erzählte von ihrer Familie, ihren vier Geschwistern, von ihrem Vater, der nach einer langjährigen Inhaftierung durch die Russen noch einmal die Kraft gefunden hatte, neu anzufangen und der jetzt als Professor für Slawistik an der Humboldt-Universität Berlin tätig sei.
»Warum haben sie ihn denn eingesperrt?«, fragte Tim, dem die Enttäuschung über Inges bevorstehende Abreise in diesem Augenblick weit stärker zusetzte als das bedauerliche Schicksal des alten Herrn Bauer.
»Er war im Dritten Reich einer der prominentesten Dolmetscher für das deutsche Außenministerium, hat für Ribbentrop übersetzt. Während des Krieges hat er auch bei Verhören politisch wichtiger Kriegsgefangener für die deutsche Abwehr gearbeitet. ›Fremde Heere Ost‹ nannte sich das damals. Die Russen hatten wohl Angst, dass mein Vater über geheime Informationen verfügte, die für viele Offiziere und Politiker in der Sowjetunion belastend sein mussten. Also wurde er ein paar Jahre lang inhaftiert.«
»Wo?«
»Auf einer Halbinsel an der russischen Schwarzmeerküste. Dort hielten sie auch einige deutsche Atomphysiker gefangen. Niemand wusste, wo er war, ob er noch lebte. Erst ein Jahr nach Kriegsende durfte er uns schreiben. Er musste für die Russen arbeiten, und nachdem er das genauso gut und zuverlässig erledigt hatte wie seine Dolmetscherei in der Nazizeit, haben sie ihn dann ›rehabilitiert‹. Er wurde auf einen Lehrstuhl an der Uni berufen, und dort arbeitet er heute noch.«
»Schön für ihn, dass er wieder in seinem Beruf tätig sein kann«, sagte Tim ohne Begeisterung. Im Augenblick empfand er nur Enttäuschung und Hilflosigkeit. Inge Bauer musste etwas von diesem Stimmungsumschwung gemerkt haben, denn sie fragte ihn unvermittelt, ob sie nicht noch ein Stück gehen sollten. Dann schaute sie auf die Uhr und hatte nun plötzlich einen Grund, aufzubrechen. »In einer halben Stunde geht’s wieder los«, sagte sie. »Ich muss nachher einen Bericht schreiben, muss also aufpassen, was gesagt wird.«
»Nein, einen Augenblick noch«, bat er. »Es ist so schön hier.« Und wirklich, es war schön: Die alten Platanen im Park leuchteten in jungem Grün, auf den Blumenbeeten prangten Tulpen, Narzissen und Stiefmütterchen, die Luft war lau, die Sonne schien.
»Es war ein guter Vorschlag, hierher zu gehen«, sagte er. Steif und unbeholfen kam er sich dabei vor. Er war im Begriff, sich in diese Inge Bauer zu verlieben und redete daher wie ein älterer Kurgast. »Ich sehe ein, dass Sie zurück müssen«, sagte er. Sie antwortete nicht. »Haben Sie nie daran gedacht, hierher zu kommen – an eine westdeutsche Klinik oder an ein Institut?«
Sie sah ihn kurz an und wollte antworten.
»Ich könnte Ihnen helfen«, sagte Tim rasch, »würde es auch gern tun.« Um sie nicht in Verlegenheit zu bringen, fügte er hinzu: »Sie haben doch gemerkt, wie gut Ihr Vortrag angekommen ist. Es gibt hier sicher viele Leute, die Sie gern bei sich hätten.«
Inge stand auf und zeigte wie zur Erklärung auf ihre Uhr. »Das ist nicht so einfach«, sagte sie. Er meinte, ein gewisses Misstrauen in ihrer Stimme zu hören. »Außerdem bin ich ganz gut aufgehoben bei Rehberger – und in meiner Familie.«
»Auch in der DDR?«
Dann blieb er plötzlich stehen, weil ihm klar wurde, wie zudringlich diese Fragen in ihren Ohren klingen mussten. »Entschuldigen Sie«, bat er. »Aber wir haben so wenig Zeit und ich finde Sie … Ja, ich mag Sie einfach, und nun tauchen Sie auf und sind auch gleich wieder weg.«
Sie schien jetzt auch etwas verlegen zu sein. Jedenfalls lächelte sie über das abrupte Geständnis, sagte aber nichts. Auf dem Weg zurück zum Kongresshaus sprachen sie nur noch über die Vorträge des Vormittags. Dann fragte sie Tim nach seinem Arbeitsgebiet, und er erklärte ihr in wenigen Worten, dass er während eines Jahres, das er an der Columbia Universität in New York verbracht hatte, eine neue Technik gelernt habe, mit der man das An- und Abschalten von Genen verfolgen könne. »Ich untersuche die Wirkung von Hormonen auf die Gen-Aktivität.« Es tat ihm gut, über etwas zu reden, das ihm am Herzen lag, etwas, das nichts mit Inges plötzlichem Erscheinen, seiner beginnenden Verliebtheit und ihrer bevorstehenden Abreise zu tun hatte. Er beschrieb seine Versuche, erwähnte auch einige Publikationen. Schließlich blieb sie stehen und fragte ihn: »Würden Sie einmal zu uns nach Berlin kommen und dort vortragen? Rehberger interessiert sich brennend für diese neuen Dinge, und«, sie schlenderte weiter, »er hat Einfluss.«
»Ich würde gern kommen.« Die Antwort kam ein wenig zu schnell. Selbst ein so argloses Gemüt wie Inge Bauer musste begreifen, dass er sich von einem solchen Besuch mehr erhoffte als nur wissenschaftliche Meriten.
»Reden wir heute Abend darüber?«, fragte sie.
Ja, darüber und über vieles andere, dachte Tim, nachdem sie sich für den Nachmittag voneinander verabschiedet hatten. Um viel Zeit zu haben, ließ er bereits für sieben Uhr einen Tisch in einem Restaurant im Rheingau reservieren, das er schon von früheren Besuchen her kannte.
Zu seiner Überraschung stand Inge nicht allein am vereinbarten Treffpunkt im Foyer der Kongresshalle. Ein schmaler, grauhaariger Mann mit einer Hornbrille war bei ihr und schien ihre Aufmerksamkeit ganz in Anspruch zu nehmen. Jedenfalls bemerkte sie Tim erst, als er neben die beiden trat.
»Darf ich vorstellen?«
Inge schien sein Erscheinen nicht zum Anlass für eine rasche Verabschiedung von dem schmächtigen Kollegen nehmen zu wollen. Sie stellte ihn in aller Kürze vor, fügte sogar noch hinzu, dass Tim und sie sich erst heute Vormittag getroffen hätten.
»Und dies ist ein lieber alter Kollege aus der Universitätskinderklinik in Halle«, sagte sie, »der oft hier im Westen ist. Entweder ist er so berühmt, dass ihn alle Leute einladen, oder er hat einflussreiche Gönner in der DDR, die ihn immer wieder reisen lassen.«
»Karl Kleinschmidt«, sagte der Mann.
Tim reichte ihm die Hand und stellte sich ebenfalls vor. Er durfte sich jetzt nicht allzu kollegial verhalten, sonst würde er Kleinschmidt anstandshalber ebenfalls zum Essen einladen müssen, und damit wären seine Inge-Pläne für diesen Abend geplatzt. Also beteuerte Tim, dass er sich freue, Kleinschmidt, von dem er bereits gehört und vor allem auch gelesen habe, nun auch einmal persönlich zu treffen. Leider müsse er ihm die Frau Doktor jetzt entführen, da sie eine ganze Reihe von Dingen miteinander zu besprechen hätten. Aber morgen? Ob er um die Mittagszeit frei sei, er würde den Kollegen gern zu einem Mittagessen einladen, wenn ihm das passe? Herr Kleinschmidt wusste nicht so recht, er müsse sich morgen Nachmittag wieder auf den Weg machen, da würde es mit der Zeit ein wenig knapp werden. Er sprach ein weiches, leicht bekümmert klingendes Sächsisch, das nicht unsympathisch klang. Inge kam Tim zur Hilfe.
»Herr Brandis macht sehr originelle Forschung, das interessiert Sie sicher«, ermunterte sie ihren Kollegen, der sich tatsächlich schnell umstimmen ließ.
»Um zwölf hier an dieser Stelle?«, fragte Tim.
Kleinschmidt wiederholte den Vorschlag, als müsse er die Möglichkeit eines solchen Treffens erst in seinen geregelten Tagesablauf einpassen.
»Bis um zwei Uhr hätte ich dann schon Zeit«, beruhigte er sich selbst, »mein Zug geht erst um fünfzehn Uhr dreißig.«
»Also dann.« Tim tat so, als sei er in Eile. »Ich sollte fahren, im Berufsverkehr kommt man nur … Sie wissen.«
Kleinschmidt lachte gutmütig und auch ein bisschen traurig. »Nee, ich weiß eigentlich nischt über solche Dinge. In Halle isses noch nich so wild mit’n Berufsverkehr.«
Immerhin, Tim hatte Inge losgeeist, fasste sie am Arm und zog sie mit sich fort, nachdem er Herrn Kleinschmidt noch einmal freundlich zugenickt hatte. Sie ließ sich nach draußen bugsieren und staunte kurz darauf über die vielen Autos, die dicht an dicht auf dem Parkplatz der Rhein-Main-Halle standen. Tim fuhr seit Kurzem ein helles, fast weißes Cabriolet, einen Mercedes 220 mit braunen Ledersitzen. Bis zu seiner Trennung von Verena hatte ihm ein VW-Käfer genügt. Dieses neue Auto, das ihm über einen Freund in der Heidelberger Klinik als Gebrauchtwagen angeboten worden war, hatte er gegen alle ökonomische Vernunft gekauft, um seine neu gewonnene Freiheit zu feiern und um seinem Kummer über den Verlust Verenas etwas entgegenzusetzen – eine Art Spaß- oder Lustsymbol, mit dem er sich selbst und anderen sagen wollte, dass sich in seinen persönlichen Lebensumständen etwas geändert hatte.
Inge war beeindruckt von diesem Wagen, überhaupt hatte Tim das Gefühl, dass ihr Interesse an ihm zunächst weniger seiner Person galt als vielmehr der Tatsache, dass er in ihren Augen den »Westen« verkörperte. Dass er den Wagen auf Raten gekauft hatte, an denen er noch eine Weile zu stottern hätte, störte sie nicht. Er war Assistenzarzt, fünf Jahre älter als sie, hatte eine eigene Wohnung gemietet, war in Amerika gewesen, hatte dort etwas Neues gelernt, das er nun in Heidelberg auf eigene Faust mittels einer Forschungsbeihilfe weiter betrieb. Und er war verrückt genug, sich ein Auto zu kaufen, dessen Unterhalt nicht billig sein konnte – alle diese Eindrücke ergaben zusammen mit dem heiteren Rahmen, den Wiesbaden im Frühling bot, dem damals schon lebhaften Berufsverkehr, der aufgeräumten Stimmung der Kongressteilnehmer ein Aroma, an dem Inge begierig schnupperte und das sie als den Geruch des westlichen Wohlstandes und westlicher Freiheit einstufte. So jedenfalls erschien es Tim später, wenn er an diese erste Begegnung mit Inge Bauer dachte. Damals, als sie im geschlossenen Cabrio zunächst durch die Straßen Wiesbadens und dann über die Chausseen des Rheingaus rollten, bezog er ihre Bewunderung und auch die gelegentlich durchscheinende Resignation – »da sind wir doch Jahrzehnte hinterher« – ganz auf sich selbst. Im Restaurant des Klosters Eberbach hatte Tim Gelegenheit, Inge mit seinen durchaus überschaubaren Kenntnissen der Rheingauer Rieslinge zu beeindrucken.
»So etwas wird Ihnen Professor Rehberger aber nicht bieten können, wenn Sie nach Berlin kommen.«
Inge ließ bewundernde Blicke durch den holzgetäfelten Raum schweifen, betrachtete mit Wohlgefallen die weißen Tischtücher und die hübsch gefalteten Servietten, das im Kerzenlicht schimmernde Silberbesteck, die blanken Gläser – das alles schien ihr sehr zu gefallen.
Ein freundlicher Ober trat an ihren Tisch, brachte ihnen die Speisekarten und eine Weinkarte und empfahl ihnen einige nicht auf der Speisekarte genannte Spezialitäten.
»Nett sind die hier«, sagte Inge anerkennend, nachdem der Kellner sich entfernt hatte.
Für einige viel zu lange Augenblicke vertieften sie sich in die Speisekarten, Tim suchte einen Wein aus, dann kam der Ober zurück und nahm ihre Bestellungen entgegen. Tim war froh, diese Formalitäten aus dem Wege zu haben. Jetzt endlich konnte er sich ganz Inge zuwenden. Der nette Ober hatte ihr eine Fleischbrühe serviert, die sie mit Behagen löffelte.
»Ich würde ja auch nicht zum Essen nach Berlin fahren«, sagte Tim.
»Auch nicht wegen des Vortrags?«
»Ich käme, um Sie wiederzusehen – das heißt, wenn ich eine Einladung erhielte.«
Inge errötete ein wenig und beugte sich über ihre Suppentasse.
»Dass Sie morgen schon wieder wegfahren, macht mich ganz traurig.«
Sie antwortete nicht gleich, sondern hielt die Suppentasse an beiden Henkeln, führte sie zum Mund und trank sie aus.
»Das darf man doch?«, fragte sie, als sie die Tasse abgesetzt hatte, und lachte ein wenig verlegen.
»Das war absolut ›comme il faut‹.«
»Ich bin auch traurig«, gestand Inge ein wenig später. »Übermorgen beginnt dann wieder der Alltag, in meinem Fall der sozialistische Alltag. Das ist schon noch etwas anderes als Ihr Alltag.«
»Erzählen Sie mir davon?«
»Nein. Damit verderben wir uns den schönen Abend.«
»Nur ein wenig«, bat er, »damit ich weiß, wo ich meine Gedanken hinschicken soll.«
»Nach Pankow«, lächelte sie. »Kennen Sie doch, oder?« Dann sang sie ihm mit leiser Stimme über den Tisch zu: »Pankow, tille tille Pankow, tille tille Pankow, heidi heidi, hopsasa …« und lachte.
Nein, das kannte er nicht. In Hamburg sang man so etwas nicht.
»Ich wohne dort bei meinen Eltern, die haben eine riesig große Altbauwohnung, und außer mir sind alle Kinder ausgeflogen.«
»Und der Alltag?«
»Jeden Tag mit der S-Bahn und mit der U-Bahn in die Stadt, ins Institut, von der Arbeit dort haben Sie ja jetzt eine Vorstellung.«
»Eine sehr positive.«
»Macht ja auch Spaß, dieser Teil jedenfalls. Das Drum und Dran allerdings, davon machen Sie sich hier keinen Begriff: Die Politveranstaltungen im Institut, die Drangsalierung der Mitarbeiter durch die Partei, die gegenseitige Bespitzelung, das alles und noch viel mehr. Will ich gar nicht im Einzelnen erwähnen«, sagte Inge. »Es ist widerlich, damit könnten wir uns wirklich den Abend verderben.«
»Sie müssen eben öfter kommen.«
»Wenn das so einfach wäre. Diese Reise zum Beispiel – das ist wie, wie …«
»Ein Geschenk?«
»Es ist wie Weihnachten«, sagte Inge und lachte fast verlegen. »Nur seltener.«
»Können Sie nicht irgendwie …«
»Abhauen?«
Tim nickte. Sie hatten beide dem Rheingauer Riesling zugesprochen, und er fing an, die verschiedenen Ausreise- oder besser Fluchtmöglichkeiten durchzusprechen: Flucht über die Grenze an Stellen, die noch nicht ausreichend gesichert waren, Ausreise mit gefälschten Papieren, Ausreise über ein anderes Ostblockland oder am einfachsten: anlässlich einer genehmigten Reise ins westliche Ausland nicht zurückkehren.
»Damit bringt man andere in Schwierigkeiten.« Inge schüttelte den Kopf. »Irgendjemand, in meinen Fall Rehberger, steht dafür gerade, dass ich zurückkomme.«
Der Ober servierte ihnen die Hauptgänge. Nachdem er sich entfernt hatte, hakte er nach:
»Wenn Sie nun jemanden aus dem westlichen Deutschland heiraten wollten?«, fragte er und spürte bei dieser Frage sein Herz klopfen. Dann bat er den Kellner um eine zweite Flasche Wein. Er wusste, die Frage war plump, deshalb erzählte er Inge die Geschichte von einer jungen Ungarin, die, um ins westliche Ausland zu kommen, zum Schein einen englischen Freund geheiratet hatte, von dem sie alsbald wieder geschieden wurde. Heute lebe sie in Wien, gar nicht weit von ihrer Heimat entfernt, habe wieder geheiratet, diesmal richtig, und habe bereits zwei Kinder.
»Und ein drittes Baby ist unterwegs«, sagte Inge. Es sollte ironisch klingen, aber es stimmte. Tim musste lachen und berichtete, dass es in der Tat so sei, er habe es nur nicht erwähnt, weil es mit der Sache selbst nicht zusammenhinge, sondern mit der Ehe danach.
Unter dem Einfluss des Rieslings und animiert durch Inges Gegenwart, durch ihre grünlichen Augen, den rosigen Mund, der sich beim Sprechen und beim Lachen so lebhaft bewegte, fühlte Tim sich zu weiter gehenden Anregungen ermutigt. »Natürlich könnte man auch gleich den richtigen Mann heiraten«, schlug er vor, worauf sie ihn spöttisch ansah, aber auch ein wenig rot wurde. Dem stünde nichts entgegen, bemerkte sie kühl, wenn der richtige Mann nichts dagegen hätte, in die DDR zu ziehen und sein Familienglück dort unter der Obhut des Arbeiter- und Bauernstaates zu suchen. Die nötigen Einreise- und Aufenthaltsformalitäten, auch eine Arbeitserlaubnis und sogar Stellenangebote wären unter diesen Umständen sicher kein Problem.
Tim fand, dass sie jetzt beim richtigen Thema angekommen waren, und griff nach der Flasche, die in einem Kübel neben ihnen stand. Inge legte abwehrend die flache Hand auf ihr Glas.
»Ich bin’s nicht gewöhnt«, erklärte sie und gab ihm die Gelegenheit, ihre Hand eingehend zu betrachten. Eine schlanke Hand mit runden Fingerkuppen. Tim konnte nicht widerstehen: Er nahm Inges Hand in die seine. Ihre Fingerkuppen fühlten sich weich an, er drehte die Hand, als wolle er Inges Zukunft aus den Linien ihres Handtellers lesen. Sie ließ es geschehen, und während er ihr erklärte, was ihm an ihren Händen so gut gefiel, fragte sie nach der in der Bundesrepublik geltenden Promillegrenze.
»In der DDR gelten null Prozent«, sagte sie. »Ich nehme an, so streng ist die Polizei hier nicht. Trotzdem« – jetzt entzog sie ihm ihre Hand langsam, aber mit einem gewissen Nachdruck – »Sie müssen noch heil bis nach Wiesbaden kommen.«
Einen Augenblick lang hatte er den Eindruck, dass sie sein Angebot, noch ein Dessert und einen Espresso zu bestellen, nur annahm, um ihm ein wenig Zeit zur Senkung seines Alkoholpegels zu geben. Dann aber erschien ihm diese Vermutung als zu kleinlich. Nein, sagte er sich, Inge fühlte sich wohl und wollte den Abend noch ein wenig verlängern. Er trank nun keinen Wein mehr, nahm ebenfalls einen Espresso und erzählte von seinem Vater, einem Hamburger Kaufmann mit guten Verbindungen in den Ostblock, die er gelegentlich eingesetzt habe, um zu Unrecht Inhaftierte in der DDR freizubekommen.
»Und wie funktioniert so was?«, wollte Inge wissen.
»Unsere Regierung bittet Privatpersonen, die Kontakte zu Politikern oder Wirtschaftsfunktionären in der DDR haben, um ihre Hilfe. Manchmal klappt das. Nehmen wir an, ich hätte versucht, Inge Bauer im Kofferraum meines Wagens aus der DDR zu entführen und sei dabei erwischt worden.«
»Wenn ich in Ihren Kofferraum gestiegen wäre!«
»Ist ja auch nur ein Beispiel.« Er sah sie an und bemerkte den Spott in ihren Augen.
»Offiziell könnte unsere Regierung in einem solchen Fall nichts unternehmen. Aber ein Mittelsmann wie mein Vater könnte in seiner Eigenschaft als Mitglied der Industrie- und Handelskammer einen Geschäftspartner in Ost-Berlin oder in Rostock anrufen und ihn bitten, beim Genossen Mielke oder bei einer anderen Person vorstellig zu werden und darauf hinweisen, dass sein Sohn nicht die Absicht gehabt hätte, die DDR zu schädigen, sondern im Zustand einer romantischen Verblendung gehandelt habe. Und dann würde er vielleicht freigekauft werden.«
Es war spät geworden. Tim Brandis und Inge Bauer waren fast die einzigen Gäste, die noch ausharrten. Unaufgefordert kam der Ober und überreichte ihm die Rechnung. Der Abend, auf den er sich so gefreut, auf den er fast irrationale Hoffnungen gesetzt hatte, war schon wieder zu Ende. Für ihn war es einer jener seltenen Augenblicke, in denen er die fast gespenstische Flüchtigkeit glücklicher Augenblicke spürte. Er zahlte, und sie verließen das Restaurant. Einzelne Gebäude, Teile des Klosters Eberbach, waren von Scheinwerfern angestrahlt, die Luft war mild und würzig. Inge hängte sich bei ihm ein, als sie zum Auto gingen. Später, als sie in der Nähe ihres Hotel anhielten, sagte sie unvermittelt: »Wenn Sie mich zum Abschied küssen wollen, dann müssen Sie es hier im Auto tun, nicht vor der Haustür.« Sie wandte sich ihm zu, legte ihren linken und dann, als er sich zu ihr beugte, auch den rechten Arm um seinen Hals und erklärte: »Der Herr Kleinschmidt aus Halle wohnt nämlich auch hier und noch ein anderer von drüben.«
Dann durfte Tim Brandis ausprobieren, wie sich diese rosigen Lippen, die er den ganzen Abend lang bewundert hatte, beim Küssen anfühlten.
2
Eigentlich hatte sich Inge auf diese Fahrt gefreut. Mit der Vorstellung, im Zug durch Westdeutschland zu fahren, verband sich die Möglichkeit, etwas von dem Leben, das die Menschen hier führten, beobachten zu können, ohne sich selbst den Blicken und dem Urteil der anderen aussetzen zu müssen. Aber das Abteil war voll, alle Plätze wurden bereits in Frankfurt besetzt, ein älteres Ehepaar, Großeltern offenbar, die zu ihren Kindern nach Ostberlin fuhren, ein Frankfurter Geschäftsmann, der zu einer Messe nach Leipzig wollte – was es da wohl zu sehen gab, wunderte sich Inge –, ein junger Mann, der seinen Bruder in Ostberlin besuchen wollte, eine Rentnerin aus Bernau, die ihren Sohn in Gießen wiedergesehen hatte und sie, Inge Bauer, die ihre Kongressreise heute beendete und auftragsgemäß zurückkehrte ins Paradies der Werktätigen. Die Beobachtung fand vorerst im Abteil statt, die Westdeutschen freuten sich auf die Begegnung mit ihren Verwandten und fürchteten sich vor den Grenzkontrollen, die Rückkehrer in die DDR, die Mutter aus Bernau und sie selbst, fühlten sich durch die Fülle der in den letzten Tagen empfangenen Eindrücke emporgehoben wie von einer Welle und sahen sich auch schon wieder hinabgleiten in das Tal der grauen Alltäglichkeit und der bedrohten Langeweile. Die Gefühle machten sich Luft, sobald die das Abteil und die Mitreisenden musternden Augenpaare ein Gesicht gefunden hatten, das durch ein Lächeln oder ein kurzes Nicken versprach, etwaige Fragen oder Bemerkungen zu beantworten oder zu kommentieren. Es dauerte nicht länger als eine Viertelstunde, bis Inge zumindest in Umrissen wusste, mit wem sie im Abteil saß, und bis sich alle Augen auf sie richteten, die bisher als Einzige geschwiegen hatte.
»Ganz allein unterwegs?«, fragte die Dame aus Bernau schließlich.
Inge musste lachen. »Das sehen Sie doch.« Sie zog eine Zeitschrift aus der Aktentasche, die sie auf dem Schoß hielt, und gab vor, sich in einen Aufsatz über neuere Behandlungsmethoden kindlicher Leukämien zu vertiefen. Was sie eigentlich beschäftigte, war Tim Brandis. Während sie in die medizinische Zeitschrift starrte, versuchte sie, jeden Augenblick des gestrigen Abends, den sie gemeinsam verbracht hatten, noch einmal zu durchleben. Wenn sie nicht alles täuschte, dann hatte dieser Tim wirklich Feuer gefangen. Ganz glauben konnte sie es noch nicht, ein Mann, der schon so viel erreicht hatte, sollte sich plötzlich Knall auf Fall in sie verlieben? In eine junge Kollegin aus dem Osten? Aber der Gedanke war ihr nicht unangenehm. Nein, er tat ihr gut. Sehr gut sogar. Mit der ermutigenden Vorstellung, dass jemand wie Tim sich in sie verknallen konnte, meldete sich allerdings auch die Frage, was aus der Bekanntschaft mit ihm denn werden könnte. Würde er die Geduld aufbringen, sie regelmäßig in Pankow zu besuchen? Und wenn Rehberger kein Interesse an einem Vortrag von Doktor Brandis zeigte? Was wäre dann? Wann würde sie denn wieder in den Westen reisen dürfen? Im nächsten Jahr? Wenn es hoch kommt, einmal im Jahr. Dass sie dieses Mal hatte reisen dürfen, war ohnehin fast ein Wunder. Oder ein bewusster Vertrauensvorschuss von Rehberger. Vielleicht auch eine kleine Anerkennung dafür, dass sie sich seinen Anordnungen widerspruchslos gefügt und sich Elenas Gruppe angeschlossen hatte. Siehst du, Mädchen, so ist es, wenn du Disziplin zeigst, dich dem Kollektiv unterordnest, die Zähne zusammenbeißt, ohne dabei zu verkrampfen und depressiv zu werden. Dann gibt es auch von meiner Seite das eine oder andere positive Signal. So könnte Rehberger sich ausgedrückt haben, wenn er seine Gedanken über sie in Worte gefasst hätte. Vielleicht, dachte Inge, vielleicht auch nicht. Wenn er wirklich so denkt, dann wird er auch nichts dagegen haben, wenn wir Tim Brandis einladen.
Mochte sie den so, wie er vorgab, sie zu mögen? Oder fühlte sie sich nur geschmeichelt? Aber selbst, wenn es so wäre, dachte sie, dann doch nur, weil er ein netter Kerl ist, höflich, gut aussehend, gescheit und bei alledem noch zutraulich und spontan. Wenn etwas aus uns würde, dann käme das wie ein Geschenk des Himmels nach den Enttäuschungen der letzten Monate. Inge fand plötzlich, dass sie angefangen hatte, diesen Tim Brandis zu mögen.
»Bebra«, sagte jemand im Abteil, als der Zug seine Fahrt verlangsamte. Sie ließ ihre Zeitschrift sinken. Die Dame aus Bernau, die ihr gegenüber saß, lächelte sie an, und Inge lächelte zurück.
Ein Beamter des Grenzschutzes schob die Tür zum Abteil auf und bat um die Ausweise. Betont nachlässig, fand Inge. Sie meinte, dass der Beamte eine Sekunde länger auf die westdeutschen Pässe schaute als auf die DDR-Papiere.
Nach wenigen Minuten hielt der Zug und rollte gleich darauf langsam weiter.
»Jetzt kommen die Unsrigen«, sagte die alte Dame aus Bernau. Es klang nicht gerade begeistert.
Die DDR-Grenzer verwandten sehr viel mehr Zeit auf die Kontrolle der Reisepapiere als ihre westdeutschen Kollegen. Vor allem widmeten sie sich dem Gepäck der Reisenden mit einer Akribie, die Inges Vater einmal als staatlich sanktionierten Voyeurismus beschrieben hatte. In ihrem Gepäck befand sich allerdings nichts, was Anstoß erregte. Der Herr aus Frankfurt aber, der angeblich zur Leipziger Messe reiste, wurde aufgefordert, mitsamt seinem Gepäck auszusteigen, um sich in der Dienstbaracke der Grenzpolizei einer genauen Kontrolle zu unterziehen.
»Aber dann versäume ich ja diesen Zug«, maulte er.
Der Mann, der sich seinen Mitreisenden bis dahin eher jovial und selbstsicher gezeigt hatte, machte plötzlich eine recht klägliche Figur.
»Dann nehmen Se eben den nächsten Zug, das heißt, wenn alles in Ordnung sein sollte«, wurde er belehrt.
Eine geschlagene Stunde stand der Zug in Wartha an der Grenzstation. Dann setzte er sich langsam wieder in Bewegung. Der Platz des Messe-Reisenden blieb leer.
»Heute noch auf stolzen Rossen, morgen durch die Brust geschossen«, zitierte die Dame aus Bernau, aber Inge, der diese Anspielung gegolten hatte, antwortete nicht. Niemand sagte etwas. Es blieb still im Zug. Der kleine Zwischenfall hatte die Stimmung gedämpft. Die Insassen des Abteils wussten jetzt wieder, wo sie hinfuhren. Erst als der Zug den Bahnhof Griebnitzsee hinter sich gelassen hatte und sich auf einer Umleitung dem Bahnhof Friedrichstraße näherte, wurde die Stimmung wieder lebhaft. Man war fast am Ziel. Zwar würde es noch einmal Kontrollen geben, aber die Menschen, die man besuchen wollte, waren nun nahe. Langsam verdrängte die Freude über das bevorstehende Wiedersehen die Angst vor der eben erlebten Willkür. Inge empfand auch so etwas wie Freude bei dem Gedanken, ihren Eltern und später den Geschwistern und Freunden von ihrer Reise zu erzählen, von dem Vortrag, der so gut gelaufen war, von der Frühlingsstimmung in Wiesbaden, den Läden mit ihren einladenden Schaufenstern, den vielen Autos, den irgendwie lässigen und entgegenkommenden Kollegen. Einigen würde sie auch von Tim erzählen. Wenn sie jetzt an ihn dachte, dann kam ihr »gestern Abend« vor wie ein lange zurückliegendes Ereignis. Zeitlich war es nahe, warum rückte es trotzdem schon wieder so weit weg?
Und Rehberger? Sie sah ihn erst einige Tage nach ihrer Rückkehr. Dabei brannte sie doch darauf, ihm von Tim Brandis’ neuartigen Arbeiten zu erzählen. Natürlich musste sie einen schriftlichen Bericht über ihre Reise abliefern. Alle Kontakte mit westdeutschen Kollegen, denen sie begegnet war, mussten darin erwähnt sein. Was die wissenschaftlich taten, interessierte genauso sehr wie die politische Einstellung dieser Menschen, soweit sie darüber etwas in Erfahrung gebracht hatte. Dann musste sie den eigenen Kollegen im Institut im Rahmen eines Seminars berichten, was sie an Neuem erfahren hatte. Da saßen sie vor ihr im kleinen Hörsaal in ihren weißen Kitteln und mit ihren ausdruckslosen Gesichtern. Wenn sie über Vorträge referierte, die sie besonders beeindruckt hatten und dabei so etwas wie Begeisterung spüren ließ, gab es zwei Reaktionen: verstocktes Schweigen auf der einen Seite, das konnte heißen: »Die sind eben in allem weiter als wir, da kommen wir nie hin, Kunststück, die sind frei. Die können reisen, sich Geld beschaffen, publizieren, auf Kongresse fahren – und wir?« Oder das Schweigen signalisierte Neid. »Tu nicht so wichtig, spiel dich nicht so auf, du Schnepfe, du treibst dich da im Westen rum und lässt uns hier deine Arbeit tun.« Die zweite Reaktion bestand in geheucheltem Interesse, vielen Nachfragen, Verweisen auf eigene Arbeiten oder Aufsätze von Kollegen im sozialistischen Ausland. »Ich darf in diesem Zusammenhang auf die Arbeit der Moskauer Gruppe um Josef Wassilew erinnern. Die haben schon vor einem Jahr ähnliche Ergebnisse veröffentlicht. Wenn Sie die Arbeit nicht kennen – ich schicke Ihnen einen Sonderdruck.« Ein schneller Blick zu Rehberger musste sicherstellen, dass die Bemerkung auch gehört und verstanden worden war. Inge war schon fast fertig mit ihren Ausführungen, einige der Kollegen sahen auf die Uhr, es war bereits früher Abend, Zeit nach Hause zu gehen oder noch irgendetwas einzukaufen, da fing sie plötzlich an, von Tim Brandis zu erzählen.
»Die interessanteste Neuigkeit habe ich am Rande des Kongresses erfahren.« Dann berichtete sie mit akribischer Genauigkeit, was Tim Brandis ihr erzählt hatte. Sie schilderte seine neue Technik, die er in New York, an der Columbia University gelernt hatte und jetzt in Heidelberg weiterführte, erzählte, was man damit machen könne und was er bereits publiziert habe. Wenn Inge bis zu diesem Augenblick pflichtgemäß berichtet und dabei häufig in ihre Notizen geschaut hatte, so sprach sie jetzt ganz frei, sehr anschaulich und mit einer Anteilnahme, die zumindest ihrem Chef auffiel. Sie vergaß auch nicht zu erwähnen, dass Tim angeboten habe, seine Technik den Kollegen am hiesigen Institut zugänglich zu machen. »Herr Brandis scheint da gar keine Vorbehalte zu haben, die man bei anderen Kollegen in der BRD doch immer wieder antrifft.« Sie log, dass wusste Inge, und sie wurde dabei ein wenig rot, aber die plötzliche Frische in ihrem Gesicht konnte auch als Erleichterung oder als Eifer gedeutet werden. Rehberger lächelte, die anderen klatschten Beifall und rannten aus dem Saal. Er kam zu ihr, nachdem sich der Saal geleert und sie ihre Unterlagen wieder eingesammelt hatte.
»Meinen Sie, wir sollten diesen Herrn Brandis einmal einladen?«
»Das wäre fantastisch, ich meine für uns. Er hat angeboten, einen Kurs zu geben.«
»Nein, ich meine zunächst zu einem Vortrag?«
Inge schluckte. »Ja, warum nicht? Vielleicht ergibt sich ein interessanter Meinungsaustausch?«
»Aber er müsste dann auch kommen. Nicht, dass er uns einen Korb gibt. Sie wissen, so etwas kommt im Ministerium nicht gut an.«
»Wenn Sie ihm schreiben, Herr Professor, dann wird er nicht absagen. Da bin ich sicher. Er ist noch jung. Er will seine Methode bekannt machen.«
Rehberger nickte. »Kommen Sie doch morgen nach der Vorlesung zu mir ins Büro. Wir können das dann noch einmal besprechen.« Er gab ihr die Hand. »Ein sehr guter und anschaulicher Bericht. Sie haben offenbar profitiert.«
Inge errötete zum zweiten Mal. »Danke.«
»Also dann bis morgen«, sagte Rehberger.
Nach dem Abend in Eberbach hörte Tim lange nichts von Inge. Es war buchstäblich, als sei sie vom Erdboden verschluckt worden. Er besuchte am Schlusstag des Kongresses noch einige Vorträge, traf sich auch wie versprochen mit Herrn Kleinschmidt aus Halle an der Saale, musste sich jedoch eingestehen, dass er nicht bei der Sache war. Der ganze Kongress kam ihm plötzlich vor wie ein Rahmen ohne Bild. Die Hauptsache fehlte. Sein Gespräch mit Kleinschmidt drehte sich, wann immer er das Wort ergriff, um Inge Bauer, das Institut, in dem sie arbeitete, wie man mit ihr in Verbindung treten könne.
»Ganz einfach«, meinte Herr Kleinschmidt. »Jemand beantragt für Sie eine Aufenthaltsgenehmigung in der DDR, am einfachsten auch gleich die Einreise mit dem Auto, und dann fahren Sie hin.«
Sie hatten sich in einem kleinen Restaurant in der Nähe der Rhein-Main-Halle zusammengesetzt.
Tim erzählte ihm, dass Inge ihren Chef dazu bewegen wolle, ihn zu einem Vortrag einzuladen – nach Ost-Berlin.
»Dauert so etwas lange?«
Kleinschmidt wusste es auch nicht. »Kann schnell gehen, kann ein paar Wochen oder Monate dauern oder überhaupt abgelehnt werden. Je nachdem.«
»Je nach was?« Der Gleichmut Kleinschmidts ging ihm auf die Nerven.
»Was man über Sie in Erfahrung bringt.«
»Und was sollte das sein?«