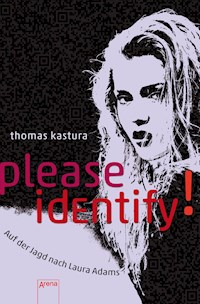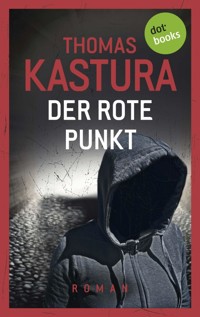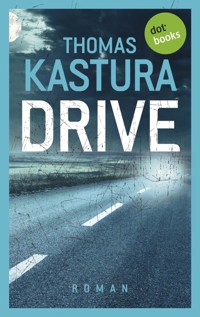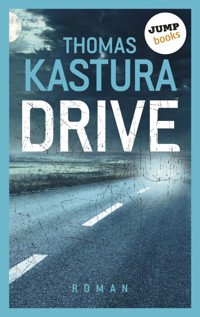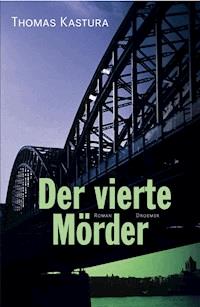
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Am Tag vor der Geburt des Erlösers werden die Menschen brennen. Es wird unter der Erde geschehen. Die Strafe wird furchtbar sein.«
Anfang Dezember geht bei der Kölner Polizei ein anonymer Drohbrief ein, der für den 23.12. einen verheerenden Brandanschlag ankündigt. Ein Fall für Hauptkommissar Klemens Raupach. Doch der einst erfolgreichste Ermittler der Kölner Kripo ist in den Innendienst, ins Polizeiarchiv, strafversetzt. Während sein Nachfolger mehr als halbherzig ermittelt, werden nach einem Brand auf einem Spielplatz ein weiterer Drohbrief und kurz darauf eine Leiche in einer Unterführung entdeckt. Raupach und seine junge, scharfzüngige Kollegin Photini Dirou nehmen sich inoffi ziell des Falles an. Doch die Zeit zerrinnt den Ermittlern zwischen den Fingern, der 23.12. rückt unaufhaltsam näher, und erst als weitere brutale Morde gemeldet werden, erhält Raupach den entscheidenden Hinweis …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Thomas Kastura
Der vierte Mörder
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Keine der Personen in diesem Buch hat einen realen Menschen zum Vorbild. Die Geschichte ist frei erfunden, wenngleich die Orte, an denen sie spielt, zum größten Teil wirklich existieren.
Für Philipp
Vae soli
8. Dezember
Endstation. Zuerst bemerkte er den Geruch. Der Mann schaute ungläubig. Er fühlte sich schläfrig. Dann begriff er.
Er zuckte auf seinem Sitz herum, verschüttete dabei seine volle Kaffeetasse, wand sich mit ungelenken Bewegungen. Er wollte hinaus.
Bleib drin.
Der Sekundenkleber auf der Polsterung hielt. Eine ganze Tube davon. Die Tür der Fahrerkabine war von außen verriegelt, der Druckknopf zum Öffnen des Schiebefensters blockiert. Rauch stieg vom Fußraum nach oben.
In der Zentrale meldete sich niemand. Die Kabel des Funkgeräts waren durchtrennt worden, während sich der Mann im Gebüsch hinter dem Wartehäuschen entleert hatte. Die letzten Fahrgäste befanden sich längst auf dem Weg nach Hause, das Reinigungspersonal war nach einer kurzen Kontrolle abgezogen. Der Triebwagen mit den beiden angehängten Waggons stand allein auf weiter Flur.
Panisch versuchte er, seine an der Sitzfläche klebende Hose abzustreifen. Als es ihm in der engen Kabine endlich gelang, war er bereits von Flammen umgeben.
Seine Kleidung fing schnell Feuer. Das Innenfutter der Jacke bestand aus Kunstfaser. Brennende Hemdzipfel. Darunter die nackten Beine, bedeckt von einer seltsamen Schmutzschicht. Nein, keine Schmutzschicht. Es waren verkohlte Härchen.
Nichts da, um den Brand zu löschen, kein Feuerlöscher, kein Eimer mit Sand. Sein Pferdeschwanz loderte auf, während er gegen die Scheiben trommelte. Auf dem Bahnsteig sah er die Umrisse einer Gestalt. Dann verwandelten sich seine Augenbrauen in zwei qualmende Striche.
Die Tür war von außen zusätzlich mit Klebeband verschlossen. Es war robustes Material aus einem Armeeladen, für alle erdenklichen Zwecke.
Der Mann glich einer Fackel. Er suchte nach einem Ausweg. Der Sicherheitshammer zum Einschlagen der Scheiben fehlte. Keine Hilfe.
Wehr dich nicht.
Brechende Fingernägel, Kratzspuren an den Scheiben, schwarz und rot. Der Sitz war mit einer geruchlosen, leicht entzündlichen Flüssigkeit getränkt. Man konnte sie in jedem Supermarkt kaufen. Sie brannte besser als erwartet.
Auf seiner Stirn bildeten sich Blasen, ebenso auf den blau rasierten Wangen, auf der Nase, am Kinn. Sein Gesicht schmolz.
Dann knickte er ein. Er schlug noch ein paar Mal mit der Faust gegen die Tür, entkräftet jetzt, ein letzter Reflex.
Die Erschöpfung kurz vor dem Ende.
Schließlich brach er zusammen.
Niemand stieg mehr zu.
30. November
Der Stein besaß annähernd die Form eines Würfels, nur dass die abgerundeten Kanten eine unterschiedliche Länge hatten, mit schiefen Winkeln wie bei einer misslungenen Bastelarbeit. Seine Farbe war grau.
Mausgrau, präzisierte Raupach. Außerdem war der Stein von weißlichen Sprenkeln bedeckt. Er besaß keine auffällige Maserung, keine Einschlüsse, soweit das zu erkennen war. Vielleicht stammte er aus einem Flussbett oder von einem Strand. Ein Kiesel, etwa fünfzehn Zentimeter breit, lang und hoch. Wie alt mochte er sein? Raupach war kein Geologe. Er stellte sich vor, dass der Stein schon vor hundert Jahren existiert hatte. Oder vor tausend? Wahrscheinlich eher vor zehntausend, hunderttausend, Steine wuchsen nicht wie Bäume, es gab sie seit einer Ewigkeit.
Vorsichtig nahm er ihn hoch. Ein gutes Kilo, schätzte er. Damit konnte man einen Menschen erschlagen. Stumpfer Gegenstand, unhandlich, ein kräftiger Mann wäre in der Lage, damit umzugehen. Auf der ansonsten glatten Oberfläche befanden sich ein paar Risse und Schründe. Dort würden Blutreste, Haare, Knochensplitter und Hautpartikel hängen bleiben, Hinweise auf das Opfer. Oder den Täter.
Den Jogger am Niederländer Ufer hatte er auf diese Weise überführen können. Das war schon eine ganze Weile her. Wie hieß er noch gleich? Sunde? Sünkel? Ein Wollfaden von seinem Handschuh war an dem Stein hängen geblieben, nachdem er damit die Schädeldecke eines Obdachlosen unter der Mülheimer Brücke zertrümmert hatte. Raupach war das Rheinufer bis zum Molenkopf entlanggegangen, immer wieder. Die Kollegen hatten sich über ihn lustig gemacht. Er solle die Fußarbeit doch der Suchmannschaft überlassen, warum stapfte er selber umher?
Nach ein paar Tagen fand er ihn. Er lag im Gebüsch unter einer ganzen Sammlung ähnlicher Brocken. Es war, als habe der Stein auf ihn gewartet.
Wenn der Jogger ihn einfach in den Fluss geworfen hätte, wäre Raupachs Ermittlung aussichtslos gewesen. Aber die Menschen gingen manchmal merkwürdige Beziehungen ein zu Dingen, mit denen sie etwas verbanden, zu Objekten, die ihnen den Eindruck vermittelten, etwas Außergewöhnliches geleistet zu haben. Das wusste Raupach. Deswegen fand er meist, was er suchte, auch wenn es länger dauerte. Viele Leute schleppten einen Stein mit sich herum oder hatten ihn irgendwo versteckt. Es kam darauf an, diesen Stein zu finden. Der Rest war Routine.
Er schüttelte den Kopf und vertrieb die unerwünschten Gedanken. Ihm fiel ein, worauf er bei dieser Übung achten sollte. Den Dingen ein bestimmtes Wort zuweisen, sie mit einem Begriff markieren.
Molenkopf, prägte er sich ein und legte den Stein auf die Terrakottafliesen zurück. Er ging einen Schritt weiter und nahm den nächsten Gegenstand in Augenschein. Eine Packung Papiertaschentücher, 4-lagig und durchschnupfsicher. So stand es in mehreren Sprachen auf der Verpackung.
»Die Zeit ist abgelaufen. Bitte geh wieder in den Übungsraum.«
Raupach erschrak. Er warf einen Blick auf die lange Reihe von Gegenständen, die noch vor ihm lag. Ein Lampion mit einem Mickymaus-Aufdruck. Eine karierte Decke. Eine Teekanne. Die anderen Teilnehmer des Seminars murmelten diese Worte vor sich hin, während sie die Terrasse durch eine Flügeltür verließen und ins Innere des Gebäudes gingen.
»Das war’s«, sagte der Dozent und zog ihn sanft am Ärmel.
Raupach trat beiseite und spähte über die Schulter des Mannes. Ein Geigenkasten. Ein Schaumgummiwürfel. Ein …
Aus dem Lächeln des Dozenten sprach jahrelange Erfahrung mit Menschen, die ungern eine Niederlage akzeptierten. Und ein gewisser Überdruss, es ihnen schonend beizubringen. »Fünf Minuten sind vorüber. Du willst doch nicht schummeln?«
Widerstrebend drehte sich Raupach um. Der Dozent dirigierte ihn zurück in die Jugendstilvilla und schloss die Flügeltür. Sie durchquerten ein lichtdurchflutetes Zimmer mit kreisförmig angeordneten Sitzkissen. Dort hatte am Morgen eine Vorstellungsrunde stattgefunden. Raupach waren Zweifel gekommen, ob er diesen Sonntag – und die folgenden Sonntage bis Weihnachten – sinnvoll verbringen würde.
Er fühlte sich unwohl in dem Seminar. Schon das unverblümte Duzen ließ ihn jedes Mal zusammenzucken. Es fiel ihm schwer, sich an diese aufgesetzte Vertrautheit zu gewöhnen. Er zog mehr Abstand vor. Aber irgendetwas musste er tun, um aus seiner jahrelangen Betäubung zu erwachen.
Raupach kam als Letzter in den Übungsraum. Alle anderen saßen mit gezückten Kugelschreibern an den Tischen. Er nahm neben einer attraktiven Kunsterzieherin Platz. Das halbe Seminar bestand aus mehr oder weniger zwangsverpflichteten Lehrern. Die rötlichen Locken der Frau standen kunstvoll in alle Richtungen ab. Sie musste Stunden vor dem Spiegel verbracht haben, um ihre Frisur so hinzubekommen. Er starrte auf ein leeres Blatt Papier.
»Beginnt … jetzt!«
Raupach nahm den Stift und notierte alle Begriffe, die er sich gemerkt hatte. Dinge im Gedächtnis zu behalten, war nicht sein Problem. Auch ihre Reihenfolge konnte er korrekt wiedergeben. Den großen Kieselstein hatte er zum Beispiel mit der Nummer fünf belegt. Selbst die Gegenstände, die er sich noch schnell im Weggehen eingeprägt hatte, konnte er sich mühelos in Erinnerung rufen. Aber nach dem Schaumgummiwürfel musste er passen. Er hatte elf. Von dreißig.
Während der Dozent die nächste Übung beschrieb, ein Konzentrationstraining mit Zahlenreihen, wertete sein Assistent die Bögen aus. Das Seminar lief wie ein Wettbewerb ab, das sollte die Motivation erhöhen. Es war der erstbeste Kurs, den der Fortbildungsbeauftragte Raupach vorgeschlagen hatte. Warum nicht mit Gedächtnistraining anfangen? Den Geist schärfen, das war eine solide Basis. Danach konnte er den nächsten Schritt tun.
Mit seinen elf Richtigen landete er auf dem letzten Platz.
»Du bist zu langsam«, tadelte ihn der Dozent und schüttelte den Kopf. »Hast du nicht auf die Uhr gesehen?«
Das hatte Raupach schon oft gehört. Er betrachtete die Rangliste auf der Tafel. Die Kunsterzieherin hatte 25 Treffer. Sie hieß Katharina.
»Diese verdammte Teekanne«, ärgerte sie sich. »So eine hab ich zu Hause. Hat mich total aus dem Konzept gebracht.«
»Das war schon sehr gut.« Der Dozent legte Katharina eine Hand auf die Schulter und beugte sich zu ihr hinab. »Vertraute Gegenstände können wir uns oft am schwierigsten merken. Wir schenken ihnen zu wenig Beachtung. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich leichter auf ungewöhnliche Dinge. Zum Beispiel auf den Lampion. Den haben alle.«
Die anderen Teilnehmer nickten.
Der Dozent ging zu einem Laptop und tippte darauf herum. Daraufhin warf der Beamer eine Zahlenfolge an die Wand. Es war die Zahl π, bis zur vierzigsten Stelle hinter dem Komma.
»Beginnen wir bei der Drei.«
Raupach dachte wieder an die Steine. Manchmal kam es vor, dass die Menschen sie nur zum Schein mit sich herumschleppten. Manchmal beabsichtigten sie sogar, dass man sie findet. Auch daraus ließen sich Schlussfolgerungen ziehen, Zusammenhänge erschließen.
Aber manchmal war ein Stein nur ein Stein.
Valerie konnte nicht glauben, was ihr Dr. Joos am Telefon erzählte. All ihre Bemühungen waren im vergangenen Jahr darauf gerichtet gewesen, die Verdachtsmomente gegen sie zu entkräften. Das Gutachten der Gerichtsmedizin, das Polizeiprotokoll, der Bericht des Drogendezernats – all dies kannte sie auswendig. Bis zuletzt hatte sie damit gerechnet, dass es zumindest einen Prozess geben würde. Dass sie ihre Aussage vor einem Richter wiederholen musste. Dann wäre Sheila vermutlich auch gehört worden – was sie ihrer Tochter unbedingt ersparen wollte.
Und jetzt das: Das Verfahren wurde eingestellt.
»Gehen Sie auf keinen Fall mehr auf die Wache!«, wies Joos sie an. »Die Polizei hat mehr als genug von Ihren Beteuerungen. Die müssen sich um andere Fälle kümmern, das Leben geht weiter.«
»Ich habe nur noch mal erklärt, was damals passiert ist«, entgegnete Valerie. »Damit es zu keinen Missverständnissen kommt.«
»Machen Sie eine Therapie, wenn Sie Redebedarf haben, fahren Sie in Kur, das wird Ihnen wegen der psychischen Belastung unter Garantie bewilligt. Aber lassen Sie die Beamten um Gottes willen ihre Arbeit machen. Sonst kommen die noch auf falsche Gedanken.«
»Ich dachte –«
»Sie brauchen nicht mehr zu denken, Frau Braq. Es ist vorbei.«
Sie konnte ein Schluchzen nicht unterdrücken, so sehr hatte sie diesen Augenblick herbeigesehnt. Etwas in ihrem Körper löste sich, ein Knoten dicht unter ihrem Kehlkopf. Wegen dieses Knotens konnte sie seit Monaten nur mit gepresster Stimme sprechen. Jetzt stiegen die Worte langsam empor wie der Pegel bei einem überraschenden Regenfall. Doch Valerie hielt sie zurück.
»Tut mir Leid«, sagte Joos. »Es war nicht so gemeint.«
Wenn er mit Valerie sprach, wurde er schnell ungehalten. Sie hatte einen leiernden Tonfall, der einen viel beschäftigten Mann wie ihn ungeduldig werden ließ. In Gedanken war er stets schon beim nächsten Fall, wenn er mit ihr sprach. Er konnte den Polizisten gut nachfühlen, dass sie ihnen auf die Nerven fiel.
»Das Jahr muss schrecklich für Sie gewesen sein.« Er heuchelte Verständnis. Vermutlich war dieses Gespräch das letzte, das er mit ihr führen musste.
»O ja, das war es«, hauchte sie.
Sie hätte es gerne in den Hörer geschrien. Was wusste dieser Anwalt schon von diesem Jahr? Wie oft hatten sie telefoniert? Viermal, fünfmal? Höchstens. Die Gespräche dauerten niemals länger als eine halbe Stunde. Jedes kostete eine Summe, für die sie im Callcenter zwei Tage schuften musste. Ein halbe Stunde Dr.-Joos-Worte für zwanzig Stunden Valerie-Worte. Und das war nur die juristische Beratung. Den Rest seiner so genannten Verteidigung, all die Briefe, den Anhörungstermin, das Hin und Her mit der Staatsanwaltsschaft, berechnete er gesondert.
»Wie geht es … Ihrer Tochter?« Er blätterte in seinen Unterlagen. »Sheila, nicht wahr? Hat sie es verkraftet?«
Ihr Blick fiel auf die Tür zu Sheilas Zimmer. Sie war seit einiger Zeit abgesperrt, wenn sie mit ihren Freunden in der Stadt unterwegs war. Ein abwesender Gast in einem Etagenhotel, nur dass sie ihren Zimmerschlüssel mitnahm. Heimat auf Zeit, kein Zuhause.
Doch Sheila war ein pflegeleichter Gast. Sie stellte wenig Ansprüche und versorgte sich selbst, wenn ihre Mutter nicht da war. Meistens kümmerte sie sich auch noch um die Wäsche. Valerie hätte es mit dem Mädchen nicht besser treffen können. Die beginnende Pubertät ihrer Tochter entlockte ihr ein wissendes Lächeln. Ein neues, exotisches Land lag vor Sheila. Valerie kannte das Gefühl, obwohl es lange zurücklag.
Kurz nach Jefs Tod hatten sie sich mehrere Tage lang intensiv unterhalten. Sheila war damals zwölf gewesen. Sie hatte nicht ganz begriffen, dass ihr Vater unwiderruflich weg war. Dass die Plage ein Ende hatte und er niemals zurückkehren würde. Andere Dinge schienen ihre Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Jungs, Mode, Musik. Valerie beneidete sie darum und ließ das Thema ruhen. Je weniger Gedanken sich Sheila machte, umso besser. Valerie war es immer gelungen, ihre Tochter aus dem Schlimmsten herauszuhalten. Das sollte so bleiben.
Dann dachte sie daran, dass Sonntag war. Dr. Joos hatte seit zwei Tagen versucht, mit ihr zu sprechen. Aber da sie seit Mitte November Doppelschichten schob und private Telefonate während der Arbeit verboten waren, hatte er sie erst jetzt erreicht. Bestimmt berechnete er einen erhöhten Wochenendtarif.
»Sie ist jung«, sagte Valerie schließlich. »Sie kommt schon klar.«
»Na dann.« Joos klappte den schmalen Aktenordner zu. Er enthielt einen unappetitlichen, aber einfachen Fall. Viel brachte er nicht ein. Aber der Aufwand war minimal gewesen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmte. »Alles Gute. Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Advent.«
»Das wünsche ich Ihnen auch«, antwortete Valerie reflexhaft, »Ihnen und Ihrer Familie.« Sie schaute aus dem Fenster. Der Wind blies ein paar Schneeflocken vom Fensterbrett, eine geisterhafte Hand, die sich anschickte, alles, was vergangen war, zu entfernen.
Valerie hatte das Gefühl, noch etwas zum Abschluss sagen zu müssen. Wie oft hatte sie die Ereignisse aus jener Nacht im Geiste durchgespielt? Monatelang war ihr Kopf damit angefüllt gewesen. Die eine, die gültige Version hatte sich schnell herausgebildet. Sie gegen alle Fragen, Einwände und Spekulationen zu verteidigen erwies sich als schwieriger. Es erforderte Disziplin und Beharrlichkeit. Immer wieder brachte sie ihre Aussage mit ihren Erinnerungen in Einklang, sagte sich die Worte vor. Auf ähnlich sture Weise hatte sie sich Gesprächsszenarien beim Telefonmarketing eingeprägt. Inzwischen kamen ihr die einzelnen Abschnitte des Skripts, das sie bei ihrer Einstellung erhalten hatte, ohne Nachdenken über die Lippen. Solch ein Automatismus ließ sich nicht so einfach abstellen. Deswegen war sie es auch nicht mehr gewohnt, kommentarlos aufzulegen. Sie spulte einfach nur ab, was sie einstudiert hatte, an ihrem Headset ebenso wie auf der Polizeidienststelle. Reden und Schweigen wurden eins.
»Danke«, sagte sie schließlich. Der Anwalt hatte nur getan, wofür sie ihn bezahlte. Trotzdem empfand sie plötzlich eine Verbundenheit für diesen nüchternen Menschen. Seine Anteilnahme hielt sich in berufsmäßigen Grenzen, aber er vertrat ihre Interessen. Er war einen kleinen Teil der Strecke mit ihr gegangen. Das war eine seltsame Erfahrung für Valerie. Sie wusste nicht, ob überhaupt einmal irgendjemand auf ihrer Seite gestanden hatte. Wie bewegt man einen anderen dazu, einem zu helfen? Sie wünschte, sie hätte sich früher an Dr. Joos gewandt.
»Danke für alles«, wiederholte sie.
Er hatte längst aufgelegt.
Raupach nahm sein Abendessen ein. Es bestand aus einem Brathering mit Graubrot und Butter. Dazu trank er schwarzen Tee mit einem Löffel Zucker. Er mochte Heringe. Sie schmeckten richtig salzig im Gegensatz zu den meisten anderen Fischen. Er musste an die Normandie denken. Dort hatte er seinen letzten Urlaub verbracht und als Vorspeise hareng saur gegessen, Bückling. Vor drei Jahren war das gewesen. Raupach hatte die Reise allein gemacht. Er fuhr nicht oft weg.
Nachdem er Teller und Besteck abgewaschen hatte, räumte er seine Wohnung auf. Er machte das jetzt jeden Sonntag in der Hoffnung, dass er dadurch ordentlicher würde. Als Photini ihn zum ersten Mal besucht hatte, wollte sie erst gar nicht hereinkommen. »Wie sieht’s denn bei dir aus?«, hatte sie gesagt und sich geweigert, einen Fuß über seine Schwelle zu setzen, bevor er nicht zumindest die Teller mit den festgetrockneten Essensresten entsorgt hatte.
Raupach legte Zeitungen und Magazine auf einen Stapel. Er ordnete herumliegende CDs ein und räumte seine Schuhe in ein Schränkchen, das er extra für diesen Zweck angeschafft hatte. Er faltete seine graue Fleecedecke zusammen. Letzte Nacht hatte er sich darin eingewickelt und im Fernsehen einen Malkurs auf Englisch angeschaut. Er konnte nicht malen und würde vermutlich auch niemals damit anfangen. Aber es entspannte ihn, dem fröhlichen, immer gut gelaunten Mallehrer dabei zuzusehen, wie er in einer halben Stunde ein fertiges Gemälde auf der Leinwand entstehen ließ. Die Bilder waren scheußlich, Landschaften in grellen, kitschigen Farben. Der Mann stammte aus Florida, da waren die Farben intensiver. Doch deswegen musste er nicht jeden Sonnenuntergang in eine Orgie aus Gelb, Pink und Violett verwandeln.
Was Raupach faszinierte, war die Auffassung, dass man bei der Ölmalerei keine Fehler begehen könne. Die Devise des Fernsehmalers lautete: »We don’t make mistakes. We only have happy accidents.« Damit machte er den Zuschauern Mut, es einmal selbst zu probieren. Am Ende wünschte er immer »Happy Painting«. Der Mann war ein Relikt aus den Siebzigern, darauf deutete schon seine Afrofrisur hin. Wenn die Kamera näher heranging, waren auf seinen Handrücken Altersflecken zu erkennen. Bestimmt fanden ihn viele Zuschauer lächerlich.
Aber Raupach mochte ihn. An der Hand, mit der er die Palette hielt, fehlte ihm ein Glied des Zeigefingers. Sie kam so gut wie nie ins Bild. Außerdem besaß er auf seiner linken Wange eine tiefe, senkrecht verlaufende Narbe. Diese Seite war der Kamera fast immer abgewandt. Der Mann versteckte seine Verletzungen. Man merkte ihm an, dass er vor seinen Fernsehkursen etwas vollkommen anderes gemacht hatte, etwas, das unauslöschliche Spuren an seinem Körper hinterlassen hatte. Sicher hatte er einen guten Grund, Fehler als glückliche Zufälle oder Unfälle anzusehen.
Raupach warf den Staubsauger an und machte sauber. Mit dem Parkettboden und den Teppichen war er schnell fertig. Dann wechselte er den Aufsatz und entfernte Staub und Spinnweben von den Wänden. Dabei achtete er darauf, die Fotografien nicht zu berühren. Er hatte sie mit Wäscheklammern an eine Leine geklemmt wie ein Fotograf, der frische Abzüge zum Trocknen aufhängt. Sie zeigten ein sechzehnjähriges Mädchen aus verschiedenen Entfernungen und Perspektiven. Auf weiteren Bildern waren Holzpflöcke mit Markierungen zu sehen, im Hintergrund befand sich ein Betonpfeiler. Schließlich gab es noch eine Fotostrecke von einer Eisenbahnbrücke. Von dieser Brücke war das Mädchen angeblich heruntergesprungen.
Raupach glaubte nicht an Selbstmord. Alle Zeugenaussagen und die düstere Vorgeschichte des Mädchens deuteten darauf hin. Aber wenn sie sich in den Tod gestürzt hatte, konnte sie nicht einige Meter von den Brückenpfeilern entfernt aufgekommen sein. Das Gelände war eben, man fand keine Roll- oder Schleifspuren, und in der fraglichen Nacht hatte es keinen Sturm oder so etwas gegeben. Dies ging aus dem Bericht zweifelsfrei hervor. Die einzige Erklärung war, dass jemand sie gestoßen hatte.
Er stellte den Staubsauger zurück in einen kleinen Abstellraum und nahm sich die Akte des Falls noch einmal vor. Während er so dasaß und über dem gerichtsmedizinischen Gutachten brütete, klingelte die Türglocke. Er sprang auf, durchquerte den Wohnraum, der gleichzeitig sein Schlafzimmer war, und stolperte über den Wäschekorb. Herrje, den hatte er vergessen. Ratlos schaute er sich um. Es klingelte wieder. Er schob den Korb mit dem Fuß beiseite, nahm seine Jacke im Vorbeigehen von einer Stuhllehne und hängte sie an die Garderobe.
Photini sah, dass Raupach versucht hatte aufzuräumen – auf den letzten Drücker, wie sie vermutete. Selbst wenn Raupach den ganzen Tag über geputzt und gewienert, wenn er die gesamte Einrichtung auf den Kopf gestellt hätte, würde immer noch vieles verraten, dass er ein hoffnungsloser Schlamper war. Wie er seinen Fernseher und den Videorekorder angeschlossen hatte: achtlos ineinander geschlungene Kabel. Seine CD-Sammlung in dem billigen Wandregal, ohne System: Klassik, Popmusik, Hörbücher, alles völlig durcheinander. Die Position des Adventskranzes, den sie ihm geschenkt hatte, obwohl sie sich nichts aus Weihnachtsbräuchen machte, weder aus deutschen noch aus griechischen: Er stand auf dem neuen Schuhschränkchen und ragte ein gutes Stück über den Rand hinaus. Man musste Angst haben, dass er jeden Augenblick herunterfiel.
Raupach konnte sie nicht täuschen. Niemand konnte das so leicht. Immerhin gab er sich Mühe, dachte sie und verkniff sich eine Bemerkung, um ihn nicht zu entmutigen. Sie unterdrückte auch den Impuls, ihm zur Hand zu gehen und den Wäschekorb in den kleinen Abstellraum neben der Küche zu stellen. Erstens kannten sie sich noch nicht gut genug für derlei Vertraulichkeiten, und zweitens sollte er das selber machen, schließlich verfolgte er damit einen bestimmten Zweck. Und ein ordentlicher Raupach, auch wenn er sich dazu zwingen musste, war ihr allemal lieber als der zerstreute Wirrkopf, als den sie ihn kennen gelernt hatte.
Dann entdeckte sie die Fotografien. Sie behielt ihre schwarze Daunenjacke an und durchquerte den Raum.
»Von wann sind diese Aufnahmen?«
Raupach murmelte eine Begrüßung und folgte ihr.
Photini schaute auf die Rückseite eines Fotos. »1999. Seit wann nimmst du das Zeug mit nach Hause?«
»Eigentlich schon immer«, antwortete er. »Das vertreibt mir die Zeit.«
Es verunsicherte ihn, dass sie so direkt nach den Fotografien fragte. Seine Berufsauffassung musste ihr doch bekannt sein. Es gefiel ihm nicht, darüber Rechenschaft abzulegen.
»Würde mir nicht im Traum einfallen.« Photini schüttelte den Kopf. Er war unverbesserlich. Dieses Pflichtbewusstsein über den Dienst hinaus – dort, wo sie beide arbeiteten, wurde das nicht honoriert. »Los, zieh dir was über. Wir gehen Eis laufen.«
Raupach überlegte, ob er widersprechen sollte. Immerhin war er ihr Vorgesetzter, etwas respektvoller konnte ihr Umgangston schon sein. Es gab niemanden, der so mit ihm sprach, nicht einmal Woytas, der vor drei Jahren seinen Platz eingenommen hatte. Und Präsident Himmerich, der um seine Verdienste wusste und ihm stets den Rücken gestärkt hatte, erst recht nicht. Alle waren ihm gegenüber zuvorkommend und höflich. Nach seiner Versetzung waren sie sogar noch eine Spur höflicher. An die Stelle von Respekt war Mitgefühl getreten.
Photini behandelte ihn dagegen wie einen störrischen Großvater. Dabei war er 41, gerade mal fünfzehn Jahre älter als sie. Er wusste nicht, warum er ihr dieses Benehmen durchgehen ließ. Vielleicht weil sie aus Griechenland stammte und er annahm, dass ihr die deutsche Zurückhaltung nicht lag. Sie war zwar in Bonn aufgewachsen, aber Höflichkeitsfloskeln wendet man meist nur in der eigenen Muttersprache an. Er vermutete, dass sein Griechisch auch etwas schroff klingen würde, wenn ihm all die kleinen beiläufigen Worte fehlten, die ein Gespräch glätteten.
Er holte ein Paar zerknautschte Halbschuhe aus dem Schränkchen, schlüpfte hinein und nahm seine Jacke vom Haken. Vor wenigen Minuten hatte er die Sachen erst weggeräumt. Es war nicht einfach, darin einen Sinn zu erkennen.
Eine Bewegung aus dem Handgelenk. Das Kratzen über die Reibfläche. Zischen, als der Sauerstoff freigesetzt wurde. Mit einem Rascheln verbanden sich die Chemikalien der Zündkopfmasse und lösten sich auf. Ohne Rückstände, wie es die Sicherheitsbestimmungen vorsahen.
Johan Land liebte dieses Rascheln. Wenn er ein Streichholz entzündete, war er voller Erwartungen. Das Geräusch rief Erinnerungen an lang zurückliegende Winter wach. Dagegen konnte er das scharfe Klicken eines Einwegfeuerzeugs nicht leiden. Streichhölzer waren intimer. Er mochte ihre Schlichtheit. In Feuerzeuge verirrten sich Stoffflusen. Oder das Gas ging zur Neige. Streichhölzer zündeten zuverlässig, selbst bei Nässe oder starkem Wind. Das wurde oft unterschätzt.
Er hielt die Flamme an den unbenutzten Docht und ließ ihr durchsichtiges Inneres an der wächsernen Umhüllung lecken. Geduldig sah er zu, wie das Wachs schmolz und der Docht Feuer fing. Die Kerzenflamme schlug hoch. Dann duckte sie sich, als wollte sie gleich wieder verlöschen, wie ein Neugeborenes, das ins Leben gleitet und sich nach einer ersten Streckung wieder zusammenkrümmt.
Er hielt den Atem an. Für einen Moment schien die Flamme vor seinen Augen zu verwischen. Sie bewegte sich mit rasender Geschwindigkeit von links nach rechts, als stände die Kerze in einem fahrenden Zug. Instinktiv folgte er der Flamme, indem er sie fixierte und dabei den Kopf blitzschnell drehte. Er verlor sie nicht aus dem Blick, konnte verhindern, dass sie unscharf wurde. Sie flackerte ein wenig. Aber sie verlosch nicht.
Johan schloss die Augen. Er zwang sich dazu. Sonst würde die Flamme und alles, was sie umgab, nicht zum Stillstand kommen. Er wartete eine Sekunde, zwei Sekunden, drei, zählte in Gedanken mit. Dann öffnete er die Augen wieder.
Die Kerze befand sich an ihrem festen Platz. Die Flamme richtete sich auf. Ruhig und gleichmäßig brannte sie weiter.
Erster Advent. Er legte die Streichholzschachtel auf den dafür vorgesehenen Platz in der Mitte des Kranzes und wedelte den Geruch von verbranntem Holz beiseite. Der erste Advent war immer aufregend. Und schmerzlich. Er wird der letzte dieser Art sein, klang es in seinem Ohr. Martas Stimme war heute ruhig und fest. Sie meldete sich selten zu Wort, wie immer, wenn sie beide übereinstimmten.
Er betrachtete seine Unterarme. Die Narben wiesen die vertraute Schraffur auf. Er lehnte sich zurück und las zum wiederholten Mal seine Reinschrift. Sie war perfekt. Dann hielt er den Zettel in die Flamme. Er hatte lange daran gefeilt, die Formulierungen genau bedacht. Es kam auf jedes Wort an, der Text durfte keines zu viel enthalten. Schwätzer, das wusste er, wurden nicht ernst genommen. Aber es sollte auch nicht zu abgehackt wirken, unbeholfen oder mehrdeutig, sonst schriebe man es irgendeinem Verrückten zu, der nur ein wenig Aufmerksamkeit erregen wollte. Man musste die Mühe erkennen, die dahinter steckte, eine unerbittliche Präzision. Dass an seinen zur Reife gelangten Absichten nicht zu rütteln war.
Es würde keine weiteren Ankündigungen geben. Er hatte nicht vor, ein Spiel zu beginnen. Er wollte nur ausschließen, dass sie den Zufall verantwortlich machten oder alles auf eine Art von Verirrung schoben. Er ging nicht in die Irre, im Gegenteil, alles lag so klar vor ihm wie noch nie.
Er hielt den Zettel so, dass er von allen Seiten gleichmäßig abbrannte. Als die Flammen fast seine Fingerspitzen berührten, machte er zwei Schritte zum Ausguss, ließ die brüchigen Überreste hineinfallen und spülte sie sorgfältig hinunter.
Genauso hatte er es mit der Mitteilung gemacht, die er nach diesem mehrfach überarbeiteten Entwurf angefertigt hatte, das Original aus erster Hand, wenn man so wollte. Er hatte es mehrmals fotokopiert, ein Prozess, der keine Hinweise auf den Urheber hinterließ. Einen Computer benutzte er für sein Vorhaben nicht, das war ihm zu unsicher. Bestimmte Dinge sollte man ohne die Hilfe moderner Speichermedien erledigen, fand er. Es machte sie einzigartig. Dann hatte er die Fotokopien in neutrale Umschläge gesteckt, sie ausreichend frankiert und in einen Briefkasten in der Nähe des Doms geworfen, fern von seiner Wohnung und seiner Arbeitsstelle.
Johan fragte sich, mit wem er diesen Abend verbringen konnte, wem sollte er einen Besuch abstatten? Im Geiste ging er die Namensliste durch. Mattes und Thierry vergnügten sich bestimmt in einer Kneipe, ohne Rücksicht darauf, dass sie am nächsten Tag wieder in ihrer Webagentur antreten mussten. Valerie würde früh zu Bett gehen, wie es am Sonntag ihre Gewohnheit war. Vielleicht ließ sie das Licht für Sheila an, die manchmal länger ausblieb – obwohl das Mädchen noch zu jung war, um sich auf der Straße herumzutreiben. Bei der alten Güsgen liefe das Abendprogramm. Sie schaltete oft um. Die Bilder hatten kaum Gelegenheit, jenes gleichmäßige, bläuliche Flimmern zu verströmen, das Johan nicht selten beruhigte und ein Stück weit Anteil nehmen ließ am Geschehen der Welt. Bei seinem eigenen Fernsehgerät fehlte das Empfangsteil. Er hatte es ausgebaut und konnte keine Programme mehr empfangen.
Es war sein Lieblingshaus. Viersener Straße Nummer sieben. Mehrere Leute von der Liste wohnten darin. Er konnte die Hinterfront bequem durch sein Schlafzimmerfenster beobachten. Oft warf er noch einen letzten Blick darauf, bevor er das Laken glatt strich und in seine Träume hinabstieg. Er ging um Punkt zehn zu Bett. Dann hatte er vor der Arbeit am nächsten Morgen genug Zeit, seine drei Runden in der Flora zu laufen.
Jedem sein eigener Rhythmus. Immer, wenn Johan sich schlafen legte, holte Luzius Goodens sein Fahrrad aus einem Schuppen im Hinterhof und verließ Nummer sieben durch die Toreinfahrt. Die einen betteten sich zur Ruhe, die anderen erwachten, so war der Gang der Welt.
Goodens stand nicht auf der Liste. Johan hatte ihn noch nie in der U-Bahn gesehen. Streng genommen existierte er deshalb gar nicht. Das war sein Glück.
Johan beschloss, das Haus nicht mehr zu verlassen. In seiner Straße gab es zwar noch ein paar viel versprechende Wohnungen, aber er war sehr mit sich zufrieden heute Abend und hatte keine Lust, in die Kälte hinauszugehen. Er lehnte sich zurück und sah der Kerzenflamme zu. Jeder seiner Atemzüge brachte sie zum Flackern.
Mit der Bahn war es nur eine Viertelstunde bis zum Neumarkt. Als sie eingestiegen waren, fragte Photini ihn nach dem Seminar. Raupach zögerte. Die junge Frau hatte eine erstaunliche Einschätzungsgabe. Er konnte darauf verzichten, von ihr veralbert zu werden. Damit übertrieb sie es meistens: Sie sagte den Menschen auf den Kopf zu, was in ihnen vorging. Aus diesem Grund war sie Raupach zugeteilt worden. Keiner der Kollegen kam mit ihr zurecht.
»Du hast versagt, stimmt’s?« Sie sah ihn an und lachte. »Jetzt redest du dir ein, dass es keine Bedeutung hat. Aber es wurmt dich trotzdem. Nun sag schon, wie schlecht warst du?«
Raupach schwieg und starrte auf die Fensterscheibe an der gegenüberliegenden Seite des Wagens. Die Tunnelpfeiler flogen vorbei. Sein Spiegelbild wackelte bei jeder Erschütterung des Wagens. Er sah einen Mann in der Mitte des Lebens. Zurückweichender Haaransatz, darunter eine zerfurchte Stirn, Augen, die selten still standen, eine auffallend lange Nase. Die Mundwinkel wiesen nach unten, woran auch ein gezwungenes Lächeln nichts ändern konnte. Kein Anblick zum Verlieben, doch mit so ungleichen Ausprägungen, dass Raupach sich gelegentlich selber Rätsel aufgab.
Er würde kein Wort über seine Niederlage verlieren. Sie war vernichtend gewesen: Gerade mal in einer Übung war es ihm gelungen, so gut wie der Durchschnitt zu sein. Eine Aufgabe zur Kreativitätsförderung. Sie bestand darin, einen Berg zu zeichnen. Ohne Zeitlimit.
Er hatte nur einen Bleistift benutzt, keine Farben. Mit ein paar Strichen hatte er den Stromboli skizziert. Er kannte den Vulkan von einer Gruppenreise in den Süden. Seine Zeichnung zeigte nicht nur den Krater, sondern den ganzen Berg samt Fuß, einzelnen Hängen und dem Meer. Die Größenverhältnisse waren genau so wie in Wirklichkeit, darauf legte Raupach besonderen Wert. Nach Einschätzung des Dozenten und der anderen Teilnehmer war sein Bild »ganz gut«, nicht »umwerfend« wie das von Katharina, aber immerhin. In der Gesamtwertung hatte er dennoch den letzten Platz belegt. Er war sich wie ein Dorftrottel vorgekommen.
»Dein Glück, dass es nur Gedächtnistraining ist. IQ-Quatsch und so was.« Photini hatte den Prospekt des Training-Centers MemPower auf seinem Schreibtisch liegen sehen und aus Neugier darin geblättert. »Wenn du deine emotionale Intelligenz unter Beweis stellen müsstest, würden sie dich sofort rauswerfen«, setzte sie hinzu.
Er umklammerte die Haltestange neben dem Sitz. »Und was ist mit sozialer Intelligenz?«, fragte er. »Bist du darin auch Expertin?«
»Autsch, das hat gesessen.« Sie lachte so herzlich, dass auch Raupach schmunzeln musste.
Über ihre zwischenmenschlichen Defizite erzählte er ihr nichts Neues. Sie kannte ihre Fehler, unternahm aber nichts, sie zu beheben. Zum Beispiel sah sie nicht ein, warum sie ihre Persönlichkeit mit Dienstantritt verleugnen sollte.
»Vielleicht hast du Recht«, räumte sie ein. »Für Fortbildung ist es nie zu spät. Auf der Polizeischule bringen sie einem nicht alles bei.«
Ihre guten Vorsätze waren noch schlechter als seine, fand er. Photini war viel zu stolz für eine freiwillige Fortbildung. Sie würde nie so einen Kurs belegen.
»Lass dich nicht beirren«, sagte er. »Deine Zeit kommt noch. Mit mir als Vorbild weißt du wenigstens, wie man stilvollendet auf dem Bauch landet.«
Er spielte es herunter. Photini erkannte, dass sie zu weit gegangen war. »Mach dir nichts daraus«, sagte sie. »Solche Seminare haben keine Bedeutung. Von diesen verkrachten Psychologen hat doch keiner eine Ahnung, worauf es wirklich ankommt. Wenn es darum geht, Spuren zu lesen, steckst du jeden in die Tasche.«
Raupach war gerührt. Sie versuchte, ihm zu schmeicheln.
»Wie sagst du immer?«, fragte sie.
Jetzt war es offensichtlich, dass sie ihn aufmuntern wollte. Glücklicherweise wurden sie von der Ankündigung der nächsten Haltestelle unterbrochen. Er stand auf und stellte sich vor die Wagentür. Das machte er immer ein bisschen zu früh, wie jemand, der selten in die Großstadt kommt.
Sie wartete neben ihm. Ihr Pony befand sich auf der Höhe seiner Achseln.
»Na los, ich kann mir den Spruch einfach nicht merken.«
Die Bahn fuhr in die Station »Neumarkt« ein. Photini stupste ihn an.
»Spuren sind in, zwischen und hinter den Dingen«, sagte er langsam. Dann lächelte er. Photini sah es in der Scheibe, bevor sich die Tür mit einem Rumpeln öffnete.
Die Wahl fiel auf Valerie. Johan zog den Vorhang beiseite und machte es sich mit einer Schale Keksen und einem Glas Milch am Fenster gemütlich. Marta hatte diese Kombination geliebt. Für Johan war es nur ein Ritual. Essen und Trinken besaß für ihn keinerlei Reiz. Das Teleskop stand an seinem angestammten Platz. Sein Notizbuch lag auf seinem Oberschenkel. Es konnte losgehen.
Irgendetwas in Valeries Leben war heute anders. Er stellte die Linse scharf – ein Augenblick, den er immer aufs Neue genoss. Das Okular war ein Teil von ihm. Wenn er hindurchsah, trat er zugleich in Vergangenheit und Zukunft ein. Sein Brief kam ihm in den Sinn. So laßt uns jetzt mit Fleiß betrachten, was durch schwache Kraft entspringt. Er war gespannt, ob jemand die Verse erkennen würde.
Valerie tanzte. Das sah er ganz deutlich. Sie hielt ein Glas Wein in der Hand und wirbelte damit durchs Wohnzimmer. Es schwappte über. Sie achtete nicht darauf. Inzwischen konnte sie das ungestraft tun, dachte Johan. Aber bisher hatte sie es nicht getan, das ganze Jahr über nicht.
Was hörte sie wohl? Sie hatte einen Stapel CDs in der Hand. In regelmäßigen Abständen nahm sie eine und warf sie in einen Müllsack.
Johan machte eine Notiz. Anfangs hatte er Martas alte Videokamera benutzt. Die hatte sich schnell als ungeeignet erwiesen. Wenn er sie bediente, entstanden nur banale technische Reproduktionen, die genau das abbildeten, worauf das Objektiv gerichtet war. Er wollte aber Aufzeichnungen anfertigen, die durch seine eigene Hand und seinen Kopf gegangen waren. Das war wichtig. Eine Kamera wurde zwar von Hand geführt, aber sie tat zu viel von alleine, zu viel, was seinem Einfluss entzogen war. Ein handschriftliches Protokoll trug dagegen einzig und allein den Stempel seines Urhebers.
Marta hatte mit der Kamera virtuos umgehen können, sie war eine große Künstlerin gewesen, vielleicht die beste auf ihrem Gebiet. Ihre Aufnahmen hätten es verdient gehabt, im Museum Ludwig gezeigt zu werden. Dagegen war sein Geschreibsel nur das Werk eines Dilettanten.
Als Valerie alle CDs weggeworfen hatte, ging der Wein in der Flasche zur Neige. Sie holte eine neue aus einem Karton mit der Aufschrift »Pavillon Royal«. Johan schraubte an der Linse. Auf der leeren Flasche war der Zusatz »Doux« verzeichnet. Sie trank Süßwein. Er schrieb es auf. Das sollte wohl alles überdecken, was ihr widerfahren war. Als ob das mit Alkohol so einfach ginge. Sie hatte nichts dazugelernt. Nachdem sie Hölle und Fegefeuer durchschritten hatte, meinte sie wohl, jetzt winke ihr das Paradies.
Betrunken taumelte sie gegen eine Box. Inzwischen trug sie nur noch ihren Slip und ein Spitzenhemdchen. Johan hatte ihrer Unterwäsche noch nie viel abgewinnen können. Da war ihm schon Aufregenderes vor Augen gekommen.
Erstaunlich viele Menschen dachten gar nicht daran, die Rollläden herunterzulassen, wenn sie im Badezimmer an ihren Körpern herumfuhrwerkten. War es Unbedarftheit oder ein Hang zum Exhibitionismus, der sie dazu anstiftete? Welche Art von Freiheit drückte sich darin aus?
Wenn Johan wollte, konnte er jeden Tag Zeuge von Peepshows werden, die in nur dreißig, vierzig Metern Luftlinie von ihm entfernt abliefen. Judy, 22, Schuhverkäuferin. Cora, 25, Sportstudentin. Iris, 42, Hausfrau. Sie waren ihm gleichgültig. Solange sie nicht die U-Bahn zu einer bestimmten Tageszeit benutzten, konnten sie von ihm aus auf einem anderen Erdteil wohnen.
Jetzt machte sich Valerie über Jefs E-Gitarre her. Es sah aus wie bei einem Rockkonzert. Sie ergriff das Instrument am Hals, holte weit aus und zertrümmerte es, als wollte sie mit einer Axt Wurzelholz spalten. Immer wieder schlug sie zu. Der gläserne Couchtisch, die Weinflasche, alles ging dabei zu Bruch.
Johan konnte die Fülle der Ereignisse nicht fassen, die unverhoffte Dramatik. Er war hin- und hergerissen zwischen dem Teleskop und seinen Notizen.
Schließlich sank sie vor den Trümmern zu Boden.
Wie oft hatte Johan sie so daliegen gesehen? Die Arme schlaff am Körper, die Beine gespreizt, als würde sie ihr Schicksal selbst gebären. Nur vor einem Jahr war es anders gewesen, in einem verlockenden Augenblick. Selbst durch die Linse der Videokamera, die er damals noch benutzte, war zu spüren gewesen, wie die Situation auf einen Punkt zugesteuert war, von dem es keine Rückkehr gab. Valerie hatte bis zuletzt gezögert. Dann hatte sie sich aufgerichtet und ihr Leben in die Hand genommen.
Sollen wir sie von der Liste streichen? Der Gedanke gefiel ihm, auch wenn Marta ihn nur zähneknirschend duldete. Johan wog ihn ab, spielte damit, als stände sein Vorhaben nicht schon längst unverrückbar fest.
Einmal hatte er Valerie in der U-Bahn beinahe angesprochen. Station für Station hatte er sich die Worte zurechtgelegt. Ein unverfänglicher Versuch, Konversation zu machen. Dass sie immer denselben Wagen wie er nähme, was das für eine schöne Gemeinsamkeit sei.
Auf diese Weise hatte er einst Marta kennen gelernt. Manchmal, kurz vor dem Einschlafen, stand ihm ihr Bild so klar vor Augen, als säße sie neben ihm auf der Bettkante. Damals in der Linie 18 am Hauptbahnhof war es ihm gelungen, den ersten Schritt zu tun. Marta blickte von ihrem Buch auf und rezitierte einfach das, was sie gerade gelesen hatte. Denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo Starkes sich und Mildes paarten, da gibt es einen guten Klang. Friedrich Schillers Lied von der Glocke, ihr Bindeglied, Anfang und Ende. Später hatte Marta ihm gestanden, dass sie die Zeilen als Wink des Schicksals aufgefasst hatte. Als Vorausdeutung ihrer Unzertrennlichkeit.
Doch Valerie war nicht Marta. Sie hatte genau in dem Moment weggeschaut, als Johan den Mund öffnete, machte sich unerreichbar. Er starrte auf ihren Hinterkopf und brachte keine Silbe heraus. Seither zog er solche Annäherungsversuche nicht mehr in Betracht. Wenn die Menschen lieber schwiegen als redeten, war ihnen nicht zu helfen.
Johan durfte sich keine Willkür erlauben. Valerie blieb auf der Liste, punktum. Mit des Geschickes Mächten ist kein ew’ger Bund zu flechten, ergänzte Marta.
Und das Unglück schreitet schnell, setzte Johan hinzu.
Nachdem sie den Eisläufern eine Weile zugesehen hatten, tranken sie an einer Bude einen Becher Glühwein. Dann liehen sie sich Schlittschuhe. Es war so ein Novemberabend, an dem man die Dunkelheit nach einem endlos trüben Tag herbeisehnte, ein Abend, wo die Konturen im Licht der Weihnachtsdekoration verschwammen. Die Stadt platzte aus allen Nähten. Ihre Bewohner schienen sich alle zugleich ihre Dosis Advent einverleiben zu wollen. Es herrschte eine Spannung, die trotz des dicht gedrängten Passantenstroms nicht gehetzt wirkte. Die Menschen bummelten ein wenig und nahmen dabei all die anheimelnden Eindrücke in sich auf, die sie seit ihrer Kindheit regelmäßig heraufbeschworen. Es würde nicht lange dauern, bis sie genug davon hatten. Bis dahin genossen sie es nach Kräften.
Raupach war froh, dass Photini ihn mitgenommen hatte. Früher hatte er den künstlichen Trubel an sich vorüberziehen lassen. Jetzt begab er sich bewusst hinein. Es blieben mehr als vier Wochen, das Jahr zu beschließen. Er wollte ihm noch einige positive Seiten abgewinnen.
Die Eisfläche war voller Leute. Photini kurvte vor ihm her, vollführte eine elegante Drehung, lief rückwärts. Sie amüsierte sich über sein erstauntes Gesicht. Das hatte er ihr wohl nicht zugetraut.
Er folgte ihr, so gut er konnte. Seine Knöchel knickten immer wieder nach innen. Als er mit einer Kufe wegrutschte, war sie neben ihm und half ihm auf die Beine.
»Du kannst aber gut Eis laufen«, sagte er. »Ich dachte, die Winter in Griechenland sind dafür zu warm.«
Er konnte diesen Anspielungen auf Photinis Herkunft einfach nicht widerstehen. Dabei wusste er genau, dass sie ihr gesamtes Leben in Bonn und Köln verbracht hatte und nur einmal im Jahr nach Griechenland fuhr, um ihre Großeltern auf dem Peloponnes zu besuchen. Sie kannte den deutschen Winter, seit sie denken konnte. Und sie konnte es nicht leiden, wie eine Ausländerin behandelt zu werden.
»In welchem Jahrhundert lebst du eigentlich, Raupach? Haben sie in deiner kleinen Welt schon den Kühlschrank erfunden?«
»1881 wurde die erste Kunsteisbahn in Deutschland gebaut. Das ist so ungefähr meine Zeit.«
»Viel zu hektisch. Du wärst niemals klargekommen. Stell dir vor, damals fuhren schon Straßenbahnen.«
»In Köln nicht, da gab es 1881 noch Pferdebahnen. Wahrscheinlich hatten sie in Athen eine Eselbahn.«
»Du bist politisch unkorrekt«, stellte Photini fest.
»Stört dich das?«
»Das zeigt nur, dass du ziemlich –«
Ihre Schulter wurde herumgerissen. Sie schlug der Länge nach hin. Offenbar hatte sie jemand angerempelt. Raupach sah eine Gruppe feixender Teenager an der Bande stehen. Ein Junge mit einer dicken Pudelmütze entfernte sich mit ein paar schnellen Schritten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Jugendlichen zu. Er bremste scharf ab. Eine Wolke aus Eis stob hoch. Dann gesellte er sich zu ihnen. Es waren drei Jungen, fünfzehn oder sechzehn Jahre alt, und drei deutlich jüngere Mädchen.
Photini rappelte sich hoch und rieb sich den Ellenbogen. Sie rief dem Jungen zu, ob er nicht aufpassen könne. Er grinste breit, die Mädchen kicherten albern. »Sind eure Spatzenhirne auf Betriebstemperatur?«, fragte Photini und tippte sich an die Stirn. »Oder herrscht da oben Eiszeit?« Daraufhin lösten sich die Jungen aus der Gruppe und kamen auf Photini zu.
Sie stellte sich breitbeinig hin und stemmte die Kufen ihrer Schlittschuhe ins Eis. Eines der Mädchen rief: »Pass doch selber auf, dumme Pute!« Der Junge mit der Pudelmütze gab dem Mädchen einen Wink, still zu sein. Dann baute er sich vor Photini auf. Er war einen halben Kopf größer als Raupach, wirkte aber ungelenk und seltsam unproportioniert, wie das Teenager häufig tun.
»Was hast du eben gesagt?« Er versuchte, bedrohlich zu klingen. Seine Freunde nahmen neben ihm Aufstellung. Die übrigen Eisläufer machten einen Bogen um die Jungen.
»Bist du schwer von Begriff?«, fragte Photini. »Soll ich’s über die Lautsprecheranlage ausrufen lassen?«
»Du hast ’ne große Klappe.« Sein Atem roch nach Glühwein.
»Und dir gehört der Hintern versohlt. Ich würd’s ja gerne selber machen, aber dann kriegen sie mich wegen Kindesmissbrauchs dran.«
Das konnte der Junge nicht auf sich sitzen lassen, befürchtete Raupach. Photini überspannte den Bogen mal wieder. Jetzt legte sie sich schon mit Halbwüchsigen an.
Der Junge steckte den Mittelfinger in den Mund, lutschte genüsslich daran, zog ihn heraus und hielt ihn Photini vors Gesicht. »Fang lieber damit an.« Die beiden anderen lachten.
»Mach das nicht noch mal«, entgegnete Photini leise.
Raupach kannte den drohenden Unterton in ihrer Stimme. Wenn sie die Beherrschung verlor, würde es Verletzte geben, das Eis war hart. Er legte eine Hand auf ihre Schulter. »Komm weiter«, raunte er ihr zu. Er versuchte, sich möglichst vorsichtig zu bewegen, damit er nicht wieder ausrutschte.
»Was geht den alten Sack das an? Der soll sich verpissen!«
»Hast du einen Namen?«, fragte Raupach.
»Halt’s Maul!«
»Warum sagst du ihn mir nicht? Ich würde gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe.«
Normalerweise beruhigte seine feste Stimme die Menschen. Sie war nicht einschüchternd. Das half ihm, wenn er mit jemandem ins Gespräch kommen wollte.
»Mio«, sagte einer der anderen Jungen. »Er heißt Mio.«
Mio bedachte seinen Freund mit einem strafenden Blick. Photini schaute Raupach ungläubig an und wollte etwas sagen. Er nahm sie in den Arm.
»Dann hast du sicher nichts dagegen, Mio, wenn wir an diesem wunderbaren ersten Advent noch ein paar Runden drehen.« Raupach veränderte die Position eines Schlittschuhs, kam aus dem Gleichgewicht und fing sich dann wieder. »Ohne auszurutschen, verstehst du?« Er lächelte. »Wie kriegt ihr das eigentlich hin? Seid ihr jeden Tag hier?«
In Mio arbeitete es. Was hatte dieser Clown vor? Er zögerte, wusste nichts zu entgegnen. Hilfe suchend schaute er zu seinen Freunden.
Eines der Mädchen kam hinzu. Sie trug Ohrwärmer aus rosa Plüsch, ein kurzes Röckchen, wie Raupach verwundert registrierte, und eine Netzstrumpfhose. Ihre dick aufgetragene Schminke und die schwarz lackierten Fingernägel konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie noch ein Kind war.
»Die Frau ist hingefallen, Mio. Sie ist wütend. Das wärst du auch.« Das Mädchen nahm ihn an der Hand und zog ihn mit. »Lass uns was trinken.«
Mio setzte sich widerstebend in Bewegung. »Komm mir bloß nicht in die Quere«, sagte er zu Photini. Dann machte er eine wegwerfende Handbewegung und fuhr davon.
Raupach gab Photini einen Knuff. Sie knuffte zurück, sagte aber nichts. Ihr Gesichtsausdruck hätte den Rhein zum Gefrieren gebracht.
Als sich die Teenager entfernten, drehte sich das Mädchen noch einmal um. Raupach erwiderte ihren Blick. Er sah eine Mischung aus Triumph – und Angst.
Luzius stand an seinem Platz neben der Säule. Es war ein guter Platz. Er konnte die meisten Gäste schon von weitem sehen und die wichtigsten Faktoren mit einem einzigen Blick erfassen. Er registrierte: Zustand, Benehmen, Alter, Kleidung, Nutzen. In dieser Reihenfolge.
Zwei Mädchen. Zustand: leicht angetrunken. Benehmen: von oben herab. Alter: Anfang zwanzig. Kleidung: Designermode aus zweiter Hand. Nutzen für den Club: dekorativ.
Während er die Kordel aufhakte und die beiden durchließ, hatte er seine Entscheidung über die nächsten Gäste in der Reihe bereits getroffen. Er bezeichnete alle Menschen, die in den Bass Club wollten, als Gäste. Einige von ihnen waren unerwünscht, manche nur für einen Abend, andere auf längere Sicht. Aber sie waren und blieben Gäste.
Luzius hakte die Kordel wieder zu. Er kannte keine Vorurteile. Der Club stand jedermann offen. Am Wochenende kostete der Eintritt zehn Euro, unter der Woche sechs. Nestor saß hinter der Empfangstheke und kassierte das Geld. Daneben lag die Garderobe, um die sich Dina kümmerte. Es passierte selten, dass jemand bis zu Nestor vordrang und Ärger machte. Luzius sonderte die Gäste mit einer Zuverlässigkeit aus, für die er bekannt war. An ihm kam keiner vorbei, wenn er es nicht zuließ. Unter der Theke befanden sich: Pfefferspray, ein Elektroschocker, ein Baseballschläger und Schlimmeres. Es diente dazu, Nestor und Dina zu beruhigen. Luzius brauchte keine Waffen.
Die Sonntagsschlange war länger als gewöhnlich. Das lag am ersten Advent. Die Gäste spürten, dass sich das Jahr dem Ende zuneigte. Sie wollten nachholen, was sie verpasst hatten, suchten Anschluss, weil es draußen kälter wurde und ihr Alleinsein sie zunehmend bedrückte. So redete Nestor. Er hatte immer eine Erklärung parat, aus welchen Gründen die Gäste kamen oder fernblieben. Nestor war der Neffe von Mark Seedorf, dem Clubbesitzer. Er musste sich über so etwas Gedanken machen. Das Wie und Warum. Er traf die Entscheidungen. Welche Musik aufgelegt wurde, welche Live-Acts stattfanden, wann es eine Happy Hour gab. Dauernd dachte er darüber nach, in welcher Beziehung die Dinge und die Menschen zueinander standen.
Luzius konnte nichts damit anfangen. Er sah und urteilte. Das ging von selbst. Unnötig, es jemandem begreiflich zu machen. Es gab keine Anweisungen, nach denen er sich richtete. Mark hatte keine Regeln aufgestellt. Er vertraute seinem Türsteher, seinem Selector, wie es jetzt hieß. Wenn ein Clubbesitzer das nicht tat, war er bald aus dem Geschäft.
Zwei Pärchen. Luzius bedeutete einer der beiden Frauen, ihren halb gerauchten Joint wegzuwerfen. Sie hatten Schlagseite, alberten herum. Die Männer versuchten, Souveränität auszustrahlen. Mit Anfang vierzig waren sie zu alt für das Bass. Overdressed. Sie trugen Abendgarderobe, vielleicht kamen sie von einem Konzert. Ein eleganter Tupfer an der Bar, teure Drinks.
Er hakte die Kordel auf und deutete eine Verbeugung an. Das tat er immer. Jeder Gast hatte eine Verbeugung verdient. Manchmal wurde ihm ein Trinkgeld angeboten. Luzius nahm es nicht an. Trinkgeld verpflichtete.
Johan vermerkte jedes Detail. Er ging systematisch vor. Stundenlang konnte er sich in Körperstudien vertiefen. Nach und nach erkundete er Valeries glänzende Gesichtshaut bis zu den dunkelbraunen Haarwurzeln. Beobachtete, wie sich ihre Brust hob und senkte. Stellte fest, dass ihre Zehen einer Pediküre bedurften. Ihre Lider flatterten im Halbschlaf. Sie focht ihre Kämpfe noch einmal aus.
Plötzlich öffnete sich die Tür. Sheila betrat das Wohnzimmer. Wendungen innerhalb einer Szene schätzte Johan besonders. Das brachte Leben in die Sache.
Das Mädchen erstarrte und ließ ihre Schlittschuhe fallen. Sie klaubte die Glassplitter von Valeries Haut, richtete ihren Körper auf und zerrte sie auf die Couch. Dabei kam Valerie zu sich. Sheila lief in die Küche, kehrte kurz darauf mit einem Glas Wasser zurück und führte es an Valeries Lippen.
Die Konturen des Bildes gerieten in Bewegung und begannen sich aufzulösen. Johan konnte den Anblick eines Kindes, das sich über seine betrunkene Mutter beugte, nicht ertragen. Er nahm das Auge von der Linse. Wie konnte er dem Mädchen helfen? Manchmal kam ihm diese Frage in den Sinn. Dann wies er sie sofort von sich. Er durfte sich nicht einmischen. Die Menschen waren für sich selbst verantwortlich. Niemand von ihnen nahm auch nur den geringsten Anteil. Sie sahen einfach zu, wenn es die Schwachen erwischte. Er hatte es erlebt.
Nicht mehr lange, und sie würden in Flammen stehen.
Johan zog den Vorhang zu. Er räumte die Kekse weg und stellte die Milch in den Kühlschrank. Dann putzte er seine Zähne, ging auf die Toilette und schlüpfte in seinen Pyjama. Er legte sich auf seine Seite des Bettes und löschte das Licht. Zeit zu schlafen.
Der gestrige Samstag war schwierig gewesen. Viele Gäste, aufgedreht und fest entschlossen, sich zu vergnügen. Das Jahr war schlecht für sie gelaufen, sagte Nestor. Ihre Ersparnisse hatten sich endgültig in Luft aufgelöst. Die meisten hielten sich mit Mühe und Not über Wasser. Selbst die Studenten waren wieder gezwungen, schlecht bezahlten Aushilfsjobs nachzugehen. Natürlich gab das niemand zu, sagte Nestor. Im nächsten Jahr würde alles besser werden, hofften sie, und bis dahin taten sie wenigstens so, als ginge es aufwärts. In einer solchen Situation wollten sie sich von einem Türsteher nicht sagen lassen, dass sie ein anderes Mal wiederkommen sollten. Das wäre wie der letzte Tritt, der sie in den Rinnstein beförderte.
Luzius hatte des Öfteren Hand anlegen müssen. Es war ihm nicht unangenehmer, als welkes Laub von seinem Balkon zu entfernen. Es wehte von der Linde herein, die direkt vor seiner Wohnung stand. Vor einigen Stunden hatte er die letzten Blätter zusammengekehrt. Seine Balkonpflanzen standen längst an einem Ort, wo sie vor dem Frost geschützt waren. Er hatte den Oleander zurückgeschnitten. Das tat ihm jedes Mal ein bisschen weh. Die Pflanzen hatten das ganze Jahr darauf verwandt, Zweige und Blätter herauszubilden. Aber sie würden neue Triebe ansetzen und umso stärker blühen, wenn er sie stutzte.
Ein Junge mit einer Pudelmütze. Seit ein paar Wochen kam er an jedem Wochenende ins Bass. Inzwischen hielt er sich für einen Stammgast.
Mit Stammgästen war das so eine Sache. Manche ließ Luzius nach zwei, drei Besuchen kommentarlos ein. Andere brauchten Jahre, um seine Billigung zu erlangen.
Der Junge tat so, als sei er ein guter Bekannter. Er klopfte Luzius auf die Schulter und fing ein Gespräch an. Das sollte seine beiden Freunde beeindrucken. Sie traten von einem Bein aufs andere und warfen neugierige Blicke auf den Vorhang, hinter dem Nestor auf Einnahmen wartete. Der Kleinere war besonders zappelig. Luzius sah es aus dem Winkel seines gesunden Auges. Kein Grund, den Kopf zu drehen.
Er wog ab. Die drei waren betrunken, hatten schon eine Pille oder so etwas genommen, viel zu früh, anscheinend hatten sie die Wartezeit in der Schlange falsch eingeschätzt. Noch führten sie sich anständig auf. Von dem Jungen mit der Pudelmütze wusste Luzius, dass er über sechzehn war. Von den anderen wollte er jetzt die Ausweise sehen.
Sie protestierten. Das war unklug. Luzius blieb freundlich. Er wies sie mit einer Äußerung des Bedauerns ab. Dann wandte er sich dem Jungen mit der Pudelmütze zu. Er dürfe zwar allein hinein, aber mit Rücksicht auf seine Freunde sollte er es lieber woanders probieren.
»Ich lasse mich nicht wie ein Kind behandeln«, sagte der Kleine, worauf ihn der Ältere zur Seite nahm. Sie gingen ein paar Schritte weg und berieten sich leise.
Luzius ließ zwei Männer Anfang dreißig ein, Köche vom Il Mulino, dem italienischen Restaurant gegenüber. Sie hatten ihren Dienst beendet und würden im Bass so lange tanzen und trinken, bis es schloss. Sie waren Nachbarn. Manchmal schickten sie einen Lehrling mit einer Leckerei aus der Küche vorbei, wenn im Club noch nichts los war. Luzius verbeugte sich und sagte ihnen, dass Mattes und Thierry schon unten seien. Den aktuellen Stand diverser Liebschaften zu kennen, gehörte zu seiner Arbeit. Die Köche bedankten sich lachend und verschwanden hinter dem Vorhang.
Bevor er sich mit den nächsten Gästen befassen konnte, trat der ältere Junge an ihn heran. Er wollte jetzt doch allein hineingehen. Seine beiden Freunde waren noch in der Nähe. Sie standen unter einer Straßenlaterne und rauchten.
Luzius zuckte mit den Schultern und ließ ihn mit einer leichten Verbeugung passieren. Er hatte kein gutes Gefühl dabei, aber er hatte auch keinen Grund, es dem Jungen zu verbieten.
Die Schlange wurde nicht kürzer. Luzius nahm einen Schluck Kaffee aus einem Thermobecher und stellte ihn zurück hinter einen Pfeiler neben dem Eingang. Er bat weitere Gäste herein. Unterdessen beobachtete er die beiden Jungen unter der Laterne. Sie warteten auf etwas, das war nicht zu übersehen.
Dann kam der Ältere zurück. »Ich hab mit Nestor gesprochen«, sagte er herablassend. »Meine Freunde dürfen auch rein.« Er winkte sie heran. Sie setzten sich in Bewegung.
»Moment.« Luzius hob die Hand. »Ohne gültigen Ausweis –«
»Frag doch deinen Chef, wenn du mir nicht glaubst.«
Luzius benutzte sein Walkie-Talkie, um seinen Posten nicht zu verlassen. »Wir machen eine Ausnahme«, teilte ihm Nestor auf seine Frage mit. »Heute gibt es bestimmt keine Kontrollen, Sonntagabend, da haben die Bullen was anderes zu tun. Wie sind die Kids drauf?«
»Passabel«, antwortete Luzius wahrheitsgemäß.
»Dann lass sie durch. Das sind die Gäste von morgen.«
Er wusste nicht, was er erwidern sollte. Nestor setzte sich so gut wie nie über seine Entscheidungen hinweg. Vielleicht kannte er diesen Jungen persönlich.
»Was ist? Hast du nicht gehört?«
Luzius legte dem Jungen eine Hand auf die Schulter. Er drückte zu. »Um zwölf seid ihr verschwunden. Sonst komm ich runter und hol euch.«
»Klar, alles klar«, stotterte der Junge, der unter Luzius’ Hand eingeknickt war.
Luzius gab den Weg frei. Keine Verbeugung. Die Jungs drückten sich vorbei.
Er nahm seine Position wieder ein. Wenn sich herumsprach, dass er am Einlass nicht das letzte Wort hatte, würden es bald alle möglichen Leute auf diese Weise versuchen. Er musste das Nestor klarmachen. Der Bass Club hatte einen Ruf zu verlieren. Mark würde das ganz und gar nicht gefallen.
Er spürte das Wummern der Musik. Der Club war nahezu schalldicht. Trotzdem drangen die Bässe durch Wände und Decken herauf. Das Kribbeln in seinen Fußsohlen gefiel ihm. Die rhythmischen Vibrationen gaben ihm das Gefühl, ein Teil von alledem hier zu sein, obwohl er draußen in der Kälte stand. Unten vergnügten sich die Menschen. Sie tanzten, lachten, feierten. Luzius sorgte dafür, dass sie dabei nicht gestört wurden. Die Gäste verließen sich auf ihn. Das war wichtig. Manche von ihnen wussten es durchaus zu schätzen. Die beiden Köche zum Beispiel. Selbst wenn sie sturzbetrunken waren, hatten sie noch ein respektvolles Nicken für ihn. Er hielt Wache, damit sie das Leben genießen konnten.
Unten legten sie ein schnelleres Stück auf. Bestimmt strömten die Gäste jetzt auf die Tanzfläche. Er sah sie vor sich. Sie vergaßen alles, gaben sich der Musik hin. So sollte es sein.
Als er sich zur Arbeit aufgemacht hatte, waren aus der Wohnung über ihm ähnliche Geräusche gedrungen. Der dritte Stock. Da oben war es fast ein ganzes Jahr still gewesen. Und davor … Musik hatte er jedenfalls selten gehört, obwohl Jef in einer Band gespielt hatte. Einmal war Luzius nach oben gegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Jef hatte ihm mit der Polizei gedroht. Das hatte gewirkt. Luzius war wieder in seine Wohnung gegangen. Am nächsten Tag hatte er die Frau an der Haustür abgepasst. Sie hieß Valerie, er hatte seine Frage wiederholt. Ob alles in Ordnung sei. Sie hatte ihn verständnislos angeschaut – und ihn dann stehen gelassen.
Vielleicht, hatte er gedacht, war er zu weit gegangen. Er konnte nicht davon ausgehen, dass Valerie seine Qualitäten zu würdigen verstand und ihm, einem Fremden, Vertrauen schenkte. In dem Haus wusste niemand, dass er die Dinge gern ins Reine brachte.
Der Mann war inzwischen gestorben. Ein Unfall. Luzius hatte es mit Erleichterung zur Kenntnis genommen.
Ein Ellenbogen landete mit voller Wucht an seiner Schläfe. Er ging zu Boden.
»Was ist los mit dir? Hinterher!«
Nestor stand neben ihm und versuchte ihn, auf die Beine zu zerren. »Die beiden haben die Kasse geklaut!«
Luzius brauchte ein paar Sekunden, um den Kopf klar zu bekommen. Dann erfasste er die Situation. Die Jungen, die ihre Ausweise nicht vorzeigen wollten. Er nahm die Verfolgung auf.
Sie waren noch nicht weit gekommen. Luzius sah, wie sie etwa fünfzig Meter vor ihm in eine Querstraße einbogen. Er war schnell, wenn er einmal in Fahrt kam und die Wut in ihm hochstieg wie Säure. Seine langen Beine flogen über den Asphalt. Die schwarzen Sneakers, die er auf der Arbeit immer trug, krallten sich in den Straßenbelag. Im Rennen war er gut. Das hatte ihn schon früher ausgezeichnet, als er noch jünger gewesen war als die beiden da vor ihm und sein alter Herr ihm mit einem Spazierstock Beine gemacht hatte.
Er benutzte die parkenden Autos so gut es ging als Deckung. Als er um die Ecke bog, verschwanden die Jungs gerade in einer Seitengasse. Er blieb an ihnen dran, machte kaum ein Geräusch. Sich lautlos zu bewegen, hatte ihn schon als Kind der Wahrheit näher gebracht.
Kurz darauf sah er sie wieder vor sich. Sie waren vor einem Schaufenster stehen geblieben. Die beiden hatten wohl nicht damit gerechnet, dass er ihnen gefolgt war. Es musste mehr passieren als ein Stoß mit dem Ellenbogen, um ihn zu stoppen.
Sie hatten Fahrräder. Auf die schwangen sie sich jetzt. Wahrscheinlich gehörte das zu ihrem Fluchtplan. Luzius beschleunigte und holte das Letzte aus sich heraus. Seine Arme pumpten wie die Kolben eines Dieselmotors.
Jetzt bemerkten sie, dass er hinter ihnen war. Sie traten wie verrückt in die Pedale. Derjenige, der die Geldkassette auf den Gepäckträger geschnallt hatte, kam langsamer in Tritt. Luzius fixierte den Hinterreifen und sprang.
Zu kurz. Er griff daneben und landete auf der Straße. Der Junge stieß einen höhnischen Schrei aus, schaltete einen Gang höher und raste davon. Luzius konnte ihm nur hinterhersehen.
Langsam richtete er sich auf und rieb sich die Schulter. Er hatte versagt. Die beiden waren verschwunden. Er dachte an den älteren Jungen, der die Diebe eingeschleust hatte. Vielleicht war aus ihm etwas herauszubekommen. Die drei schienen unter einer Decke zu stecken.
Und wenn der dritte Junge auch getürmt war?
Luzius hätte sie kriegen müssen. Er kam sich schrecklich nutzlos vor. Die Höhle, in der sein Glasauge saß, schmerzte. Mit den Handflächen wischte er Jacke und Hose sauber. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als unverrichteter Dinge zurück zum Bass Club zu gehen.
Dann bemerkte er den Lieferwagen.
Er stand auf dem Parkplatz eines Bürogebäudes, etwas abseits von der schlecht beleuchteten Seitengasse. Der Laderaum besaß keine Scheiben. Dumpfe Geräusche drangen aus dem Inneren. Ein klatschender Laut war zu hören, dann nichts mehr.
Luzius trat näher. Er horchte.
Jemand wiederholte immer wieder denselben Satz. Es waren drei oder vier Worte, die durch die Blechwand nicht zu verstehen waren. Es klang, als flehte jemand um Hilfe. Die Stimme war hell und hoch. Sie schien von einem Kind zu stammen.
Plötzlich ertönte ein rauer Schrei. Schmerz, vermutete Luzius, gepaart mit Wut.
Die Tür wurde einen Spaltbreit geöffnet. Eine Hand versuchte, die Tür aufzustoßen. Dann verschwand sie wieder im Inneren. Die Tür schlug zu.
Die Hand hatte einem Mädchen gehört. Die Fingernägel waren lackiert. Jetzt schwankte der Wagen. Ein Rumpeln, wie wenn ein Körper hinschlug.
Luzius streifte Latexhandschuhe über. Er trug sie für alle Fälle immer bei sich, damit er sich nicht mit wer weiß was ansteckte, wenn er jemandem eine offene Verletzung zufügte. Dann riss er die Tür auf.
Das Mädchen kauerte neben einem Radkasten und hielt die Hände vors Gesicht. Ihr nackter Rücken war mit roten Flecken bedeckt.
Neben ihr stand ein Mann. Er starrte Luzius einen Moment lang fassungslos an. Außer einem weißen Trägerhemd, das sich über seinen muskulösen Oberkörper spannte, war auch er nackt. Auf dem Boden lag eine Matratze, im Hintergrund waren eine große Lautsprecheranlage und die Trommeln eines Schlagzeugs zu erkennen.