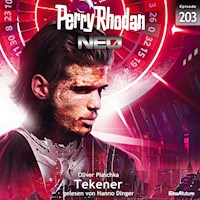12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vornehme Geschäftsleute in einer nachtschwarzen Limousine, ein Schmugglerpärchen mit einem Laster voller gestohlenem Whiskey, ein jugendlicher Waisenjunge aus dem Wilden Westen – sie alle geraten im Hinterland der kalifornischen Küste in einen Sturm, der sie verschlingt. Aber jenseits dieses Orts tut sich ihnen eine fantastische Welt auf. Keiner der im Sturm Verschollenen ahnt: Sie alle sind Spielball des genialen und exzentrischen Erfinders Ross, der vor zwölf Jahren mit seiner kleinen Tochter in derselben Gegend verschwand. Dort, in der malerischen Wildnis von Big Sur, hat er mithilfe magischer Kräfte die »Welt unter dem Winde« geschaffen, über die er gleich einem König gebietet. Die Gestrandeten geraten in ein Netz aus Intrigen, Erinnerungen und Schuld, fast ohne jede Chance zu entkommen. Eine moderne Fantasygeschichte in der Tradition Neil Gaimans, die Motive aus William Shakespeares »Der Sturm« neu aufleben lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Oliver Plaschka
Der Wächter der Winde
Roman
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
© 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Karte: Thilo Corzilius
Cover: © Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung einer Abbildung von © Max Meinzold, München
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96243-7
E-Book: ISBN 978-3-608-19162-2
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
PROLOG
Der Sturm
ERSTER TAG
Welt unter dem Winde
ZWEITER TAG
Der Turm der gescheiterten Träume
DRITTER TAG
Die Krone des Wächters
EPILOG
Ein Jahr später
Dank
Karte
Meinem Sturm –Jonas, Jeff, Eric, Paul,Janina, Elisabeth, Felix, Josie, Thomas, Sinem, Katrin, Judith und Laura
PROLOG
Der Sturm
Eine Weile hört sie nichts als das Lied des Windes auf den Klippen und das Tosen der Brandung, die sich in der Tiefe an den Felsen bricht.
Ich will es sehen, sagt Mira. Zeig es mir. Zeig mir alles!
Sie spürt ihren Herzschlag und ein Rauschen erfüllt ihre Ohren, dann gehorcht der Geist …
Toni Zwölf Jahre nach dem ersten Sturm
Die Vergangenheit holte sie auf dem Rückweg von Bella Kings Beerdigung ein, und sie bediente sich dabei eines Tricks. Die Bühne dafür wurde am Himmel über dem Highway bereitet.
Der Sturm hatte sich schon seit ihrem Aufbruch in Monterey zusammengebraut. Nicht draußen über dem Pazifik, sondern heimlich über den Bergen, sodass ihr noch für trügerisch lange Zeit ein hoffnungsvoller Riss am Horizont die Position der Nachmittagssonne verriet, während sie gedankenversunken aus dem Beifahrerfenster aufs Meer sah. Als dieser Spalt sich schließlich schloss und die schrägen Sonnenstrahlen den Wettlauf gegen die zu frühe Dunkelheit verloren, lagen die letzten Häuser der Carmel Highlands schon fast eine halbe Stunde hinter ihnen, und sie und Francis waren allein mit dem Sturm auf dem Highway, allein zwischen Ozean und Fels und Erinnerung.
Antonia Perrault – Toni für ihre Freunde, von denen sie nicht mehr viele besaß – hatte ein feines Gespür dafür, wenn jemand sie übervorteilen wollte. Nicht, weil sie eine besonders angreifbare Frau gewesen wäre, sondern weil es für sie immer noch mehr zu verlieren gab als für andere; trotz allem, was man ihr genommen hatte. Sie hätte der Sonne nicht trauen sollen. Vielleicht hätte sie Bella nicht trauen sollen, dass sie ausgerechnet in dieser Gegend gestorben war – hatte Bella King gewusst, was Toni mit Carmel und Big Sur verband? Wahrscheinlich.
Die Elemente klafften auf, der Boden schien unter ihnen wegzusinken, und sie brauchte einige Sekunden, bis sie das graue Gitterwerk vor ihnen als die strengen Kranichbeine der Bixby Creek Bridge erkannte. Dann flogen sie auch schon im Takt der Scheibenwischer durch das Nichts, eingerahmt vom raschen Zinnenmuster der Brüstung.
Die über siebenhundert Fuß lange Art-déco-Bogenbrücke war die größte in einer eindrucksvollen Reihe von Brücken, die in den frühen Dreißigerjahren die California State Route 1 vervollständigt hatten. Das hieß auch, dass sie zuvor bereits die Rocky Creek Bridge überquert haben mussten, ohne dass es Toni wahrgenommen hatte.
Kaum, dass der wetterfleckige Stahlbeton hinter ihnen zurückblieb, senkten sich die Wolken über sie wie ein Kerzenlöscher und tauchten den Wagen in Dunkelheit. Die Lichter des Armaturenbretts spiegelten sich auf Francis’ Brille, während ihr alter Assistent den geliehenen Nissan mit angespannter Miene durch den prasselnden Regen steuerte.
Sie dachte an jenen anderen Sturm vor zwölf Jahren, als ihre kleine Tochter dieselben finsteren Bergrücken erblickt hatte. Ob sich die Regenfront seitdem in den Tälern des Santa-Lucia-Gebirges versteckt und auf sie gewartet hatte? Hier in Big Sur schien die Zeit anderen Gesetzen zu gehorchen. Zu Beginn des Jahrhunderts war die wilde Westküste Kaliforniens eins der unzugänglichsten Gebiete des Landes gewesen, und noch heute war es für viele ein mystischer Ort: Wanderer, Naturfreunde, Hippies. Sie kamen hierher, um der schroffen Natur nachzuspüren, oder ihren Träumen, oder sich selbst …
Sie schüttelte den Gedanken ab. Sagte sich, dass ein plötzlicher Sturm sogar hier, an einem Tag wie heute, nichts zu bedeuten habe. Sie lehnte sich zurück und sammelte sich. Ihr war klar, dass das Gefühl der Bedrohung bloß ihrer Einbildung entsprang. Zu keinem Zeitpunkt hielt sie den Sturm für eine reale Gefahr für Leib und Leben.
Das änderte sich erst, als wenige Minuten später die Windschutzscheibe des Leihwagens mit lautem Knall barst und ein wildes Spinnwebmuster ihnen von einem Moment auf den anderen die Sicht nahm.
»Francis!«, schalt sie, als wäre der plötzliche Verlust ihrer Sicht einem Fahrfehler geschuldet.
Mit einer für sein Alter beachtlichen Reaktionsschnelle brachte Francis den Wagen am Straßenrand zum Stehen.
Seinem starr nach vorn in die milchige Leere gerichteten Blick und den um das Lenkrad verkrampften Händen sah sie das Entsetzen an. Seine Schultern hoben und senkten sich schwer, als er Atem schöpfte, und sein Schnauzbart zitterte wie ein lebendiges Wesen. Toni schauderte.
»Das war knapp«, sagte er, und wiederholte seine Worte, wie immer, wenn er nervös war. »Richtig knapp.«
»Was war das?«, fragte sie.
Statt einer Antwort schaltete er den Motor aus.
Draußen vor dem Nissan heulte der Wind, und Regen trommelte in Böen auf das Dach, so stur wie eine Fliege, die gegen eine Fensterscheibe drängt.
»Ich sehe nach«, erklärte er und stemmte die Tür auf. Sofort drang die nasse Meeresbrise ins Wageninnere. Selbst für Ende November war es kalt, und Toni bereute ihre Entscheidung, sich nach der Beerdigung nicht umzuziehen. Sie zog ihren Mantel enger um sich und warf einen prüfenden Blick auf ihr Handy. Kein Empfang, wie üblich in dieser Gegend, die auf ihre Art noch immer so abgeschnitten vom Rest der Welt war wie früher. Toni fluchte. Natürlich hatten sie einen Unfall, kaum, dass sie in das erste Funkloch geraten waren …
Kurz darauf öffnete sich die Tür abermals und Francis ließ sich erschöpft zurück in den Fahrersitz fallen. Sein schütteres Haar klebte ihm nass an den Schläfen, und sein Bart troff wie bei einem verschnupften Walross. Gott, sie hasste diesen Bart. Der Geruch von Salz und Erde und Asphalt breitete sich aus.
»Und?«, fragte sie. »War es ein Steinschlag?«
»Ich glaube, es war ein Flügel«, sagte er.
»Ein Flügel?«
»Windpumpenflügel. Etwa so groß. So.« Er hielt die Hände ein gutes Stück auseinander. »Sah alt aus. Antik. Aermotor Windmill Company. Normalerweise sehr solide.«
Sie lachte. »Soll das ein Scherz sein, Francis?«
»Kein Scherz«, verteidigte er sich. »Kein Scherz. Er lag dort hinten auf der Straße. Ich habe ihn weggeräumt.«
Sie schwiegen. Ihre Gedanken aber rasten, wirbelten wie die Flügel jener Pumpe, die Flügel einer Mühle – eines Windrades. Was immer diese unglückliche Verkettung von Umständen ausgelöst hatte, allmählich wurde es persönlich.
Francis fingerte nach seinem Mobiltelefon.
»Nichts«, stellte er fest und wischte sich den Bart. »Kein Empfang.«
»Ich weiß.«
»Vielleicht hinter der nächsten Kurve …?«, schlug er vor.
»Sie erwarten, dass wir durch den Regen laufen und unsere Handys in den Wind halten?«
»Wir brauchen einen Abschleppwagen«, beharrte er. »Die nächste Ortschaft ist zehn Meilen von hier.«
»Sie meinen Big Sur Village.« Wie die meisten Siedlungen der Gegend bestand das Dorf aus wenig mehr als ein, zwei Tankstellen, überteuerten Restaurants und selbsterklärten Kunstgalerien. Manchmal alles unter einem Dach.
»Wir finden sicher schon früher ein Haus. Irgendwo wird man uns telefonieren lassen. Und das Ende des Sturms abwarten.«
»Ich gehe da nicht raus.« Sie deutete auf ihre leichte Trauerkleidung. »Nicht so.«
Er biss die Zähne zusammen, nickte. »Dann allein. Ich gehe allein.«
»Machen Sie sich nicht lächerlich! Ich habe keine Lust, hier herumzusitzen, während Sie sich dort draußen den Tod holen.«
»Was schlagen Sie vor?«, fragte er mit seltener Direktheit. Ausgerechnet Francis, immer ängstlich, stets bemüht, Probleme von ihr fernzuhalten, fragte sie rundheraus, ob sie eine bessere Idee hätte. Beachtlich.
»Wir warten. Früher oder später wird jemand vorbeikommen. Schalten Sie den Warnblinker ein.«
Er gehorchte, nicht ohne einen leisen Seufzer der Erleichterung auszustoßen. Sie bezweifelte nicht, dass er sein Angebot ernst gemeint hatte – aber mehrere Meilen zu Fuß durch den Sturm zu laufen, hätte dem alten Mann mehr abverlangt, als er zugab.
»Ich stelle lieber das Warndreieck auf.« Er schwang sich ein weiteres Mal aus dem Wagen.
Wirklich merkwürdig, dachte sie, während er den Kofferraum des Nissans öffnete und ihr eine nasskalte Böe in den Nacken fuhr. Der Highway lag wie ausgestorben. Normalerweise hätte längst jemand halten müssen. Reisende, Anwohner. Die Gegend war zwar nur schwach besiedelt, aber der Highway 1 verband Nord- mit Südkalifornien und war eine der beliebtesten Strecken des Landes. Viele Touristen fuhren die legendäre Route zwischen San Francisco und Los Angeles allein der Aussicht wegen, und normalerweise verging keine Minute, ohne dass ein Mustang oder eine Harley vorbeirauschte.
Normalerweise kam so viel Regen aber auch nur in einem ganzen Jahr herunter.
Die schiere Zahl an Problemen und Unannehmlichkeiten, die der Besuch von Bella Kings Beerdigung inzwischen verursacht hatte, imponierte ihr fast. Freilich war es Tonis eigene Entscheidung gewesen, für den Heimweg nach Santa Clarita nicht das Flugzeug zu nehmen, sondern einen Mietwagen – um endlich wieder jenen Ort aufzusuchen, um den sie fast zwölf Jahre einen weiten Bogen geschlagen hatte, ungeachtet ihrer wechselnden Therapeuten und der Polizei, die ihr rieten, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Und das hatte sie nun davon.
Dies war der Ort, an dem sie Mira verloren hatte. Und auch damals, vor zwölf Jahren, hatte es ein schweres Unwetter gegeben. Ist es hier passiert?, fragte sie sich. An dieser Stelle? Man konnte fast nichts von der Welt dort draußen erkennen …
Sie sah einen Schatten neben der Fahrertür: Francis kam zurück. Es regnete Bindfäden, und sie fragte sich, weshalb er nicht einstieg.
Da tauchten hinter ihnen ein paar Scheinwerfer aus dem Halbdunkel auf. Die Lichtkegel teilten den strömenden Vorhang, und ohne nachzudenken, öffnete Toni die Tür und stieg aus. Augenblicklich wehte ihr der Sturm seinen nassen Atem ins Gesicht, und ihr Haar trank den Regen wie eine durstige Wüstenpflanze. Sie fühlte alle Wärme aus ihren wedelnden Armen weichen, aber sie wollte verdammt sein, wenn dieser Wagen vorbeifuhr und sie noch länger hier mit Francis festsaß.
Die Lichter wurden heller und heller, und eine Schrecksekunde lang fürchtete sie, dass der Fahrer ihr Warndreieck in dieser Waschküche übersehen hatte und sie beide von der Straße fegen würde. Die Lichter strahlten sie an wie einen Bühnenstar. Dann hörte sie den Motor zu einem Flüstern verebben und die Reifen auf der nassen Fahrbahn leise knirschen, als der Wagen zum Stehen kam.
Francis’ Gesicht verriet, dass er genauso erschrocken war wie sie. Geblendet kniff er die Augen zusammen und legte ungläubig den Kopf schief.
Es war ein langer, nachtschwarzer Lincoln.
Sie sahen ihn an diesem Tag nicht zum ersten Mal.
Ein paar lange Sekunden starrten sie den Lincoln an. Der Motor schnurrte leise vor sich hin, aber die Türen blieben geschlossen. Die Scheibenwischer schoben gleichmäßig den Regen beiseite, doch sie konnten den Fahrer im Gegenlicht nicht erkennen.
Das war aber auch nicht nötig. Sie wussten, wem dieser Wagen gehörte.
Die Lichthupe sandte einen kurzen Gruß.
»Holen Sie das Gepäck!«, befahl sie Francis, nahm ihre Handtasche vom Beifahrersitz und lief los.
Das hintere Fenster des Lincolns senkte sich einen Spaltbreit.
»Nur zu!«
Toni öffnete die Tür und ließ sich in den rückwärts gewandten der beiden freien Sitze sinken, während Francis die Koffer im Gepäckraum verstaute. Dann nahm er ungeschickt auf dem Sitz ihr gegenüber Platz.
»Schließen Sie die Tür.«
Pflichtschuldig gehorchte Francis. Der Sturm blieb hinter den getönten Scheiben zurück, und der Lincoln nahm Fahrt auf.
Toni wischte sich fröstelnd die Nässe aus der Stirn, aus der Kleidung, und war sich bewusst, dass der Ledersitz, den sie gerade ruinierte, wahrscheinlich so teuer wie ihr ganzer Leihwagen war.
Ihr Gastgeber musste ihre Gedanken erraten haben.
»Mach dir keine Sorgen, Toni.«
Unwillkürlich nahm sie Haltung an. »Es ist sehr freundlich, dass du uns mitnimmst.«
Alexander King schenkte ihr ein knappes Lächeln. »Das ist doch selbstverständlich – bei einem solchen Wetter.«
Er griff in die kleine Bar neben seinem Sitz und reichte ihr eine weiche Stoffserviette, die mit seinen Initialen bestickt war. Sie duftete, so wie alles im Wagen: ein Duft nach Trauer – vermutlich hatte sie ihn schon auf der Beerdigung wahrgenommen – und nach Macht.
»Dennoch – unter diesen Umständen.« Sie trocknete sich das Haar und nickte dem jungen Mann im Sitz neben sich befangen zu. Dann reichte sie die Serviette an Francis weiter. »An diesem Tag …«
Alexander King hob abwehrend die Hand. Schwere Ringe glitzerten an seinen schwarzen Fingern. »Entschuldigst du dich gerade für den Tod meiner Tochter, Toni?«
Sie verkniff sich eine Antwort. Wenn Alex den großen Gönner spielen wollte, sollte er nur. Er würde ihr die Rechnung noch früh genug präsentieren – das hatte er bislang immer getan.
»Mein Sohn und ich haben uns gerade darüber unterhalten, wie schwierig es ist, jemandem die Schuld am Tod eines anderen Menschen zu geben. Nicht wahr, Bastian?«
Der Junge zu ihrer Seite erwiderte nichts. Wenn sie ihn ansah, erkannte sie immer noch das kleine Kind von früher in ihm. Heute war er fast so groß wie Alexander, doch neben der imposanten, fleischigen Gestalt seines Vaters wirkte Bastian King fast unscheinbar. Nur hinter seinen Augen sah Toni das gleiche Feuer, die gleiche Wut wie heute Mittag. Sie hatte sich schon auf der Beerdigung gefragt, auf wen genau diese Wut zielte.
»Dich und mich verbindet eine ganze Menge«, fuhr Alexander King sinnend fort. »Aber es gibt nichts, was dir peinlich sein müsste. Ich habe dich eingeladen, meine Trauer um Bella zu teilen. Du hast mir die Höflichkeit erwiesen, meine Einladung anzunehmen. Nun bist du in eine Notlage geraten, und ich erweise dir die Höflichkeit, dir auszuhelfen. Das ist alles.«
»Ich stehe in deiner Schuld, Alex.«
Sein Lächeln wurde einen Hauch breiter.
»Wie kam es zu dem Unfall?«, erkundigte er sich.
»Unsere Windschutzscheibe«, erklärte Francis und warf Toni einen unsicheren Blick zu. »Zertrümmert … von einem Stück Holz. Einem Holzstück.«
»Es ist ein heftiger Sturm«, sagte Alexander King und gab nicht zu erkennen, ob er die Nervosität des älteren Mannes bemerkt hatte.
Francis räusperte sich. »Es war unser Glück, dass Sie vorbeikamen, Mr. King. Unser großes Glück. Hätten Sie einfach das Flugzeug genommen …«
»Mein Vater hat Flugangst«, sagte Bastian scharf. »Er verliert niemals die Bodenhaftung. Genau wie der Riese aus der griechischen Sage: Solange seine Beine die Erde berühren, ist er stark. Ist es nicht so, Vater?«
Was für einen Konflikt Vater und Sohn auch miteinander austrugen, durch Bellas Beerdigung war er offenbar nicht beigelegt worden.
Alexander King ging auf die Provokation nicht weiter ein. »Du erzählst Francis nichts Neues. Er kennt mich und meine Gewohnheiten sehr gut, selbst wenn er es zu verschleiern versucht.«
Betreten wandte Francis den Blick ab. Es war dieselbe Art von Verlegenheit wie damals, als Toni ihn wegen seiner Fehltritte zur Rede gestellt hatte. Er wusste, wie leicht er zu überführen war, und er hasste sich dafür.
Eine Weile breitete sich ungemütliches Schweigen im schaukelnden Wagen aus. Der Sturm warf ihnen den Regen wie aus Waschzubern entgegen.
»Bei der nächsten Ortschaft kannst du uns rauslassen«, sagte Toni nach einer Weile.
»Das ist nicht die rechte Zeit für Bescheidenheit«, widersprach Alexander King. »Swaine kann dich bis vor deine Haustür fahren. Ich habe keine Termine mehr heute.«
»Wir müssen den Wagen abschleppen lassen.« Auf gar keinen Fall würde sie diese Gesellschaft die nächsten vier Stunden bis nach Santa Clarita ertragen …
»Ich bitte dich.« Alexander King blinzelte langsam, als hätte die Durchschaubarkeit ihrer Lügen eine einschläfernde Wirkung auf ihn. Offenbar wollte er es aus ihrem Mund hören.
»Ich habe nicht nur einen Wagen in dieser Gegend verloren, Alex. Sondern auch etwas anders.«
»Etwas?« Er hob eine Braue. Francis betrachtete angestrengt seine Hände.
»Ich muss mich für meinen Vater entschuldigen«, mischte sich Bastian ein. »Er glaubt, nur weil er trockenen Fußes durch ein Tränenmeer waten kann, müssten andere Menschen die gleiche Gabe besitzen. Gefühle perlen an ihm ab wie Regen an Autolack. Ein emotionaler Lotuseffekt.«
Alexander King lachte leise. »Mein Sohn hat viele poetische Vergleiche auf Lager, seit er vom College zurück ist. Und wie jeder gute Poet stört er sich daran, dass in L.A. die Arbeit auf uns wartet.«
Bastian funkelte ihn an, sagte jedoch nichts weiter.
»Natürlich weiß ich, was dich beschäftigt«, fuhr Alexander King fort. »Ich habe dich immer respektiert, Toni. Auch zu der Zeit, als wir Rivalen waren. Und schau nur, was aus uns geworden ist!«
Er meint: als er uns vom Markt drängen wollte, dachte sie, sprach es aber nicht aus. Bis Ross mir keine andere Wahl ließ, als ihm Kite Enterprises auf einem Silbertablett zu servieren, und mit Mira …
»King Industries war uns stets überlegen«, sagte sie. »Und das meine ich als Kompliment.«
Der Wagen machte einen Satz und schien eine Sekunde lang durch die Luft zu fliegen. Dann hatten die Reifen wieder Haftung und das Fahrzeug blieb in der Spur.
»Was war das?«, entfuhr es Francis.
Alexander King betätigte eine Taste neben seinem Sitz, und die dunkle Glasscheibe in Tonis Nacken, die ihren Bereich der Kabine vom Cockpit trennte, senkte sich. Sie drehte den Kopf und sah die Fahrerin: ein junges Mädchen mit auffallend heller Haut und blonden Locken in weißer Uniform, inklusive einer Chauffeursmütze; ein Christbaumengel, der sich zur Marine verirrt hatte. Alexander King hatte immer schon einen exzentrischen Geschmack besessen, was seine Bediensteten anging.
»Swaine?«, fragte er. Er hat noch immer diese Gabe: den Namen eines Menschen wie eine Herausforderung klingen zu lassen, dachte Toni.
»Nur eine Böe auf der Brücke. Es tut mir sehr leid, Sir.«
»Welche Brücke?«, fragte Toni verwirrt.
»Die Bixby Creek Bridge.«
Toni stutzte. »Die liegt doch längst hinter uns.«
Das junge Mädchen hob höflich die Brauen im Rückspiegel, dann richteten sich ihre Augen wieder auf die Straße.
Toni blickte zum Heckfenster hinaus. Symmetrische Schemen blieben hinter ihnen zurück, aber durch die getönte Scheibe und die Regenschwaden waren kaum Details zu erkennen. Vielleicht waren es auch Bäume …
»Die Brücke lag bereits hinter uns, als wir den Unfall hatten«, beharrte sie. »Ich habe sie doch gesehen.«
»Dann musst du dich verfahren haben«, lachte Alexander King. »Das kann dem besten Fahrer passieren in einem solchen Sturm. Ist ja der reinste Orkan da draußen.«
»Wir sind auf dem Highway 1, Alex. Der hat nur zwei Richtungen.« Sie sah hilfesuchend zu Francis. Auf einmal schien es ihr, als wäre die Klimaanlage des Lincolns viel zu kalt eingestellt.
»Wir haben die Brücke überquert«, bestätigte Francis. »Vor einer halben Stunde.«
Alexander legte gutmütig den Kopf auf die Seite. »Nun, das wird sich wohl klären, wenn man deinen Wagen holt. Ich bin gespannt, wer diese kleine Wette gewinnt.«
»Swaine«, bat Bastian. »Könnten Sie bei den ersten Häusern bitte halten?«
»Das wäre sehr freundlich«, bekräftigte Toni. »Wir sollten wirklich telefonieren, und wir haben kein Netz. Ich möchte nicht, dass jemand bei der schlechten Sicht noch unseren Wagen rammt.«
»Vielleicht wäre es besser, erst dem Wetter zu entkommen«, sagte Alexander King, und so, wie er es sagte, klang es nicht wie ein Vorschlag.
»Da vorne ist etwas«, sagte Swaine.
Toni drehte sich abermals um und sah, dass die junge Frau die Stirn gerunzelt hatte. Dann spitzte sie die Lippen zu einem Ausdruck der Verblüffung und trat auf die Bremse.
Der Lincoln schlingerte.
»Was ist los?«, fragte Alexander streng.
»Da war ein Mann!«, rief Swaine mit heller Stimme. »Auf einem Pferd!«
Die Gesichter wandten sich zu den Fenstern, versuchten, in der Dunkelheit etwas anderes als ihre eigenen Spiegelungen zu erkennen.
»Ein Pferd?«, wiederholte Alexander skeptisch. »Sind Sie sicher?«
»Halten Sie bitte«, sagte Bastian.
Swaines Augen im Rückspiegel gingen zu Bastians Vater. Der winkte knapp mit zwei Fingern seiner rechten Hand.
Der Lincoln hielt an.
»Haben Sie wieder Empfang?«, fragte Toni Francis, der mit ernster Miene auf sein Handy starrte, doch sie kannte die Antwort schon, bevor er den Kopf schüttelte.
Bastian stieg aus dem Wagen. Der Sturm wehte Regen und Kälte ins Innere.
»Bastian!«, rief Alexander King ihm mit lauter Stimme nach. »Was soll das? Willst du das Pferd suchen?«
»Ich habe es nicht angefahren, Sir«, versicherte die Chauffeurin.
»Was hat ein Reiter denn auf dem Highway verloren?«, stellte Francis die offensichtliche Frage. »Bei so einem Sturm?«
»Wir werden es nicht herausfinden«, brummte Alexander King. »Und es ist nicht unsere Sorge.«
»Er könnte verletzt sein«, gab Francis zu bedenken. »Schwer verletzt …«
Alexander machte ein finsteres Gesicht. »Bastian!«
»Das müsst ihr euch ansehen!«, rief sein Sohn von draußen. Er drehte ihnen den Rücken zu und seine Stimme war im Wind kaum zu verstehen.
Alexander King wollte erst zu einer scharfen Erwiderung ansetzen, dann weiteten sich seine Augen vor Staunen.
Mit klopfendem Herzen rutschte Toni auf Bastians Seite und warf einen Blick aus der Tür. Regen schlug ihr ins Gesicht.
Und da sah sie es auch.
Draußen, jenseits der Sicherheit des Lincolns, war die Welt hinter vielfachen Vorhängen aus Regen versunken. Die Straße, die Klippen, das Meer und die Berge, nichts war mehr geblieben außer blassgrauen Umrissen hinter den tosenden Seidenschleiern des Sturms. Doch in diesen Schleiern – hypnotisch wirbelnd, der Fieberwahn eines Don Quijote – wuchsen große Schattenblumen auf langen Stielen empor, hoch wie die Beine der Bixby Creek Bridge; einbeinige, einäugige Riesen, die traumschwer ins Dunkel starrten, rastlose Herzen, die flüsternd und raunend ihre tonlosen Lieder in den Wind schrieben.
»Windräder«, hauchte sie. Und einen irrationalen Moment lang prägte sich ihr ein Gedanke auf, der alles andere verdrängte – ihre Verwunderung, ihren Unglauben, ja selbst ihre Angst: Ross hätte dieser Anblick gefallen: Windräder, die den ewigen Küstenwind des Westens einfangen wie stolze Fischernetze im endlosen Ozean der Luft. Das wäre sein Traum gewesen …
»Was ist das?«, fragte Bastian verstört. »Das kann nicht sein!«
Er sieht es auch, begriff sie. Aber es muss doch eine Täuschung sein …!
Da drehte der junge Mann sich um und stieß einen entsetzten Schrei aus. »Vorsicht!«
Sie folgte seinem Blick und zog gerade noch rechtzeitig den Kopf ein, als der Stamm des vom Sturm gefällten Baums den Lincoln unter sich begrub.
Du hast mir noch nicht alles gezeigt, stellt Mira fest.
Der Geist gibt keine Antwort, doch sein Schweigen verrät ihr, dass sie recht hat. Sie gestattet sich ein siegesgewisses Lächeln.
Wer noch?, fragt sie. Wer war noch dabei?
Fernando Einhundertvierundvierzig Jahre davor
Der Sturm erwischte Fernando nur wenige Wegstunden vor seinem rettenden Ziel.
Sein Vater hätte darin vielleicht ein Zeichen gesehen; es schien, als stemmte sich selbst das Land seiner Vorfahren gegen ihn. Was Fernando betraf, so hatte ihn die Erfahrung seines jungen Lebens gelehrt, dass höhere Mächte ihn nicht zu warnen pflegten, ehe sie in sein Leben eingriffen, und ihn auch nicht um seine Meinung baten.
Abwehrend hob er die Hand gegen die nassen Äste, die ihm ins Gesicht schlugen und nach der in Wachstuch verpackten Gitarre auf seinem Rücken griffen. Ein heißer Schmerz stach in seiner Seite.
Fernando hatte seine Eltern in jungen Jahren verloren. Sein Vater war – wie fast alle Esselen – von den Spaniern umgesiedelt, getauft und zur Arbeit in einer Missionsstation gezwungen worden, ehe es ihn auf den Rancho des alten Guillermo verschlug. Dort hatte er Fernandos Mutter kennengelernt, eine echte Kalifornierin. Ihre Familienwurzeln hatte sie bis ins alte Spanien zurückverfolgen können, durch ihre Armut aber war sie zur Arbeit als Wäscherin gezwungen worden. Es war eine tragische Geschichte, die der alte Guillermo ihm mehr als einmal erzählt hatte. Alle Widerstände, die der Heirat zwischen einem Indio und einer Californiana entgegenstanden, hatten sie überwunden – besiegt hatte sie ein hohes Fieber, dem sie beide binnen weniger Tage erlegen waren. Ihr Kind hatte nur deshalb überlebt, weil sie es rechtzeitig in die Hände eines Kindermädchens gegeben hatten.
Der alte Guillermo hatte ihn nicht allein aus Mitleid auf dem Rancho aufwachsen lassen. Fernando hatte hart auf den Feldern geschuftet und in seinen ersten Jahren vor allem die verschrammte Gitarre zum Freund gehabt, die ihm als Einziges von seiner Mutter geblieben war. Von seinem Vater besaß er die Halskette mit dem Kreuz, ein Hochzeitsgeschenk seiner Frau, das er bis zu seinem Tod getragen hatte.
Genau wie Fernandos Mutter waren die meisten Leute auf dem Rancho Nachfahren der frühen Kolonisten gewesen. Sie hatten das Land seit Generationen bestellt, erst unter spanischer, dann unter mexikanischer Herrschaft. Doch die junge Republik Mexiko hatte ihre nördlichen Territorien lange vernachlässigt; und so hatten nicht wenige Kalifornier den Anschluss an die Vereinigten Staaten befürwortet – so auch Guillermo.
Natürlich waren sie damit, als der Mexikanisch-Amerikanische Krieg ausbrach, zwischen alle Fronten geraten.
Die Gesichter von einst zogen vor Fernandos innerem Auge vorbei, und ein ums andere Mal glaubte er ihre Stimmen im Dunkel zu hören, wie sie nach ihm riefen. Vielleicht ahnten sie, dass es mit ihm zu Ende ging, er bald schon einer der ihren sein würde. Er brauchte dringend Hilfe und einen Schutz vor dem Sturm, nicht nur für sich, auch für Moonchild. Noch ertrug der Schimmel den plötzlichen Wetterumschwung mit stoischer Ruhe, aber immer öfter drohte er im Dunkel fehlzutreten. Es war wahrhaft eine wilde Gegend.
El sur grande, das große Land des Südens, wie es die Spanier genannt hatten. Seit wenigen Jahren gehörte es zu den Vereinigten Staaten, so wie der Rest Oberkaliforniens. Wie schnell es letztlich gegangen war, hatte nicht zuletzt die zerstrittenen Generäle und Gouverneure überrascht. Zu allem Überfluss hatten ein paar amerikanische Siedler in Sonoma noch ihre eigene Republik ausgerufen und eine selbstgemalte Bärenflagge gehisst, mit der niemand etwas hatte anfangen können. Damit war die Verwirrung perfekt gewesen. Angeblich hatte der Comandante des Presidios sein Bestes gegeben, die Aufständischen mit Wein und Schnaps bei Laune zu halten.
Eine Strategie, die auch der alte Guillermo verfolgt hatte, als die Banditen spätabends an seiner Tür erschienen waren – leider mit weniger Erfolg.
»Ihr gehört hier nicht her«, hatten sie geknurrt, auf Spanisch, finster aussehende Männer mit löchrigen Hüten und schmutzigen Tüchern um den Hals. »Eure Zeit ist vorbei!«
Der alte Guillermo hatte das anders gesehen.
Fernando war nur deshalb der Feuersbrunst entkommen, weil er noch bis spät nach der Arbeit mit seiner Gitarre auf den Feldern gesessen hatte. Ein verängstigtes Dienstmädchen erzählte ihm hinterher, was passiert war.
Wahrscheinlich waren die Banditen von einem anderen Großgrundbesitzer geschickt worden, dem die politische Gesinnung seines Nachbarn ein fast so großer Dorn im Auge gewesen war wie dessen Landbesitz. Das ließ sich aber nie beweisen. Fernando hörte nur, dass die Brandstifter aus Monterey stammten, was nicht weit weg war; und weil er sonst keinen Ort hatte, an den er gehen konnte, machte er sich dorthin auf.
Fast so wie heute.
Fernando ließ den Wald hinter sich und ritt auf einen sturmgepeitschten Hügel hinaus, der nackt und schimmernd wie ein Schildkrötenpanzer im Dunkel lag. Er ahnte das aufgewühlte Meer zu seiner Linken; am Horizont flackerte Wetterleuchten. Irgendwo in dieser Richtung musste Monterey liegen.
Eine dunkle Raute kam wie ein großer Vogel aus dem Wind getorkelt und schlug dem Hengst gegen die Beine. Der wieherte überrascht und tänzelte beiseite. Fernando brauchte einen Augenblick, bis er erkannte, worum es sich handelte: das Kreuzgestell in der Mitte, der schleifengeschmückte Schwanz …
»Das ist nur ein Drachen«, flüsterte er schwach und tätschelte Moonchilds Hals. »Frage mich, wo der herkommt? Vielleicht haben wir ja Glück und in der Nähe gibt es ein Haus oder eine Farm …«
Mühsam hob er die Hand zum Schutz vor dem Regen über die Augen und hielt nach Zeichen von Besiedlung Ausschau. Er dachte daran, wie er vor vier Jahren zuletzt durch diese Gegend gereist war. Wie er sich durchgeschlagen und in Monterey Arbeit gefunden hatte, ein Dreizehnjähriger mit wenig mehr als seiner Gitarre, ein paar Liedern und der Bereitschaft, seine Wünsche an das Leben hintanzustellen …
Nur die Männer, die den Rancho überfallen hatten – die hatte er nie gefunden.
Der Schmerz an seiner Seite riss ihn ins Hier und Jetzt zurück. Fernando biss die Zähne zusammen, tastete unter seiner Weste nach dem Hemd. Heiße Wellen pulsierten durch seinen Rumpf. Er zog die Hand wieder heraus und hielt sich die Finger dicht vor die Augen.
Der Verband war durchgeblutet.
Einen Moment lang färbte sich die schwarze Nacht noch schwärzer, als ihm schwindlig wurde. Dann fauchte ein heller Blitz über den Himmel und Moonchild scheute erschrocken. Sobald Fernando wieder Herr der Lage war, ritt er weiter, den Hügel hinab, durch einen aufgeschwemmten Bach. Er musste durchhalten …
Seine Gedanken aber kehrten zurück zu jenem anderem Tag, als er mit nassen Stiefeln einen anderen Fluss auf einer Reihe trügerischer Trittsteine durchquert hatte …
*
Als ihm das goldene Funkeln aufgefallen war, hatte er es zunächst für ein Spiel der Sonnenstrahlen oder vielleicht einen verlorenen Concho vom Sattel eines Reiters gehalten. Seinen Irrtum hatte er kurz darauf bemerkt. Erst viel später wurde ihm hingegen klar, dass das Gold, das er gefunden hatte, nur der erste Bote jener großen Gier gewesen war, die Kalifornien in den kommenden Monaten befiel.
Binnen kürzester Zeit hatte sich an dem Fluss eine kleine Siedlung gebildet. Der winzige Nugget hatte ihn nicht über Nacht reich gemacht, ihm aber viele neue Freunde beschert. Mit den meisten verstand Fernando sich gut, viele waren Kalifornier oder Mestizos wie er, und abends nach der Arbeit, wenn sie ihre Siebe vor der kleinen Küche abgelegt hatten, saßen sie beisammen und lachten, aßen Caldo tlalpeño, spielten Musik, träumten von der Zukunft und tranken Ale aus flusskalten Flaschen. Nur von ihrem Schnaps wollten die anderen Männer ihm nichts abgeben, dazu war er noch zu jung.
Manchmal kam es Fernando so vor, als hätte er wieder eine Familie gefunden.
Da die Vereinigten Staaten den Krieg inzwischen gewonnen hatten, waren es dieses Mal folgerichtig Amerikaner, die den Traum zerstörten. Davon abgesehen waren sie keinen Deut besser als die Banditen, die einst den Rancho heimgesucht hatten. Ein paar waren ehemalige Soldaten, die noch ihre zerrissenen Uniformen trugen und nicht gut auf Mexikaner – oder wen sie dafür hielten – zu sprechen waren. An ihrem Gold jedoch hatten sie nichts auszusetzen.
»Eure Zeit ist vorbei«, riefen sie, diesmal auf Englisch. »Ihr gehört hier nicht her!«
Es kam Fernando alles schrecklich bekannt vor.
Abermals war Fernando der Einzige, der mit heiler Haut entkam. Und abermals stellte er den Banditen nach – freilich ohne eine Ahnung, was er tun würde, wenn er sie denn einholte. So folgte er ihnen wochenlang durch Gebirge und Wüsten und schlief im Schutz von Büschen am Wegesrand.
Und er war nicht allein.
Er bemerkte den geheimnisvollen Fremden eines Nachmittags, als er dem Lager der Banditen schon ganz nahe war. Oder vielleicht wäre es richtiger zu sagen, dass es der Fremde war, der Fernando bemerkte, denn ehe er sich’s versah, blickte er in den doppelten Lauf seiner Flinte. Der Fremde war gekleidet wie ein Vaquero, ein mexikanischer Rinderhirte. Den breitkrempigen Sombrero hatte er tief in die Stirn gezogen, sodass sein Gesicht im Schatten lag, die hohen Stiefel endeten in eleganten Spitzen. Das Holster unter dem langen Mantel saß hoch auf der Hüfte, damit er es beim Reiten besser erreichte. Auf der Brust trug der Fremde einen fünfzackigen Silberstern.
»Sieht so aus, als hätten wir die gleiche Absicht, Junge«, flüsterte er.
»Meine Absicht ist es, diese Männer dort zur Rechenschaft zu ziehen«, erwiderte Fernando.
»Das musst du mir erklären, Junge. Es ist ohnehin noch etwas früh für einen Angriff.«
Der Fremde ließ die Flinte sinken und führte ihn ein Stück vom Lager der Banditen fort, damit sie sich unterhalten konnten. Dort wartete ein schöner weißer Hengst auf sie. Der Fremde pfiff ihn zu sich, und der Hengst kam und ließ sich von Fernando streicheln.
Fernando erzählte, was ihm widerfahren war und wie ihm immer wieder alles, was er fand, genommen wurde. Der Fremde hörte aufmerksam zu und nickte mitfühlend.
Dann war es an ihm, seine Geschichte zu erzählen.
Der Name des Fremden war Reid, und er war ein Ranger. Den Texas-Stern auf seiner Brust hatte er sich aus einer mexikanischen 5-Peso-Münze geschnitten. Das Abzeichen gebe eine gute Zielscheibe ab, sagte er, aber er habe seine Prinzipien.
»Ich kenne diese Männer aus dem Krieg. Wir kämpften in der Schlacht von Monterrey.«
»Monterey?«, fragte Fernando verblüfft. »Unser Monterey?« Denn die einzigen Schüsse, die dort bei der Eroberung durch die U.S. Navy gefallen waren, hatten der neuen Flagge der Stadt als Salut gegolten.
»Nein, nicht Monterey«, sagte der Ranger. »Monterrey – unten in Mexiko.«
Und da kam sich Fernando auf einmal sehr dumm vor, denn ihm dämmerte, was er mit dreizehn falsch verstanden hatte, als er das erste Mal ausgezogen war, um Banditen zu jagen. Er hatte sich bloß um etwa fünfzehnhundert Meilen verschätzt.
»Wir standen unter dem Befehl von General Taylor«, fuhr der Ranger fort.
»Dem Präsidenten?«, fragte Fernando mit großen Augen.
»Zachary Taylor, so wahr ich hier stehe. Er schenkte mir mein Pferd. Sein Name ist Moonchild.«
Fernando schüttelte verwirrt den Kopf. »Aber wenn Sie alle für den Präsidenten kämpften, dann sind diese Männer Ihre … Kameraden?«
Der Ranger lächelte traurig. »Ja und nein. Bloß weil wir gemeinsam kämpften, sind wir keine Freunde. Vielleicht waren wir noch nicht einmal im Recht. Manchmal gibt es kein Gut und kein Böse, weißt du? Glaub mir, das einzusehen, fällt oft sehr schwer.«
Unsicher erwiderte Fernando das Lächeln.
»General Taylor handelte den Waffenstillstand aus, der den Mexikanern einen würdevollen Abzug ermöglichte. Damals war er noch kein Präsident, und der Präsident war ziemlich wütend, dass der General einfach so Frieden schloss. Er sagte sinngemäß, als General habe man nicht zu verhandeln, sondern zu töten und den Mund zu halten. Das verstanden ein paar von Taylors Männern als Einladung und sie fielen über die Stadtbevölkerung her.«
Fernando schwieg betroffen. Damals, auf dem Rancho des alten Guillermo, hatten sie sich gewünscht, dass die Vereinigten Staaten den Krieg gewinnen würden. Was damals in Mexiko in amerikanischem Namen geschah, das hatten sie nicht geahnt.
»Heute ist Taylor Präsident, doch diese alte Sache nagt an ihm. Er hat die Kriegsverbrechen nie verurteilt – ein paar der Verbrecher aber sind danach desertiert und ziehen jetzt plündernd durchs Land. Für ihn war das der Vorwand, den er brauchte, seine alte Rechnung zu begleichen. Also schickte er mich und noch ein paar Ranger. Leider ging die Suche länger als gedacht, und heute bin bloß ich noch übrig.«
»Und Ihre Suche führte Sie hierher?«, fragte Fernando. »Bis nach Kalifornien?«
Reid machte eine Geste, die die Berge, die Felsen, die Wüste und die kargen Sträucher mit einschloss. »Wer sonst sollte es tun? Ihr bräuchtet wirklich eure eigenen Ranger, Junge!«
»Ich möchte helfen«, sagte Fernando.
Der Ranger schaute ihn ernst an. »Bist du dir sicher?«
»Ich kenne diese Männer«, sagte Fernando. »Das heißt, nicht persönlich. Irgendwie scheinen es aber immer dieselben zu sein, wohin man auch kommt.«
»Nimm es dir nicht zu Herzen.« Reid legte ihm die Hand auf die Schulter. »Solche Männer gibt es überall – und an die Mächtigsten kommst du nur selten ran. Zu lange haben wir das Land in den Händen von Gesetzlosen gelassen, für die ihre Mitmenschen nur Marionetten sind, die sie tanzen lassen. Und wenn sie sie nicht mehr brauchen, schneiden sie ihnen die Fäden durch! Was sagst du: Wollen wir ein paar Puppenspielern das Handwerk legen?«
Fernando war sich nicht sicher, ob er verstand, was der Ranger meinte. In seinen Augen waren die Übeltäter selbst nur Marionetten – Gefangene ihrer Gier und ihres Hasses. Doch genau deshalb durfte man sie nicht gewähren lassen.
»Wenn nicht, dann werde ich ihnen nie entkommen.«
»Also gut.« Der Ranger drückte ihm die Flinte in die Hand. »Kannst du mit so was umgehen?« Fernando überprüfte Hahn und Schloss und nickte – mit einer solchen Waffe konnte auch ein ungeübter Schütze nicht viel falsch machen. »Dann gibst du mir Feuerschutz, und ich kümmere mich um alles weitere.«
Nach Einbruch der Dunkelheit pirschten sie sich an die Banditen heran: Fernando mit der doppelläufigen Flinte und Reid mit Büchse und Revolver bewaffnet. Der Ranger verstand sein Geschäft; sie kamen den Männern, die teils trinkend, teils dösend um ein Feuer saßen, so nahe, dass Fernando meinte, die Hand nach ihnen ausstrecken zu können. Sein Herzschlag dröhnte in seinen Ohren.
Reid war ein Mann des Gesetzes – deshalb eröffnete er nicht einfach das Feuer, sondern rief die Männer an. Diese aber ließen keine Zweifel daran, was sie von Gesetzen hielten. Kaum hatten sie den Ranger entdeckt, flogen die Kugeln.
Wie Reid es ihm aufgetragen hatte, feuerte Fernando hinter seinem Baum blindlings ins Lager, um vom Ranger abzulenken. Er feuerte, dann feuerte er abermals, dann wollte er nachladen, doch da war es schon vorbei. Es konnte höchstens eine halbe Minute vergangen sein, doch Fernando kam es vor wie ein ganzes Leben.
Vorsichtig lugte er aus seiner Deckung hervor. Die Banditen lagen niedergestreckt am Boden.
Nachdenklich schritten er und Reid durch ihre Reihen. Gerade hatte Fernando einen Rest des Goldes gefunden, das man ihm gestohlen hatte, und wollte es an sich nehmen, als der Ranger ihn mit einem Schrei beiseitestieß.
Zwei Schüsse fielen.
Beide fanden ihr Ziel.
»Schätze, das war mein letzter Ritt«, flüsterte Reid kurz darauf, den Kopf in Fernandos Schoß gebettet. Fernando rannen die Tränen übers Gesicht, denn der Ranger hatte ihm wahrscheinlich das Leben gerettet; und er spürte, dass hier etwas zu Ende ging, das größer war, als er erfassen konnte.
Reid griff an seine Brust und löste den silbernen Stern von seinem Hemd. »Wenn du jemals Präsident Taylor begegnest, wirst du ihm den geben?«
Fernando nickte.
»Und gibst du auf Moonchild acht?«
»Das werde ich«, versprach Fernando schluchzend.
»Du bist ein guter Junge«, sagte der Ranger. »Glaube weiter an die Gerechtigkeit … und gib nie auf!«
Fernando versprach ihm auch das.
Dann starb der Ranger in seinen Armen.
Fernando hob ein Grab für ihn aus und legte Steine darauf, wegen der wilden Tiere. Die Leichen der Banditen ließ er liegen, denn es waren zu viele. Reids Flinte und das Gold, verwahrt in einer kleinen Tabakdose, nahm er an sich.
Dann ging er zu Moonchild und erzählte ihm, was mit seinem Herrn passiert war. Der Hengst ließ ihn aufsteigen und sie ritten davon – zurück nach Norden, Richtung Monterey.
Er war zwei Tagesritte weit gekommen, als er in den Hinterhalt geriet.
*
Vielleicht war ihnen einer der Banditen entkommen. Vielleicht hatte ihn irgendwer sonst für leichte Beute gehalten. Er wusste nur, dass ein umgestürzter Baum ihn gezwungen hatte, langsamer zu reiten, als hinter einem Felsen unvermittelt ein Schuss fiel und ihn in die Seite traf. Im nächsten Moment sprang Moonchild über den Stamm, so schnell wie das Mondlicht, das ihm seinen Namen lieh, und trug ihn in Sicherheit.
*
Fernando hatte kaum noch die Kraft, sich im Sattel zu halten, als er die Lichter vor sich im Sturm entdeckte. Sie bewegten sich in perfektem Einklang, als ritten zwei Männer mit Laternen nebeneinander, die jede Bewegung gemeinsam ausführten.
Der Sturm hüllte ihn ein wie ein Schwarm wilder Raben, schlug und zwickte und zerrte an seiner Kleidung. Der Regen rann an seiner Nase, seinen Händen, den Zügeln herab.
Moonchild lief mit gesenktem Kopf, und die starken Schultermuskeln unter dem nassen Fell arbeiteten unermüdlich. Der Boden war nun ebener; vielleicht hatten sie einen Pfad gefunden. Die Klippen mussten schon gefährlich nahe sein. Fernando versuchte zu erkennen, wo sich der Abgrund zum nächtlichen Meer hin auftat, doch es war zu dunkel. Zwar glaubte er ein fernes Brausen zu hören … aber das mochte bloß eine neue Melodie des Windes oder des nahen Ozeans sein. Die Wunde an seiner Seite pochte mit jedem Herzschlag.
Die Lichter kamen sehr schnell näher. Die Präzision der beiden Reiter war beachtlich. Vielleicht konnten sie ihn zu ihrer Behausung oder der nächsten Siedlung mitnehmen …
»Hola!«, rief Fernando aus Leibeskräften. »Hierher!«
Nun hörte er eindeutig ein tiefes Brummen, eingebettet in den heulenden Wind, lauter und lauter. Er konnte das Geräusch nicht einordnen. Es klang nicht, als wäre es natürlichen Ursprungs – eher wie ein indianisches Schwirrholz, das man immer schneller und schneller im Kreis dreht …
Da sprang ihn ein schwarzer Schatten aus der Nacht an, so groß wie zwei Bisons, ein jedes mit einem gleißenden Licht auf der Stirn, und er stieß einen Schreckensschrei aus. Die Böe, mit der die geisterhafte Erscheinung an ihm vorüberrauschte, war selbst im Sturm noch wahrnehmbar. So musste es sein, wenn man einer Eisenbahn in die Quere kam …
Wiehernd bäumte Moonchild sich auf. Fernando fiel und riss schützend die Arme vor den Kopf. Das Letzte, woran er im Fall noch dachte, war die Gitarre auf seinem Rücken; das Letzte, was er sah, als er aufschlug, war der weiße Hengst, der in der sturmgepeitschten Nacht verschwand.
Es tut mir leid, dachte er, an den Ranger gerichtet. Schätze, das war auch mein letzter Ritt …
Etwas fehlt noch, sagt Mira. Das Bild ist noch immer nicht komplett. Zeig mir den Rest …
Stephanie Zweiundsiebzig Jahre dazwischen
Rince prahlte wieder.
Eigentlich hatte er bereits den ganzen Weg bis Monterey nichts anderes getan, als zu prahlen – aber seit er den Laster tatsächlich im genannten Lagerhaus am Hafen gefunden hatte, war sein Ego kaum noch auszuhalten.
Jedoch, wie ihre Mutter stets betont hatte, man suchte sich nicht aus, wen man liebte.
Man konnte sich höchstens aussuchen, wann.
»Baby, wir werden reich sein«, setzte Rince seinen Sermon fort. »Ich habe immer gesagt, uns steht eine goldene Zukunft bevor! Wann habe ich dich je enttäuscht?«
»Rince, Liebes, du sollst doch keine Fragen stellen, auf die du die Antwort nicht hören willst«, erinnerte sie ihn. »Wieso erzählst du mir nicht endlich, was wir eigentlich transportieren? Und solltest du den Laster nicht eigentlich nach Reno bringen?«
»Wir fahren genau in die richtige Richtung«, versprach er ihr. »Und was wir transportieren, wirst du sehr bald schon sehen. Ich verspreche dir, du wirst Augen machen!«
Stephanie seufzte. Rick »Rince« Vincent III. hatte noch nie der Versuchung widerstehen können, im Rampenlicht zu stehen. Das hatte sich in jungen Jahren schon gezeigt, als er versucht hatte, sich als Komiker auf den billigsten Bühnen Chicagos durchzuschlagen. Genau dort hatte sie ihn auch kennengelernt. Damals hatte er noch fest daran geglaubt, dass jemand seine Witze lustig fand – und sie, dass sich der Weg in ein besseres Leben mit ehrlicher Arbeit erkellnern ließ. Heute war er nach Meinung seines großen Vorbilds Al Capone der unterschätzteste Kleinkriminelle in mindestens drei Staaten, und Stephanie – in jeder Hinsicht außer einer so viel weiser – sein einziges Publikum.
Sie schaute aus dem Fenster, wo der Regen niederging und sich ärmliche Hütten unter ihren baufälligen Dächern in den Schlamm kauerten. »Das sieht aber nicht aus wie der Weg nach Reno.«
»Das ist er auch nicht. Schon lange nicht mehr.«
»Ich wiederhole mich ungern, aber wenn das die richtige Richtung ist, doch nicht der Weg nach Reno – wobei Reno ist, wohin wir den Laster bringen sollen –, dann lässt dies nur den Schluss zu, dass du es nicht für richtig hältst, den Laster nach Reno zu bringen. Warum sagst du mir nicht einfach, was du vorhast?«
Statt einer Antwort beugte Rince sich zu ihr und gab ihr einen Kuss. Der Laster hüpfte über einen Stein, und sie stießen mit den Schneidezähnen zusammen.
»Autsch!«
»Unsere Zukunft liegt nicht in Reno.« Rince grinste und trommelte auf das Lenkrad. »Sondern eine Stunde in dieser Richtung.« Er deutete voraus in den Regen. »Vielleicht auch zwei.«
Stephanie machte große Augen. »So wie ich das sehe, liegen dort vor allem noch mehr Baustellen und Arbeitersiedlungen.« Schaudernd dachte sie an die düsteren Gesichter und die rostigen Dampfmaschinen zurück, die sie die letzte Stunde passiert hatten. »Und ziemlich viele Schluchten und Klippen, die es mir wie eine reichlich schlechte Idee erscheinen lassen, bei diesem Wetter weiter auf einer unbefestigten Straße zu fahren.«
Wie um ihre Meinung zu bekräftigen, holperte der Laster über eine wacklige Holzbrücke, die einen der zahlreichen Creeks des Hinterlands überspannte. Stephanie war sich nicht sicher, welcher es war, und die zerknitterte Landkarte gab wenig Aufschluss; Rocky oder Bixby Creek wahrscheinlich. In jedem Fall gab es dort draußen gerade mehr Wasser, als ihr lieb war. Die Brücke knarrte und schwankte im Sturm, und nur unter Protest zog der heulende Motor sie hinüber auf die andere Seite. Auf der Ladefläche unter der Plane rumpelten die Kisten.
»Vertrau mir.«
»Was hatten wir noch gleich da hinten geladen?«
Er grinste. »Unsere Zukunft, Baby. Dort hinten liegt unsere Zukunft.«
»Aber nicht in Reno«, vergewisserte sie sich. »Sondern drei Stunden in dieser Richtung durch die Wildnis.«
»So ist es.« Rince klang überaus zufrieden mit sich.
Sie versuchte einen neuen Anlauf. »Woran erkennen wir unser Ziel?«
Ein weiterer Fingerzeig voraus. »Ein Licht wird uns den Weg weisen.« Er bemerkte ihren zweifelnden Gesichtsausdruck. »Na schön – es ist auch deine Zukunft, also sollst du alles wissen.«
Erwartungsvoll blinzelnd schaute sie ihn an. Männer wie Rince brauchten so viel Bestätigung. So viel Pflege. So viel Geduld.
»Wir fahren den Laster nicht nach Reno, weil wir ihn an die Küste fahren. Ich meine, klar, ein paar Leute in Reno werden ziemlich sauer sein, aber wieso sollen wir ihnen den Gefallen tun, die ganze Arbeit für sie zu erledigen?«
»Ich kann dir nicht ganz folgen, Liebes. Sie haben dir einen Job gegeben, oder nicht?«
Er nickte, wirkte allerdings wenig erfreut, daran erinnert zu werden. »Das dachte ich auch erst, aber dann kam mir ein anderer Gedanke. Ich dachte: Wieso soll ich bloß den Fahrer spielen, wenn ich das Geschäft auch selbst abwickeln kann?«
Stephanie wusste keine Antwort darauf. Schon deshalb nicht, weil sie ja nicht wusste, was das Geschäft eigentlich war.
»Also habe ich ein paar Kontakte spielen lassen«, fuhr Rince fort. »Wir bringen die Ware nicht nach Reno, sondern verkaufen sie selbst.«
»Hier? In dieser Gegend?«
»Wir treffen unseren Mann ein Stück weiter im Süden an der Küste. Er kommt mit einem Schiff.«
»Hierher«, wiederholte sie. »Mit einem Schiff. Bei diesem Wetter.«
Er schnaubte ungeduldig. »Mag sein, dass das Schiff sich ein bisschen verspätet …«
Sie seufzte.
»Verdammt, freust du dich denn gar nicht?«, brauste er auf. »Das ist unsere Chance! Unser Durchbruch! Dieser Deal wird uns reich machen, und wir können gehen, wohin immer wir wollen! Hast du dir nicht genau das immer gewünscht?«
Sie starrte aus dem Fenster in den Regen und suchte nach der passenden Antwort. Er hatte ja recht: Sie hatte sich immer gewünscht, Geld zu haben und ein neues Leben zu beginnen. Ein bisschen was von der Welt zu sehen und sich dann irgendwo niederzulassen. Deshalb hatte sie ihn auch in den Westen begleitet, als er die Möglichkeit gewittert hatte, sich einen Namen zu machen. Rince schien den richtigen Riecher für lukrative Geschäfte zu haben, das hatte er mehr als einmal bewiesen. Aber manchmal konnte er so verdammt … naiv traf es nicht ganz … sorglos? Übermotiviert sein?
Sie kannte seine neuen Partner in Reno nicht – doch dank der alten Freunde in Chicago wusste sie, wie es aussah, wenn jemand mit einer Menge Löcher im Bauch in einer Gasse verblutete. Und sie hatte sich geschworen, dass sie das nicht so schnell wieder erleben wollte.
»Ich hätte es dir nicht erzählen sollen«, maulte er.
Du hättest mir überhaupt etwas erzählen sollen, dachte sie. Und zwar gleich.
»Ich freue mich«, versicherte sie ihm stattdessen und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Schließlich bist du doch mein Rince.«
»Der Mann, den Al Capone seinen linken Daumen nannte«, rief er ihr ins Gedächtnis.
»Ich erinnere mich.« Allerdings hatte sie nie recht begriffen, weshalb er so verdammt stolz darauf war. Al war betrunken gewesen, umringt von Untergebenen, die sich darum gerissen hatten, seine rechte Hand oder wenigstens sein Fuß oder etwas in der Art zu sein, und Al waren schlicht die Körperteile ausgegangen. Bis die Reihe an Rince kam, waren nur noch die weniger schmeichelhaften Bereiche seiner Anatomie geblieben, und Stephanie war bis heute nicht restlos überzeugt, dass Rince sich damals nicht verhört hatte.
Abermals gab er ihr einen Kuss. Der Laster täuschte einen weiteren Hüpfer an, doch diesmal vollzog sich der Lippenkontakt ohne dentale Schäden.
»Wenn du dich freust, was belastet dich dann so?«, fragte er.
Sie wählte ihre Worte mit Bedacht. »Ich mache mir bloß Sorgen, dass dir etwas passiert.«
»Was sollte mir schon passieren?«, fragte er ehrlich verwundert. Dann fuhr er ihr mit der Hand durchs Haar wie einem kleinen Jungen. »Ich gebe schon auf dich acht. Auf uns beide.«
Sie schluckte die Erwiderung hinunter. Das war wieder so typisch: sein Problem zu ihrem zu machen. Wenn einer von ihnen Schutz brauchte, dann er – vor allem vor sich selbst.
»Ich mache mir keine Sorgen um uns«, sagte sie. »Aber vielleicht um den Laster. Die Gegend hier ist die reinste Wildnis …«
»Wenn sie erst den neuen Küstenhighway gebaut haben, wird sich das ändern.«
»Ja, aber jetzt …«
»Ich habe gehört, dass sie schon überlegen, ob sie nicht Sträflinge zur Arbeit einsetzen sollen. Die armen Schweine!« Er prustete vergnügt.
»Auch das Schiff wird Schwierigkeiten haben, bei diesem Wetter die Küste anzulaufen …«
»Genau dafür gibt es Leuchtfeuer. Bei so einem treffen wir uns.«
Sie schüttelte den Kopf. »Du glaubst wirklich, dass sie kommen? Und dass sie die Abmachung einhalten? Was, wenn sie sich dasselbe sagen wie du? Was, wenn sie sich sagen: Warum sollten wir diesem dahergelaufenen Fremden …«
»Ich bin kein Fremder für sie. Sie kennen mich.«
»Schön«, lenkte sie ein. »Was, wenn sie sich sagen: Warum sollten wir diesem überaus bekannten Schmuggler, diesem Rince, dem Mann, den Al Capone seinen linken Daumen nannte, seine Ladung – die er eigenhändig gestohlen hat! – abkaufen, wenn wir sie ihm auch einfach abnehmen und selbst verscheuern können?«
»Schau mal ins Handschuhfach.«
»Was …«
»Schau einfach ins Handschuhfach.«
Stephanie gehorchte.
Im Handschuhfach lag ein Revolver. Stephanie wusste nicht, was für ein Revolver es war, aber er war klein und schwarz und tödlich und löste eine Vielzahl widerstreitender Gefühle in ihr aus. Eine gewisse Faszination war dabei, eine leichte Erregung; vor allem jedoch Sorge, dass sich eine solche Waffe im Besitz eines Mannes wie Rince befand.
»Siehst du?«, freute sich Rince, der ihr Schweigen als Stolz missdeutete. »Mit uns legt sich besser niemand an.«
»Hoffen wir, dass wir das Schießeisen nicht brauchen«, sagte sie diplomatisch, um ihn nicht weiter zu verunsichern.
Eine Weile sah sie schweigend aus dem Fenster. Sie waren einen weiten Umweg gefahren, um den letzten Canyon zu überqueren, und Berge, Wälder und Regen bildeten ein schwer zu lesendes Muster aus nahen und ferneren Schatten. Der Wind riss das Licht der Scheinwerfer davon, kaum dass es auf die ersten Tropfen traf. Die Straße unter den Reifen war ein einziger Morast, immer wieder drehten die Räder durch und der Motor heulte auf. Sie fragte sich, ob Rinces Abnehmer nicht einen leichter erreichbaren Treffpunkt hätten wählen können, und ob er überhaupt noch wusste, wo sie sich befanden.
Dann meinte sie vor sich die Umrisse der Küste zu erahnen: schroffe Felsen, die in die Tiefe abfielen und den Weg hinaus auf den schwarzen Ozean wiesen. Tatsächlich glaubte sie auch eine Lichtquelle auszumachen; eins der Leuchtfeuer wahrscheinlich, welche die gefährlichen Landungsstellen markierten, von denen die wenigen Bewohner dieser gottverlassenen Gegend abhängig waren, wenn die Straßen im Winter unpassierbar wurden.
Rince hatte das Licht wohl ebenfalls gesehen, denn er steckte sich zufrieden eine Zigarette in den Mund. Dank der holprigen Straße vollzog sich das Entzünden jedoch nicht halb so lässig wie geplant. Ein strenger Geruch breitete sich in der Kabine aus, als eine Strähne seines dunklen Haars zum Raub der Flammen wurde und Rince das Streichholz fluchend fallen ließ.
»Nimm es mir nicht übel, Liebes … aber ist das deine neue Pomade, die da so riecht?«
»Erhöhter Fettgehalt«, erklärte er stolz und strich sich das versengte Haar aus der Stirn. »Beste Qualität.«
Das Rumoren in ihrem Magen war anderer Ansicht. »Es riecht fast wie Gänsebraten …«
»Nicht Gans«, belehrte er sie. »Ente.«
»Liebes«, versuchte sie. »Findest du wirklich, dass …«
Sie sprach den Satz nie zu Ende, weil in diesem Moment wie aus dem Nichts ein Pferd vor ihnen auf die Straße sprang. Es war ein schöner Schimmel, genauso erschrocken wie sie beide. Es gab keinerlei Erklärung dafür, wo er auf einmal herkam; von daher zeichnete er sich in diesem Augenblick auch weniger durch seine Schönheit als durch seine schiere unvermittelte Präsenz aus, als er sich auf die Hinterbeine aufbäumte und nach ihrem Laster trat.
»Was zum …!«, schrie Rince, um Haaresbreite klüger als das Pferd, und riss das Lenkrad herum, um dem Schimmel auszuweichen.
»Rince! Pass auf den Hang auf!«
Doch da war es schon zu spät: Der Laster kam von der Straße ab und raste querfeldein durch Büsche und Schlaglöcher. Ein Reifen platzte, dann noch einer. Halb rollten, halb rutschten die Räder durch den Schlamm, direkt auf einen Umriss zu, den Stephanie zunächst für einen Baum hielt und dann – nur Sekundenbruchteile, bevor sie ihn rammten – als eine alte Aermotor-Windpumpe erkannte, wie man sie häufig auf dem Land sah.
Stephanie stieß einen spitzen Schrei aus. Das fragile Gestell knickte ein, die Flügel barsten, um vom Sturm wirbelnd davongetragen zu werden.
Immer noch schossen sie voran, obwohl Rince mit beiden Füßen auf die Bremse trat und ebenfalls aus Leibeskräften schrie; dann sah Stephanie vor sich das Meer, der Laster schlitterte das letzte Stück, die Vorderräder hingen plötzlich in der Luft und der Abgrund unter ihnen gähnte so jäh wie die völlige Ratlosigkeit in ihrem Verstand.
In der Pause zwischen zwei Herzschlägen dachte sie noch, dass sie gerne erfahren hätte, ob Rinces Plan für ihre Zukunft wirklich besser gewesen wäre als dies.
Dann blieb die Hinterachse mit einem heftigen Ruck an einem Felsen hängen, Stephanie schlug mit dem Kopf gegen die Scheibe und versank in der Schwärze.
ERSTER TAG
Welt unter dem Winde
Mira
»Ariel?«, flüsterte Mira. »Bist du da?«
Erst kam keine Antwort, doch Mira spürte, wenn der Geist in der Nähe war, gleich, welche Gestalt er sich gerade gab. Sie nahm seine Präsenz wahr wie einen fernen Duft, einen Schatten über der Wiese, eine halb geträumte Melodie. Sie konnte selbst nicht sagen, welcher ihrer Sinne genau auf den Geist reagierte.
Eine Weile schaute sie auf das Meer hinaus, ließ die Beine baumeln und flocht einen Kranz aus den Gänseblümchen, die sie auf dem Weg gesammelt hatte. Der Klippenrand war einer ihrer Lieblingsorte: umgeben von farbenfroh blühenden Kräutern, unter ihr die sonnenbadenden Seehunde am Strand, über ihr die Möwen scheinbar reglos in der Luft. Die Sturmwolken hatten sich an den westlichen Rand der Welt zurückgezogen und bildeten ein schwarzes Band über dem Pazifischen Ozean, das sich wie eine raublustige Piratenflotte entfernte. Natürlich verschwanden die Ausläufer nie vollständig: Der Sturm währte ewig – er begrenzte Miras Welt. Doch an Tagen wie diesem, an denen die Morgensonne das regennasse Gras wärmte und der Seewind die Träume des Dorfes mit dem Versprechen von Leben lockte, konnte Mira fast vergessen, dass die Welt unter dem Winde für sie ein Gefängnis war.
Und wie einsam sie sich manchmal darin fühlte.
Du bist nicht allein, sagte Ariel und schmiegte sich unter ihre Hand.
Lächelnd legte sie die Blumen beiseite und strich dem Fuchs über den weichen grauen Pelz. Dies war eine seiner häufigsten Erscheinungsformen, wenn er zu ihr kam. Ariel war ein Geist dieses Ortes, ein Geist der Natur und Elemente: Er war Füchse und Hirsche und Falken und die See und der Himmel. Er konnte mit dem Land verschmelzen und es beherrschen. Das Einzige, was er nicht war, war ein Mensch – und das Einzige, was er nicht konnte, war, diesen Ort zu verlassen.
In dieser einen Hinsicht war er Mira fast ähnlich.
»Hast du den Sturm gestern gerufen?«, fragte sie den Geist, obgleich sie die Antwort schon kannte.
Hat er dir gefallen?, fragte Ariel, wie immer eine Stimme in ihren Gedanken, und rieb den Kopf an ihr wie eine Katze. Dann ließ er sich neben ihr nieder, die spitze Schnauze ordentlich auf den Pfoten, die Augen wohlig geschlossen, während sie ihn hinter den Ohren kraulte.
»Es war ein heftiger Sturm. Vater wollte nicht, dass ich nach draußen gehe, und mein Haus schaukelte die ganze Nacht wie wild.«
Es hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für dich bestanden, versicherte ihr Ariel, der ihr Leben lang auf sie achtgegeben hatte. Aber es war nötig, damit der Sturm auch über dem Winde weht.
›Über dem Winde‹ lag die Welt, aus der ihr Vater und sie einst gekommen waren und an die Mira nur undeutliche Erinnerungen besaß.
»Du hast die Welten in Deckung gebracht?« Mira wusste, dass dies in Ariels Macht stand: Ariel befehligte den Sturm und konnte ihn auf beiden Seiten rufen, um eine Verbindung zu schaffen, so wie er es damals für ihren Vater getan hatte. Auf ihrer Seite tobte der Sturm ohne Unterlass, selbst wenn er bis zum Horizont zurückwich; lief man weit genug in jedwede Richtung, würde man stets auf die magischen Gewalten stoßen, die Ariel vor zwölf Jahren entfesselt hatte, und die sie seither umschlossen wie ein Schiff in seiner Flasche. Ein paarmal hatte Mira jene magische Schwelle aufgesucht, jenseits derer nur Trugbilder und das Brüllen der überirdischen Mächte wirbelten; und im Gegensatz zu allem anderen in Ariels Reich hatte es ihr Angst gemacht.
Der graue Fuchs hob kurz den Kopf, als hätte er etwas gehört oder sich an etwas erinnert, dann besann er sich anders und legte sich wieder hin.
»Hat Vater dich also darum gebeten?«, forschte sie weiter, als der Geist keine Antwort gab. Nichts in der Welt unter dem Winde geschah ohne Vaters Wunsch. Der Sturm, das Dorf und die Träume, die darin lebten – all das existierte nur seinetwegen; selbst die Wahngebilde an den Grenzen ihrer Welt waren Vaters. Auch das war etwas, das ihr manchmal Angst machte.
Nun, wie du schon sagtest: Er wollte nicht, dass du das Haus verlässt. Natürlich war der Sturm sein Wunsch.
»Aber wieso?«, fragte sie.
Ich denke, das will er dir selbst erklären. Wir werden vielleicht bald schon Gäste haben.
»Gäste?«, fragte Mira aufgeregt und erstarrte. Ariel tat, als hätte er nichts gesagt, und wartete darauf, dass sie ihn weiterkraulte.
»Wir haben Gäste?«, wiederholte sie und legte die Hände vor den Mund. »Wer sind sie? Wie viele? Wann sind sie hier?«
Mit leisem Seufzen schlug Ariel die Augen auf und schaute zu ihr auf. Sie reisen auf unterschiedlichen Wegen. Bald wirst du mehr erfahren …
»Jetzt gleich!«, beharrte sie, ehe der Geist neue Ausflüchte fand. Sie hatte immer gehofft, dass eines Tages andere den Weg zu ihnen fanden. Zwölf Jahre hatte sie darauf gewartet …
Eine Weile hörte sie nichts als das Lied des Windes auf den Klippen und das Tosen der Brandung, die sich in der Tiefe an den Felsen brach.
»Ich will es sehen«, sagte Mira. »Zeig es mir. Zeig mir alles!«
Sie spürte ihren Herzschlag und ein Rauschen erfüllte ihre Ohren. Dann gehorchte der Geist, nicht ohne sich zunächst zu recken und zu strecken. Ungeachtet des tiefen Abgrunds unter ihnen strich er über ihren Rock und ihre Beine, setzte sich auf ihren Schoß und schaute sie skeptisch an, ein kleiner sturmgrauer Körper vor dem weiten, klaren Himmel; doch mächtig genug, diesen Himmel auf die Erde herabzuzwingen.
»Bitte«, fügte Mira hinzu.
Also schön. Aber sag es deinem Vater nicht …
Mira begegnete Ariels Blick, sah in seine regenkalten Augen. Im nächsten Moment brachen die Eindrücke über sie herein wie ein Wintersturm. Mira war zumute, als wäre sie im Inneren einer Schneekugel gefangen, die Ariel sachte für sie schüttelte.
Und sie sah: einen glänzend schwarzen Wagen, größer als alle Autos, die sie je gesehen hatte, begraben unter einem umgestürzten Baum. Es musste noch gestern Abend sein, denn es regnete, und das einzige Licht kam von den Scheinwerfern des Wagens und dem Flackern der Blitze. Zwei Frauen und drei Männer in vorwiegend dunkler Kleidung kämpften sich aus dem Wagen. Von den Frauen war eine deutlich älter als die andere; sie hatte rote Locken und wartete auffordernd, bis man ihr die Äste beiseitehielt, ehe sie ausstieg. Die andere Frau, anscheinend die Fahrerin, war kaum älter als Mira und trug als Einzige weiß, von ihren Schuhen bis zu dem Regenschirm, den sie nun aufspannte.
Auch die Männer waren sehr verschieden. Zwei waren dunkelhäutig, der kräftige Ältere befehlsgewohnt in seinem Gebaren, während der schlankere Junge Abstand zu ihm hielt. Der dritte Mann, welcher der Frau aus dem Wagen geholfen hatte, wirkte noch älter mit seinem schütteren Haar und dem ergrauten, buschigen Schnurrbart. Im Schutze des Schirms, ihrer Hände und Jacken stolperten sie fort von dem beschädigten Wagen, tiefer in den Wald …
Das Bild verwehte.