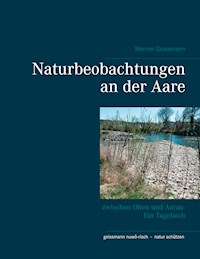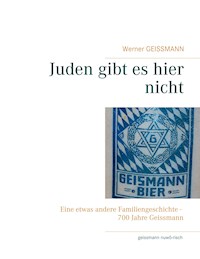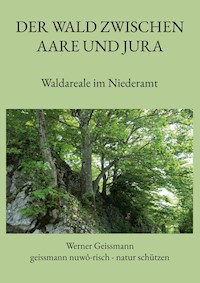
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Von einem ihrer vielen Spaziergänge mit unseren Hunden im Wald zurückkommend, fragt mich meine Frau: «Was ist im Wald los, überall wird geholzt, ist das nachhaltig?». Meine Erfahrungen bei Waldläufen und Hundespaziergängen zeigen ebenso eine verstärkte Aktivität der Forstwirtschaft. Um der Sache auf den Grund zu gehen, beschloss ich, dieses Buch zu schreiben. Ich habe das Niederamt in die drei Regionen: Jura, Aaretal und Mittelland unterteilt. Während eines Jahres habe ich einige ausgewählte Waldparzellen mehrmals besucht und das Vorgefundene auch bildlich festgehalten. Einleitend sind die Grundlagen der Geographie und Geschichte des Niederamtes dargestellt. Der Kampf um den Erhalt des Waldes ist Jahrhunderte alt. Die erste Holzverordnung im Kanton Solothurn stammt aus dem Jahr 1751.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bemerkungen zum Autor
Werner Geissmann
Mail: [email protected]
Berufliche Aktivität, bis 2014:
Projektleiter im internationalen Infrastrukturanlagenbau
Webseite zum Buch: www.wald-jura-aare.ch
Weitere Webseiten des Autors: www.naturgartentagebuch.ch / www.judengibteshiernicht.ch
Weitere Bücher des Autors:
Wildnis im Naturgarten - Tagebuch eines Naturgartenjahres. (2019)
ISBN 9783748163329
www.naturgartentagebuch.ch
Juden gibt es hier nicht
Eine etwas andere Familiengeschichte – 700 Jahre Geissmann. (2019)
ISBN 9783735760272
www.judengibteshiernicht.ch
Naturbeobachtungen
an der Aare
zwischen Olten und Aarau (2020)
ISBN 9783751956628
Die letzten Insekten
im Niederamt
zwischen Aare und Jura (2021)
ISBN 9783755761334
Für Valerie
Geographische Lage des Niederamts
am Jurasüdfuss
zwischen
Olten und Aarau
Inhalt
GEOGRAPHIE
Geographie
Geschichte
Jungsteinzeit
Bronzezeit (2200 bis 700 v.Chr.)
Eisenzeit (700 bis 15 v.Chr.)
Römische Zeit (15 v.Chr. bis 500 n. Chr.)
Mittelalter (500 n. Chr. bis 15. Jahrhundert)
Neuzeit (15. Jahrhundert bis heute)
JURA
Lage
Waldgeschichte
Geologie
Wald heute
Lostorf – Dottenberg
Lostorf – Walacker
Lostorf – Gross-Chastel
Wisen – Flueberg
Erlinsbach – Gugen
Hauenstein – Ifenthal – Ifleter Berg
Kienberg – Nesselgraben
Stüsslingen - Rohr – Guschenweid
Stüsslingen - Rohr – Walmattberg
Stüsslingen - Rohr – Geissflue
Trimbach – Rossberg Froburg
AARETAL
Lage
Waldgeschichte
Geologie
Wald heute
Eppenberg - Wöschnau – Schachenwald
Schönenwerd – Schachenwald im Grien
Obergösgen – Schachenwald im Grien
Niedergösgen – Usserholz- Mundleten
Winznau – Unterhard - Aarelauf
Starrkirch – Wil – Ischlag
MITTELLAND
Lage
Waldgeschichte
Geologie
Wald heute
Eppenberg – Wöschnau – Buechholz (Refugium)
Schönenwerd – Rüttenen
Gretzenbach – Groder Möösli
Däniken – Berg
Däniken – Cholholz
Erlinsbach – Summerhalden
Dulliken – Dulliker Engelberg
Walterswil – Flueweid - Mattental
FORSTWIRTSCHAFT
Geschichte der Forstwirtschaft
A1 Gesetze und Verordnungen
Holzbewirtschaftung in früheren Zeiten
Forstwirtschaft heute
C1 Vorgehen, Verantwortlichkeiten
C2 Forstmethoden heute
C3 Aktivitäten heute - Holzschlag
WALDRESERVATE UND NATURSCHUTZ
Bestand
AUSBLICK UND ERKENNTNISSE
Literaturverzeichnis
«Wälder kann man nicht besitzen, man kann sie durch das Recht auf Besitz nur verwüsten»
Robert Pogue Harrison 1992
Von einem ihrer vielen Spaziergänge mit unseren Hunden im Wald zurückkommend, fragt mich meine Frau: «Was ist im Wald los, überall wird geholzt, ist das nachhaltig?». Meine Erfahrungen bei Waldläufen und Hundespaziergängen zeigen ebenso eine verstärkte Aktivität der Forstwirtschaft.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, beschloss ich, dieses Buch zu schreiben. Ich habe das Niederamt in die drei Regionen: Jura, Aaretal und Mittelland unterteilt. Während eines Jahres habe ich einige ausgewählte Waldparzellen mehrmals besucht und das Vorgefundene auch bildlich festgehalten. Einleitend sind die Grundlagen der Geographie und Geschichte des Niederamtes dargestellt.
Der Kampf um den Erhalt des Waldes ist Jahrhunderte alt. Die erste Holzverordnung im Kanton Solothurn stammt aus dem Jahr 1751. In Solothurn, das eine lange Geschichte von Beziehungen mit Frankreich hat, wurde sicher der Text von Le Roy, dem Oberförster des Parkes von Versailles gelesen, der zur selben Zeit in der «Encyclopédie » von Diderot unter dem Titel «Forêt» abgedruckt wurde:1
«….., dass man zu allen Zeiten die Wichtigkeit des Schutzes der Wälder empfunden hat, sie sind immer als Eigentum des Staates betrachtet und in seinem Namen verwaltet worden: die Religion selbst hatte die Wälder geweiht, zweifellos um durch die Verehrung das zu schützen was geschützt werden musste»2
Le Roy war ein typischer Vertreter der Aufklärung, mit wissenschaftlichen Methoden sollte der Staat zum Schutz des Waldes eingreifen:
«Wenn die Wälder wegen ihres allgemeinen Nutzens als Eigentum des Staates betrachtet werden müssen, so ist ein Forst auch oft nur eine Ansammlung von Gehölzen, die Eigentum mehrerer Privatleute sind. Aus diesen beiden Gesichtspunkten ergeben sich verschiedene Interessen, die eine gute Verwaltung versöhnen muss. Der Staat braucht Holz aller Art und zu allen Zeiten, er muss vor allem grosse Bäume kultivieren. Wenn man sie für die gegenwärtigen Bedürfnisse verwendet, muss man sie schützen und für die kommenden Generationen bereitstellen. Anderseits haben es Eigentümer eilig, zu profitieren».
Le Roy glaubte, dass der Wald durch die aufgeklärte Forstverwaltung, geschützt werden kann. Den Förstern schrieb er ins Gebetbuch:
«übermässige Verjüngung ändert das Wachstum und erschöpft den Erdboden»
«er muss entscheiden, einige Wälder mehrere Generationen hindurch unberührt zu lassen, so dass hochwachsende Bäume gedeihen können»
«seine Wachsamkeit ist also dazu verpflichtet, sich falschverstandener Habgier der Privateigentümer entgegen zu stellen»
Der Wald wird in der Aufklärung als Ressource betrachtet, um zum Beispiel das abgebrannte Dachgestühl von Notre Dame wieder aufzubauen. Allein dafür wurden über tausend Eichen (Alter über hundert Jahre) in ganz Frankreich zur Fällung ausgewählt, um diese Arbeiten ausführen zu können. 3 Glücklicherweise hat sich in den letzten Jahren die Einsicht durchgesetzt, dass es eine Pflicht ist; die Schöpfung zu schützen. Der Mensch hat nicht das Recht, die Natur zu zerstören. Schon 1763 hat J.J. Rousseau in seinem Buch «Projet de constitution pour la Corse » folgendes geschrieben:
«In dem Masse wie die Bevölkerung der Insel wächst und das Fällen zunimmt, wird es in den Wäldern zu einer rapiden Verschlechterung kommen, die sich nur langsam beheben lassen wird…………..die Schweiz war einst derart reichlich von Wald bedeckt, dass sie fast darunter begraben lag……….zum Glück haben die Schweizer, durch das Beispiel Frankreichs gewarnt die Gefahr gesehen und dort Ordnung geschaffen…..»4
Das deutsche Wort «Wald» bezeichnet nach seiner Herkunft aus germanischen Sprachen ein Gelände, das «wild» und somit nicht einer Kultur unterstellt ist, während Forst einen bewirtschafteten Wald bezeichnet.5
In der Schweiz ist die Waldfläche mittels der Waldgesetze gut geschützt. Die Gesetze werden auch vollzogen. Etwas anders sieht es bei der Arterhaltung der natürlich vorkommenden Waldgesellschaften aus. Besonders bedroht ist nun der Wald durch die ausgerufene Energiewende, da die Holznutzung als nicht CO₂ ausstossend betrachtet wird. Natürlich ein wissenschaftlicher Unsinn: es ging hier nur darum, die Zustimmung der Forstwirtschaft zu dieser «Wende» zu erhalten.
Frisch bereitgestelltes Brennholz im Niederämter Wald
1 « Encyclopédie » von Diderot D. Volume 7, page 129-132, chapitre forêt, (1747 bis 1773)
2 (Harrison 1992) Wälder – Ursprung und Spiegel der Kultur, Seite 142
3https://actu.fr/insolite/six-chenes-d-occitanie-vont-etre-utilises-dans-la-nouvelle-charpente-de-notre-dame-de-paris_47405586.html
4 Jean-Jacques Rousseau (1763), Projet de constitution pour la Corse
5 (Bartsch 2020) Waldbau auf ökologischer Grundlage, Seite 13
I GEOGRAPHIE
A Geographie
Das Niederamt ist eine Region, bestehend aus 17 Gemeinden, die zwischen Olten und Aarau (Kanton Solothurn/Schweiz), beidseitig entlang der Aare angesiedelt sind. Die Gesamtfläche, die das Gebiet bedeckt, erstreckt sich auf ca. 9600 Hektaren. Etwa 40 % (ca. 3820 ha) davon ist Wald, der grundsätzlich durch das Bundesgesetz über den Wald, gut geschützt ist.6 In seiner Erstausgabe von 1876 hiess es: Forstpolizeigesetz. Im Laufe des Buches werden wir auf die aktuellen Probleme zu sprechen kommen.
In den Gemeinden leben insgesamt etwa 41500 Personen. Wenn nun alle Leute gleichzeitig im Wald spazieren gehen würden, sähen wir auf jeder Hektare (100 x 100 Meter) Wald die grosse Zahl von 11 Homo sapiens. Das Niederamt ist also eine sehr dicht mit Menschen besiedelte Region.
In diesem Buch werden wir das Gebiet in drei Untergebiete aufteilen:
Jura : Kettenjura (Faltenjura) und wenige Gebiete des Tafeljuras
Aaretal: Schachenwälder entlang der Aare
Mittelland: Ebenes und hügeliges Mittelland
Die Wälder im Jura des Niederamtes befinden sich zu Recht im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN 1017).7
B Geschichte
Es werden hier nur einige Hinweise gegeben; für eine genaueres Geschichtsbild siehe zum Beispiel die Solothurner Geschichte von Amiet.8
Jungsteinzeit
Bereits in der Jungsteinzeit (Neolithikum) , die das Zeitfenster von vor 7’500 Jahren bis etwa vor 3’800 Jahren abdeckt, war das Niederamt «dicht» besiedelt. In einem Zehn-Kilometer-Umkreis von Olten fanden sich über dreihundert Fundstellen mit Spuren menschlicher Ansiedlungen.9 Ob im Niederamt auch Pfahlbausiedlungen existiert haben, wissen wir nicht, können es aber annehmen.10
Fey schreibt, dass besonders das Vorkommen von Silex oder Feuerstein, dem Material, das für die Herstellung von Werkzeugen und Waffen ein unabdingbarer Rohstoff war, die Ansiedlung begünstigte. Ein Bergwerk im Chalchofen beim Dorf Wangen lieferte den begehrten Rohstoff. Aus diesem wurden dann die bekannten Pfeilspitzen hergestellt. Ein Beispiel einer Pfeilspitze aus der Jungsteinzeit, die im Niederamt gefunden wurde, sehen wir am Textrand.
Nicht nur der Silex, wohl hauptsächlich die attraktive Wohnlage lud zur Niederlassung ein. Zu jener Zeit waren in den Siedlungen folgende Haustiere vorhanden: Hund, Schwein, Ziege, Schaf und Hausrind.11 Die Tiere kamen mit den Ansiedlern ins Land und waren nicht aus den bereits vorkommenden Arten gezüchtet worden. Durchwegs waren die Tiere kleiner als die heute vorkommenden Arten.
Der Mensch war ein sesshafter Landwirt geworden, der auch Vieh züchtete. Es sind wenig Skelettreste vorhanden, diese deuten auf einen kleinen Körperbau hin.12 Anhand der Grabfunde in den Studenweid-Kiesgruben in der Gemeinde Däniken weiss man, dass die Neolithiker nur eine Körperlänge von 140 bis 160 cm erreichten. Die Toten in Däniken waren in Hocker- oder Schlafstellung in Steinkistengräber beerdigt worden. Die vielen Grabbeigaben wie Schmuck, Werkzeuge und Pfeilspitzen deuten darauf hin, dass die Menschen an ein Weiterleben nach dem Tode glaubten. 13
An Früchten und Gemüsen wurden gesammelt und angebaut: Erbsen, Linsen, Möhren und Äpfel. Auf den Äckern wuchsen Weizen, Gerste, Hirse und Emmer.14
Von den Wildtieren wurde vor allem der Edelhirsch gejagt, aber auch die Wildschweine waren beliebt. In den Wäldern streiften noch Braunbären und die Biber fanden hier ideale Lebensbedingungen vor.15
Damals war wohl die grösste Ausdehnung des Waldes im Niederamt erreicht. Es war der sogenannte Eichen-Hainbuchenwald.16 Dieser erstreckte sich beidseitig links und rechts der Aare, hinter den flussnahen Weiden(Salix) und Erlen(Alnus). Vom Engelberg bis zur Wöschnau standen die Buchen (Fagus) an den trockenen Standorten.
Bronzezeit (2200 bis 700 v.Chr.)
Fester Bestandteil der Bronze ist immer Kupfer, 60 Prozent müssen davon enthalten sein, damit heute von Bronze gesprochen werden kann. In der Bronzezeit (1800 bis 700 vor Christus) bestand Bronze aus Kupfer und Zinn. Auch heute wird noch Zinnbronze verwendet. Da im Niederamt die Metalle Kupfer und Zinn nur spärlich vorkommen, müssen die Bronze-Gegenstände mit dem Handel oder der Einwanderung neuer Bewohner den Weg hierher gefunden haben. Aus der Bronzezeit finden sich nur wenig Spuren im Niederamt. In einer Höhle im Käsloch in der Gemeinde Winznau hielten sich Menschen auf. In Dulliken vermutet man eine Siedlung im Chrüzacker.17 Interessant ist übrigens, dass in dieser Zeit das domestizierte Hauspferd eingeführt wurde. In den letzten Jahren haben viele Landwirte hier im Niederamt ihre Betriebe auf Pferdepensionen umgestellt. Die Pferde werden heute aber nicht mehr zum Arbeiten auf dem Feld gebraucht. Da viele Schwerter gefunden wurden, gehen die Historiker von einer eher kriegerischen Epoche aus.18
Eisenzeit (700 bis 15 v.Chr.)
In diese Zeit fällt der Bau des berühmten Refugiums vom Eppenberg.19
Da bei den Ausgrabungen, finanziert von dem Unternehmer Bally, eine Tonschale aus der jüngeren Eisenzeit (Latènezeit,450 v.Chr. bis 15 v.Chr.) und eine zweite Tonschale aus der älteren Eisenzeit (700 bis 450 v.Chr.) stammen, wissen wir in welcher Zeit die Anlage besiedelt war.
Im 19. Jahrhundert wurde das Refugium «Heidenschanze Ebenberg» genannt.20
Die Siedlung ist gegen Norden durch eine 20 – 40 Meter hohe, senkrechte Felswand geschützt. Auf den anderen Seiten wurde der Ort durch einen gebauten Wall geschützt. Auf der Aussenseite türmte er sich bis zu 8 Metern auf, im Innern der Anlage war er ein bis zwei Meter hoch. Der Wald war mit Eichen (Quercus) bestockt. Die eingeschlossene Fläche beträgt 12,7 Hektaren, es konnten also Tausende von Menschen mit ihrem Vieh hier Zuflucht suchen.21
Das Bau-Datum des Refugiums ist weiterhin umstritten, respektive nicht bekannt. Der Kantonsarchäologe Pierre Grab, denkt die Bauarbeiten hätten in der jüngeren Eisenzeit, so 100 bis 200 Jahre vor Christus, stattgefunden.22 Bauherren waren Helvetier, ein keltischer Stamm. Sie lebten vom Ackerbau und der Jagd.