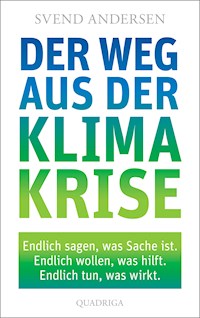
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Quadriga
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Klimakrise ist das drängendste Thema, die wichtigste Aufgabe der kommenden Jahre, da sind sich alle Politiker einig! Doch wissen sie eigentlich, was sie wirklich tun müssten, welche Instrumente längst da sind - und welche wirken? Als Treibhausgas-Experte hat der Deutsche Svend Andersen Antworten, denn in seiner Wahlheimat Kanada ist Klimaschutz längst Staatsauftrag. Treibhausgas-Buchhalter Andersen analysiert und zeigt, wie mit wenigen Maßnahmen große Wirkung erzielt werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorenTitelImpressumZitatVorwort1. KLARTEXT: Die Wahrheit auf dem Vulkan: Wo wir in der Klimakrise wirklich stehenHigh Noon auf Hawai’i: Die Werte der Keeling-Kurve sagen allesEine moralische Verpflichtung: Wissen, was Sache istWarum wir Treibhausgase beim Namen nennen solltenVon Wolken, Molekülen und fernen Strahlen: Der TreibhauseffektVon GWP und CO₂Äq: Wie werden Treibhausgase eigentlich berechnet?Eine Institution namens IPCC: Die Schaltzentrale der KlimakriseEmissionen und ihre Quellen: Das sind unsere dicksten BrockenStürmische Zeiten vor unserer Haustür: Die Folgen des KlimawandelsDie größte Klimaschutzbremse: Fadenscheiniges Tun statt echten Handelns2. KOPFSACHE: Emissionsarmes Frühstück ist gut, erkenntnisreiches Handeln besser: Warum wir persönlich umdenken solltenWer das Problem ernst nimmt, sollte auch die Herangehensweise ernst nehmenÖkologie und Klimaschutz: Zwei völlig verschiedene WeltenZwischen Lochkarten, Kowloon und Kanada:Mein Weg zum TreibhausgasbuchhalterEtwas wirklich Neues schaffen: »Actionable Insights«3. KURSKORREKTUR: Besser gute und gerechte Wege gehen statt draufzahlen und verlieren: Warum CO₂-Steuer und Zertifikate der Wirtschaft und uns nur schadenZwischen Palmen und Profit: Lukrative Geschäfte im Rahmen des GesetzesDie großen Widerhaken im Klimaschutz: Opportunismus, Etikettenschwindel, GreenwashingKlare Spielregeln, klare Kriterien, klare Kante: Eine Navigationshilfe für den Markt der ZukunftUngerecht und wirkungslos: Die CO₂-Steuer ist ein volkswirtschaftlicher DinosaurierAnachronismus Nummer zwei: Warum der Emissionshandel ein schlechter Deal istDringend gefragt: Warum ordnungspolitische Lösungen uns den Weg öffnen4. AUFBRUCH: So kriegen wir die Klimakrise geregelt: Gute Gesetze fordern, kluge Lösungen fördern – und Strom und Co. von den Emissionen befreienDas internationale Tauziehen ums Klima: Eine Reise nach Nirgendwo, die endlich ein Ziel brauchtOffene Ohren statt vorgekauter Meinungsnahrung: Nur so einigen wir uns auf einen guten WegVon British Columbia lernen, wie es geht: Deutschland muss als größter Emittent Vorreiter in Europa sein»Neugift« oder die Wasser-Analogie: Warum ordnungspolitische Maßnahmen unsere Pflicht sindGanz oben auf der Liste: Eine saubere Antwort auf die große EnergiefrageRegeln statt nur kennzeichnen: So kriegen wir den Strom in den GriffRegulieren und unterstützen:So drücken wir die Stromemissionen Richtung nullEnergie klug speichern: Pumpspeicherwerke sind das Mittel der WahlWo klimaneutral draufsteht, muss auch klimaneutral drin seinBäume, Moore, Meer: Der natürliche Weg zur Netto-NullE-Autos, autonome Minibusse und die richtige Schiene fahren: So klappt die TransportwendeUnternehmen: Regulierter Klimaschutz bedeutet ZukunftKlarheit schaffen: Die wichtigste Verantwortung der BundesländerGemeindesache: Lieber genau hinschauen als Vorgefertigtes nachmachenGemeinsam stark: Comox-Projekte in den GemeindenWas kann ich selbst fürs Klima tun – um wirklich etwas zu bewegen?NachwortDanksagungWeiterführende LiteraturQuellenverzeichnisÜber dieses Buch
Die Klima-Krise ist das drängendste Thema, die wichtigste Aufgabe der kommenden Jahre, da sind sich alle Politiker einig! Doch wissen sie eigentlich, was sie wirklich tun müssten, welche Instrumente längst da sind - und welche wirken? Als Treibhausgas-Experte hat der Deutsche Svend Andersen Antworten, denn in seiner Wahlheimat Kanada ist Klimaschutz längst Staatsauftrag. Treibhausgas-Buchhalter Andersen analysiert und zeigt, wie mit wenigen Maßnahmen große Wirkung erzielt werden kann.
Über die Autoren
Svend Andersen, MBA, Dipl.-Psych., ist Treibhausgasbuchhalter, Klimaschutzexperte und Psychologe mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Umweltmanagement. Svend hat sich seit 2005 auf die Arbeit mit den ISO 14000-Reihen und den Treibhausgas-Buchhaltungsstandards ISO 14067/9/4-1/2/3 konzentriert. 2009 gründete er GHG Accounting, die Firmen und Institutionen bei der Erreichung ihrer Umweltmanagementziele unterstützt. Svend war in leitenden Positionen in Kanada, Hongkong, Deutschland und den USA tätig. Er wurde 2015 vom Bundesumweltministerium und von der Universität Süddänemark eingeladen, einen Beitrag zu den kommunalen Komponenten der COP 21-Erklärungen der Vereinten Nationen in Paris zu leisten. Das von Svend und seinem Team entwickelte Treibhausgasbilanzierungssystem wird von der Regierung von British Columbia genutzt, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Klimaneutralität für alle öffentlichen Einrichtungen zu überwachen. Svend Andersen ist Gastdozent an der University of British Columbia, dem British Columbia Institute of Technology und der Simon Fraser University.
Marc Bielefeld, 1966 in Genf geboren, hat als Journalist zahlreiche Artikel und Reportagen geschrieben u.a. für mare, Merian, National Geographic, Die Zeit oder Süddeutsche Zeitung. Er hat mehrere Bücher geschrieben und als Co-Autor u.a. mit Heidi Hetzer UNGEBREMST LEBEN (Ludwig) und zuletzt den KREBS-KOMPASS (C. Bertelsmann) mit Verena und Achim Sam. Momentan arbeitet er mit der Politikerin Diana Kinnert an einem Buch über das Phänomen der modernen gesellschaftlichen Vereinsamung (ET Frühjahr 2021).
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Angela Kuepper, München
Umschlaggestaltung: U1berlin/Patrizia Di Stefano
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1503-4
quadriga.de
luebbe.de
lesejury.de
An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.
Erich Kästner
Vorwort
Als der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore den Klimawandel 2005 zum großen Thema machte und in einer Serie von über tausend Reden über dessen Ursachen und Auswirkungen sprach, hatte er einen passenden Namen für sein Wachrütteln gewählt. Er nannte es »Inconvenient Truth«, eine unbequeme Wahrheit. Ein Jahr darauf wurde daraus sogar ein prämierter Film. Ich hatte damals die Gelegenheit, Al Gore bei einem seiner Auftritte live zu erleben. Und schon davor hatte ich den Klimaschutz zu meiner Lebensaufgabe gemacht, als Treibhausgasbuchhalter schließlich zu meinem Beruf.
Nach Al Gores Präsentation damals dachte ich, dass eine derart große öffentliche Aufmerksamkeit die Dinge beim Klimaschutz endlich ins Rollen bringen würde. Sechzehn Jahre später muss ich leider feststellen, dass es die unbequemen Wahrheiten noch immer gibt. Und mehr als das: Inzwischen sind daraus erschreckende Wahrheiten geworden. Noch viel alarmierender allerdings ist die Tatsache, dass diese Wahrheiten sich nicht mehr auf das beschränken, was die meisten erwarten würden: nämlich, dass wir bisher einfach nicht genug getan haben, um die Klimakrise abzuwenden. Längst sind wir einige Stadien weiter. Heute stehen wir vor erdrückenden Tatsachen. Vor blanken Fakten und nicht zu leugnenden Entwicklungen, die uns mehr und mehr davon abhalten, diese Krise überhaupt noch zu bewältigen, und stattdessen drohen, unsere Gesellschaft zu zersprengen. Im Klartext: Inzwischen müssen wir befürchten, dass wir an der Klimakrise katastrophal scheitern werden. Und ich muss mich nur umschauen, um zu erkennen, dass sich dieses Szenario immer realer abzeichnet.
In den sozialen Medien wird mit aller Härte gestritten, wie wir als Gesellschaft mit den existenziellen Bedrohungen für die nächsten Generationen umgehen sollen. Längst ist die Debatte einem erbitterten Schlagabtausch gewichen. Bei der Frage, wie stark die Preise für Energie erhöht werden dürfen, ohne dass es zu sozialen Verwerfungen kommt, ist mehr zorniges Chaos zu beobachten als der Wille zu Übereinkünften.
All das zeigt, wie weit wir davon entfernt sind, diese Krise zu lösen. Es herrschen Wirrnis statt Wahrheit, Übervorteilung statt Bewältigung. Derweil vernehmen wir die üblichen Narrative. Uns wird erzählt, dass wir uns einschränken müssen. Dass wir umsichtiger essen sollen, weniger fliegen dürfen und mehr Fahrrad fahren müssen. Dann wieder hören wir, dass Zertifikate die Lösung sind. Dass wir uns einem Emissionshandelssystem anpassen und immer mehr für Energie zahlen müssen.
Wer jedoch genau hinhört und hinsieht, stellt fest, dass es einen wirklichen Plan nicht gibt. Um diese globale Krise zu bewältigen, werden immer wieder neue Ziele formuliert – doch weit und breit ist keine Strategie erkennbar, die diesen Namen verdient. Als Treibhausgasbuchhalter, der sich täglich mit Klimaschutz befasst, kann ich in Deutschland keinen erfolgversprechenden Kurs erkennen – und das, obwohl wir seit Jahrzehnten wissen, dass wir ein Problem haben. Was also ist der Ausweg? Wo finden wir eine praktikable Methode, um uns aus dem Dilemma zu holen?
Es wird gern behauptet, wir hätten sämtliches Wissen und auch die nötigen Technologien, um zu handeln. Beides müssten wir nur noch anwenden. Doch da habe ich meine Zweifel. Denn wenn dies der Fall wäre – dann hätten wir längst gehandelt.
Mir scheint indes, dass es sich ganz anders verhält. Wenn ich Vorträge halte oder an Universitäten spreche, stelle ich immer wieder fest, dass die Konzepte, Prinzipien und Einsichten der Treibhausgasbuchhaltung fast niemandem vertraut sind. Dabei beschäftigt sich die Treibhausgasbuchhaltung unmittelbar mit dem Kern des Problems. Hier geht es ausschließlich um die Emissionen, um ihre Ursachen und um die Methoden, sie zu reduzieren. Und dies mit wissenschaftlicher Präzision, bis zu den Kommastellen. Das mag sich trocken anhören, doch wie heißt es so schön: Was wir nicht messen oder gar präzise beschreiben können, das können wir auch nicht managen. Und schon gar nicht lösen.
Darum erschreckt es mich regelrecht, dass die Mechanismen und quantitativen Aspekte der Treibhausgasthematik so wenig bekannt sind – obwohl die Treibhausgase doch der Casus knacksus der Klimakrise sind und in der präzisen Beschäftigung mit ihnen der Schlüssel zur Lösung liegt.
Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist für die Klimakrise verantwortlich. Dies und nichts anderes ist der singuläre und wichtigste Faktor, um den wir uns kümmern müssen. Nichtsdestotrotz würde ich – auch nach über einem Jahrzehnt der Berufserfahrung – behaupten, dass es in der Tat noch immer nur sehr wenige Menschen gibt, die sich professionell und unabhängig mit der Entstehung und Vermeidung von Treibhausgasen beschäftigen.
Auf der anderen Seite sehen wir viele wichtige Beiträge zur Klimakrise, sie erreichen uns aus allen Himmelsrichtungen. Bei genauer Betrachtung jedoch befassen sie sich nicht so sehr mit den Ursachen des Problems, dafür umso mehr mit den Auswirkungen.
Womöglich ist es spannender, über die neuesten Waldbrände zu berichten, Wirbelstürme zu zeigen und immer neue Dürren zu konstatieren. Doch damit starren wir lediglich auf unsere eigene Zukunft und verharren in einer Faszination des Schreckens. Keine gute Idee. Aus dieser pubertären Phase sollten wir inzwischen rausgewachsen sein. Denn wenn wir weiter auf das Inferno blicken, während uns das Dach über dem Kopf abbrennt, ist es bald zu spät. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir haben nur noch eine Chance, das Ruder herumzureißen. Deutlich gesagt: Nichts oder das Falsche zu tun ist jetzt keine Option mehr.
Angesichts dieser prekären Situation sollten wir es darum als unsere Pflicht ansehen, besser informiert zu sein. Sollten es uns dringend zur Aufgabe machen, die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen unter die Lupe zu nehmen, um deren Gefahren und Fallstricke zu erkennen. Und dann sollten wir auch dies tun: offen sein für echte Handlungsalternativen, bereit für jene Schritte, mit denen wir zügig und sicher vorankommen.
In diesem Buch habe ich darum alle wichtigen Aspekte der Treibhausgasproblematik zusammengetragen und lege die entscheidenden Einsichten offen. Mich wundert, dass dies bisher noch nie jemand getan hat: das Einmaleins der Emissionen aus Sicht eines Emissionsexperten erklären und die Säulen des Klimaschutzes somit viel präziser begreifen. Mit diesem Wissen jedoch ergeben sich nicht nur neue Perspektiven. Wir gewinnen auf diese Weise ein anderes Verständnis der Situation und schärfen den Blick für einen transparenten und praktikablen Weg aus der Krise.
Das Buch gliedert sich dafür in vier Teile. Im ersten Kapitel reden wir Klartext. Wo liegen wir derzeit bei den Treibhausgasemissionen? Worauf steuern wir zu? Das zweite Kapitel legt offen, warum es eine Illusion ist, wenn wir glauben, die Emissionen durch unser persönliches Verhalten ausreichend reduzieren zu können. Gefragt ist hier ein Umdenken, im besten Fall ein Engagement auf anderer Ebene. Das dritte Kapitel seziert die marktbasierten Instrumente, mit denen uns die Politik derzeit aus der Misere wirtschaften will: die CO₂-Steuer und den Emissionshandel. Sehen wir uns die Historie dieser beiden Werkzeuge an und messen sie an wissenschaftlichen Standards, wird klar: Im Vergleich zum internationalen Wissensstand steckt Deutschland in der klimapolitischen Steinzeit fest. Und was uns dabei noch immer als Allheilmittel verkauft wird, entpuppt sich als Scheinlösung – mit erheblicher gesellschaftlicher Sprengkraft.
Im letzten Teil des Buches zeige ich schließlich die Möglichkeiten auf, wie wir mit den besprochenen Inhalten und Erkenntnissen umgehen können. Und auch umgehen sollten. Denn wenn wir das Wissen anwenden, zeichnet sich der Weg logisch ab: ein ordnungspolitischer Aufbruch, der uns effektiv aus der Krise führen könnte – praktikabel, sozial und ökonomisch gerecht sowie in Übereinstimmung mit unseren freiheitlichen Grundwerten.
Noch ist es möglich, die Katastrophe abzuwenden. Und auch Sie können dazu beitragen. Nicht jedoch allein, sondern nur gemeinsam mit anderen.
Manche werden es vielleicht nicht gerne hören, doch bei der Klimakrise handelt es sich nicht um eine Modeerscheinung. Auch haben wir es hier nicht mit einer Jugendbewegung zu tun, nicht mit dem Hobby von Klimaaktivisten und auch nicht mit einem politischen Thema. Es geht um Menschenleben, und zwar knallhart. Der Klimawandel wird die Lebensbedingungen auf unserem Planeten so drastisch verändern, dass es für Millionen von Menschen ums nackte Überleben gehen wird. Angesichts dieser Aussicht ist es wohl angemessen, zu sagen, dass wir es jetzt mit einer moralischen Verpflichtung zu tun haben. Wir müssen uns informieren. Wir müssen wissen, was Sache ist. Und dann müssen wir tun, was wir am besten tun können, um uns und allen anderen dieses Schicksal zu ersparen.
Svend Andersen, Vancouver, im Juli 2021
1. KLARTEXTDie Wahrheit auf dem Vulkan: Wo wir in der Klimakrise wirklich stehen
Auf dem Dach des Mauna Loa lässt sich die ungeschminkte Realität regelrecht an der Luft ablesen: Hier oben werden die globalen Treibhausgase gemessen, die trotz E-Autos, CO₂-Steuern und neuer Reduktionsziele immer weiter zunehmen. Ein Besuch auf der Forschungsstation hält uns vor Augen, auf welche Fakten und Zusammenhänge wir uns jetzt dringend konzentrieren müssen. Darum: Was ist der Unterschied zwischen biogenen und anthropogenen Treibhausgasen? Was ist ein CO₂-Äquivalent, welches Erderwärmungspotenzial haben die einzelnen Treibhausgase? Wie können uns kleinste Moleküle derart einheizen? Und: Wer pustet sie eigentlich am heftigsten in den Himmel? In diesem Einmaleins des Klimawandels liegen die Knackpunkte unserer größten Krise – aber auch die Schlüssel zur Lösung.
High Noon auf Hawai’i: Die Werte der Keeling-Kurve sagen alles
Treibhausgasbuchhalter. Das hört sich so nüchtern und bürokratisch an. Nach Erbsenzählerei. Vorschriften, Paragrafen, Daten. Und das stimmt ja auch auf eine Weise. Immer wieder verbringe ich in meinem Beruf viel Zeit mit Zahlenkolonnen, Emissionswerten, Treibhausgasbilanzen. Ich evaluiere prozessbezogene Basisdaten für verschiedenste Instrumente des Treibhausgasmanagements, analysiere Stoff- und Materialströme, erstelle sogenannte Lebenszyklusanalysen. Man könnte mich darum auch einen Fußabdruckspezialisten nennen. Einen, der berechnet, wie viele Treibhausgase bestimmte Produkte in ihrem Produktleben denn nun genau verursachen, und zwar von A bis Z. Das kann eine Flasche Tomatensaft sein, ein Shampoo, ein Autoreifen oder auch ein Treibstoff wie Benzin. Dann wieder schaue ich, für wie viele Emissionen einzelne Unternehmen, Landkreise, ganze Städte und auch Regierungen verantwortlich sind. Wo und wie genau entstehen die Treibhausgase eigentlich? Was sind das für Treibhausgase? Und über welche Mengen reden wir überhaupt genau?
Es ist nicht so, dass ich mich dafür in Schornsteinen abseile, mit Sonden und Messgeräten Proben nehme und die Abgase anschließend auf angefeuchtetem Indikatorpapier analysiere. Auch klemme ich mich nicht hinter Kühlschränke oder Auspuffe und messe, was dort herauskommt. Das wäre nicht sehr praktisch, und im Übrigen existieren längst Tausende von Daten über solche Produkte und Prozesse. Zudem gibt es sogenannte Standards, wie man sie berechnet.
Der erste Schritt meiner Arbeit liegt immer darin, Klarheit zu schaffen. Was ist der Stand der Dinge? Was hängt womit zusammen? Danach allerdings geht es so schnell wie möglich darum, Lösungen zu finden. Als Klimaschutzberater rede ich dabei von »Actionable Insights«: auf Fakten basierende Antworten darauf, wie sich Emissionen am effektivsten reduzieren lassen – gezielt und je nach Situation. Das eigentliche Endergebnis meiner Funktion als Klimaschutzberater ist die Antwort auf die Frage: Was sind die effektivsten Klimaschutzmaßnahmen für ein bestimmtes Treibhausgasprofil?
Genau das ist mein Beruf. Und nach zwölf Jahren, denke ich, ist es höchste Zeit, die Methoden und Einsichten der Treibhausgasbuchhaltung zusammenzufassen und sie nicht nur auf die Klimakrise als Ganzes zu beziehen, sondern besonders auch auf Deutschland. Denn das ist neu. Erstaunlicherweise hat das noch nie jemand getan.
Zugegeben, meine Arbeit kann bisweilen kleinteilig und trocken sein. Und dann fühlt sie sich so gar nicht danach an, sich für etwas Wichtiges und Großes einzusetzen. Aber ich weiß, warum ich das tue. Oft spaziere ich durch meinen Lieblingswald nahe Vancouver, heute nur noch das Überbleibsel eines einst gewaltigen Küstenregenwalds. Ich sehe die Bartflechten, die dort wachsen, die Schwertfarne und Mooslandschaften. Dann schaue ich mir die mächtigen Bäume an und blicke anschließend hoch in den Himmel, um den es geht. Die Atmosphäre, die den Planeten umhüllt und ohne die unsere Erde lediglich eine Hölle aus Eis und tödlicher Strahlung wäre.
Atmosphäre. Das Wort stammt vom Altgriechischen atmós, was auf Deutsch so viel wie Dampf heißt. Eine Schicht, in der Wasserdampf aufsteigt und Wolken ziehen. Eine Schicht, die vornehmlich jedoch aus Stickstoff und Sauerstoff besteht, aus Argon, Edelgasen und Treibhausgasen. Ein Mantel aus chemischen Elementen, der das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht. Die Atmosphäre ist die Basis der Evolution, die Grundlage von allem. Bis in 15 Kilometern Höhe spielt sich in der Troposphäre das Wetter ab. Dann wird die Luft immer dünner, beginnen Stratosphäre und Mesosphäre. In 90 Kilometer Höhe ist ab der Kármán-Linie die Grenze zum Weltraum überschritten, danach verflüchtigt sich die gasförmige Hülle der Erde in der Thermosphäre und Exosphäre immer weiter. So vereinzelt und von der Sonnenenergie aufgebracht schwirren die Ionen und freien Elektronen dort oben umher, dass man ab 90 Kilometern Höhe auch von der Ionosphäre spricht.
Verrückt, dass sich meine Arbeit im Grunde um das Unsichtbare dreht. Um 5,15 Billiarden Tonnen Luft, die die Erde umhüllen und lediglich ein Millionstel ihrer Masse ausmachen. Genauer gesagt beschäftige ich mich sogar nur mit einem Bruchteil davon: nämlich mit den Treibhausgasen, deren Anteil an der gesamten Atmosphäre letztlich bei unter ein Prozent liegt – die allerdings eine entscheidende Rolle spielen.
Ich mag meine Arbeit. Gerade wegen ihrer Akribie. Denn all die Zahlen und Fakten bedeuten schließlich auch Wissen, Einsicht, Genauigkeit und Planbarkeit. Eine Voraussetzung, um Lösungen zu finden und effektiv handeln zu können. Egal in welcher Hinsicht – ganz besonders jedoch beim Klimaschutz. Aber nebenbei bemerkt: Ganz so trocken ist meine Arbeit als Treibhausgasbuchhalter auch wieder nicht. Manchmal entführt sie mich an höchst interessante Orte und bringt mich mit außergewöhnlichen Menschen zusammen. Und dann lande ich schon mal sonst wo. Zum Beispiel auf einem entlegenen Vulkanrücken mitten im Pazifik.
Es ist ein Donnerstagabend im April 2017, als ich in Vancouver ins Flugzeug steige und über das nächtliche Meer nach Westen fliege. Nach sechs Stunden landet die Maschine auf dem Kona International Airport von Big Island, der größten der Hawaii-Inseln, die selbst noch den alten polynesischen Namen Hawai’i trägt. Die Luft ist warm und schwül, als ich aus der Ankunftshalle spaziere, weiße Passatwolken ziehen am Himmel entlang. Über den nahen Highway rollen die Pick-up-Trucks und erinnern mich daran, dass ich nun in den USA bin. Allerdings ziemlich weit weg vom nächsten Festland. Japan liegt 6.600 Kilometer im Westen, Kalifornien 4.000 im Osten. Um mich herum der Stille Ozean.
Kurz darauf sitze ich in meinem kleinen Mietwagen, fahre über den Daniel K. Inouye Highway und mache mich auf zu meiner Unterkunft: ein einfaches Bed and Breakfast, eigentlich nur eine zum Gästezimmer umgebaute Garage. Auf dem Weg an der Nordküste entlang sehe ich bald, dass Hawai’i und besonders dieser Teil der Insel wenig mit dem Tropenparadies aus den Urlaubskatalogen zu tun haben. Von Luxushotels und Honeymoonern keine Spur, die meisten Touristen weilen lieber auf den bekannteren Inseln des Archipels, O’ahu, Maui, Kaua’i. Nach meiner Ankunft in Hilo weiß ich auch, warum. Die Stadt habe nicht mal genug Geld für ein eigenes Ordnungsamt, erfahre ich, als ich nach einem Parkplatz zwischen den alten Häusern suche. »Parken Sie irgendwo«, sagt ein Mann zu mir. »Spielt keine Rolle, hier gibt dir eh niemand einen Strafzettel.« Als ich schließlich meine Pension erreiche, strotzt auch sie nicht vor buntem Südseeambiente. Kein adretter Palmengarten, kein Jacuzzi, kein Pool. Dafür begrüßt mich der Besitzer umso freundlicher.
Und ich bin ja auch nicht zum Baden hier. Ich bin nach Hawai’i gekommen, um mit eigenen Augen zu sehen, wie es unserer Erde geht. Präziser: unserer Atmosphäre.
Später sitze ich wieder im Wagen und fahre gen Westen. Wie ein schwarzes Band zieht sich der Highway unter dem weiten Himmel die Berge hinauf. Das Seitenfenster steht offen, und die tropische Luft wird langsam kühler. Ich habe schon an Höhe gewonnen, inzwischen naht die Baumgrenze. Es ist faszinierend, in nur wenigen Stunden durch so viele verschiedene Klimazonen zu fahren. Jede einzelne ist geprägt von unterschiedlichen Pflanzen, Tieren, Farben. Und das nur, weil auf jeder einzelnen Höhenlage andere Temperaturen herrschen und die Niederschlagsmengen variieren.
Das Auto schaukelt auf einmal richtig, so heftig drücken die Windböen über die Flanken des dunklen Gesteins. Vor der Scheibe fliegen mir die Passatwolken entgegen, dahinter leuchtet der Himmel.
Zwischen zwei mächtigen Vulkanen treibe ich den Wagen weiter hinauf, bis ich auf einem Hochplateau ankomme. Rechts ragt ganz dicht der gewaltige Mauna Kea 4.207 Meter neben mir auf, doch mein Ziel erhebt sich zu meiner Linken ein Stück weiter in der Ferne. Ich bin auf dem Weg zum Gipfel des Mauna Loa, gemessen an seiner Fläche und Masse der mächtigste Vulkan der Erde: ein 4.169 Meter hoher, manchmal schneebedeckter Gigant mitten im Pazifik.
Während der Fahrt muss ich an meine Präsentationen und Vorträge denken, die ich oft halte. An die Leute, die von mir wissen wollen: »Was sagst du als Treibhausgasbuchhalter zur Lage – wo stehen wir? Wie schlimm ist es wirklich mit dem Klimawandel?«
Ich neige nicht zu Übertreibungen. Schwarzmalerei mag ich schon gar nicht. Lieber will ich die Dinge positiv sehen, nach vorn schauen und effektive Lösungen für den Klimaschutz finden. Und das auf der Grundlage von Daten und Fakten, um zu einer möglichst realistischen Einschätzung der Situation zu kommen. Es liegt in der Natur meines Berufs als Greenhouse Gas Accountant. Also erzähle ich den Menschen, die mich nach dem Klima fragen, von der Messstation auf dem Vulkan. Vom Mauna Loa. Denn die Daten und Fakten darüber, wie es um den Klimawandel wirklich steht, schweben dort oben buchstäblich in der Luft.
Heute will ich mich mit eigenen Augen vergewissern. Will selbst mit den Wissenschaftlern dort oben sprechen. Will sehen, wo die entscheidenden Werte stehen und wie sie sich in letzter Zeit entwickelt haben. Sie sind die Basis meiner Arbeit. Umso überzeugter kann ich meinen Zuhörern danach antworten: »Schaut euch die Werte der Keeling-Kurve an. Sie sind das Maß der Dinge, wenn es um den Klimawandel geht.«
In diesem Jahr bin ich aber noch aus einem anderen Grund nach Hawai’i gekommen. Kaum nämlich hatte Donald Trump sein Amt als Präsident der USA bekleidet, trat er aus dem Pariser Klimaabkommen aus und kippte gleich noch eine ganze Reihe weiterer Regulierungen und Budgets, die wenigstens halbwegs dabei halfen, die entscheidenden Emissionen zu reduzieren. Für das Team auf dem Vulkan muss es sich wie eine Ohrfeige angefühlt haben. Als wäre ihre langjährige Arbeit mit einem Schlag für nichtig erklärt worden. Ich will darum Solidarität zeigen, sie in ihrer Arbeit bestärken. Sogar ein Carepaket habe ich mitgebracht, typische Snacks und Gadgets aus Kanada. Eine Geste, die sagen soll: Bitte, bitte, macht weiter! Haltet durch, auch wenn es im Moment schwer ist. Wir brauchen die Werte! Wir brauchen euch! Wir brauchen alles, was geht, um das zu schaffen.
Seit einigen Kilometern ist kein Auto mehr entgegengekommen, die baumlose Landschaft mutet immer unwirklicher an. Eine Welt wie ein dürres Gerippe, übersät von Geröll und kargen schwarzbraunen Flächen. Die Straße, auf der ich fahre, wird nicht umsonst auch Saddle Road genannt. Sie durchquert die Hochebene zwischen den beiden großen Vulkanen der Insel. Ich bin sozusagen auf dem Rücken eines feuerspeienden Drachen unterwegs.
Gleich muss irgendwo die Abzweigung kommen, an einer Markierung zwischen Meile 27 und 28. Ich fahre langsam, halte Ausschau nach einer verwitterten Tafel, die den Weg nach ganz oben anzeigt und offenbar leicht zu übersehen ist. Noch eine Kurve, dann schiebt sich auf einmal eine tiefschwarze Masse in mein Blickfeld. Lava. Es sind die erkalteten Magmamassen, die den Vulkan ab 2.500 Metern Höhe flächendeckend überziehen. Ab hier steigen die Flanken immer flacher an bis zum eigentlichen Gipfel.
Endlich entdecke ich den Marker, biege ab und muss kurz anhalten. Verschnaufen. Nicht nur, weil die Luft hier oben so dünn ist, sondern auch wegen des einspurigen Wegs, der sich vor mir auftut. Gerade mal ein dünner Pfad, der sich in endlosen Kurven in die Weiten windet. Da mit dem Mietwagen hoch? Wenn ich vom Weg abkomme, werde ich den armen Kleinwagen an den spitzen Felsbrocken aufschlitzen! 30 Kilometer sind es noch bis zur Station. Also weiter. Vorsichtig gebe ich Gas, taste mich den Berg empor.
Die Fahrt gerät zur Schikanenroute. Die Luft wird noch einmal deutlich dünner, meine Atmung geht schneller, ich fühle mich leicht benommen. Das Mauna Loa Observatory liegt immerhin auf 3.397 Metern, und ich habe meine Fahrt vorhin an der Küste in Hilo begonnen, auf Meereshöhe. Wir reden über fast 3.500 Meter Höhenunterschied in weniger als zwei Stunden: nicht gerade viel Zeit, um sich an hochalpine Verhältnisse zu gewöhnen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit des Emporhoppelns stoße ich durch eine dünne Wolkendecke, und nun taucht endlich eine Abwechslung in der scharfkantigen Steinwelt auf: zwei bis drei Meter hohe Würfel, die in weiten Abständen und scheinbar willkürlich in dieser verrückten Mondlandschaft aufgestellt worden sind. Ganz nah komme ich an einigen der silbern glänzenden Kästen vorbei. Wähne mich schon fast wie in einem Jules-Verne-Roman und habe das seltsame Gefühl, beobachtet zu werden.
Nun wird der Weg noch einmal steiler, bevor am ausladenden Grat ein silbrig glänzendes Hüttendorf auftaucht. Ich erreiche einen kleinen Parkplatz, stelle den Wagen ab. Ein hoher Sicherheitszaun umfängt die Station. Die letzten 500 Meter muss ich zu Fuß gehen.
Dann erreiche ich jenen Ort, von dem ich in meinen Vorträgen immer erzähle. Für mich – und sicher alle, die hier oben arbeiten – ist dies ein ganz besonderer Ort. Es gibt ihn nur einmal auf der Welt. Eine Art Mahnmal, könnte man sagen. Ein Wallfahrtsort der Wahrheit. Genau hierher nämlich kommt jener Messwert, der wegweisender sein sollte als alle Börsenkurse, ausschlaggebender als alle Politbarometer dieser Welt. Es handelt sich um eine dreistellige Zahl, mit einigen Kommastellen dahinter. Gemessen über Monate und Jahre, ergibt dieser Wert sozusagen eine Fieberkurve des Planeten. Und sein täglich aktueller Stand bedeutet nichts anderes als das: eine Momentaufnahme, wie es unserer Erde klimatechnisch gerade geht.
Aidan kommt mir schon entgegen, Colton sein Nachname. Ein drahtiger junger Mann mit langen Koteletten, einem roten Basecap auf dem Kopf und einer grünen Daunenweste über der Jeans. Er hat einen Abschluss vom Boston College, ist ein Experte der Umwelt-Geowissenschaften und arbeitet seit Jahren hier oben auf dem einsamen Dach des Pazifiks. Wir begrüßen uns, ein schnelles Hallo im kalten Wind, dann nimmt er mich auch schon mit, um die letzten Meter zum sogenannten Keeling-Haus zu gehen. Wir kommen an mehreren hüttenartigen Gebäuden vorbei und bleiben an einer kleinen Bude aus Fertigteilen stehen. Daneben: Antennen, Messgeräte. Aus dem Dach ragen zwei lange Rohre. Nur eine Butze ist dieses sagenumwobene Keeling Building. Gerade mal ein paar Quadratmeter Blech, die der Menschheit einen unschätzbaren Dienst erwiesen haben.
Bereits 1958 begann der Klimaforscher Charles David Keeling mit seiner Arbeit an der Scripps Institution of Oceanography. Die Aufgabe, der er sich stellte, war damals ziemlich revolutionär. Keeling machte sich als Erster daran, systematisch den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre zu messen. Eine seiner Messstationen errichtete er dafür schon bald hoch oben auf dem Mauna Loa.
Das Dach des hawaiianischen Vulkans liegt weit entfernt von großen CO₂-Quellen, die seine Messungen hätten beeinflussen können. Zudem spielen die Höhe und auch die besondere Umgebung bei Messungen dieser Art eine wichtige Rolle. Keelings auserwählter Messpunkt lag damals wie heute so gut wie immer über der Wolkendecke. Nicht einmal die umliegenden Inseln mit ihren wenigen Häfen und Flughäfen konnten seine Werte beeinträchtigen. Einen weiteren Vorteil bietet die geologische Beschaffenheit des abgelegenen Vulkans. Die lavaschwarze Bergkuppe heizt sich am Tag in der Sonne stark auf – wenn sie sich nachts wieder abkühlt, saugt sie Luft aus noch höheren Luftschichten nach unten. So konnte schon Keeling seine Daten aus perfekt durchmischten Luftschichten gewinnen. Luftschichten, die einen möglichst konsistenten Messpunkt darstellen – unverfälscht von lokalen und bodennahen Ereignissen. Die Wahl des Standorts war entscheidend: Die Station der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) auf dem Mauna Loa hat sich deshalb und aufgrund der kontinuierlichen Messreihe seit 1958 zum globalen Referenzpunkt entwickelt, um systemische Veränderungen des CO₂-Gehalts in der Erdatmosphäre zu erfassen. Fast dreieinhalb Kilometer über dem Pazifik wird bis heute die sogenannte Keeling-Kurve ermittelt. Ein extrem wichtiger Referenzwert, der von der Wissenschaft in aller Welt akzeptiert ist, wenn es um den Treibhauseffekt geht.
Die Keeling-Kurve ist bis heute die wichtigste Referenz, wenn es um die CO₂- Konzentration in der Erdatmosphäre geht. Seit Jahrzehnten steigen die Werte immer schneller an. Bei etwa 500 ppm ist der Point of no Return erreicht: Die Erderwärmung wird sich dann nicht mehr aufhalten lassen. Wer die monatlichen Werte der Messstation verfolgen möchte, kann das auf folgender Website tun:
www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html
Anfangs sorgten die Messungen für Verwirrung. Keeling stellte nämlich gleich zu Beginn fest, dass die CO₂-Werte signifikante Schwankungen aufwiesen. Doch was war der Grund dafür? Erst als er die Messungen beharrlich fortsetzte, erkannte Keeling schließlich ein saisonales Muster. Zum Sommer nahm der CO₂-Wert in der Atmosphäre jeweils ab, zum Winter stieg er wieder an. Die Erklärung lag auf der Hand: Die schwankenden Werte konnten nur eine Reflexion des natürlichen Vegetationszyklus auf der Nordhalbkugel darstellen. Dort, wo der größte Teil der Landmasse auf der Erde zu finden ist.
Wenn die unzähligen Bäume und Pflanzen im Frühjahr wachsen, nehmen sie gigantische Mengen des CO₂ aus der Atmosphäre auf. Im Herbst jedoch, wenn die Blätter von den Bäumen fallen und biologisch abgebaut werden, wird ein Teil dieses CO₂ wieder an die Atmosphäre abgegeben – allerdings in geringerem Maße als im Frühjahr aufgenommen. Der Grund: Bäume, Pflanzen und Wurzeln gewinnen über den Sommer an Masse über und unter der Erde, worin stets beträchtliche Mengen CO₂ gespeichert bleiben.
Die grüne Natur um uns herum ist sozusagen aus CO₂ gemacht. Die durch Fotosynthese entstehenden Kohlenhydrate bilden die Substanz aller Pflanzen. Das gilt auch für das Gemüse, das wir essen. Und es gilt sogar für uns Menschen: Auch wir sind sozusagen aus atmosphärischem CO₂ »gemacht«. Darum, nebenbei bemerkt: Kohlenstoffdioxid als chemische Substanz generell zu verteufeln ist irreführend.
Der oszillierende jahreszeitliche Zyklus, den Keeling beobachtete, stellte also nichts anderes dar als natürliche Schwankungen im großen Gefüge der Natur. Die Kohlenstoffe und Kohlenstoffdioxide, die Teil dieses periodischen Kreislaufs sind, müssen darum rein natürlich sein: Sie werden deshalb als biogen bezeichnet.
Doch über die Zeit beobachtete Keeling noch einen anderen Trend. Der Kohlenstoffdioxidgehalt, den er auf seiner Station präzise ablesen konnte, stieg schon innerhalb der ersten zehn Jahre stetig an – und bald lagen die Werte weit über jener Amplitude, die er vom natürlichen Zyklus inzwischen kannte. Und mehr noch: Der Anstieg nahm Jahr für Jahr an Fahrt auf. Die CO₂-Werte kletterten vor seinen Augen nicht nur immer höher, sie stiegen auch immer schneller.
Keeling war beunruhigt. Da stimmte etwas nicht. Was bisher immer in relativ stabilen Grenzen ausschlug, veränderte sich auf einmal. Veränderte sich rapide und sprengte die bekannten Limits.
Der logische Schluss konnte nur darin liegen, dass jedes Jahr größere Mengen an CO₂ in die Atmosphäre eingebracht wurden – dies zudem sehr konsistent und in sehr großen Mengen. Ich kann mir leibhaftig vorstellen, wie ihm zumute war, als er mal wieder oben auf dem Vulkan weilte, die Werte ablas und sich einen Reim auf das seltsame Geschehen zu machen versuchte. Es muss erschreckend gewesen sein.
Keeling war schnell klar, dass es sich hier um keinen natürlichen Prozess handeln konnte. Auch wenn sein Untersuchungsgegenstand ungeheure Dimensionen besaß. Immerhin ging es hier um die gesamte Erdatmosphäre, mit der auf einmal seltsame Dinge geschahen.
Doch Keeling war sich sicher: Keine natürliche Ursache konnte dafür verantwortlich sein, dass sich Jahr für Jahr derart große Mengen an CO₂ in der Atmosphäre ansammelten. Seine Schlussfolgerung, so wahnwitzig sie im ersten Moment auch schien: Auslöser des kuriosen Anstiegs konnte nur der Mensch sein.
Keeling recherchierte, sah sich verschiedene Daten und Erhebungen an, die vor allem globale und maßgebliche Veränderungen auf der Welt abbildeten. Bis er schließlich eine signifikante Parallele entdeckte. Dargestellt als historische Kurve, verliefen die zunehmende Industrialisierung und die Nutzung fossiler Brennstoffe äußerst ähnlich zu den ansteigenden Mengen an CO₂ in der Atmosphäre. Es konnte demnach nicht am biogen produzierten CO₂ der Natur liegen, dass seine Messwerte stetig weiter nach oben kletterten – sondern nur am menschengemachten Kohlenstoffdioxid, also am anthropogenen CO₂ der Zivilisation.
Andere Forschungen bestätigten seine Vermutung. Ein wichtiges Indiz: das sogenannte Indikator-Isotop C14. Die Konzentration von C14 in der Atmosphäre nahm ab, weil sich das C14 in dem Kohlenstoff aus fossilen Quellen nach Millionen von Jahren unter der Erde abgebaut hatte. Somit musste das zusätzliche CO₂ von fossilen Brennstoffen stammen.
Damit war eine sensible Grenze überschritten. Nicht mehr die Natur, sondern der Mensch war zum Hauptakteur auf der Erde geworden. Willkommen im Anthropozän – so nennen wir unser menschengemachtes Zeitalter inzwischen. Und nun kratzte der Mensch also auch an jener Hülle der Erde, die seit Hunderten von Millionen Jahren die Grundlage allen Lebens ist. Es muss Keeling wie ein Schlag getroffen haben. Denn was das CO₂ in der Atmosphäre bewirkt, war zu seiner Zeit bereits bekannt. Und heute bekommen wir die Folgen längst zu spüren.
Eine Ausrede, dass er nicht wusste, was auf ihn zukommen würde, hat der Mensch also nicht. Sogar schon 1896 hatte der schwedische Physiker, Chemiker und Nobelpreisträger Svante Arrhenius über die Konsequenzen eines CO₂-Anstiegs geschrieben. In der fünften Ausgabe des Wissenschaftsmagazins The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science veröffentlichte er die Ergebnisse seiner Forschung. Darin wird zum ersten Mal erwähnt, dass eine Erhöhung der Konzentration des CO₂ in der Atmosphäre zu einem Anstieg der Temperaturen führen würde.
Oben auf dem Vulkan stehen Aidan und ich nun direkt vor der berühmten kleinen Wellblechhütte. Mein Blick fällt auf eine bronzefarbene Plakette, die neben der Tür angebracht ist. Eine stilisierte Kurve ist darauf zu sehen und ein Schriftzug: Keeling Building. Doch dies ist nicht die Originalhütte von Charles Keeling, sondern ein neueres Gebäude, das nach ihm benannt wurde.
»Wie lange bleibst du eigentlich auf Hawai’i, wie viel Zeit hast du mitgebracht?«, fragt mich Aidan. »Ich zeige dir gerne die gesamte Anlage, immerhin unterstützt ihr seit Jahren unsere Arbeit.«
In seiner Daunenweste steht Aidan vor der Metalltür zum Keeling Building, der Wind zerrt an seiner Kappe. Ich antworte ihm nicht. Stehe da wie festgewurzelt, versunken in Gedanken, versunken in den Ausblick, der sich hier oben eröffnet. In der Ferne sehe ich das Meer, nur wenige Schritte links von mir neigt sich eine Bergflanke ins Endlose, dahinter drückt eine dünne Wolkenschicht gegen die westlichen Ausläufer des Vulkans.
Ich höre Aidans Stimme wie aus einem fernen Off. Dann blicke ich hoch, außer Atem wegen der Höhe. Der Himmel ist blau und völlig ungetrübt, doch je mehr ich den Kopf in den Nacken lege und je steiler ich nach oben schaue, desto dunkler scheint die Farbe des Himmels zu werden. Eines Tages muss der alte Keeling auch so hier oben gestanden haben. Stumm ins Firmament blickend.
Als Klimaforscher, der am California Institute of Technology lehrte, als Professor für Chemie, der später als Gastprofessor auch in Heidelberg und Bern arbeitete, wusste Keeling natürlich, was los war. Wusste, welche Rolle unter anderem das CO₂ da oben im Himmel spielt, in den ich gerade abwesend stiere.
Er wusste, dass die Wirkung von Kohlenstoffdioxid auf dessen molekularer Schwingungsfrequenz basiert. Wusste, dass diese Frequenz des CO₂-Moleküls der Wellencharakteristik von Wärmestrahlung entspricht, auch Infrarotstrahlung genannt. Und er wusste, was die Konsequenzen sein würden, wenn sich immer mehr CO₂ in der Atmosphäre ansammeln würde. Die Erde würde stetig wärmer werden, was eine ganze Reihe unabsehbarer Kettenreaktionen auslösen würde. Reaktionen, die zu fundamentalen Veränderungen führen könnten.
»Nur ein paar Tage«, sage ich nach einer viel zu langen Pause zu Aidan. »Dann muss ich zurück nach Kanada. Zeig mir so viel, wie du kannst. Ich will alles sehen.«
Aidan schließt die Tür auf, sie quietscht und könnte mal etwas Öl vertragen. Im Flur bleibt er vor einem Metallregal stehen, in dem eine nicht mehr ganz neue Gerätschaft ruht. Als ich frage, ob es das ist, was ich denke, nickt Aidan. Vor meinen Augen ist die Original-Messapparatur von Charles Keeling ausgestellt. Ich schaue mir jedes Detail an, jeden Regler und Fühler. Von einem kleinen Foto neben dem Gerät lächelt Professor Keeling mir entgegen wie ein guter Geist der Station. Ich trete näher, kann das fantastische Ding fast berühren. Im analogen Plotter von damals hängt noch immer ein Datenstreifen, als hätte Keeling die Maschine erst letzte Nacht benutzt.
Die Messinstrumente hier oben auf dem Mauna Loa liefern bis heute die unbestechlichen Werte der Keeling-Kurve. Aber natürlich ist inzwischen alles moderner, noch präziser. Die Sensoren, die Übermittlungsaggregate. Computer steuern die Systeme, wenige Klicks auf die Tasten genügen, um alles zu überwachen und bis auf die Kommastellen genau abzulesen. Heute wird die Luft über Schläuche vom Dach des Gebäudes in die modernen digitalen Instrumente geleitet. Aidan nimmt mich mit in den nächsten Raum. Hier kommt das atmosphärische CO₂ an und wird in die Geräte eingespeist, wo die Messungen schließlich stattfinden. Jede Nacht aufs Neue, wenn sich das schwarze Lavagestein der Bergkuppe abkühlt und die Luft aus den höheren Schichten zu sich hinabzieht wie ein thermischer Magnet. Ich schaue mir auch diese Gerätschaften genau an. Das ist es also, das heutige »Fieberthermometer« der Erde. Jenes Instrumentarium, das die unverfälschtesten und wahrsten Ergebnisse liefert, wenn es um den klimarelevanten Zustand des Patienten Erde geht.
Aidan öffnet den Reißverschluss seiner Weste, es ist warm in dem kleinen Raum. Dann setzt er sich auf einen alten Bürostuhl, weckt den Computer auf und klickt sich auf eine ellenlange Tabelle.
»Hier kannst du es sehen«, sagt er schließlich. »Gestern Abend waren wir bei 410,65 ppm. Nicht gut, aber es war schon mal schlimmer.«
Der Wert des atmosphärischen CO₂ wird in ppm gemessen, in parts per million. Dieser Wert stellt dar, wie viele Teile des wärmereflektierenden Treibhausgases sich in einer Million Teilen Luft befinden. Mitte 2016 hatte dieser Wert das erste Mal seit mehreren Millionen Jahren die Schwelle von 400 überschritten. Wissenschaftlern weltweit stockte der Atem. Nicht wegen der dünnen Luft, sondern weil dies ein historischer Moment war. Ein historischer Moment des Schreckens.
»Willst du die ganze Kurve sehen?«, fragt Aidan.
»Ja, am besten von dem Tag an, als Charles Keeling seine erste Messung aufzeichnete.«
Aidan braucht nur ein paar schnelle Klicks. Sich das gesamte Ausmaß des Klimawandels vor Augen zu führen, dauert heute nicht länger, als den Stand einer DAX-Aktie abzurufen.
»Hier haben wir das ganze Szenario«, sagt Aidan. »Krass, oder?«
Ich kann es sehen. Schwarz auf weiß. Hier oben auf dem Dach des Vulkans, wo die entscheidenden Werte jeden Abend einfach in der Luft schweben. Man muss sie nur messen. Als Charles Keeling dies das erste Mal tat, an einem milden Septembertag 1958, las er einen Wert von 316 ppm ab. Dieser lag damals bereits über jenem Wert, der heute als vorindustrielles Mittel angenommen wird: 280 ppm – ein CO₂-Pegel in der Atmosphäre, der auf der Erde über Jahrtausende der Status quo war.
Die langfristigen Daten über den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre erschließen sich uns zum Beispiel über Bohrkerne, die wir aus dem Meeresboden holen oder aus der Arktis bekommen. Die Zusammensetzung des Bodens und der eingeschlossenen Luft im Eis lassen nämlich präzise auf vergangene CO₂-Werte in der Atmosphäre schließen. Auf dem Vulkan sind die Daten aber noch zuverlässiger, weil der CO₂-Gehalt hier direkt in der Atmosphäre gemessen wird.
Im März 2021 – erdgeschichtlich nur mikroskopische 62,5 Jahre nach Keelings ersten Messungen – registrierten die Instrumente der NOAA-Station, vor denen Aidan und ich gerade sitzen, einen neuen Rekordwert: Gemessen wurde erstmals ein atmosphärisches CO₂ von 418,53 ppm.
Bei einem Wert von 500 ppm ist ein Punkt erreicht, bei dem der sogenannte Forcing Factor des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre eine so große Klimaveränderung auslöst, dass sie nicht mehr aufzuhalten sein wird. Wir erleben dann einen Point of no Return. Einen Kipppunkt, nach dem die Erderwärmung immer weiter voranschreitet, unaufhaltbar und von vielen losgetretenen Faktoren beschleunigt wie ein außer Kontrolle geratener Waldbrand. Andere forcierende Faktoren, die dies weiter beschleunigen, sind zum Beispiel das Schmelzen von rückspiegelnden Eismassen, der Effekt anderer Treibhausgase oder auch abgestorbene Waldflächen, die einstmals als riesige CO₂-Speicher dienten.
Die Auswirkungen wären unvorstellbar. Ein globaler Dominoeffekt, der von dramatischen Wetterveränderungen und Verwüstungen über den Anstieg des Meeresspiegels bis hin zu massiven Engpässen bei der weltweiten Versorgung mit Wasser und Nahrung führen würde. Von den unzähligen Neben- und Nachwirkungen, die das Leben auf dem Planeten unvorhersehbar verändern würden, ganz zu schweigen.
Aidan und ich sitzen noch immer vor den Zahlen und Kurven.
»Schau dir die einzelnen Monate seit 2016 an«, sagt er. »Alle über 400. Nun, du weißt ja, was das bedeutet. Du weißt es besser als ich. Schließlich bist du der Buchhalter der Treibhausgase.«
»Ja, ich weiß, was das bedeutet«, antworte ich.
Aidan führt mich weiter herum. Neben der Messapparatur für das CO₂ steht die Anlage zur Messung von atmosphärischem Methan. Auch das wird hier gemessen, allerdings in ppb, in parts per billion. Das Methan kommt im Vergleich zum CO₂ also in einer wesentlich geringeren Konzentration in der Atmosphäre vor, wobei das englische billion im Deutschen immerhin einer Milliarde entspricht. Doch weist Methan dafür einen viel höheren Wärmerückstrahlungswert auf als das CO₂. Das heißt, es sorgt für einen deutlich stärkeren Treibhauseffekt in der Atmosphäre.
Ich folge Aidan in den nächsten Raum. Auch hier stehen diverse Messinstrumente herum, hängen Dutzende Kurven an den Wänden. Sie gelten den ozonzerstörenden Substanzen, die ebenfalls auf dem Mauna Loa gemessen werden. Gemeint sind jene Fluorchlorkohlenwasserstoffe – abgekürzt FCKW –, die das Ozon in der Stratosphäre zersetzen. Diese Stoffe gehören auch zur Gruppe der Treibhausgase, und sie besitzen noch einmal deutlich krassere Wärmerückstrahlungswerte: Sie liegen 124- bis 14.800-mal so hoch wie beim CO₂.
Das Montrealer Protokoll, das 1987 vereinbart wurde und 1989 in Kraft trat, verbietet die Nutzung dieser Stoffe. Allerdings nicht wegen ihrer Wirkung als Treibhausgase, sondern um die Ozonschicht der Erde zu schützen. In regelmäßigen Abständen wird diese Vereinbarung an neue Erkenntnisse und aktuelle Messergebnisse angepasst. Das geschieht allerdings nur sporadisch, so zum Beispiel 1990 und 1992. Und an den Messkurven in diesem Raum lässt sich erkennen, dass die Konzentration der verbotenen Fluorchlorkohlenwasserstoffe seit Mitte der 1990er tatsächlich kontinuierlich sinkt. Interessant ist aber auch: Genau der Anteil jener Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die bis heute nicht verboten sind, steigt weiter. Aidan muss nichts sagen. Wir beide wissen um diesen entscheidenden Zusammenhang beim FCKW. Und nicht nur hier. Die Abschaffung bestimmter Stoffe spielt eine wesentliche Rolle auch bei der Klimakrise.
Aidan winkt mich herüber, ich soll ihm noch weiter folgen. Als Nächstes kommen wir in einen Rundbau, der aussieht wie eine kleine Sternwarte mit Kuppel. Statt eines Fernrohrs ist jedoch ein Lidar-Laser verbaut. Lidar steht für light detection and ranging. Hier wird nachts mit dem Laser die Ozonkonzentration gemessen, direkt über der Station. Und auch daran lässt sich ablesen, dass die ozonzerstörenden Substanzen in der Atmosphäre generell abnehmen, die Ozonanteile hingegen wieder zunehmen. Messungen aus dem All bestätigen es: Das Ozonloch über den Polen schließt sich im Moment langsam wieder. Endlich mal eine gute Nachricht, denke ich. Weiß allerdings auch: Die verbleibenden ozonzerstörenden Gase, die in ihrer Konzentration weiter zunehmen, müssen unbedingt im Montrealer Protokoll aufgenommen werden. Sonst wird der bisherige Erfolg wieder zunichtegemacht.
Auch Aidan weiß um diese Lücke. »Kein Wunder«, sagt er. »Was nicht klipp und klar geregelt wird, nimmt hemmungslos seinen Lauf. Von allein geschieht nun mal nichts.«
»Da triffst du einen Punkt«, sage ich.
»War schon immer so«, sagt Aidan. »Und wird immer so sein.«
Meine Tour durchs Mauna Loa Observatory geht noch ein bisschen weiter, denn es gibt noch mehr wichtige Messgeräte, die das Team überwacht. Wichtig sind auch die Sonnenenergie-Inventar-Messungen, die mithilfe vieler Pyranometer durchgeführt werden. Diese Geräte messen die Stärke und Menge der Sonnenenergie, die die Erde erreicht. Ein bisschen sehen sie aus wie umgedrehte weiße Teller, auf denen sich in der Mitte eine Glashalbkugel befindet. Mich erinnern sie an eine Kolonie futuristischer Seepocken. Wieder erklärt mir Aidan die technischen Details, und wahrscheinlich könnten wir noch viele Tage hier oben verbringen.
Doch irgendwann muss ich mich auf den Rückweg machen, schließlich wartet die lange Piste den Vulkan hinab. Aidan und ich verabschieden uns. Ein Gruß im Wind, ein paar letzte Worte in der dünnen Luft. Dann steige ich in den Wagen und mache mich auf den Weg zurück nach Hilo.
Ich bin erfüllt von dem Gefühl, einen der wenigen Orte auf der Welt gesehen zu haben, wo wirklich etwas für den Klimaschutz getan wird. Wenigstens einen Tag durfte ich hier oben miterleben. Am Abend schnappe ich mir noch ein Fahrrad, will unbedingt zu den Lavafeldern der Insel. Und während ich so dahinstrample, denke ich darüber nach, was ich heute erlebt habe. In welchem Zusammenhang die Wahrheiten auf dem Vulkan mit all den Aspekten der Klimakrise stehen. Und was dies am Ende bedeutet. Auf Hawai’i bekommen die Geschehnisse noch einmal eine andere Dimension. Hier draußen wird es einem besonders bewusst: Es geht um einen Planeten. Um den einzigen, den wir haben.
Dann wird es auch schon dunkel, und bald starre ich in das nächtliche Schauspiel des Vulkans. Wie ein Fluss aus gleißend hellem Licht wälzt sich die Lava vor meinen Augen ins Meer und lässt meterhohe Rauchwolken in den Himmel steigen. Ich muss plötzlich an das Prinzip von Ursache und Wirkung denken. Hier ist es lupenrein zu beobachten: das uralte Naturgesetz, das besagt, dass alles, was in der Welt geschieht, irgendetwas auslöst. Bei den Treibhausgasen und der Klimakrise sind die Zusammenhänge in dieser Hinsicht zugegebenermaßen recht komplex. Die Ursachen, die Auswirkungen. Doch genau darin sehe ich meinen Beitrag und liegt meine Passion: die Zusammenhänge so akkurat wie möglich herauszuarbeiten, sie transparent zu machen und anderen verständlich.
Eine moralische Verpflichtung: Wissen, was Sache ist
Gut, dass ich selbst auf dem Vulkan war. Denn auf Vorträgen zeige ich die Keeling-Kurve immer zuerst, noch bevor ich die weiteren Mechanismen des Treibhauseffekts erkläre. Und bestimmt präsentiere ich eines nicht: Bilderfluten von Wirbelstürmen, Überschwemmungen und getöteten Tieren. Erst Angst und Schrecken verbreiten und dann plötzlich dazu aufrufen, endlich auf die rationale Botschaft der Wissenschaft zu hören? Das passt irgendwie nicht zusammen. Diese Phase der Aufregung sollte überwunden sein – wir brauchen gezieltes Handeln. Und dafür benötigen wir auf Fakten basierendes Wissen.
Ich bleibe darum lieber sachlich, konzentriere mich auf den Stand der Dinge. Tatsache ist, dass die Konzentration von CO₂ und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre seit 1958 immer schneller ansteigt. Und auch das ist nicht wegzureden: Rein gar nichts, was wir bisher unternommen haben, hat etwas Entscheidendes verändert. Es hat nicht einmal zu einer signifikanten Verlangsamung des Anstiegs geführt.
Und dies scheint mir die eigentliche Katastrophe zu sein.
Die Zunahme der Treibhausgaskonzentration wiegt weit schwerer als die Frage, ob dieser oder jener Gletscher zwei oder drei Meter zurückgegangen ist oder ob der letzte Sommer nun der heißeste oder nur der zweitheißeste war. Um in die richtige Richtung zu handeln, zählt allein die Frage, ob wir es schaffen, die Zunahme der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre zu stoppen.
Nicht mehr, nicht weniger.
Eine Abnahme der Konzentration werden wir so schnell allerdings nicht erleben, unter anderem, weil sich das CO₂ in der Atmosphäre nur sehr langsam abbaut. Das ist auch der Grund, warum die Wissenschaft von einem Point of no Return spricht. Hat die Konzentration die Marke von 500 ppm nämlich erst einmal überschritten, werden die klimatischen Auswirkungen so weit vorgeschritten sein, dass sie sich selbst verstärken. Und weil es aufgrund des langsamen Abbaus unmöglich ist, die Konzentration auf die Schnelle wieder zu senken, entgleitet uns jede Möglichkeit der Korrektur. Deshalb ist es so wichtig, unser Handeln ganz und gar darauf auszurichten, den Eintrag von Treibhausgasen zu reduzieren. Wir sollten schon 450 ppm nicht überschreiten und dürfen die 500 ppm nicht erreichen. Und wenn wir uns der Signifikanz dieser Marke bewusst werden, dann wollen wir diesen Punkt auch gar nicht erreichen.
Neben der Keeling-Kurve bestätigen heute noch viele andere Methoden und Werte das Szenario. Die Zunahme des Treibhausgases wird inzwischen auch mithilfe von komplexen Messnetzwerken präzise ermittelt. Die Modelle werden kontinuierlich angepasst und verbessert, Satellitendaten mit Auswertungsalgorithmen analysiert, Daten werden heute fast überall auf der Erde erhoben, und dies mehr oder weniger stündlich. Kurz: Der Raum für Fehler oder Abweichungen ist so gering, dass er nicht ins Gewicht fällt.
Auch wenn ich mich wiederhole: Dies ist denn auch die erste, substanziellste und leider auch schwerwiegendste Wirklichkeit, um die wir nicht herumkommen – die CO₂-Konzentration in der Erdatmosphäre nimmt kontinuierlich zu, ebenso wie die der anderen Treibhausgase. Dies zu ignorieren oder gar zu leugnen, wäre in etwa so, als hielten wir Sonne, Mond und Sterne für Attrappen aus Pappmaché.
Viele Menschen wissen inzwischen um diese Tatsache und akzeptieren sie als konkrete Bedrohung. Allerdings sind daraus bisher nur wenige gesellschaftliche Handlungsoptionen entstanden. Eingedenk der Schwere des Problems frage ich mich: Warum nur nicht? Bei meiner Arbeit erlebe ich quasi die Antwort auf diese Frage immer wieder: Vielen sind wichtige Begrifflichkeiten, Hintergründe und bestimmte Funktionsweisen offenbar noch immer nicht ganz klar. Darum ist es essenziell, diese Punkte zu erklären.
Denn schon hier kommt eine Verantwortung ins Spiel, der wir uns gleich zu Beginn stellen sollten. Wenn wir nämlich zugeben, ein ernsthaftes Problem zu haben, dann müssen wir das Problem erst einmal verstehen, bevor wir es lösen können. Wenn es also darum geht, gesellschaftlich verantwortungsvoll zu handeln, und wenn dabei sogar die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen auf dem Spiel steht – ist es dann nicht gar eine moralische Verpflichtung, die Zusammenhänge erst einmal genau zu begreifen? Sie anschließend transparent zu machen, verständlich, sachlich und korrekt zu kommunizieren? Nur so können wir uns schließlich auf das Wesentliche konzentrieren, um dem Klimawandel zu begegnen.
Immerhin haben wir es hier mit einem Problem zu tun, das Medien, Wissenschaft, Politik, vor allem jedoch Millionen Menschen auf allen Kontinenten als die Zukunfts- und Menschheitsfrage schlechthin bezeichnen. Zudem: Das Problem ist akut. Wir können es nicht morgen lösen – wir müssen es jetzt lösen.
Natürlich ist es verständlich, dass in einer solchen Situation viele Stimmen zu Wort kommen. Auch ist es normal, dass komplexe Vorgänge Fragen aufwerfen, dass Interessenkonflikte auftauchen und die Debatten ausufern, wenn mit dem Dach über unserem Planeten auf einmal Dinge geschehen, die nicht gut sind. Mir als Treibhausgasbuchhalter wird aber nicht nur in der dünnen Luft auf dem Mauna-Loa-Vulkan leicht schwindelig, sondern manchmal auch, wenn ich höre, was alles in einen Topf geworfen wird, wenn es um das Thema Klimawandel geht.
Ökologie. Artensterben. Die Verschmutzung der Meere. Gerechtigkeit. Elektroautos. Die weltweite Fleischproduktion. Palmölplantagen. Das Roden der Regenwälder. Unsere Heizungen zu Hause. Strohhalm oder nicht Strohhalm? Fernreise oder doch besser Urlaub vor der Haustür machen? Dann wieder geht es um fossile Brennstoffe, um Kohle und CO₂-Steuer, um Diesel und Energiewende. Millionen Schüler gehen freitags aus der Schule und auf die Straße. Dann wieder wird auf das Bleichen der Korallen hingewiesen, auf das Schmelzen der Gletscher, das Sterben der Bienen und Eisbären. All diese Punkte sind auf ihre Art wichtig. Aber hat das alles wirklich mit dem dringlichsten und gefährlichsten Problem zu tun: nämlich dem Treibhauseffekt? Und wenn ja – inwiefern? Und in welchem Maße?
Spätestens bei dieser Frage geraten viele ins Stottern – und oft haltlos aneinander. Denn vieles wird durcheinandergebracht, beliebig bewertet und von vornherein nicht systematisch betrachtet.
Ich sehe jeden Tag, wie die Vielzahl der Themen, die Gewichtung der verschiedenen Aspekte, die zahlreichen Meinungen, Meldungen und Schauplätze am Ende eher verwirren und den klaren Weg zur Lösung des Problems verbauen. Die Kommunikation findet vielmehr chaotisch und prophetisch statt. Probleme wie Eisschmelze, Wetterveränderungen oder etwa Engpässe bei der Nahrungsversorgung erreichen uns oft diffus und wie aus weiter Ferne. Zudem weiß keiner mehr so richtig, ob die eine Maßnahme nun dringlicher ist als die andere und wie am Ende alles zusammenhängt.
Solche Wirbelstürme aus Meinungen und Bedrohungsszenarien hinterlassen vielmehr ein generelles Gefühl von Ohnmacht und Unverständnis. Umso mehr ist von drohenden Gefahren die Rede, nicht von entscheidenden Ursachen und systematischen Lösungen. Eine zweite Folge: Die Diskussion wird zu einem emotionalen Schlagabtausch und basiert nicht mehr auf den zentralen Tatbeständen. Eine dritte Folge: Wir haben am Ende ein schlechtes Gewissen, weil nicht genug geschieht. Und dann handeln wir anekdotisch getrieben, nicht wissend und sachlich informiert. All das aber ist kontraproduktiv und nicht konsequent. Dabei bin ich fest überzeugt: Das Treibhausgasproblem in den Griff zu bekommen ist absolut möglich, kann äußerst motivierend wirken und die Menschheit große Schritte voranbringen.
Die derzeitige Situation allerdings kann mich als Treibhausgasbuchhalter nicht zufriedenstellen. Sie macht mich nervös, manchmal werde ich sogar richtig kribbelig. Als würde man den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Als würde man den Klimaschutz vor lauter Diskussion um den Klimawandel nicht mehr richtig zu packen kriegen.
Es ist mir deshalb ein wichtiges Anliegen, die Tatsachen immer wieder mit Hilfe von Fachwissen zu kommunizieren und die Zusammenhänge deutlich zu erklären. Denn erst wenn alle die Säulen des Klimawandels kennen, schaffen wir eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür, das Problem entsprechend effektiv anzugehen. Die Wissensträger haben hier eine Verantwortung, die Medien, die Politik, ein jeder von uns und natürlich besonders ich als Treibhausgasbuchhalter. Das erste Ziel sollte darum lauten: keine Panik verbreiten und kein Horrorszenario nach dem nächsten ausmalen – sondern sich stattdessen auf die entscheidenden Dinge konzentrieren.
Nennen wir es das Einmaleins des Klimawandels, des Klimaschutzes und der Treibhausgase. Doch was längst eine klare Angelegenheit ist, wirft nach wie vor Fragen auf und führt zu Missverständnissen. Ich erlebe das immer wieder, wenn ganz grundsätzliche Aspekte des Themas zur Sprache kommen. Zum Beispiel: Was ist eigentlich das Hauptproblem beim Klimawandel? Was sind Treibhausgase? Sind Treibhausgase und CO₂ dasselbe? Was geschieht genau beim Treibhauseffekt? Wo und wie entstehen Treibhausgase?
Die Antworten auf diese Fragen zu kennen ist wichtig. Erst so schaffen wir in einer demokratischen Gesellschaft einen Konsens. Und erst so erkennen wir auch die effektivsten Lösungen.





























