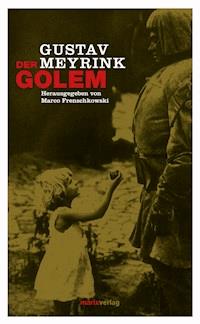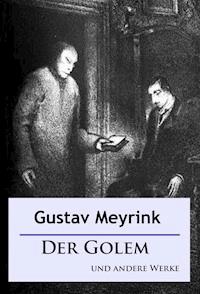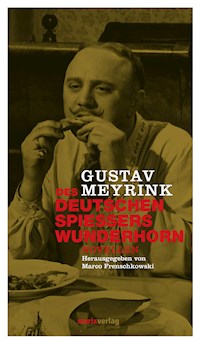1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DigiCat
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In Gustav Meyrinks Werk 'Der Weisse Dominikaner' taucht der Leser in eine mysteriöse Welt voller Okkultismus und Dunkelheit ein. Der Roman, der zuerst 1921 veröffentlicht wurde, kombiniert Elemente des realen Lebens in Prag mit übernatürlichen Ereignissen und spirituellen Themen. Meyrinks literarischer Stil ist geprägt von einer düsteren Atmosphäre und einer detaillierten Beschreibung der Handlungsorte, die dem Leser erlauben, in die Welt des Okkulten einzutauchen. Als Teil der literarischen Strömung des magischen Realismus eignet sich 'Der Weisse Dominikaner' für Leser, die es genießen, in eine Welt voller Geheimnisse und mysteriöser Ereignisse einzutauchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Der Weisse Dominikaner
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
"Herr X oder Herr Y hat einen Roman geschrieben"—was heißt das?
Nun, sehr einfach: "Er hat mit Hilfe seiner Phantasie Personen geschildert, die in Wirklichkeit nicht existieren, hat ihnen Erlebnisse angedichtet und sie miteinander verwoben."—So ungefähr lautet, weitläufig gefaßt, das allgemeine Urteil.
Was Phantasie ist, glaubt jedermann zu wissen, daß es aber höchst merkwürdige Kategorien der Einbildungskraft gibt, ahnen nur sehr wenige.
Was soll man sagen, wenn zum Beispiel die Hand, dieses scheinbar so willfährige Werkzeug des Gehirns, sich plötzlich weigert, den Namen des Heldens der Geschichte niederzuschreiben, den man sich ausgedacht hat, und statt seiner hartnäckig einen andern wählt? Muß man da nicht unwillkürlich stutzig werden und sich fragen: "Schaffe" ich tatsächlich oder—ist meine Einbildungskraft am Ende nur eine Art magischer Empfangsapparat? Etwa das, was auf dem Gebiete der drahtlosen Telegraphie eine Antenne genannt wird?
Es hat Fälle gegeben, daß Menschen nachts im Schlaf aufstanden und schriftliche Arbeiten, die sie abends, übermüdet von den Anstrengungen des Tages, unfertig hatten liegen lassen, vollendeten und Aufgaben besser lösten, als sie es im Wachsein vermutlich imstande gewesen wären.
Dergleichen liebt man mit den Worten zu erklären: "Das für gewöhnlich schlummernde Unterbewußtsein ist zu Hilfe gekommen."
Geschieht so etwas in Lourdes, so heißt es: "Die Mutter Gottes hat geholfen."
Wer weiß, vielleicht sind Unterbewußtsein und die Mutter Gottes ein und dasselbe.
Nicht, als ob die Mutter Gottes nur das Unterbewußtsein wäre, nein, das Unterbewußtsein ist die "Mutter"—"Gottes".
In dem vorliegenden Roman spielt ein gewisser Christopher Taubenschlag die Rolle eines lebenden Menschen.
Ob er jemals gelebt hat, gelang mir nicht ausfindig zu machen; meiner Phantasie ist er sicherlich nicht entsprungen, das glaube ich fest; ich sage das rund heraus, auf die Gefahr hin, daß man mich für jemand halten wird, der sich interessant machen will. Genau zu schildern, auf welche Weise das Buch zustande kam, liegt hier kein Anlaß vor; es genügt, daß ich nur in Streiflichtern knapp skizziere, was sich begeben hat.
Man möge entschuldigen, daß dabei in einigen Sätzen von mir selbst die Rede ist, ein Übelstand, der sich leider nicht vermeiden läßt.
Ich hatte den Roman in allen Umrissen fertig im Kopfe und begann ihn niederzuschreiben, da bemerkte ich—später erst, beim Durchlesen der Niederschrift!—, daß sich der Name "Taubenschlag", ohne daß es mir sogleich bewußt geworden wäre, eingeschlichen hatte.
Doch nicht genug damit: Sätze, die ich mir vorgenommen hatte, zu Papier zu bringen, änderten sich unter der Feder und drückten etwas ganz anderes aus, als ich sagen wollte; es entspann sich ein Kampf zwischen mir und dem unsichtbaren "Christopher Taubenschlag", in dem dieser schließlich die Oberhand behielt.
Ich hatte geplant, eine kleine Stadt zu schildern, die in meinem Gedächtnis lebt: es wurde ein völlig anderes Bild daraus, ein Bild, das heute schärfer vor mir steht als jenes wirklich erlebte.
Es blieb mir schließlich nichts anderes übrig, als dem Einfluß, der sich Christopher Taubenschlag nennt, seinen Willen zu lassen, ihm, sozusagen, meine Hand zur Niederschrift zu leihen und alles aus dem Buche zu streichen, was meinen eigenen Einfällen entstammte.
Setzen wir den Fall: Jener Christopher Taubenschlag sei ein unsichtbares Wesen, das auf rätselhafte Weise imstande ist, einen Menschen bei klarem Bewußtsein zu beeindrucken und nach seinem Willen zu lenken, so stellt sich die Frage ein: warum hat er mich denn benutzt, um seine Lebensgeschichte zu schildern? Aus Eitelkeit?—Oder damit ein "Roman" zustande kommt?
Möge jeder sich selbst die Antwort geben.
Meine eigene Aussicht will ich für mich behalten.
Vielleicht steht mein Fall bald nicht mehr vereinzelt da; vielleicht ergreift jener "Christopher Taubenschlag" morgen die Hand eines andern.
Was heute ungewöhnlich erscheint, kann morgen alltäglich sein! Vielleicht ist die alte und doch ewig neue Erkenntnis auf dem Wege:
"Jedwede Tat, die hier geschieht, Geschieht nach dem Naturgesetz; Ich bin der Täter dieser Tat— Ist selbstgefälliges Geschwätz."
Und die Figur des Christopher Taubenschlag ist nur ihr Vorbote, ist ein Symbol, ist die als Persönlichkeit sich gebärdende Maske einer gestaltlosen Kraft?
Für die Siebengescheiten, die da so überaus stolz sind auf ihr "Hausherrentum", mag freilich der Gedanke widerwärtig sein, daß der Mensch nur eine Marionette ist.
Als ich von ähnlichen Empfindungen erfaßt, eines Tages mitten im Schreiben war, kam mir plötzlich der Gedanke: Ist dieser Christopher Taubenschlag vielleicht nur so etwas wie ein von mir abgespaltenes Ich? Eine vorübergehende, zu selbständigem Leben erwachte, in mir unbewußt gezeugte und geborene Phantasiegestalt, wie es bei Leuten vorkommen soll, die zeitweilig Erscheinungen zu sehen glauben und sich mit ihnen sogar unterhalten?
Als hätte jener Unsichtbare in meinem Gehirn gelesen, unterbrach er sofort den Lauf der Erzählung und streute, meine schreibende Hand benützend, wie in Parenthese die sonderbare Antwort ein:
"Sind Sie"—(es klang wie Spott, daß er mich 'Sie' und nicht 'Du' nannte)—"Sind Sie, wie alle Menschen, die sich gleich Ihnen einbilden, Einzelwesen zu sein, vielleicht etwas anderes als eine 'Ichspaltung'?—Abspaltung jenes großen Ichs, das man Gott nennt?"
Ich habe seitdem oft und viel über den Sinn dieses merkwürdigen Satzes nachgedacht, denn ich hoffte in ihm den Schlüssel zu dem Rätsel, das Christopher Taubenschlags Daseinsbedingungen für mich umgibt, zu finden. Einmal glaubte ich bei meinen Grübeleien bereits ein gewisses Licht entdeckt zu haben, da verwirrte mich ein ähnlicher "Zuruf":
"Jeder Mensch ist ein Taubenschlag, aber nicht jeder ist ein Christopher. Die meisten Christen bilden es sich nur ein. Bei einem echten Christen fliegen die weißen Tauben aus und ein."
Von da an gab ich die Hoffnung auf, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, und verwarf gleichzeitig jede Spekulation, ich könnte am Ende—die antike Theorie, der Mensch verkörpere sich mehrmals auf Erden, vorausgesetzt —einst jener Christopher Taubenschlag in einem früheren Leben gewesen sein!
Am liebsten wäre mir, ich dürfte glauben: jenes Etwas, das mir die Hand führte, ist eine ewige, freie, in sich selbst ruhende und von jeglicher Gestaltung und Form erlöste Kraft; aber, wenn ich des Morgens nach traumlosem Schlafe erwache, sehe ich zuweilen zwischen Augapfel und Lid das Bild eines alten, weißhaarigen, bartlosen Mannes, hochgewachsen und jugendlich schlank, wie eine Erinnerung der Nacht vor mir, und der Eindruck erfüllt mich für den Tag mit dem nicht loszuwerdenden Gefühl: das muß Christopher Taubenschlag sein.
Oft hat sich mir dabei der merkwürdige Gedanke zugesellt: Er lebt jenseits von Zeit und Raum und tritt das Erbe eines Lebens an, wenn der Tod nach dir die Hand ausstreckt. Doch wozu solche Erwägungen, die Fremde nichts angehen!
Ich bringe nunmehr die Kundgebungen Christopher Taubenschlags, so wie sie erfolgten, in der oft abgerissenen Form, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzulassen.
Kapitel 1. Christopher Taubenschlags erste Kundgebung
Solange ich denken kann, behaupten die Leute in der Stadt, ich hieße Taubenschlag.
Wenn ich als kleiner Junge mit einer langen Stange, an deren Spitze ein Docht brannte, in der Abenddämmerung von Haus zu Haus trabte und die Laternen anzündete, marschierten die Kinder der Gasse vor mir her, klatschten im Takt in die Hände und sangen: Taubenschlag, Taubenschlag, Taubenschlag, Trarara Taubenschlag.
Ich ärgerte mich nicht darüber, wenn ich auch selbst nie mitsang.
Später griffen die Erwachsenen den Namen auf und redeten mich mit ihm an, wenn sie etwas von mir wollten.
Anders steht es mit dem Namen Christopher. Er hing mir, auf einem Zettel geschrieben, am Halse, als man mich als Säugling, nackt, eines Morgens vor der Türe der Marienkirche liegen fand.
Den Zettel wird wohl meine Mutter geschrieben haben, als sie mich damals ausgesetzt.
Es ist das einzige, was sie mir mitgegeben hat. Darum habe ich von je den Namen Christopher als etwas Heiliges empfunden. Er hat sich mir in den Körper eingeprägt, und ich habe ihn wie einen Taufschein—ausgestellt im Reiche des Ewigen—, wie ein Dokument, das niemand rauben kann, durchs Leben getragen. Beständig wuchs und wuchs er wie ein Keim aus der Finsternis empor, bis er als der wieder erschien, der er von Anbeginn an gewesen, sich mit mir verschmolz und mich geleitete in die Welt der Unverweslichkeit. So, wie da geschrieben steht: es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.
Jesus wurde als erwachsener Mensch bei vollem Bewußtsein dessen, was geschah, getauft: der Name, der sein Ich war, senkte sich auf die Erde herab; die Heutigen werden als Säuglinge getauft; wie könnte es sein, daß sie erfassen, was sich mit ihnen begeben hat! Sie irren durchs Leben dem Grabe zu wie Schwaden, die der Windhauch in den Sumpf zurücktreibt; ihre Leiber verfaulen, und an dem, der aufersteht—ihr Name—, haben sie kein Teil. Ich aber weiß, soweit ein Mensch von sich sagen darf, er wisse, daß ich Christopher heiße.
In der Stadt geht die Sage, ein Dominikanermönch, Raimund de Pennaforte, habe die Marienkirche gebaut aus Gaben, die ihm aus aller Herren Länder unbekannte Spender zugesandt.
Über dem Altar steht die Inschrift: "Flos florum—so werde ich offenbar nach dreihundert Jahren." Sie haben ein farbiges Brett darübergenagelt, aber es fällt immer wieder herab. Jedes Jahr am selben Marientag.
Es heißt, in gewissen Nächten am Neumond, wenn es so finster ist, daß man die Hand nicht vor Augen sieht, werfe die Kirche einen weißen Schatten auf den schwarzen Marktplatz. Das sei die Gestalt des weißen Dominikaners Pennaforte.
Wenn wir Kinder des Findel- und Waisenhauses zwölf Jahre alt wurden, mußten wir zum erstenmal zur Beichte gehen.
"Warum warst du nicht beichten?" herrschte mich am nächsten Morgen der Kaplan an.
"Ich war beichten, Hochwürden."
"Du lügst!"
Da erzählte ich, was sich begeben hatte: "Ich stand in der Kirche und wartete, daß man rufe, da winkte mir eine Hand, und als ich an die Beichtzelle trat, saß ein weißer Mönch darin und fragte mich dreimal, wie ich heiße. Beim erstenmal wußte ich es nicht, beim zweitenmal wußte ich es wohl, aber ich hatte es vergessen, ehe ich es aussprechen konnte; beim drittenmal trat mir kalter Schweiß auf die Stirn, und meine Zunge war lahm, ich konnte nicht reden, aber jemand in meiner Brust schrie: 'Christopher'— —Der weiße Mönch hat es wohl hören müssen, denn er schrieb den Namen in ein Buch und deutete darauf und hat gesagt: 'So bist du hinfort eingetragen in das Buch des Lebens.' Dann hat er mich gesegnet und hat gesagt: 'Ich vergebe dir deine Sünden—die vergangenen und die zukünftigen.'"
Bei meinen letzten Worten, die ich ganz leise gesprochen hatte, damit keiner meiner Kameraden sie hören sollte, denn ich fürchtete mich, trat der Kaplan wie in wildem Entsetzen einen Schritt zurück und schlug das Kreuz.
Noch in derselben Nacht geschah es zum erstenmal, daß ich auf unbegreifliche Weise das Haus verließ, ohne daß ich mir hätte erklären können, wie ich wieder heimgekommen bin.
Ich hatte mich entkleidet niedergelegt und erwachte des Morgens im Bette völlig angezogen und mit staubigen Stiefeln. In der Tasche hatte ich Bergblumen, die ich wohl auf dem Höhen gepflückt haben mußte.
So ging es später noch oft, bis die Vorsteher des Waisenhauses dahinter kamen und mich schlugen, weil ich nie sagen konnte, wo ich gewesen war.
Eines Tages wurde ich ins Kloster zum Kaplan gerufen. Er stand mit dem alten Herrn, der mich später an Kindes Statt annahm, mitten in der Stube, und ich erriet, daß sie über mein Wandern gesprochen hatten.
"Dein Körper ist noch zu unreif. Er darf nicht mitgehen. Ich werde dich anbinden", sagte der alte Herr, als er, mich an der Hand führend und bei jedem Satz seltsam nach Luft schnappend, seinem Hause zuschritt.
Mir bebte das Herz vor Angst, denn ich begriff nicht, was er meinte.
An der mit großen Nägeln verzierten eisernen Haustüre des alten Herrn stand in Metall gehämmert: Bartholomäus Freiherr von Jöcher, ehrenamtlich bestallter Laternenanzünder.
Ich verstand nicht, wieso ein Adliger ein Laternenanzünder sein könne; mir war, als ich es las, als falle all das kümmerliche Wissen, das sie mir in der Schule beigebracht, wie Papierfetzen von mir ab, so sehr zweifelte ich in jenem Augenblick daran, ich sei überhaupt fähig klar zu denken.
Später erfuhr ich, daß des Barons erster Ahnherr ein schlichter Laternenanzünder gewesen war, den man geadelt hatte wegen etwas, das er nicht weiß. Seitdem zeigt das Wappen derer von Jöcher neben anderen Emblemen eine Öllampe, eine Hand und einen Stab, und die Barone beziehen von Geschlecht zu Geschlecht alljährlich eine kleine Rente von der Stadt, gleichgültig, ob sie ihr Amt, die Laterne in den Straßen anzuzünden, ausüben oder nicht.
Schon tags darauf mußte ich auf das Geheiß des Barons das Amt antreten. "Deine Hand soll lernen, was später dein Geist ausüben wird", sagte er. "Es sei ein Beruf noch so gering, geadelt wird er, wenn dereinst der Geist ihn übernehmen kann. Eine Arbeit, die die Seele zu erben sich weigert, ist nicht wert, daß der Leib sie vollbringt."
Ich sah den alten Herrn an und schwieg, denn ich verstand damals noch nicht, was er meinte.
"Oder möchtest du lieber ein Kaufmann werden?" setzte er mit freundlichem Spott hinzu.
"Soll ich früh morgens die Laternen wieder auslöschen?" fragte ich schüchtern.
Der Baron streichelte mir die Wange: "Freilich, wenn die Sonne kommt, brauchen die Menschen kein anderes Licht."
Zuweilen, wenn der Baron mit mir sprach, hatte er eine merkwürdig verstohlene Art mich anzublicken; in seinen Augen schien die stumme Frage zu liegen: "Verstehst du endlich?", oder wollte er damit sagen: "Ich bin voll Unruhe, du könntest erraten haben?"
In solchen Fällen fühlte ich oft ein heißes Brennen in meiner Brust, als gäbe jene Stimme, die damals bei meiner Beichte vor dem weißen Mönch den Namen Christopher geschrieben hatte, eine mir unhörbare Antwort.
Der Baron war verunstaltet durch einen ungeheuren Kropf an der linken Seite, so daß der Kragen seines Rockes bis zur Schulter aufgeschnitten sein mußte, um den Hals an der Bewegung nicht zu hindern.
Nachts, wenn der Rock über den Lehnstuhl gehängt war und aussah wie der Rumpf eines Geköpften, flößte er mir oft ein unbeschreibliches Grauen ein; ich konnte mich nur davon befreien, wenn ich mir vorstellte, welch überaus liebenswürdiger Einfluß im Leben von dem Baron ausging. Trotz seinem Gebreste und dem beinahe lächerlichen Anblick, den es bot, wenn der graue Bart wie ein gesträubter Besen vom Kropf abstand, hatte mein Pflegevater etwas ungemein Feines und Zartes an sich, etwas hilflos Kindliches, ein Niemand-verletzen-Können, das noch gehoben wurde, wenn er sich zuweilen drohend gab und einen durch die scharfen Brenngläser seines altmodischen Nasenkneifers streng anblickte.
In solchen Momenten kam er mir immer vor wie eine große Elster, die sich dicht vor einen hinpflanzt, als wolle sie einen zum Kampfe herausfordern, derweilen ihr Auge, wachsam bis zum äußersten, kaum die Angst verhehlen kann: "Du wirst dich doch nicht etwa unterstehen, mich fangen zu wollen!?"
Das Haus derer von Jöcher, in dem ich so viele Jahre leben sollte, war eines der ältesten in der Stadt; es hatte viele Stockwerke, in denen die Vorfahren des Barons gehaust—immer ein Geschlecht ein Geschoß höher als das vorhergegangene, als sei ihre Sehnsucht, dem Himmel näher zu sein, immer größer geworden.
Ich kann mich nicht entsinnen, daß der Baron diese alten Räume, deren Gassenfenster blind und grau geworden waren, jemals betreten hätte; er wohnte mit mir in den paar schmucklosen, weiß getünchten Zimmern dicht unter dem flachen Dach.
Anderwo wachsen die Bäume auf der Erde und die Menschen schreiten darunter hin; bei uns wächst ein Holunderbaum mit weißen, duftenden Dolden hoch oben in einem großen verrosteten Eisenkessel, der, einst zur Regentraufe bestimmt gewesen, eine mit verfaultem, angewehtem Laub und Schutterde gefüllte Röhre hinab aufs Pflaster sendet.
Tief unten strömt ein breiter, wellenloser, von Gebirgswasser grauer Fluß dicht an den uralten, rosa-, ockergelb- und hellblaufarbigen, aus kahlen Fenstern blickenden Häusern hin, auf denen die Dächer sitzen wie moosgrüne Hüte ohne Krempen. Als ein Kreis umströmt er die Stadt, die darin liegt, inselgleich, von einer Wasserschlinge gefangen; er kommt von Süden, wendet sich nach Westen, kehrt wieder zum Süden zurück, dort nur mehr durch eine schmale Landzunge, auf der unser Haus als letztes steht, getrennt von der Stelle, wo er die Stadt zu umarmen begann,—um hinter einem grünen Hügel dem Blick zu entschwinden.
Über die braune, mit mannshohen Planken eingefaßte Holzbrücke—der Boden aus rohen rindigen Stämmen, die beben, wenn der Ochsenwagen darüberfährt—kann man hinübergelangen ans andere, ans bewaldete Ufer, wo Sandbrüche ins Wasser abfallen. Von unserem Dach aus sieht man über sie hinweg weit ins Wiesenland hinein, in dessen dunkelster Ferne die Berge wie Wolken schweben und die Wolken wie Berge auf der Erde lasten.
Mitten aus der Stadt ragt ein burgartiges, langgestrecktes Gebäude auf, zu nichts mehr gut oder schlimm, als die stechende Glut der Herbstsonne aufzufangen mit feuerglimmenden lidlosen Fenstern.
In dem Eierpflaster des immer menschenleeren Marktplatzes, darauf die großen Schirme der Händler in Haufen umgestürzter Körbe wie vergessenes Riesenspielzeug stehen, wächst Gras zwischen den Ritzen der Steine.
Bisweilen an Sonntagen, wenn die Hitze die Mauern des barocken Rathauses heiß sengt, dringen die gedämpften Klänge einer Blechmusik, getragen vom kühlen Lufthauch, aus der Erde herauf,—werden lauter, das Tor der Gastschenke "zur Post, genannt beim Fletzinger" gähnt plötzlich, ein Hochzeitszug marschiert gemessen zur Kirche in alter bunter Tracht, Burschen mit farbigen Bändern schwingen feierlich Kränze, voran ein Trupp Kinder, weit an der Spitze flink wie ein Wiesel trotz seiner Krücken ein winziger, zehnjähriger, vor Fröhlichkeit halbtoller Krüppel, als gehe nur ihn allein die Freude des Festes an, während alle andern unter dem Ernste der Feier stehen.
Als ich an jenem Abend um einzuschlafen bereits im Bette lag, ging die Türe auf, und wiederum packte mich eine unbestimmte Angst, denn der Baron trat zu mir, und ich glaubte, er wolle mich anbinden, wie er gedroht hatte.
Aber er sagte nur: "Ich will dich beten lehren;—sie alle wissen nicht, wie man betet. Man betet nicht mit Worten, man betet mit den Händen. Wer mit Worten betet, der bettelt. Man bettelt nicht. Der Geist weiß schon, was dir nötig ist. Wenn sich die Handflächen berühren, ist das Linke im Menschen durch das Rechte zur Kette geschlossen.
So ist der Leib fest gebunden, und aus den Fingerspitzen, die nach oben stehen, steigt frei eine Flamme auf.—Das ist das Geheimnis des Betens, von dem in keiner Schrift geschrieben steht."
In dieser Nacht wanderte ich das erstemal, ohne daß ich am nächsten Morgen mit staubigen Stiefeln und angekleidet im Bette erwacht wäre.
Kapitel 2. Die Familie Mutschelknaus
Mit unserem Hause beginnt die Straße, die mein Gedächtnis die Bäckerzeile nennt.—Es ist das erste und steht allein.
Drei Seiten blicken ins Land hinein, von der vierten aus kann ich die Mauer des Nachbarhauses berühren, wenn ich unser Stiegenfenster öffne und mich hinausbeuge, so schmal ist die Gasse, die die beiden Gebäude trennt.
Die Gasse dazwischen hat keinen Namen, denn sie ist nur ein steilansteigender Durchlaß—ein Durchlaß, wie es wohl keinen zweiten mehr auf der Welt gibt—, ein Durchlaß, der die beiden linken Ufer des Flusses miteinander verbindet; er durchquert hier die Landzunge jenes Wasserkreises, auf der wir wohnen.
Frühmorgens, wenn ich fortgehe, um die Laternen auszulöschen, öffnet sich eine Türe unten im Nachbarhause, und eine besenbewaffnete Hand kehrt Hobelspäne in den heranströmenden Fluß, der sie um die ganze Stadt herum eine Reise machen läßt, um sie eine halbe Stunde später kaum fünfzig Schritte entfernt über das Wehr zu spülen, wo er brausend Abschied nimmt.
Dieses Ende des Durchlasses mündet in die Bäckerzeile; an der Ecke über dem Laden im Nachbarhaus hängt ein Schild, darauf steht:
Fabrik für letzte Ruhestätten ausgeübt von Adonis Mutschelknaus
Früher hatte darauf gestanden:
Drechslermeister und Sargtischler
man kann es noch deutlich lesen, wenn das Schild vom Regen naß wird; dann leuchtet die alte Schrift wieder durch.
Jeden Sonntag gehen Herr Mutschelknaus, seine Gattin Aglaja und seine Tochter Ophelia in die Kirche, wo sie in der ersten Reihe sitzen. Das heißt: Frau und Fräulein Mutschelknaus sitzen in der ersten Reihe. Herr Mutschelknaus sitzt in der dritten Reihe, am Eck. Unter der Holzfigur des Propheten Jonas, wo es ganz finster ist.
Wie mir das alles jetzt nach den vielen Jahren so überaus lächerlich vorkommt und—doch so unsagbar traurig!
Frau Mutschelknaus ist stets in schwarze knisternde Seide gehüllt, aus der das amaranthrote, samtene Gebetbuch aufschrillt wie ein Halleluja in Farben. In matten, spitzen Prünellstiefelchen mit Gummizug umtrippelt sie, dezent die Röcke hebend, sorgsam jede Pfütze; auf ihren Wangen verrät ein dichtes Netz feiner rotblauer, unter der rosa geschminkten Haut geplatzer Äderchen das nahende Matronenalter; die sonst so beredsamen Augen, sorgfältig an den Wimpern getuscht, sind züchtig niedergeschlagen, denn es ziemt sich nicht, wenn die Glocken die Menschen vor Gott rufen, sündigen Frauenreiz zu strahlen.
Ophelia trägt ein wallendes griechisches Gewand und einen Goldstreifen um das feine, aschblonde Lockenhaar, das ihr bis auf die Schultern fällt, und immer, so oft ich sie sah, von einem Myrtenkranz gekrönt war.
Sie hat den schönen, ruhigen, gelassenen Gang einer Königin.
Immer klopft mir das Herz, wenn ich an sie denke.
Sie ist auf dem Kirchgang dicht verschleiert—erst viel später habe ich ihr Gesicht gesehen, darin die dunkeln, großen, weltverloren blickenden Augen so seltsam abstechen von dem blonden Haar.
Herr Mutschelknaus, im langen, schwarzen schlottrigen Sonntagsrock, geht meistens ein wenig hinter den beiden Damen; wenn er sich vergißt und mit ihnen auf die gleiche Höhe kommt, flüstert ihm Frau Aglaja jedesmal zu:
"Adonis, einen Schritt zurück!"
Er hat ein schmales, trübselig langes, eingefallenes Gesicht mit rötlichem, schütterem Bart und eine weit vorspringende Vogelnase unter der Stirn, die, nach innen gebaucht, in einem kahlen Spitzschädel ausläuft, der aussieht mit seinem mottenfleckigen Haargürtel, als habe sein Herr damit ein räudiges Fell durchstoßen und die ringsum hängengebliebenen Reste abzuwischen vergessen.
Der Rand des Zylinderhutes, den Herr Mutschelknaus bei jeder feierlichen Gelegenheit trägt, muß immer an der Stirnseite mit einem fingerdicken Watteknödel gefüttert sein, damit er nicht wackle.
An Wochentagen wird Herr Mutschelknaus nie sichtbar. Er ißt und schläft unten in seiner Werkstatt. Seine Damen wohnen in mehreren Zimmern im dritten Stock.
Es mögen wohl drei bis vier Jahre, seit mich der Baron aufgenommen hatte, vergangen sein, ehe ich erfuhr, daß Frau Aglaja und Tochter und Herr Mutschelknaus zusammengehörten.