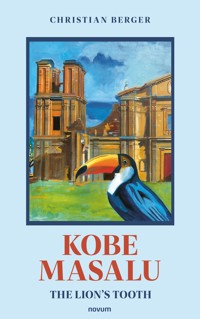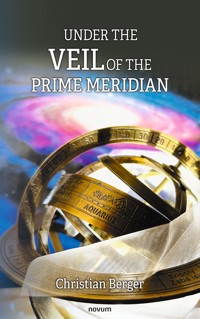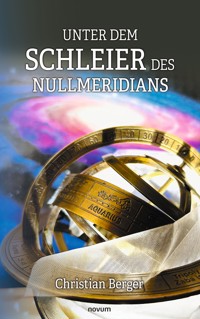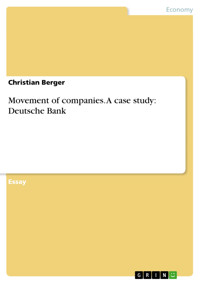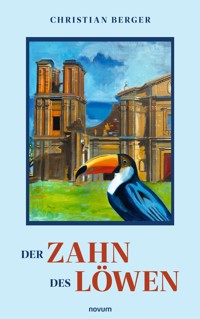
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Afrika, 16. Jahrhundert. Kobe Masalu, der jüngste Sohn eines Häuptlings, hat den größten Beweis seines Mutes erbracht: Er hat einen Löwen im nächtlichen Zweikampf bezwungen. Doch sein Triumph ist nur von kurzer Dauer. Als portugiesische Sklavenhändler sein Dorf am Ogowe-Fluss überfallen, wird Kobe verschleppt – in Ketten, über das Meer, in eine fremde Welt. Eine Welt der rachsüchtigen Götter und brennenden Herzen. In der glühenden Hitze der Tropen beginnt für ihn ein neues Kapitel seines Lebens: voller Schmerz, Widerstand – und einer inneren Kraft, die nicht gebrochen werden kann. Zwischen kolonialer Gewalt, verlorener Heimat und der Sehnsucht nach Freiheit wird Kobe nicht nur Zeuge der Geschichte – er wird Teil einer Bewegung, die das Schicksal des Kontinents veränderte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Impressum
Widmung
Vorwort
Prolog
Kapitel 1
Interludium
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Epilog
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
63
64
65
66
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
85
86
89
90
91
92
93
95
96
97
98
98
99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Navigationspunkte
Cover
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0938-0
ISBN e-book: 978-3-7116-0939-7
Lektorat: Juliane Johannsen
Umschlagfoto: Umschlag- & Innenabbildungen: Ulrich Bosch
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Widmung
Für meinen Lehrer
Paul Mühlberger SJ
und für
Jorge Maria Bergoglio SJ
Vorwort
„Wir haben die Erde von unseren Eltern nicht geerbt,
sondern wir haben sie von unseren Kindern nur geliehen.“
– Sprichwort der Sioux Lakota –
Prolog
Kobe Masalu vom Stamme der M’Wenga saß am Ufer des Ogowe-Flusses und blickte gen Osten. Im zarten Licht der Morgendämmerung schwirrten Tausende Mücken über die Fluten des gemächlich dahinströmenden Gewässers. Vereinzelt sprangen Fische über die Wasseroberfläche und versuchten, aus den Myriaden von Insekten ein Exemplar gezielt durch die Öffnung ihres Maules zu verschlingen. An der gegenüberliegenden Seite des Flusses zeichnete sich die Silhouette des Lope-Gebirges ab. Die dicht mit Regenwald bedeckten Hügel des Gebirges standen in krassem Kontrast zur Savanne diesseits des Ogowes. Die Streifzüge im Lope waren für die M’Wenga eine willkommene Abwechslung, da der tropische Regenwald Mangobäume und Baobabs beherbergte. Die Früchte des Affenbaums wurden seit jeher von den Schamanen als Medizin verwendet. Außerdem gewährten die Anhöhen einen Blick auf die heiligen Berge der Bakete, aus denen der Ogowe entsprang und in deren heißen Quellen die M’Wenga sich regelmäßig einem reinigenden Ritual unterzogen. Im Sumpfgebiet zu seiner Linken verließ der Leitbulle einer Herde von Flusspferden sein Habitat und machte sich daran, das Ufergras abzuweiden. Ganz nebenbei entledigte er sich seiner Exkremente, indem er die halb verdauten Pflanzen durch repetitive Bewegungen seines kurzen Schwanzes auf der Erde verteilte. Die Flusspferde waren Vertraute der M’Wenga. Nur durch die Pfade, welche die Tiere bei ihren Wanderungen durch das Binsengras traten, war ein Durchqueren des Sumpfes mit dem Kanu möglich. Die Fischgründe weiter stromaufwärts lohnten immer einen Besuch. Kobe band einen nahezu rechteckigen Stein an die Leine seiner Angel und spießte die zappelnde Raupe einer Waldkönigin auf den verrosteten Haken. Die Distanz zwischen Stein und Haken war so bemessen, dass die Raupe in Ellenlänge über dem Boden des Gewässers schweben würde. Nur dadurch würde Kobe den Fisch fangen, auf den er es abgesehen hatte. Kobe warf den Köder in die Fluten und lächelte. Er spürte das Gewicht seines Buschmessers, das nun in einer Scheide aus dem Schwanz eines Löwen an seiner Hüfte hing. Ihm war gelungen, was seinen älteren Brüdern bis dato verwehrt gewesen war. Die Erinnerung an jene schicksalhafte Nacht keimte in ihm hoch. Als jüngster Sohn des Häuptlings war Kobe mit dem Hüten des Viehs beauftragt worden. Die Nacht war drückend heiß gewesen, und die Kühe hatten verstört und nervös gewirkt. Als sich das Vieh endlich beruhigt hatte, fiel auch Kobe in einen kurzen Dämmerschlaf, aus dem er jedoch jäh durch das Brüllen eines Löwen gerissen wurde. Die Raubkatze hatte ein Kalb beim Hals gepackt und sich mit ihremmächtigen Körper auf ihr Opfer geworfen. Kobe nahm eine der letzten lodernden Fackeln aus dem nächtlichen Lagerfeuer und warf sie in Richtung der Raubkatze. Der Löwe ließ jedoch nicht von seinem Opfer ab und biss nur noch tiefer in den Nacken des lauthals schreienden Kalbes. An die darauffolgenden Ereignisse konnte sich Kobe nur schemenhaft erinnern. Irgendwie fand er seinen Speer neben sich liegend und schleuderte ihn mit aller Gewalt dem majestätischen Löwen entgegen. Das Geschoss traf die Raubkatze unter dem linken Schulterblatt. Mit einem ohrenbetäubenden Gebrüll ließ der Löwe von seinem Opfer ab, erhob sich und rannte auf Kobe zu. Kobe zückte sein Buschmesser. Sein Herz pochte bis zum Hals. Jede Faser, jeder Muskel seines Körpers war bis zur Unerträglichkeit angespannt. Im Innersten fühlte er, dass ihn die Götter für diesen Augenblick vorbereitet hatten. Der erste Prankenhieb des Löwen verletzte Kobe am Oberschenkel, und er wich schmerzerfüllt zurück. Als sich die Raubkatze erneut näherte, hallten die Worte seines Vaters in seinem Kopf. „Du musst Stärke zeigen und es ihn spüren lassen!“ Kobe nahm all seinen Mut zusammen und rannte mit gezücktem Messer und einem Gebrüll, das aus der Tiefe seiner Seele emporkroch, auf den Löwen zu. In diesem Augenblick taumelte sein Widersacher, und Kobe stürzte sich auf ihn. Sein Messer drang tief in den Hals des Tieres ein, und nach kurzem Ringen war das Schicksal der majestätischen Katze besiegelt. Kobe war völlig außer Atem und rang nach Luft. Was darauf folgte, erlebte der erfolgreiche Jäger wie in Trance. Durch den Lärm des Kampfes kamen die Dorfbewohner in Scharen zum Ort der Auseinandersetzung gerannt und tanzten um den toten Körper der Raubkatze. Das Haupt und der Schwanz des Löwen wurden mit Buschmessern von seinem Leib getrennt. Das Fleisch wurde geteilt und an die Hunde verfüttert. Als Kobe am nächsten Morgen erwachte, trat sein Vater an ihn heran und übergab ihm den mit Ochsenfett präparierten Schwanz der Raubkatze. In einem hölzernen Becher trank Kobe ein Gemisch aus Kalbsblut und Milch. Den Preis der Krieger. Kobe war nun ein Krieger der M’Wenga, und gemäß der Stammessitte durfte er nun nach Vollzug des Übergangsrituals eine Frau wählen.
Die Wahl fiel ihm nicht schwer: Inaya.
Kapitel 1
Glänzende Götter I
Kobe betastete den rechten Reißzahn des Löwen, der an einem ledernen Band um seinen Hals hing. Nach dem nächtlichen Zweikampf hatte er die Trophäe eigenhändig dem monströsen Gebiss der Raubkatze entrissen. Plötzlich spürte er eine zärtliche Umarmung seines Bauches. Eine sanfte Brise wehte durch das hüfthohe Gras des Ufers. Kobe erkannte seine Frau an ihrem Geruch. „Hast du etwas gefangen, Kobe Masalu, du Löwentöter?“, fragte Inaya schelmisch. Kobe ergriff ihre Hände und drehte sich um. „Und ob, aber was sagt unser Sohn dazu?“, antwortete Kobe. „Woher weißt du, dass du nicht mit unserer Tochter sprichst?“ „Er wird die Kraft eines Löwen und die Ausdauer einer Gazelle haben“, antwortete Kobe und betastete den vorgewölbten Bauch seiner Frau. „Was machst du hier, so weit vom Dorf?“ „Ich bringe dem eifrigen Fischer frisches Hirsebrot und Samen des Baobabs. Außerdem bin ich es leid, im Dorf eingesperrt zu sein, du weißt, wie sehr ich die offenen Weiten der Savanne liebe.“ Kobe öffnete die mit Flusswasser gefüllte Jagdtasche aus Ziegenleder und zog einen prächtigen Katzenfisch hervor. „Unser Mahl, bitte, bereite ihn in einem Mantel aus Bananenblättern zu, so wie ich es liebe. Wir kehren bald ins Dorf zurück, lass uns zuvor etwas essen.“
Kobe holte frisches Wasser vom Fluss und setzte sich mit Inaya ans Ufer. Auf dem Rücken der Flusspferde stromaufwärts hatten sich Hunderte Madenhacker niedergelassen und säuberten die Tiere von lästigen Parasiten. Nach einem kurzen Grunzen des Leitbullen stiegen die Vögel in die Lüfte empor. Kobe verfolgte ihre Flugbahn und blickte gen Westen. Am weit entfernten Horizont sah er ein glänzendes Blitzen. Inaya war noch mit dem Verzehr des Hirsebrotes beschäftigt, als er sich erhob und den Fluss betrachtete. „Was ist das, Inaya?“ „Wahrscheinlich nur eine Spiegelung des Wassers“, sagte Inaya, als sie ihren Blick erhob. „Komm, lass uns gehen!“ „Warte, es bewegt sich“, antwortete Kobe. Je länger er auf den behäbig strömenden Fluss starrte, desto klarer wurden die darauf befindlichen Objekte. „Es sind Boote, die stromaufwärts rudern. Da sind Männer auf den Booten.“ „Vermutlich die Za’Wanga, sie kommen einmal im Jahr, um zu tauschen“, sagte Inaya. Kobe setzte sich ins Gras und wartete. „Ihre Boote haben eine andere Form“, sagte er. „Dann lass uns ins Dorf gehen und sie dort empfangen“, antwortete Inaya. „Du weißt, dass Vater mit meinen Brüdern zum heiligen Berg aufgebrochen ist. Ich bin nun für unseren Stamm verantwortlich. Ich muss wissen, wer sich auf unser Stammesgebiet begibt.“ Inaya nickte verständnisvoll. Als sich die drei Boote in Sichtweite genähert hatten, nahm Kobe seinen Speer und den mit Zebrafell überzogenen Schild und stellte sich auf einen felsigen Vorsprung des Flusses. Inaya stand an seiner Seite. „Ich bin Kobe Masalu, der Löwentöter, Sohn des Häuptlings Zuna. Mein Vater herrscht über das Land und den Fluss. Wer seid ihr?“ Von den sich nähernden Booten kam keine Antwort. „Das sind keine Händler der Za’Wanga, ihre Ruder tragen nicht die traditionellen Farben“, sagte Kobe mit einem Hauch von Unsicherheit. Er wiederholte seine Aufforderung und schrie aus voller Kehle: „Ich bin Kobe Masalu, Sohn des großen Zuna, gebt euch zu erkennen!“
Doch nichts geschah. Als sich die Eindringlinge bis auf Wurfweite genähert hatten, schleuderte Kobe seinen Speer auf das erste Boot. Das Geschoss verfehlte sein Ziel und versank in den Fluten des Ogowes. Plötzlich blitzten Dutzende Feuer auf, die von einem grollenden Donner gefolgt wurden. Die Luft knisterte förmlich und pilzförmiger Rauch stieg von den Booten empor. Kobe spürte, wie sich Inaya an seinen Körper klammerte und zu Boden glitt. „Was war das?“, fragte er mehr sich selbst als seine Frau. Er blickte auf Inaya und sah das Loch, das an ihrer linken Flanke weit offen klaffte. Ströme von Blut färbten den sandigen Boden dunkelrot. Kobe schrie voller Panik: „Inaya!“ Er kniete neben seiner Frau, die sich vor Schmerzen krümmte. Beim nächsten Grollen des Donners duckte er sich instinktiv. „Nur weg von hier“, dachte Kobe und umfasste Inaya mit beiden Händen und trug sie durch das hüfthohe Gras der Savanne. Kobe rannte, so schnell er konnte. Die Wunde an Inayas Seite blutete unaufhörlich. Das Blut tropfte auf seine Hände, seine Unterarme und auf seine Oberschenkel. Inaya schrie vor Schmerzen. Kobe hastete die Hügel empor, hinter welchen das Dorf der M’Wenga lag. In den wenigen Momenten, in denen er seine Augen vom Boden erhob, sah er, dass sich Inayas Blick trübte. „Halte durch, Inaya, wir sind gleich zu Hause“, flüsterte er. Mitunter glaubte er, dass ihn seine Kräfte verlassen würden, doch die jammernden, wehklagenden Laute seiner Frau setzten in ihm neue Energie frei. Als er schließlich die ersten Lehmhütten erreichte, bettelte er schreiend um Hilfe. Niam, Inayas Bruder, rannte dem schwer unter der Last seiner Frau atmenden Kobe entgegen. „Kobe, was ist passiert?“ „Unten am Fluss sind fremde Männer. Inaya ist schwer verletzt. Hilf mir, sie zu tragen!“ Beide Männer nahmen Inaya unter den Schultern und trugen sie in Niams Hütte. Unter lautem Stöhnen legten sie Inaya auf die Schilfmatte. „Wir müssen die Blutung stoppen“, sagte Niam. „Nimm vom Samen des Affenbrotbaumes und vermische ihn mit den grünen Blättern und den zermahlenen Schalen der Flusskrebse, die dort drüben liegen. Los, gib sie mir!“ Niam nahm die Blätter, Krebsmehl und den Samen in den Mund. Die Blätter des Hirtentäschels brannten wie Feuer in seinem Mund und hinterließen einen bitteren Nachgeschmack. Niam zerkaute die Pflanzen und Krebsschalen, bis sie eine pastöse Konsistenz hatten. Dann spuckte er das Gemisch in ein Bananenblatt. Niam hob seinen Blick und sah Kobe direkt in die Augen. „Wer war das, Bruder?“ Kobe zuckte mit den Schultern. „Ich weiß es nicht. Als ich meinen Speer nach ihnen warf, blitzten Dutzende Feuer aus ihren Mündern. Die Feuer wurden vom Groll des Donners begleitet. Ich glaube, es sind die Rachegötter der M’Pongwe, schließlich hat mein Vater dich und Inaya aus eurem Dorf geraubt.“ „Unsere Götter sind wie eure“, sagte Niam, „doch habe ich noch nie einen Menschen Feuer speien sehen, geschweige denn den Gott des Donners von Angesicht zu Angesicht erblickt.“ „Aber die heiligen Berge und ihre mystische Kraft“, erwiderte Kobe. „Ja, unser Volk lebt wahrlich an den Hängen der heiligen Berge“, sagte Niam. „Aber selbst die Fäustlinge1, die tief in den verschlungenen Pfaden des Regenwaldes leben, verfügen nicht über solche Zauberkräfte.“
Kaum dass Niam diese Worte gesprochen hatte, füllte sich die Luft wieder mit dem ohrenbetäubenden Grollen des Donners. Die Wände der Lehmhütte schienen zu beben. Niam und Kobe erstarrten unter dem Lärm, der sich wie eine gewaltige Gewitterfront über das Dorf legte. Allmählich mischten sich unter den Donner das Geschrei und die verzweifelten Rufe der Dorfbewohner. Kobe warf Niam einen letzten Blick zu. „Ich muss mich um das Dorf kümmern. Kannst du bei Inaya bleiben?“ Niam nickte. Als Kobe die Hütte verließ, sah er das wahre Ausmaß der Zerstörung. Beim ersten Grollen des Donners hatten sich viele Dorfbewohner in die schützenden Lehmhütten begeben. Doch nun standen die Schilfdächer in Brand und die Menschen rannten in Panik durcheinander. Das Dorf wurde von mehreren Seiten angegriffen. Im Norden konnte Kobe Krieger der Za’Wanga erkennen, welche die Hütten mit Brandpfeilen überdeckten. Ihre Gesichter und Oberkörper waren mit dem roten Sand ihrer Heimat bemalt. Der Legende nach hatte sich der Sand ob des vielen Blutes, das über das Land vergossen worden war, im Laufe von Generationen rot gefärbt. Ihre Haare jedoch waren mit dem weißen Kalk der Muscheln gefärbt, die sie als Tauschwährung verwendeten. Im Süden standen die glänzenden Götter. Ihre Körper waren mit hell strahlenden Panzern bedeckt. Selbst ihre Häupter glänzten im Licht der Sonne. Unaufhörlich entfuhren Blitze und Feuer ihren Körpern, deren furchteinflößende Zerstörungskraft Kobe an seinen Fähigkeiten zweifeln ließ. Männer wie Frauen, die ihre Kinder traditionellerweise um ihren Leib gebunden hatten, fielen dem Zorn der glänzenden Götter reihenweise zum Opfer. Selbst Serigne, der Dorfälteste, der sich vor seiner Hütte mit Speer und Schild aufgestellt hatte, wurde von einem gewaltigen Blitz niedergestreckt und fiel mit weit geöffneten Augen zu Boden. Seine Stirn hatte sich durch den Blitz geöffnet und aus seinem Schädel ergoss sich eine Fontäne von Blut. Kobe besann sich auf die Worte seines Vaters: „Tritt deinem Feind mit Stärke entgegen, der Zweifel hat in der Schlacht nichts verloren.“ Kobe Masalu fasste neuen Mut und rannte mit gezücktem Buschmesser auf die glänzenden Götter zu. Kurz bevor er sie erreichte, spürte er, wie sich eine Schlinge um seinen Hals zog und ihm der Boden unter den Füßen entglitt. Dann versanken seine Gedanken im Reich der Finsternis.
Kobe erwachte aus der Finsternis durch das laute Grunzen des Flusspferdbullen. Seine Hände und Füße schmerzten unter dem Druck der eisernen Fesseln. Während das Gebrüll des Tieres in immer weitere Ferne rückte, verstärkte sich das Schwanken des Bootes, in dem er lag. Der Geruch des rostigen Eisens gepaart mit dem Blut, das aus seinen Gelenken triefte, befüllte seine Seele mit einem Gefühl der Hilflosigkeit, mehr noch einem Ausgeliefertsein, das er noch nie in seinem Leben empfunden hatte. Noch bevor er seine Augen öffnen konnte, überkam ihn aus den Tiefen seines Körpers das überwältigende Gefühl der Übelkeit. Er übergab sich mehrmals und rang nach Luft. Der Schmerz an seinen Extremitäten war unerträglich. Kobe wagte kaum, seine Augen zu öffnen. Wie durch einen Schleier erblickte er einen Krieger der Za’Wanga. Im nächsten Augenblick setzte ihm dieser seinen nackten Fuß an die Kehle. „Kotz gefällig woanders hin!“, schrie er mit einem Ausdruck von Ekel und Abscheu. Mit einem getrockneten Ast des Köcherbaumes schöpfte der Krieger Wasser aus dem Fluss und reinigte seinen Fuß. Danach goss er den Rest des Wassers über Kobe und sein Erbrochenes.
Neben dem Krieger stand einer der glänzenden Götter. Sein weißes Gesicht war von einem dunklen Bart bedeckt, doch er hatte Augen, Arme und Beine wie gewöhnliche Menschen. Seine Brust und sein Kopf jedoch waren durch einen eisernen Panzer bedeckt, der das Sonnenlicht auf unnatürliche Weise reflektierte. Tausende Gedanken schossen durch seinen Kopf. „Was ist aus Inaya und Niam geworden? Warum sind die Za’Wanga, die seit jeher mit den M’Wenga in Frieden lebten, plötzlich unsere Feinde, und wo bringen sie mich hin?“ Jede Faser seines Körpers schmerzte und das dumpfe Dröhnen in seinem Kopf wurde immer stärker. Voller Resignation schloss Kobe wieder seine Augen und zog sich aus der Welt zurück.
Kobe wurde durch den harten Aufprall des Bootes in die Realität zurückgeholt. Der Krieger der Za’Wanga befestigte eine schwere eiserne Kette an seinen Fußfesseln und befahl: „Aufstehen, alle, raus aus dem Boot.“ Erst jetzt sah Kobe, dass mit ihm auch vier weitere Dorfbewohner in Ketten lagen. Sirak, der aus dem Norden zu den M’Wenga gekommen war, und sein Bruder Jamal waren übel zugerichtet worden. Beide mühten sich ebenso wie Kobe, das schwankende Boot zu verlassen. Kobe blickte sich um. Am Ufer des Flusses standen dutzende Hütten, aus denen Rauch aufstieg. Die Za’Wanga trieben die Gefangenen mit der Spitze ihrer Speere vor sich her. Auch von den anderen Booten wurden Gefangene in Richtung eines provisorischen Rinderpferchs getrieben. Kobe hatte Mühe, Sirak, der vor ihm ging, zu folgen. Bei jedem Schritt scheuerte die eiserne Fußfessel erneut an seinem Sprunggelenk, sodass sich die ohnedies schon blutende Wunde immer mehr vertiefte und an der Außenseite des Fußes der blanke Knochen sichtbar wurde. Mit letzter Kraft schleppte er sich in den Pferch und fiel erschöpft zu Boden.
Die Krieger der Za’Wanga schlossen das Tor und befestigten die schweren Eisenketten an einem Pfahl. Erst nachdem alle Gefangenen sicher verwahrt worden waren, trat einer der glänzenden Götter an einen Mann mit einem imposanten Kopfschmuck heran. In einem halbrunden Flechtwerk aus Schilfgras waren die Federn des Silberreihers und des Fischadlers eingearbeitet. „Häuptling Kappanira, hier ist der Lohn für eure Mühen.“ Kappanira nahm den Lederbeutel, öffnete die Tabaksbeutelnaht und blickte auf die darin befindlichen Silbermünzen. Er nickte zufrieden. „Passt gut auf die Sklaven auf, gebt ihnen das Notwendigste. Ich erwarte meine Verstärkung in den nächsten Tagen. Dann brechen wir mit den Gefangenen nach Cap Lopez auf“, sagte Roberto Ruiz. „Seid bis dahin mein Gast“, erwiderte der Häuptling. In der Mitte von Kappaniras Hütte loderte ein Feuer, über dessen Glut auf vier steinernen Podesten ein nahezu runder Stein ruhte. Kappaniras Frau nahm den vorgefertigten Teig aus einem tönernen Gefäß und formte annähernd runde Ballen, welche sie daraufhin auf dem Stein zu Fladen drückte. Der Häuptling bat Roberto Ruiz, Platz zu nehmen. Aus einer Amphore wurde von einem Diener mittels eines Trichters aus Bananenblättern der Inhalt in kleine Becher gegossen. Kappanira reichte Ruiz einen Becher Palmenwein, der mit Kuhmilch versetzt war. Ruiz nippte zuerst vorsichtig an dem Getränk und nickte nach dem ersten Schluck wohlwollend mit dem Kopf. Auf einen Wink des Häuptlings wurde der gebratene Schlögel einer Impala von Dienern in die Hütte getragen. Die knusprige Haut der Gazelle duftete herrlich und war mit dem Honig von wilden Bienen gewürzt. Ruiz hatte die Ehre, als Erster den Braten zu versuchen. Er nahm seinen Dolch und trennte mit einem gekonnten Schnitt eine große Tranche des zartrosa gefärbten Fleisches vom Knochen. Kappanira bedeutete ihm durch einen auffordernden Blick, die lokale Delikatesse zu probieren. Mit einem herzhaften Biss kostete Ruiz von dem noch dampfenden Fleisch und war sofort von seinem Geschmack und seiner zarten Konsistenz begeistert. Die Fladen aus Hirsebrei ergänzten das Mahl perfekt. Nach mehreren Bechern des Palmenweins erhob sich Roberto Ruiz und dankte Häuptling Kappanira für seine Gastfreundschaft. Er würde die Nacht auf seinem Boot bei seinen Männern verbringen.
Kobe erwachte, als die Äquatorialsonne hinter dem Horizont verschwand. Von allen Seiten konnte er das verzweifelte Jammern seiner Leidensgenossen hören. Das Hämmern in seinem Kopf hatte nachgelassen, doch er verspürte fürchterlichen Durst. „Komm, trink etwas Wasser“, sagte eine vertraute Stimme. Der Schleier war aus seinen Augen gewichen und er erkannte Niam als sein Gegenüber, der ihm eine hölzerne Kelle mit Wasser reichte. Kobe trank gierig und musste sich im nächsten Moment wieder übergeben. „Noch einmal“, sagte Niam ermutigend. Mit zittriger Hand nahm er die Kelle und trank in moderaten Schlucken. Als er seine Augen auf Niam richtete, erschrak er zutiefst. Über seinem linken Auge trug Niam einen blutdurchtränkten Lappen, der quer über seinen Schädel befestigt war. „Inaya?“, fragte Kobe ängstlich. Niam senkte seinen Blick und schüttelte den Kopf. „Nachdem du die Hütte verlassen hast, kamen die weißen Menschen. Inaya ist in meinen Armen gestorben und kurz darauf haben sie mich gefasst und aus der Hütte geschleppt. Siraks Speer hat einen der weißen Menschen an der Hand getroffen, und sie hat geblutet. Deine Rachegötter sind aus Fleisch und Blut.“ Kobe brach in Tränen aus. „Inaya und mein ungeborener Sohn tot, das Dorf niedergebrannt. Wer sind sie?“, fragte Kobe mit zitternder Stimme. „Die Za’Wanga nennen sie Portugesch, mehr weiß ich nicht“, antwortete Niam betroffen. „Aber Blitz und der Donner, den du gesehen hast, entlädt sich aus eisernen Rohren, welche sie verwenden. Eines dieser eisernen Rohre hat mich an der Stirn getroffen.“ „Was wird aus uns?“, fragte Kobe verunsichert. „Das weiß ich nicht, aber du bist Kobe, der Löwentöter, Sohn des großen Zuna. Dein Vater und deine Brüder werden kommen und sich rächen“, sagte Niam.
Nach drei Tagen wurde das Tor des Pferchs geöffnet. Die hochstehende Sonne brannte mit unverminderter Intensität auf die Gefangenen nieder. Niam und Kobe wurden mit den anderen Stammesmitgliedern zu den Ufern des Ogowes getrieben. Die eisernen Ketten an ihren Füßen rasselten auf dem Weg zum Fluss. Über Nacht waren noch mehr glänzende Götter mit großen Booten gekommen, die nun in der sandigen Bucht vor dem Dorf lagen. Häuptling Kappanira stand am Ufer des Flusses Ogowe, als die Boote schließlich ablegten. Er blickte zufrieden nach Westen. Der Beutezug war für die Za’Wanga ein voller Erfolg gewesen und hatte seinem Dorf Lambarene2 in zweierlei Hinsicht die Zukunft gesichert. Zum einen waren die mächtigen Portugesch nun seine Verbündeten, und zum anderen würde sich der Sklavenhandel von hier aus zum Wohle seines Volkes entwickeln.
Kobe und Niam wurden an die Ruder des Bootes gekettet. Sie ruderten Tag und Nacht um ihr Leben. Am Heck des Bootes stand einer der weißen Männer mit einer Peitsche. Wenn sich ein Ruderer dem Rhythmus der Trommel, welche am Bug des Bootes geschlagen wurde, entzog und eine Rast einlegte, wurde er durch einen Hieb mit der Peitsche wieder an seine Aufgabe erinnert. Das Züchtigungsinstrument hinterließ dicke, blutunterlaufene Striemen auf dem Rücken der Gefangenen. Jamal, Siraks jüngerer Bruder, war nach Tagen der unerträglichen Strapazen am Ende seiner Kräfte und sank auf der Ruderbank in sich zusammen. Trotz mehrerer Peitschenhiebe und dem lauten Brüllen des weißen Mannes bewegte er keinen Muskel seines Körpers. Was darauf folgte, versetzte alle Gefangenen in Angst und Schrecken. Jamal wurde losgekettet und über Bord geworfen. Durch den dumpfen Aufprall seines Körpers wurden die am Ufer lauernden Krokodile auf eine präsumtive Beute aufmerksam und begaben sich in die Fluten des Ogowes. Jamal tauchte aus den Wassern des Stromes auf und rang nach Luft. Er streckte seine Arme empor und schrie nach Hilfe. Die Boote trieben in der Zwischenzeit weiter stromabwärts. Schon nach kurzer Zeit wurde Jamals Körper von den Prädatoren erfasst und mit rollenden Bewegungen unter Wasser gezogen. Die Wasser des Ogowes schäumten angesichts der bestialischen Kraft der Krokodile. Sirak stockte der Atem beim Anblick des Dramas, das sich auf dem Fluss abspielte, und er brach in Tränen aus. Dann senkte er vor Entsetzen sein Haupt und schloss seine Augen. Im nächsten Augenblick wurden an der Wasseroberfläche die zerfetzten Teile eines menschlichen Körpers sichtbar. Sie verschwanden schlussendlich in den weit geöffneten Schlünden der Reptilien. „Das soll euch eine Lehre sein“, rief einer der weißen Männer in der Sprache der Za’Wanga. Als Sirak seine Augen wieder öffnete, brannte in ihnen das Feuer des Zorns. Er riss an seinen eisernen Fesseln, erhob sich von der Ruderbank und versuchte, den Mann, der seinen Bruder den Fluten des Flusses übergeben hatte, an der Kehle zu packen. Ein mächtiger Hieb des feuerspeienden Eisenrohres beendete seine Attacke, und Sirak glitt bewusstlos zu Boden. Kobe und Niam blickten einander in die Augen und wussten in diesem Moment, dass ihr Schicksal besiegelt war.
Im Lauf der endlos scheinenden Tage auf dem Wasser verbreiterte sich der Ogowe in seinem Lauf und zweigte sich in die mäanderförmigen Nebenläufe eines Deltas auf. Auf Befehl von Roberto Ruiz folgten die Boote einem Seitenast des Flusses. Der Hauptstrom ergoss sich weiter südlich in den Ozean. Die südliche Route führte über das Kap auf offener See. Trotz der geringeren Strömung entschied sich Ruiz für die nördliche Route. Cap Lopez lag an einer dem Norden des Atlantischen Ozeans zugewandten Bucht. Von allen Seiten kamen Boote mit Sklaven und vereinigten sich zu einem Konvoi, der auf den Hafen der Stadt zusteuerte. Über dem Hafen der Stadt thronte das steinerne Fort mit zehn Kanonen, welche die Stadt sowohl zur See als auch die Landmasse der Halbinsel absicherten. In der Bucht ankerten drei spanische Schiffe. An Bord der Galeeren waren die Matrosen für die bevorstehende Überfahrt beschäftigt. Sie überprüften die Takelage und reinigten den Schiffsrumpf von Seepocken und Entenmuscheln, die sich im Laufe der Zeit an der Schiffshaut festgesetzt hatten. Zahlreiche Möwen umkreisten die Schiffe und versuchten, eine der