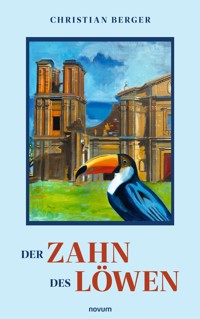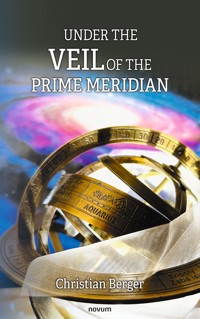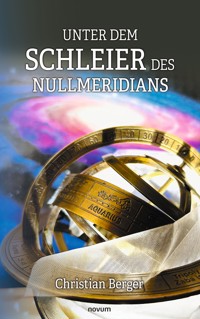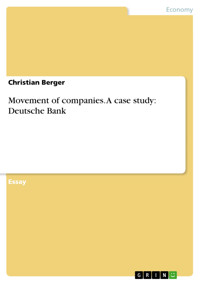Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: übermorgen
- Sprache: Deutsch
"Raus aus der Krise der Care-Economy, hin zur Sorge als gesellschaftliches Prinzip." Was ist Sorge? Zum Beispiel die Versorgung, das Stillen der Grundbedürfnisse – bei genauem Hinsehen das ökonomische Fundament dessen, was wir als (Markt-)Wirtschaft verstehen. Und: Sorge ist der zweifelnde Blick in eine ungewisse Zukunft, den es positiv in Verbundenheit und Verantwortungsgefühl zu wenden gilt. Davon ausgehend fächert Christian Berger das allgegenwärtige Thema entlang verschiedener Bruchlinien unserer Gesellschaft auf. Sei es die Krise in Pflege und Bildung, sei es die immer noch klaffende Ungleichheit der Geschlechter, sei es die Ökonomisierung privater Lebensbereiche: Berger liefert eine fundierte Analyse einer Sollbruchstelle unserer Gesellschaft, die in seiner Forderung mündet, den Begriff des Wohlstands radikal neu zu denken, ihn an der Sorge um das Lebendige, nämlich am Prinzip der Nachhaltigkeit, am Reichtum sozialer Beziehungen neu auszurichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sorge
Christian Berger
Inhalt
Einleitung
Differenz
Ökonomie
Aufteilung
Väter und Mütter
Krise
Was tun?
Anmerkungen
Literatur
„[…] die Antwort, welche den Menschenin den Mittelpunkt der gegenwärtigen Sorgerückt und meint, ihn ändern zu müssen, umAbhilfe zu schaffen, ist im tiefsten unpolitisch;denn im Mittelpunkt der Politik stehtimmer die Sorge um die Welt […]“1
- Hannah Arendt
Einleitung
Was ist Sorge? Eine Emotion. Etwas Öffentliches und etwas Privates, Intimes zugleich. Arbeit. Ein Wirtschaftssektor, der sogenannte Care-Sektor. Grundlage nicht nur individuellen, rationalen und weniger rationalen, sondern auch politischen Handelns. Fundament für Ökonomie und Gesellschaft. Und: Sorge ist der zweifelnde Blick in eine ungewisse Zukunft; Sorge um den Zustand der Welt, die angesichts einer gegenwärtig vielfach und dauerhaft gewordenen Krise auf dem Spiel steht. Eine vernachlässigte Dimension dieser Vielfachkrise, zu deren Überwindung zwar seit einiger Zeit „Resilienz“ von Märkten, Unternehmen, kritischen Infrastrukturen und Systemen aller Art ins Treffen geführt wird, nicht jedoch das eigentümliche Moment und Motiv der Sorge, die als Institution den Grund für unsere ökonomischen und sozialen Beziehungsgeflechte legt.
Sei es der Notstand in der Pflege, sei es Geschlechterungleichheit oder sei es die Ökonomisierung so vieler Lebensbereiche, die materielle Grundversorgung prekärer machen, die gemeinschaftliche Vorsorge zurückdrängen und Existenzverhältnisse unsicher machen: In all diesen Tendenzen steht die private Bedürfnisbefriedigung und Risikobewältigung im Zentrum politischer Diskurse und Maßnahmen. Die öffentliche Organisation von Versorgung und Vorsorge wird seit einigen Jahren reduziert; Institutionen wie Kranken- und Pensionsversicherungen, Bibliotheken oder Theater, deren Ordnungslogiken auf Solidarität basieren und die Bedürfnisse und deren Befriedigung als kollektive Verantwortung und Aufgaben anerkennen, verlieren ihre verbindende und das Dasein in spezifischer Weise kultivierende Bedeutung. Daseinsvorsorge wird zur Privatsache, organisiert über anonyme Märkte und digitale Plattformen, lokalisiert in Einfamilienhäusern und Wohnungen. Diesen und anderen bekannten oder weniger bekannten Bruchlinien und Sollbruchstellen der Gesellschaft ist gemein, dass sie einen Mangel an Sorge offenbaren.
All das übt Druck auf Beziehungen und „global“ gewordene Haushalte und Sozialstrukturen aus. Die Sozialphilosophin Nancy Fraser sieht „gesellschaftliche Reproduktion insgesamt in Bedrängnis“.2 Aktuell zeigt sich dies an der Destabilisierung und Informalisierung von Arbeits- und Lebensverhältnissen, der Privatisierung von Arbeitslosigkeit, Diskriminierung und sozialen Verwerfungen durch den Neoliberalismus, der nicht die Sorge um andere, sondern die Selbstverantwortung als Prinzip staatlicher Systeme definiert. Eine Folge dieses gesellschaftlichen Drucks ist das Erleben und Erleiden von Entgrenzung und grassierender Zeitarmut, Depressionen und Burn-outs. Die Konsumraten von Schlaf- und Schmerzmitteln steigen kontinuierlich. Der gesellschaftliche Druck zeigt sich zudem an der überindividuell ungleichen Verteilung von und individuellen Belastung durch unbezahlt geleistete, bisher wenig beachtete oder geschätzte Sorge- und Versorgungsarbeit. Sie wird stillschweigend vorausgesetzt und überwiegend durch Frauen erbracht; ihre systemerhaltende Funktion wurde in der Corona-Krise nun etwas sichtbarer und spürbarer. Die Corona-Krise hat gezeigt, welche Art von Arbeit essenziell, überlebensnotwendig und trotzdem unter- oder gar unbezahlt ist.
Im Zuge der neoliberalen Transformation wurde der niemals für alle gültige wohlfahrtsstaatliche Klassenkompromiss aufgekündigt, sozial Deklassierte kämpfen an den Rändern der Gesellschaft schon längst ums Überleben. Vor der Corona-Krise konnte man die Tendenz feststellen, dass öffentliche Angebote und Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitssystem, der Kinderbetreuung, der Pflege und Altersversorgung reduziert oder „vermarktlicht“ wurden und sich die von Nancy Fraser diagnostizierte „Krise der sozialen Reproduktion“ zuspitzte. Corona zeigt das Ausmaß der Care-Krise. Corona zeigt, dass Ungleichheit tötet. Die Arbeiter*innenklasse ist am stärksten betroffen, vor allem Personen, die im Einzelhandel, in der Reinigungs- und Pflegebranche arbeiten, allen voran Frauen und Migrant*innen. Ihre Arbeit ist unter- oder unbezahlt und dennoch notwendig, sie sind die, auf die man für das Funktionieren der Gesellschaft nicht verzichten kann, die man nicht ins Homeoffice schicken kann.
Diese Entwicklung zeigt nicht zuletzt, dass die Krise der Care-Institutionen in einem weiteren politökonomischen Systemzusammenhang steht. Sie verweist auf gesellschaftliche Widersprüche, die Krisen hervorbringen. Der plötzliche Ausfall von institutionellen Einrichtungen – vor allem von Schulen und öffentlichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten – bedeutet eine Verdichtung von Sorgearbeit in privaten Räumen und Beziehungen, erhöht Mehrfachbelastungen und gesellschaftlichen Druck. Corona hat vielfach ungleichheitsverstärkend gewirkt.3
Kaputtgesparte Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sind nicht in der Lage, Menschen massenhaft ausreichend oder gar gut zu versorgen. Das wissen wir zwar nicht erst seit Corona, auch wenn Corona die Dringlichkeit und Gegenwart der Care-Krise in das öffentliche Bewusstsein gerückt hat. So sind etwa zwei Drittel derjenigen Menschen, die im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus verstorben sind, auf Pflege- und Betreuungseinrichtungen entfallen. Der Care-Notstand, die Unterausstattung mit Personal und die Einführung von immer strikteren Effizienzvorgaben verursachen nicht nur Stress und Erschöpfung bei den Care-Arbeiter*innen, sondern auch vermeidbare Tode.
Die „sozialreproduktive Krisentendenz“4 ist – unabhängig von Einzelkrisen und Konjunkturschwankungen – typisch für die kapitalistisch organisierte Gesellschaft. Diese wäre ohne konstante Aneignung von und strukturelle Abwertung von weiblicher Arbeitskraft undenkbar, denn die sich wandelnde, kapitalistisch organisierte Gesellschaft beruht auf geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung. Die Integration dieser feministischen Erkenntnisse in eine Politik des Wandels von Arbeits- und Wirtschaftsverhältnissen, die – unter anderem – in diesem Buch entworfen wird, macht es zuvorderst notwendig, den Begriff Wohlstand radikal neu zu denken. Beziehungen, Ökonomie und Gesellschaft entlang von „Sorge um andere und das Lebendige als leitendes Prinzip“5, wie die Politologin und Ökonomin und Gabriele Michalitsch schreibt, neu auszurichten, ist eine der wesentlichsten Fragen, an denen sich unsere Zukunft entscheidet.
„Wo Frau liebt, sind alle Konzepte deralten Wirtschaftsführung überholt.Sie kommt dabei nicht […] auf ihre Rechnung,sondern auf ihre Differenz.“6
– Hélène Cixous
Differenz
Die Sorge entsteht in der Beziehung zu sich, zu anderen, zur Welt. Sie setzt ein Differenzverhältnis voraus. Mit der Differenz wird es jedoch schon kompliziert. Wo Differenz ist, ist auch Ungleichheit; Gleichheit gibt es nur zu dem Preis, Differenz zu neutralisieren – sie setzt empirische Ähnlichkeit voraus, um Verschiedenes gleich zu behandeln. Gleiches gleich, Ungleiches ungleich. Herrschaft am Horizont.
Differenzfeministische Ansätze versuchen, menschliche Qualitäten (wie Emotionalität, Sympathie, Empathie, Fürsorglichkeit) als Qualitäten, die weiblich sind und sich ausgeprägt überwiegend bei Frauen finden, als solche – als weibliche Werte – aufzuwerten. Größere Bekanntheit in ethischen und rechtlichen Diskursen erlangten Carol Gilligans moralpsychologische Studien einer „Ethik der Fürsorge“, die eine „andere Stimme“ („different voice“) von Frauen in Fragen der Identität und Lebensführung zu bestätigen scheinen.7 Laut der Schriftstellerin Hélène Cixous als ebenjene Stimme, die „ins taube männliche Ohr [fällt], das in der Sprache nur hört, was männlich spricht“8.
„Die Frauen reproduzieren untereinandervermutlich die seltsame Skala der vergessenenTuchfühlung mit ihrer Mutter. Komplizenschaftim Unausgesprochenen, heimlichesEinverständnis des Unsagbaren, des Augenzwinkerns,eines Tons der Stimme der Geste,eines Farbtons, eines Geruchs: darin sindwir, unseren Personalausweisen und Namenentflohen, in einem Ozean der Präzision, einerInformatik des Untrennbaren. Keine Kommunikationzwischen Individuen, sondern eineEntsprechung zwischen Atomen, Molekülen,Wortfetzen, Satztropfen. Die Gemeinschaft derFrauen ist eine Gemeinschaft der Delphine.“9
– Julia Kristeva
Die weibliche Differenz ist etwas, das erst errungen werden muss.
Gilligans Arbeiten zufolge würden Frauen moralische Probleme nicht als im Rekurs auf abstrakte Rechte und Pflichten gerecht oder fair zu lösende Interessenkonflikte betrachten, sondern als Beziehungsprobleme und daher als lebensweltliche Fragen von Verantwortung und Fürsorge. Weibliches Handeln steht hier ganz im Zeichen von Partikularität und Parteilichkeit, von „Liebe und Fürsorge für andere“ – sie mache sogar „den Kern der Moralität aus, und alle sollten dem nacheifern“10, wie Martha Nussbaum den differenzfeministischen Ansatz zusammenfasst. Er ist zweifelsohne ein wichtiger Bezugspunkt für die Kritik am politökonomischen Konstrukt des rationalen, individualistischen Bürgers und die Suche nach alternativen Möglichkeiten der Konfliktlösung: Sie soll rascher und günstiger sein, dazu auf gute Kooperation und Lösungen für alle in einen Streit involvierten Personen und Gruppen ausgerichtet – man denke nur an den Mediations-Boom der 1980er und 1990er Jahre. Ihr Ansatz ist aber auch Bezugspunkt für die Bestätigung von Geschlechterklischees, so wurde die Care-Ethik – durchaus erfolgreich – als Legitimation der Unterrepräsentation von Frauen in Unternehmen herangezogen.11 Demnach gebe es keine geschlechtsspezifische Diskriminierung, sondern nur die geschlechtsspezifische Differenz.
Weibliche Werte führen in einer solchen Argumentation zu weiblichen Priorisierungen von gegenseitiger Fürsorge in Beziehungen und gegen eine berufliche Karriere und Konkurrenzverhältnisse. Dass das, was Menschen priorisieren und wofür sie sich entscheiden, in erheblicher Weise von gesellschaftlichen Zuständen und damit von sexueller Ungleichheit und Sexismus bestimmt ist, bleibt dabei unhinterfragt.12
Auf legistischer Ebene wurde schließlich von der Rechtswissenschaftlerin Tove Stang Dahl Anfang der 1990er Jahre sogar ein „Geburtenrecht“ vorgeschlagen, in dem abstammungs-, reproduktions- und sozialrechtliche Aspekte aufgehen, sowie ein spezifisches „Hausfrauenrecht“, in dem die Arbeits- und Lebensleistungen von Frauen an finanzielle Ansprüche und soziale Sicherheiten geknüpft werden sollten, um diese derart rechtlich anzuerkennen und staatlich zu honorieren.13
Differenzfeministische Entwürfe „anderer“ Modelle von Ethik und Konfliktlösung oder gar Gesetze sind schon eine ganze Weile nicht mehr vorgelegt worden. Sich affirmativ auf Weiblichkeit – also auf Frauen als Gruppe besonders mitfühlender, fürsorglicher Wesen – zu beziehen, wurde zunehmend als essenzialisierend und homogenisierend kritisiert; ein spezifisch weiblicher Bezugspunkt zur Regulierung sozialer Beziehungen geht mit einer schwierigen Vorstellung von „Gleichheit in der Differenz, als Ungleichheit der selbstbestimmten Lebensentwürfe“14 einher. Die Forderung nach Anerkennung von gleichen Rechten – in diesem Zusammenhang Frauenrechten15, jedoch lässt sich dieser Gedanke auf LGBTIQ-Personen und andere marginalisierte, diskriminierte Gruppen erweitern – kann nicht funktionieren, ohne Geschlechterrollen und Gruppenidentitäten zugleich normativ zu fixieren. Das wiederum kann dazu führen, dass strukturelle Ausschlüsse und Ungleichheiten aus dem Blick geraten. Doch auch eine nach wie vor vitale feministische Diskussion, die etwa primär auf Quoten für Spitzenpositionen fokussiert, verschleiert daher auch Macht- und Herrschaftsverhältnisse im Allgemeinen und Differenzen zwischen Frauen im Besonderen, indem sie schlechthin individuelle Wahlfreiheit unterstellt und Zugangsbarrieren und die geschlechtsspezifische Segregation des Erwerbsarbeitsmarkts ausblendet.16