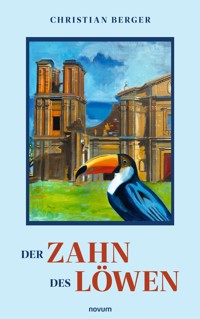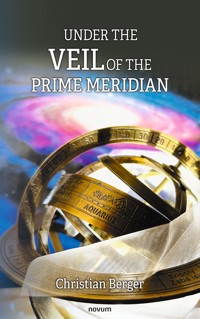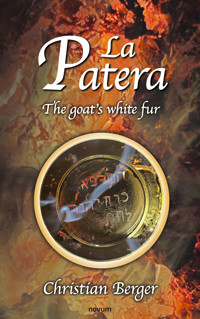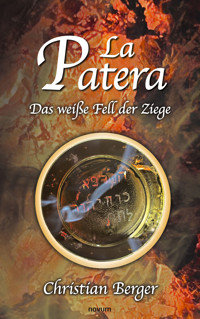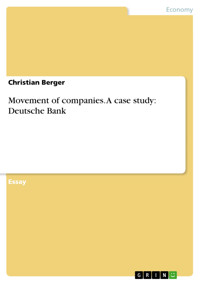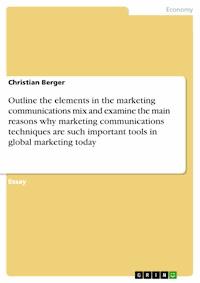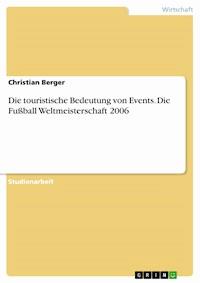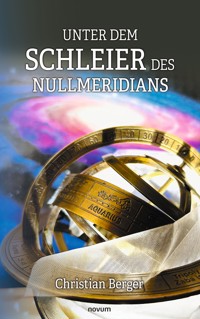
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Festlegung des Nullmeridians war über die Jahrtausende nicht eine Frage der Macht, sondern auch ein Abbild der Grenzen des menschlichen Vorstellungvermögens. Beispielgebend für die Leiden, aber auch die Freuden, der an ihnen lebenden Menschen, sowie ihrer historischen Signifikanz, treten einzelne Plätze immer wieder aus dem Schleier der Geschichte hervor, und zeugen so von den wechselvollen Schicksalen einiger der größten Imperien der Menschheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-99130-755-6
ISBN e-book: 978-3-99130-756-3
Lektorat: Dr. Angelika Moser, Mag. Gerda Kislinger
Umschlag- & Innenabbildungen: Christian Berger
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Widmung
Für meinen Großvater
Raimund Kislinger
Vorwort
Do not let your mind be disturbed. All things must bend to nature.
And soon you will decay to nothing, like Hadrian and even the Great Augustus. Empires will come and go,
death and pestilence will prevail.
Marcus Aurelius
Prolog
Famadihana
Madagaskar (15° 43’ S, 46° 19’ O)
im Jahre 2012
Annuratia, der Ombaysi des Dorfes, nahm einen weißen Seidenschleier aus dem heiligen Schrank seines Hauses und segnete ihn mit dem Rauch von immergrünen Blättern1. Der Rauch verlieh dem Textil einen angenehmen Geruch. In seiner Funktion als Schamane des Dorfes an der Westküste Madagaskars war Annuratia für das Seelenheil der Foko, seiner Dorfgemeinschaft, verantwortlich. Eine „Fady“ hatte sich ereignet. Dieser Tabubruch war ein schwerwiegendes Vergehen. Ein junger Mann hatte sich heimlich mit einer Frau der benachbarten Foko getroffen. Unter den Kreisen des Geckoweihs hatten sie sich auf einer grasbewachsenen Anhöhe gepaart. Das Kreischen des Habichts hatte den Jungen verunsichert. Er war daraufhin völlig verängstigt zu Annuratia gekommen, da er glaubte, die Ahnen hätten ihn in Form des Schlangenhabichts bei seiner sträflichen Übertretung beobachtet. Eine „Fady“ war das schwerste Verbrechen in der Foko und bedurfte einer reinigenden Auseinandersetzung mit den Ahnen. Die Zeit für den Kontakt mit den Ahnen des jungen Mannes in Form einer „Razana“ war gekommen. Annuratia fokussierte seinen Geist, indem er drei Blätter der heiligen Pflanze Khat2 in seinen Mund nahm und solange mit seinen Zähnen zerkleinerte, bis er ihre Wirkung verspürte.
Erst als in seinem Innersten völlige Klarheit und Offenheit herrschten, erhob er sich von seinen Knien und trat mit dem weißen Schleier vor sein Haus. Die gesamte Dorfgemeinschaft hatte sich bereits versammelt. In ihrer Mitte stand der völlig verängstigte Jüngling. Annuratia umhüllte das Haupt des jungen Mannes mit dem weißen Schleier und stimmte den heiligen Gesang der Foko an. Gemeinsam zogen sie unter den salbungsvollen Stimmen der Anwesenden und den Klängen der Valiha, einer Bambusröhrenzither, zum Friedhof am Rande der Siedlung. Annuratia übergab dem Jungen eine heilige Schaufel aus Mahajanga, dem Nordwesten der Insel. Das versteinerte Holz war bis weit über seine Grenzen für die purpurfarbene Maserung bekannt. Nachdem das Grab des Großvaters durch den Rauch von Immergrün gesegnet worden war, begann der Jüngling mit der Freilegung der sterblichen Überreste. Zehn Jahre nach seinem Tod waren schlussendlich nur noch die Gebeine des Vorfahren als stumme Zeugen seiner Existenz übrig. Die Exhumierung wurde vom permanenten monotonen Gesang der Foko begleitet. Die Dorfältesten spielten auf der Bambusröhrenzither die heiligen Klänge. Annuratia umhüllte die sterblichen Überreste mit dem weißen Schleier und kniete in einem Akt von Trance neben ihm. Die Razana konnte nur vollzogen werden, wenn er eins mit dem Geist des Verstobenen war. Durch rhythmische Bewegungen seines Kopfes begab sich Annuratia in einen Zustand völliger spiritueller Transzendenz.
Die ostafrikanische Sonne stand hoch am Zenit und strahlte mit unerträglicher Intensität auf die anwesenden Dorfbewohner. Die erdrückende Hitze wurde durch die feucht schwüle Luft noch verstärkt. Hoch am Himmel zog ein Habicht seine Kreise und machte durch lautes Kreischen auf seine Gegenwart aufmerksam. In seinen Fängen kringelte sich eine Schlange im Todeskampf um die tiefsitzenden Krallen. Selbst die omnipräsenten Lemuren, von den Einheimischen „Katta“ genannt, waren verstummt. Plötzlich hielt Annuratia inne und blickte mit weit geöffneten Augen zuerst gen Himmel und daraufhin in die versammelte Menschenmenge. In diesem Moment ließ der kreisende Habicht von seiner Beute ab und die Schlange fiel zu Boden. Ein Raunen ging durch die versammelte Dorfgemeinschaft. Annuratia sah das Omen und beugte sein Haupt in Demut. Das Aufkommen einer sanften Brise kündigte seine Wiederkehr aus einer anderen Welt an. Er öffnete seine Handflächen und signalisierte dadurch als „Tompon’ny lambantatana“, Meister der hohlen Hand, den Vollzug der „Razana“. Die Ahnen hatten zu ihm gesprochen. Dann wisperte er in völliger geistiger Klarheit die erlösenden Worte: „Famadihana!“
Die Zeit der Wiederbestattung war gekommen. Die sterblichen Überreste des Verstorbenen wurden von vier Männern getragen und in ihr neues Grab überführt. Dieses war zuvor mit den Blättern des Immergrüns gereinigt worden. Nachdem der Leichnam sorgfältig gebettet worden war, bedeckte ihn Annuratia mit einem weiteren Seidenschleier und wies den Jüngling an, die Grablegung zu vollenden. Völlig erschöpft vom heiligen Ritual kniete Annuratia neben dem Grab und stimmte schlussendlich den Versöhnungsgesang der Foko an. Die erleichterte Dorfgemeinschaft feierte unter Jubel die Versöhnung mit den Ahnen.
Es sollte nicht die letzte sein.
1 „Cantharanus roseus“, das Immergrün der Insel Madagaskar, enthält Alkaloide, die vor Malaria schützen.
2 Das Kauen der Blätter von Catha edulis ist im Nahen Osten und in Ostafrika stark verbreitet. Die Blätter der Pflanze enthalten die Substanz Cathin, das eng mit den Amphetaminen verwandt ist. Die Besiedelung Madagaskars erfolgte hauptsächlich durch austronesische Asiaten und Ostafrikaner vor etwa 2500 Jahren. Der Begriff „Fady“ ist mit dem aus Polynesien stammenden Wort „Tabu“ vergleichbar. Die Pest erreichte Madagaskar erst im Jahre 1850. Das Ritual der Wiederbestattung ist essenzieller Bestandteil der Jahrtausende alten Kultur der Madagassen. Sowohl die Architektur Madagaskars, ähnlich der auf Borneo, als auch die Sprache und die Valiha bezeugen die austronesischen Wurzeln der Ureinwohner. Im Jahre 2015 gab es laut WHO weltweit 275 Pesttote, allein 63 davon auf Madagaskar. Dieses Faktum ist wahrscheinlich dem Ritual der Wiederbestattung geschuldet. Im Durchschnitt erfolgt eine „Famadihana“ alle zehn Jahre, je nach den spirituellen Vorgaben des verantwortlichen „Ombayasi“.
Kapitel 1
Die Villa (48°18’ N, 16° 20’ O)
im Jahre 180 n. Chr.
Gaius Flavius Accipiter blickte gegen Westen und sah, dass sich eine gewaltige schwarze Gewitterfront auftürmte. Der Beiname „Accipiter, der Habicht“, war eine Referenz seiner Eltern aus der Kindheit an das Sehvermögen ihres Sohnes. Nach einem langen harten Winter war es ungewöhnlich kalt für Mitte März. Die Reben seiner Weinberge schlummerten noch im Winterschlaf. Ein Greifvogel mit langem Schwanz zog am Himmel seine Kreise auf der Suche nach Beute. Das fahle Licht der Sonne erleuchtete den Mons Zibethicus an der gegenüberliegenden Seite des Stromes Danuvius. Dazwischen lag ein Auwald, in dem Gaius im Herbst oft zur Jagd zu gehen pflegte. Außer Niederwild war der Wald ein Refugium für Biber und Wildschweine. Gaius folgte den kreisenden Bahnen des Greifvogels und fragte sich, warum der Kaiser seine Villa als Quartier ausgewählt hatte. Als Schwager von Titus Germanicus, des Statthalters der Garnison von Vindobona, war Gaius eine führende Persönlichkeit in der Provinz Pannonia superior. „Doch ein Kaiser zu Besuch in seinem bescheidenen Heim?“
„Felix, qui potuit rerum cognoscere“, dachte Gaius.3
Marcus Aurelius war erst vor einer Woche nach der Beendigung der „Expeditio Germanica secunda“ in Vindobona eingetroffen. Der Feldzug hatte drei Jahre gedauert und endete mit einem Sieg, jedoch nicht mit der vollständigen Unterwerfung der rebellischen Markomannen und Quaden. Der Kaiser war geschwächt von den Strapazen des Feldzugs und hatte Titus Germanicus damit beauftragt, eine standesgemäße Bleibe zu suchen. Gaius Villa befand sich im Norden der Garnison von Vindobona, etwa einen Tagesmarsch entfernt. Die Hauptstreitkraft des nördlichen Heeres lagerte in den Garnisonen Carnuntum und Sirmium. Titus Germanicus war mit Marcus Valerius Maximianus übereingekommen, die Liegenschaft dem Kaiser als temporäre Residenz anzubieten. Marcus Maximianus, der Tribun der Legio II. Adiutrix, selbst in der Provinz Pannonia, früher Illyricum inferius genannt, geboren, kannte die Vorzüge der Landschaft. Sauberes Wasser, guter Wein und die Abgeschiedenheit von den Truppen. Seit dem Feldzug gegen die Parther vor fünfzehn Jahren hatte die Pest unter den römischen Soldaten um sich gegriffen. Diese Bedrohung musste unbedingt vom Kaiser ferngehalten werden.
Gaius wurde von einem lauten Schreien jäh in seinen Gedanken unterbrochen. Drusus, sein Maior Domus, rannte wild gestikulierend auf ihn zu. „Meister, Meister, der Kessel des Hypokaustums4 ist gebrochen, wir können das Haus nicht mehr beheizen. Der Kaiser friert. Commodus ist außer sich vor Wut.“
„Holt die Kessel aus dem Weinkeller und bringt sie unter die Villa!“, befahl Gaius. „Sehr wohl, mein Herr“, antwortete Drusus. Beide rannten die Hänge des Mons Fugis hinab und trafen schließlich im Keller der Villa ein. Drusus wies die Sklaven an, die bronzenen Kessel herbeizuschaffen. Nachdem die Kessel mit Wasser befüllt worden waren, beauftragte der Maior Domus vier Sklaven damit, permanent das Röhrensystem mit Holzfächern zu belüften. Erst als sich Gaius sicher war, dass die Heizung wieder funktionierte, rannte er die steinernen Treppen empor und blickte auf den Himmel. Durch die Arkaden des Atriums bahnten sich vereinzelte Schneeflocken ihren Weg und blieben auf dem gefrorenen Boden liegen. Titus Germanicus kam ihm aufgeregt entgegen und stellte seinen Schwager zur Rede. „Der Kaiser des Imperiums verdient nach den Entbehrungen der Expedition ein warmes Heim und du schaffst es nicht, dem Herrn über 1.000 Länder eine warme Liegestatt bereitzustellen!“ „Das Problem ist gelöst, mein Schwager, wie geht es unserem Imperator?“ „Komm und sieh selbst, er wünscht dich kennenzulernen!“
Gaius und Titus durchquerten das Peristylium, den von Kolonnaden gesäumten Innenhof, und öffneten die Tür zum geräumigsten Cubiculum der Villa. Marcus Aurelius lag im Schlafzimmer in einem großen Bett, das von einem Baldachin überdacht wurde. „Wie klein und verletzlich er aussieht“, dachte Gaius. Über dem Bett prangten in goldenen Farben die Insignien der Macht: SPQR, „Senatus populusque romanorum.“5 Der Kaiser krümmte sich vor Schmerzen. Die ansonsten so rosige Farbe seines Gesichts war einer fahlen Blässe gewichen. Favola, die Lieblingssklavin des Imperators, war gerade damit beschäftigt, seinen Körper zu waschen. Sie entfernte die Exkremente aus seinem Subligaculum und zeigte sie dem Leibarzt des Kaisers. Flavius Haemostypticos nahm eine bronzene Schale und ging damit in das Tabulinum der Villa. Favola begleitete ihn mit sorgenvoller Miene. Unter dem Licht einer Öllampe betrachtete der Leibarzt die Exkremente des Kaisers. Der Kot in der Patera war pechschwarz und roch abscheulich. „Melaena“6, murmelte Flavius und bedeutete Favola, ihm in die Küche zu folgen.
„Bereite ihm einen Sud aus Alraune und Binsenkraut!“ Dann nahm Flavius Haemostypticus eine Glasphiole und goss einige Tropfen ihres Inhalts in den bronzenen Becher. „Was ist das?“, fragte Favola. „Papaveris lacrimae7, es wird seine Schmerzen lindern“, antwortete der Leibarzt.
Flavius erinnerte sich an die Zeit seines Dienstes an der Front im Kampf gegen die Germanen. Den Beinamen „Haemostypticus“ hatte er aufgrund seiner Fähigkeit erhalten, abgetrennte Extremitäten mit eigens von ihm entworfenen tellerförmigen Brandeisen zu verschorfen, ohne dass die Soldaten dabei verbluteten oder später an Wundbrand verstarben. Der Inhalt der bronzenen Patera bereitete ihm tiefe Sorge. Als Schüler des großen Galenus wusste er um die Signifikanz der Symptome, die der Kaiser aufwies. Sein Tod war nur noch eine Frage Zeit.
„Wie lange noch, Flavius?“, fragte Commodus, der Sohn des Kaisers, der unbemerkt an ihn herangetreten war. „Wir müssen das Orakel befragen“, antwortete Flavius. „Ich brauche eine Gans, nur dann kann ich gemäß den Regeln der Haruspices eine Eingeweideschau vornehmen.“ Commodus befahl Gaius, eine Gans aus dem Geflügelstall zu holen. „Sehr wohl, mein Herr“, antwortete dieser und übertrug Drusus die Aufgabe, ein geeignetes Exemplar bereitzustellen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kehrte der Maior domus mit einem Federvieh zurück. Flavius Haemostypticus enthauptete das Tier und öffnete seinen Körper in einer goldenen Patera. „Die Leber ist fettig degeneriert, kein eindeutiges Zeichen, aber was mir Sorgen bereitet, ist die Verwicklung des Darms“, sagte Flavius mit ernster Miene. „Es werden weitere Symptome folgen.“
„Wie wird es enden“, fragte Commodus besorgt.
„Mit Tränen und einer Reise ins Jenseits“, antwortete der Leibarzt zögerlich. „Die Götter werden über Orkus oder Elysium entscheiden.“ Mit diesen Worten beendete Commodus die Eingeweideschau. Gaius trat einen Schritt zurück und betrachtete das ausgeweidete Tier. Dann wies er Drusus an, den Kadaver zu verbrennen8. Commodus dankte Flavius für seine Prognose und zog sich in seine Gemächer zurück.
In der darauffolgenden Nacht begann das Martyrium des Marcus Aurelius. War es zu Beginn nur eine zaghafte Erleichterung seines Speichels in die bronzene Patera, die Favola dem Kaiser reichte, so intensivierte sich seine Übelkeit in zunehmendem Maße. Favola weckte Flavius Haemostypticus mit den Worten: „Kommt schnell, mein Herr, der Kaiser stirbt.“ Flavius eilte zur Liegestatt des Imperators und nach einer kurzen Phase der Erschütterung betastete er das Abdomen des Kaisers. Es war bretthart und Marcus Aurelius krümmte sich vor Schmerzen. „Schnell, gebt mir einen Becher“, befahl Flavius der Sklavin. Er verabreichte dem beinahe bewusstlosen Imperator eine weitere Dosis von „Papaveris lacrimae“. Marcus Aurelius erbrach sich in diesem Moment schwallartig und Flavius konnte anhand des Erbrochenen sehen, dass es sich um Kot handelte. „Weckt Commodus, Gaius und Titus Germanicus“, befahl er Favola. Minuten später befanden sich die Gerufenen im Cubiculum.
„Miserere habet“9, sagte Flavius mit ernster Stimme, „die Vorboten des nahen Todes.“
Flavius Haempstypticus nahm die Zunge des Imperators in die linke Hand und versuchte mit der rechten Hand die Atemwege des Kaisers zu reinigen. Marcus Aurelius krümmte sich in seinem Bett. Sein ganzer Körper verkrampfte sich und die Augen traten auf unnatürliche Art aus seinem Schädel hervor. Nur durch die geballte Kraft der Anwesenden konnte er gebändigt werden. Kurz darauf verlor Marcus Aurelius das Bewusstsein. „Helft mit, ihn aufzusetzen“, befahl er Porticus und Favola. Flavius schlug dem Sterbenden mehrmals auf die Rückseite seines Brustkorbs, um die todbringende schwarze Galle aus seinen Atemwegen zu entfernen. Nach einem letzten Schwall des Erbrechens öffnete Marcs Aurelius unvermittelt seine Augen und senkte seinen Blick auf Porticus, seinen Diener. Porticus war ein Hüne eines Mannes. Mit seinem kahlen Haupt und den muskelbepackten Armen glich er einem Gladiator. Die Lücke zwischen seinen Schneidezähnen verlieh seinem Antlitz eine Nuance von Milde, besonders wenn er lächelte. In all den Jahren des Triumphes war es gemäß der Lehre der Stoa seine Aufgabe gewesen, den Imperator in den berauschenden Momenten des Bades in der Menschenmenge mit den Worten: „Du bist nur ein Mensch“ an seine Vergänglichkeit zu erinnern. Commodus und Titus blickten auf den beinahe leblosen Körper des Kaisers und mit einem letzten Atemzug schloss der Imperator seine Augen und ließ die Sorgen der Welt und des Imperiums hinter sich.
„Der Kaiser ist tot“, sprach Titus und wandte sich Commodus zu. Eine nahezu erdrückende Stille erfüllte den Raum. Titus Germanicus senkte sein Haupt und kniete vor Commodus. Dann nahm er die rechte Hand des Mitkaisers und küsste sie dreimal.
„Heil dir, Caesar, die Götter mögen dich segnen.“ Gaius Flavius Accipiter tat es ihm gleich. „Ihr könnt euch entfernen“, sprach Commodus zu den Anwesenden im Raum. „Ich möchte allein von meinem Vater Abschied nehmen.“ Gaius und Titus zogen sich in die Schreibkammer der Villa zurück. Favola reichte beiden einen Becher Wein und entfernte sich beflissentlich. Drusus, der Maior Domus, wurde gerufen und damit beauftragt, die Nachricht vom Ableben des Kaisers in der Villa zu verbreiten. Nach kurzer Zeit erschien Commodus im Tabulinum. „Es ist Zeit, das Imperium zu benachrichtigen“, sagte er mit gebrochener Stimme. Unter Tränen diktierte Commodus seinem Schreiber den Nachruf auf seinen Vater.
„Trauert mit mir, meine Brüder! Unser großer Vater ist von uns gegangen. Marcus Aurelius Antonius war nicht nur unser souveräner Caesar, sondern auch ein moralisches Vorbild für alle Bürger des Imperiums. Er war ein besonnener Philosoph und großartiger Feldherr, der das Reich nach Norden hin vergrößerte. Seid gewiss, meine Brüder, ich werde das Imperium in seinem Sinne weiterführen und bei allen Entscheidungen nach seinen Grundsätzen handeln.“
Nachdem der Schreiber zwei Abschriften vollendete hatte, signierte Commodus die Dokumente mit seinem Namen und verwendete erstmals den Zusatz Augustus, als Zeichen dafür, dass er nun alleiniger Kaiser des Imperiums war. Nachdem die Briefe mit karminrotem10 Wachs und dem persönlichen Siegel verschlossen worden waren, wurden sie dem Hauptmann der Prätorianergarde übergeben.
Die Garnisonen Vindobona, Carnuntum und Sirmium, in denen das gesamte nördliche Heer lagerte, sollten die Nachricht als Erste erhalten. Der zweite Brief war für den Senat in Rom bestimmt. Nachdem die Amtsgeschäfte erledigt waren, begaben sich alle zur Ruhe. Gaius Accipiter lag hellwach in seinem Bett. Tausende Gedanken kreisten in seinem Kopf. Das dramatische Ableben des Kaisers und die Art und Weise, wie er gestorben war. „Ein böses Omen“, dachte Gaius. „Hoffentlich wird nach den feierlichen Zeremonien wieder Frieden in mein Haus einkehren.“
Bereits in der Todesnacht wurde Favola von Commodus damit beauftragt, den Körper des Imperators zu waschen und ihn entsprechend der Gesetze mit Balsam zu versehen. Unter Tränen reinigten Porticus und Favola die sterblichen Überreste ihres Herrn und kleideten sie in die schönste Toga. Der Gürtel des Leichengewands war mit purem Gold besetzt. Favola legte die Hände des Kaisers gekreuzt über sein Abdomen und küsste zum letzten Mal die Hände ihres Herrn. Dann verhüllte sie ihren Kopf mit einem Ricinium, dem schwarzen Schleier der Trauernden, und verließ das Cubiculum. Porticus weigerte sich, von der Seite seines Herrn zu weichen. Der Führungsstil, mit dem Marcus Aurelius, das Imperium regiert hatte, die tiefsinnigen Schriften, die Aphorismen in den Meditationes, dem philosophischen Hauptwerk des Kaisers, in denen er sich selbst und die Welt betrachtete, und nicht zuletzt die Art und Weise, wie er ihn, Porticus, immer mit größter Wertschätzung und Respekt behandelt hatte, entfachten in ihm eine Woge der Trauer. Erst jetzt verstand Porticus die Intention des Kaisers, dass er ihn als ständigen Mahner an seine Vergänglichkeit ausgewählt hatte. Die Welt hatte einen großartigen Menschen verloren, Porticus jedoch einen väterlichen Mentor und einen Freund. Noch in dieser Nacht beschloss er, Commodus um einen höchst außergewöhnlichen Gefallen zu bitten.
Carnuntum (48° 6’ 53” N, 16° 51’ 57” O)
im Jahre 180 n. Chr.
Von Norden blies ein eisiger Wind und vereinzelt landeten Schneeflocken auf der Rüstung des Tribuns. Marcus Valerius Maximianus inspizierte die Truppen, die aus der Provinz Norica zur Unterstützung im Kampf gegen die Germanen gesandt worden waren. Insgesamt fünf Kohorten waren zur Unterstützung nach Osten verlegt worden. Von besonderem Interesse war die Qualität der Schwerter der Truppe. Commodus hatte sich persönlich bei Marcus Valerius, Oberbefehlshaber des nördlichen Heers, über Mängel bei der Ausrüstung der Soldaten beschwert. Das Pilum, ein leichter Speer, war die effizienteste Waffe aus kurzer Distanz, und doch vermochten die römischen Truppen nicht die Schilder der Germanen zu durchdringen. Die Provinz Norica war über ihre Grenzen hinweg für die Härte des dort hergestellten Stahls berühmt.11
Marcus Valerius blickte gen Himmel und wusste instinktiv, dass die Zeichen auf Sturm standen. Die Truppe war durch den langen Feldzug mit all seinen Entbehrungen geschwächt und die Pest griff im Lager um sich. Noch vor der Ankunft des Kaisers hatte er die schwerkranken Pestopfer nach Sirmium im Osten bringen lassen. „Wenn nur Flavius Haemostypticus an seiner Seite wäre“, dachte der Tribun. In all den Jahren des Kriegs hatte er sich immer als loyaler und kompetenter Berater in medizinischen Fragen erwiesen. Außerdem war er ein unterhaltsamer und trinkfester Begleiter. Oft hatten sie sich in den langen, kalten Nächten in den Wäldern Germaniens beim offenen Feuer über Strategien der Kriegskunst, aber auch das ein oder andere Mal über die Schönheit der römischen Frauen unterhalten. Nun lagerten vierzigtausend Mann unter seinem Kommando. Die wahre Kriegskunst beschränkte sich nicht nur auf den Sieg in der Schlacht, sondern auch auf die Verpflegung und Betreuung der Truppen. Marcus Valerius Maximianus wurde durch eine vertraute Stimme aus seinen Gedanken gerissen.
„Tribun, werter Herr, seid gegrüßt.“ Der Mann, der da auf einem Ochsenkarren saß, war kein anderer als Publius Drystanus, ein Kelte aus einem Dorf tief im Gebirge der Provinz Norica. Neben ihm saß seine Frau Moja. Ihr feuerrotes Haar hatte nichts von seinem Glanz verloren. Marcus Valerius und Drystanus verband eine jahrelange Freundschaft. Wenn es seine Verpflichtung im nördlichen Heer zuließ, entfloh Marcus den heißen Sommern der östlichen Steppe und suchte Drystanus in seiner Heimat auf. Sein Dorf lag inmitten eines Gebirgssees. An klaren windstillen Tagen spiegelte sich die kantige Spitze des nahegelegenen Gletschers an seiner Oberfläche. Drystanus war in seinem Dorf ein angesehener Mann. Er besaß mehrere Salzsiedereien, die hervorragendes Steinsalz produzierten. Wenn sie am Morgen zur Jagd aufbrachen, waren die Bergleute schon tief in den Schächten des Salzbergs, um das weiße Gold zu fördern. Mit ihren schweren eisernen Äxten schlugen sie Schächte in den Berg und stützten sie mit schweren Holzbalken ab. Das Steinsalz wurde durch das Kerben tiefer paralleler Rillen aus dem Berg gebrochen und anschließend mit Wollsäcken über die Schächte und Stiegen12 an die Oberfläche befördert. Das Dorf betrieb schon seit Jahrhunderten regen Handel und seine Ware wurde bis an die Ostsee im Tauschhandel gegen Bernstein gebracht.
„Was führt euch nach Carnuntum?“, fragte Marcus Valerius. „Ich bringe Nachschub für eure Truppen. Je eine Wagenladung mit gepökeltem Fleisch und eine Ladung Salz in feinster Qualität.“ „Das können wir auch dringend gebrauchen“, antwortete der Tribun. „Kommt, lasst euch umarmen, mein Freund.“ Drystanus schwang seinen beleibten Körper vom Kutschbock und begrüßte Marcus mit einem herzhaften Lachen. „Wie geht es den Kindern, Moja?“, fragte der Tribun. „Es geht ihnen gut, danke der Nachfrage, Tribun. Sie wachsen und gedeihen, allerdings sind sie kaum satt zu kriegen.“ „Kein Wunder bei dem Vater“, antwortete Marcus und versetzte seinem Gegenüber einen zarten Hieb auf den Bauch. „Liefert eure Ware beim Schatzmeister ab, er wird sicher den ein oder anderen Tremissis13 für euch bereitstellen“. „Pecunia non olet“, antwortete Drystanus mit einem breiten Grinsen. „Trefft mich am Abend in meinem Zelt, wir haben viel zu bereden“, sagte der Tribun.
Drystanus trug den geräucherten Schlögel eines Wildschweins, als er das Zelt des Tribuns betrat. Die Luft im Raum war geschwängert vom Duft des Weihrauchs. Neben dem Tisch stand eine steinerne Büste des Kaisers. Drystanus legte den Leinensack ab und wusch sich die Hände in einem bronzenen Becken, dessen Inhalt nach Rosen und Rosmarin duftete. „Mit lieben Grüßen aus meiner Heimat, er ist gut abgelegen und sollte euch munden.“ „Seid bedankt, mein Freund, kommt und setzt euch zu mir.“ Marcus reichte seinem Freund einen Becher Wein. Dieser nippte an dem Getränk und spitzte die Lippen als Zeichen des guten Geschmacks. „Wie verlief der Feldzug?“, fragte Drystanus. „Wir haben die rebellischen Germanen zum zweiten Mal in sieben Jahren in ihre Schranken gewiesen, doch eine vollständige Unterwerfung steht noch aus. Die Männer sind geschwächt vom Kampf und von Krankheit, ihr Siegeswille jedoch ist ungebrochen. Alles hängt davon ab, wie sich der Kaiser entscheidet. Eine vollständige Unterwerfung im Sinne einer „Debellatio“ wäre meiner Ansicht nach die beste Lösung. Wir sollten diesen seit Jahren schwelenden Konflikt ein für alle Mal beenden. Ich bin es leid, die langen düsteren Winter in den Wäldern Germaniens zu verbringen.“ Kaum hatte er diese Worte gesprochen, stürmte einer seiner Adjutanten ins Zelt. „Eine dringende Botschaft aus Vindobona, Tribun.“ Marcus Valerius Maximianus erhob sich von seinem Stuhl und begutachtete den Brief. Im Schein einer Öllampe betrachtete er das Siegel. „Dieser Brief trägt nicht das Siegel des Kaisers“, murmelte er. Ein höchst unangenehmer Gedanke keimte in ihm hoch. „Das ist das Siegel von Commodus.“ Marcus nahm seinen Dolch und brach das Siegel. Beim Lesen der Zeilen tauchte seine Gedankenwelt in ein Meer von Befürchtungen und möglichen Konsequenzen. Bestürzt hob er seinen Blick und befahl seinem Adjutanten: „Sattelt mein schnellstes Pferd und stellt mir eine persönliche Eskorte von 50 Mann mit Fackeln zusammen. Wir müssen sofort nach Vindobona aufbrechen!“
„Marcus Aurelius ist tot!“
Nach drei Tagen der Trauer begann der letzte Weg des Kaisers. Commodus hatte befohlen, den Leichnam nach Vindobona zu bringen. Die treuen Soldaten der Legio II. Adiutrix, die sich durch ihre Tapferkeit im Kampf gegen die Markomannen und Quaden ausgezeichnet hatten, sollten ihren obersten Heerführer noch einmal zu Gesicht bekommen, bevor er dem Feuer übergeben werden würde. Die gesamte Belegschaft der Villa war versammelt, als Marcus Aurelius durch das Peristylium von Dienern ins Freie getragen wurde. Er ruhte auf einer goldenen Bahre. Nach dem Frost der letzten Tage schien zum ersten Mal wieder die Sonne. Der Kaiser war in eine reinweiße Toga gekleidet. Der Schmerz war aus seinem Gesicht gewichen und er erweckte den Eindruck eines friedlich schlafenden Menschen. Commodus, Titus und Gaius folgten dem toten Imperator. Sie trugen gemäß der Sitte eine schwarze Toga, sodass sich der Kaiser selbst nach seinem Tode von den Versammelten abhob. Der Tradition nach übernahmen die Leibgardisten des Imperators die Aufgabe, ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten. Die Prätorianer waren in voller Rüstung angetreten. Auf Commodus Befehl hin traten drei der Leibgardisten hervor und übernahmen das Tragen der Bahre. Diese hatte an den vier Enden goldene Griffe, sodass allgemeine Verunsicherung herrschte, wie das Tragen mit drei Männern zu bewerkstelligen war. Auf ein Nicken des neuen Imperators hin zwängte sich Porticus durch das Defilee der Soldaten und übernahm das rechte vordere Ende der Bahre. Ein Raunen ging durch die versammelte Menge. Ein Sklave als Mitglied einer imperialen Prozession war höchst ungewöhnlich. Commodus überging das allgemeine Staunen und befahl dem Leichenzug, sich in Bewegung zu setzen. Von der Anhöhe, auf der die Villa thronte, führte der Weg hinab zum Ufer des Stroms. Die Prozession kam nur langsam voran und erreichte schlussendlich einen kleinen Hafen in einem Tal zwischen zwei Bergen. Die Erhebungen im Norden Vindobonas waren von großer strategischer Bedeutung für die Verteidigung der Garnison, da man von ihnen weit in das gegnerische Gebiet blicken konnte. Eine kleine Flotte an Flussschiffen wartete bereits auf die Ankunft des toten Kaisers. Die letzte Etappe seiner Reise sollte Marcus Aurelius auf dem mäch