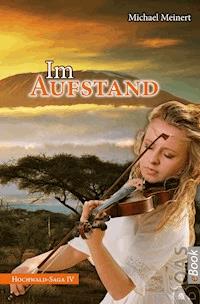9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BOAS-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hochwald-Saga
- Sprache: Deutsch
Breslau, 1866. Um seine Schulden loszuwerden, lässt Leutnant Graf von Schleinitz sich auf eine tollkühne Wette ein: Er reitet in preußischer Uniform über die Grenze, um der von allen Offizieren umworbenen Tochter seines Generals einen Strauß Rosen aus dem feindlichen Böhmen zu bringen. Unterwegs trifft er im schlesischen Hochwald auf Lisa Grüning, die bezaubernde Tochter des Oberförsters von Wölfelsgrund. Und plötzlich befindet sich Schleinitz zwischen zwei völlig verschiedenen Welten. Auf der einen Seite städtisches Amüsement, unheilvolle Intrigen und die verführerische Tochter des Generals - auf der anderen Seite die Ruhe des Waldes, schlichter Glaube und die gottesfürchtige Tochter des Oberförsters. Er ist hin- und hergerissen, dabei erfordern die Dienstpflichten bei der lebensgefährlichen Jagd auf Spione seine ganze Aufmerksamkeit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Breslau, 1866. Um seine Schulden loszuwerden, lässt Leutnant Graf von Schleinitz sich auf eine tollkühne Wette ein: Er reitet in preußischer Uniform über die Grenze, um der von allen Offizieren umworbenen Tochter seines Generals einen Strauß Rosen aus dem feindlichen Böhmen zu bringen. Unterwegs trifft er im schlesischen Hochwald auf Lisa Grüning, die bezaubernde Tochter des Oberförsters von Wölfelsgrund. Und plötzlich befindet sich Schleinitz zwischen zwei völlig verschiedenen Welten. Auf der einen Seite städtisches Amüsement, unheilvolle Intrigen und die verführerische Tochter des Generals – auf der anderen Seite die Ruhe des Waldes, schlichter Glaube und die gottesfürchtige Tochter des Oberförsters. Er ist hin- und hergerissen, dabei erfordern die Dienstpflichten bei der lebensgefährlichen Jagd auf Spione seine ganze Aufmerksamkeit ...
Die Hochwald-Saga spielt in der schlesischen Grafschaft Glatz und der Provinzhauptstadt Breslau. Über drei Generationen, von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, wird die wechselvolle Geschichte einer eng mit den schlesischen Wäldern verbundenen Familie erzählt.
Michael Meinert wurde 1979 in Datteln geboren. Er ist verheiratet und lebt heute in Mülheim an der Ruhr. Schon als Kind fand er zum Glauben an Jesus Christus. In der Hochwald-Saga, in der er tiefgehende und aktuelle Glaubensthemen mit der Handlung verwebt, entführt er die Leser ins historische Preußen.
www.michael-meinert.eu
Dieses E-Book darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, E-Reader) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das E-Book selbst, im von uns autorisierten E-Book Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Die Bibelzitate sind der Elberfelder Übersetzung
(Edition CSV Hückeswagen) entnommen.
Titelfotos:
Mädchen © tuzyra - Fotolia.com
Offizier © Verein Historische Uniformen des Deutschen Kaiserreiches 1871-1918 e.V.
Foto Coverrückseite: © Tim Fuhrländer
Lektorat: Friedhelm von der Mark
Umschlaggestaltung und Satz:
DTP-MEDIEN GmbH, Haiger
eBook Erstellung:
ceBooks.de, Eduard Klassen
Paperback:
ISBN 978-3-942258-06-7
Art.-Nr. 176.806
eBook (ePub):
ISBN 978-3-942258-56-2
Art.-Nr. 176.856
2. Auflage 2018
Copyright © 2014 BOAS media e. V., Burbach
Alle Rechte vorbehalten
www.boas-media.de
Für meine fleißigen und aufmerksamen Probeleserinnen
Elisabeth
Liliane
Catharina
für euer Kritisieren und Motivieren sowie für eure Unterstützung bei den Recherchen zu mode-technischen, chemischen, medizinischen und militärischen Fragen.
Es ist ein Stück weit auch euer Buch.
Dienstgrade in der preußischen Armee des 19. Jahrhunderts
Infanterie
Kavallerie
Bemerkung
Mannschaften
Grenadier,
Füsilier etc.
Reiter
Gefreiter
Gefreiter
Obergefreiter
entfällt
Unteroffiziere
Korporal
Korporal
Befehlshaber einer Korporalschaft (bis zu 30 Mann starke Einheit)
Sergeant
Sergeant
Vizefeldwebel
Vizewachtmeister
Feldwebel
Wachtmeister
Offiziere
Fähnrich
Fähnrich
Offiziersanwärter im Rang eines Unteroffiziers
Leutnant
Leutnant
niedrigster Offiziersdienstgrad, oft Zugführer (bis zu 60 Mann starke Einheit)
Oberleutnant
Oberleutnant
Hauptmann
Rittmeister
meist Chef einer Kompanie (Infanterie) bzw. Eskadron/Schwadron (Kavallerie), einer bis zu 250 Mann starken Einheit
Major
Major
Oberstleutnant
Oberstleutnant
meist Stellvertreter des Regimentskommandeurs
Oberst
Oberst
Kommandeur eines Regiments (bei der Kavallerie bestehend aus fünf Eskadronen)
Generalmajor
Generalmajor
Generalleutnant
Generalleutnant
General
der Infanterie
General
der Kavallerie
Kommandeur eines Armeekorps’ (höchste militärische Befehlsstelle im Frieden, ca. 40.000 Mann, 12.000 Pferde, 144 Geschütze, 2.000 Fahrzeuge)
Generaloberst
Generaloberst
höchster regulär erreichbarer Dienstrang
General- feldmarschall
General- feldmarschall
Titel für besondere Verdienste
Karte: © 52 Pickup – wikipedia.org (Lizenz: CC BY-SA 3.0)
Teil I
Breslau, Mai 1866
Als Valeria von Mutius aufsprang und lachend zu dem anderen Boot hinüberwinkte, ließ Leutnant Graf Ludwig von Schleinitz das Ruder los und schüttelte den Kopf. Diese Wasserfahrt auf der Oder, die in ein Wettrennen ausgeartet war, würde ganz sicher mit einem Unfall enden.
„He, Schleinitz, was ist los?“ Rittmeister Julian von Mutius stieß ihn in die Seite. „Willst du unbedingt, dass wir das Rennen doch noch verlieren?“
Schleinitz sah zu dem zweiten Boot hinüber, in dem sich zwei Offiziere in die Ruder legten, um zu ihrem Boot aufzuschließen. Der dritte winkte zu Valeria von Mutius herüber, die sich gefährlich weit über die Planken lehnte.
„Gnädiges Fräulein“, Schleinitz ergriff die Schwester seines Kameraden am Oberarm. „Sie sollten sich nicht so weit hinauslehnen. Die Oder hat hier gefährliche Strömungen.“
Sie lachte perlend. „Aber Herr Graf, ich bin sicher, dass Sie mich sofort wieder aus dem Wasser ziehen würden, wenn ich hineinstürzen sollte.“
„Selbstverständlich. Nur meine ich, dass ein Bad in der Oder kein Vergnügen werden dürfte.“
Sie sah ihn an und lächelte, und er wunderte sich wieder einmal, wie sehr ihre dunklen Augen strahlen konnten. „Mit einem Ritter wie Ihnen an Bord habe ich keine Furcht, mein lieber Graf. Und von Ihnen gerettet zu werden, halte ich durchaus für ein Vergnügen.“ Sie lehnte sich wieder hinaus und winkte erneut zu dem anderen Boot hinüber.
„Komm lieber an dein Ruder, Schleinitz“, rief Rittmeister von Mutius. „Du willst doch nicht, dass meine Schwester als Zweite das Ziel erreicht?“
„Ich will noch viel weniger, dass deine Schwester das Boot verlässt, ehe wir das Ziel erreichen.“
„Jetzt ziehen sie an uns vorbei! Herr Graf, bitte tun Sie etwas!“ Valeria fuchtelte aufgeregt mit den Armen.
„Bitte nehmen Sie Platz, gnädiges Fräulein. In einem Boot, das nicht schwankt, kommen wir schneller voran.“ Schleinitz griff nach dem zweiten Ruder, und Valeria setzte sich auf die hölzerne Bank.
Mit einigen kräftigen Stößen trieben Schleinitz und der Rittmeister das Boot voran, sodass die drei Offiziere in dem anderen Boot wieder zurückblieben.
Valeria klatschte in die Hände. „Wunderbar! Wir werden siegen! Sehen Sie nur, dort vorne kommt schon der Landungssteg unseres Gartens in Sicht.“ Sie sprang wieder auf und warf den Herren im anderen Boot lachend eine Kusshand zu.
Schleinitz versuchte, das Schwanken des Bootes auszugleichen, während er sich gleichzeitig in das Ruder stemmte.
Valeria wandte sich zu ihm um und strahlte ihn an. Sie sah einfach bezaubernd aus. Einige Löckchen, die unter ihrem Hut hervorsahen, umschmeichelten ihr Gesicht, und ihre dunklen Augen blitzten unternehmungslustig.
Schleinitz lächelte zurück und trieb das Boot weiter mit kräftigen Schlägen voran.
Schwungvoll drehte sie sich wieder zu dem anderen Boot um und streckte den Arm aus. „Sehen Sie nur, wir haben erneut einige Ellen ...“ Mit rudernden Armbewegungen versuchte sie, in dem immer stärker schwankenden Boot aufrecht stehen zu bleiben.
In diesem Augenblick schnellte auch ihr Bruder hoch. „Valeria! Gib acht!“
Abrupt verstärkte sich das Schaukeln des Kahns, dann ein spitzer Schrei und ein lautes Platschen – und die junge Frau war in der Oder verschwunden.
Schleinitz riss die Knöpfe seines Uniformrocks auf. „Mutius, zum Landungssteg rudern und einen Arzt holen. – Kameraden!“, rief er zum anderen Boot hinüber und warf den Rock von sich. „Hierher! So schnell ihr könnt!“
Er warf einen kurzen Blick auf die braunen Wasser des Flusses. Etwa zwei Ellen entfernt stiegen Luftblasen auf, während Valerias Hut flussabwärts getrieben wurde.
In Windeseile stieß Schleinitz sich die hohen Reitstiefel von den Füßen – er wusste selbst nicht, wie er es geschafft hatte, sie so schnell auszuziehen –, dann sprang er kopfüber in die Oder. Wie eisige Nadeln stach die Kälte des Wassers in seine Haut. Seine Kleidung saugte sich sofort voll und zog ihn nach unten, gleichzeitig wurde er von der Strömung erfasst. Valeria in ihrem aufwendigen Kleid mit einer Vielzahl von Unterröcken würde allein bestimmt nicht mehr an die Wasseroberfläche kommen.
Mit kräftigen Zügen kämpfte Schleinitz gegen den Sog an. Als sein Kopf die Wasseroberfläche durchstieß, holte er tief Luft. Er schüttelte den Kopf, um das Wasser aus den Augen zu bekommen. Dort vorn, nur wenige Ellen entfernt, kam gerade eine Hand hervor – Schleinitz konnte sogar die manikürten Fingernägel und den Ring am Mittelfinger erkennen, ehe die Hand wieder verschwand.
Dann wurde auch er wieder unter Wasser gezogen. Von der Strömung unterstützt, tauchte er in die Richtung, wo er die Hand gesehen hatte. Hoffentlich würde es ihm überhaupt gelingen, mit Valeria in ihren schweren Kleidern die Wasseroberfläche zu erreichen, wenn er schon selbst Mühe hatte, sich über Wasser zu halten.
Da fassten seine Hände in etwas Weiches. Das musste ihr Kleid sein. Aber wo war ihr Kopf? Ihre Arme, ihre Beine? Er riss an dem Stoff. Wie viele Schichten trug sie denn übereinander? Dass sie nicht zappelte und um sich schlug, deutete darauf hin, dass sie bereits das Bewusstsein verloren hatte.
Er merkte, wie auch ihm langsam die Luft ausging. Aber er durfte Valerias Kleid nicht mehr loslassen, sonst würde er sie nie wiederfinden. Er tastete weiter. Da war etwas, das sich anfühlte wie ein Schuh – richtig, ein Schuh mit Absatz. Er zog daran – doch der Schuh löste sich vom Fuß.
Sein Herz begann zu rasen. Er musste unbedingt an die Wasseroberfläche und Luft schnappen. Aber nicht ohne Valeria.
Die Rüschen und Bänder ihres Kleides schlangen sich um seine Arme – doch jetzt hatte er etwas erfasst, das sich wie ein Arm anfühlte. Er riss sie an sich, legte seinen rechten Arm um ihren Leib und versuchte, sich nach oben zu kämpfen. Seine Kräfte erlahmten, er merkte, dass er nur noch wenige Sekunden hatte. Seine Kleider und die Last Valerias zogen ihn wie Bleigewichte nach unten. Hastig ruderte er mit den Beinen und dem linken Arm, mit dem anderen presste er Valeria so fest wie möglich an sich.
Da – mit einem letzten Kraftakt stieß er seinen Kopf durch die Wasseroberfläche. Er schnappte nach Luft, ehe er wieder unter Wasser gezogen wurde. Aber in diesem kurzen Augenblick hatte er gesehen, dass das Boot der anderen Offiziere bereits ganz nah war.
Die frische Luft in seinen Lungen gab ihm neue Energie. Er schlang seinen rechten Arm noch fester um die junge Frau und brachte sich mit kräftigen Beinbewegungen wieder über Wasser. Gerade glaubte er, auch Valerias Kopf aus dem Wasser zu bringen, als sich seine Beine in dem Stoffgewirr ihres Kleides verfingen. Sofort begann er wieder zu sinken.
Er riss seinen linken Arm nach oben. Vielleicht waren seine Kameraden nahe genug, dass sie seine Hand ergreifen konnten. Wild schlug er mit den Beinen, doch dadurch verwickelten sie sich offenbar nur noch mehr in dem Kleid, und er sank immer tiefer.
Da spürte er etwas Hartes an seiner linken Hand. Reflexartig griff er zu, und dann merkte er, wie er nach oben gezogen wurde. Endlich kam sein Kopf wieder über Wasser, er zog Valeria nach, die schlaff in seinem Arm hing. Jetzt sah er auch, dass seine Kameraden ihm ein Ruder entgegengestreckt hatten und ihn daran zu ihrem Boot zogen.
Sechs Hände griffen nach der jungen Frau und hoben sie mit einem Ruck ins Boot, während er sich keuchend an den Planken festhielt. Endlich zerrten seine Kameraden ihn ebenfalls ins Boot, wo er erschöpft auf eine Bank sank.
„Das Wasser“, japste er. „Drückt ihr das Wasser aus dem Leib!“
Sein Herz raste, als habe er gerade mit seinem Zug Kürassiere eine Attacke geritten. Wie aus weiter Ferne bekam er mit, dass zwei seiner Kameraden sich um Valeria von Mutius bemühten, während Leutnant von Burbach die Ruder ergriff und mit kraftvollen Schlägen auf den Landungssteg zuhielt. Schleinitz schloss die Augen und versuchte, seinen fliegenden Atem zu beruhigen.
„Sie atmet.“ In Fähnrich von Zaberns Stimme schwang Erleichterung mit.
Langsam öffnete Schleinitz wieder die Augen und sah zu der jungen Frau hinüber. Selbst mit der ruinierten Frisur und der verwischten Schminke sah sie immer noch verführerisch aus.
Zabern wies grinsend auf ihr nasses Kleid, das sich eng um ihren Körper schlang. „Prächtiger Anblick, dünkt mich.“
„Lass das, Zabern.“ Schleinitz drehte Valeria den Rücken zu. „Du solltest die Situation der Dame nicht ausnutzen.“
Endlich erreichten sie den Landungssteg, wo Julian von Mutius sie schon erwartete. Mithilfe seiner Kameraden trug Schleinitz die Gerettete an Land. Bereits kurze Zeit später traf Medizinalrat Dr. Jöhle, der Hausarzt der Familie Mutius, ein und teilte ihnen nach einer eingehenden Untersuchung mit, dass Valeria Glück gehabt habe – sie werde bald wieder auf den Beinen sein.
„Schleinitz, alter Junge.“ Leutnant von Burbach schlug ihm auf den Rücken, dass er fast gestürzt wäre, da er sich noch wackelig auf den Beinen fühlte. „Du Glückspilz – nun hast du bestimmt einen Stein bei ihr im Brett – einen ziemlich dicken Stein.“
„Holla, Schleinitz und die von Mutius! Mich dünkt, man könnte grün werden vor Neid“, grinste Fähnrich von Zabern. „Darauf musst du eine Runde spendieren, Schleinitz!“
Schleinitz verzog das Gesicht. Der große Durst seiner Kameraden würde seinen angespannten finanziellen Verhältnissen nicht gerade dienlich sein.
„Sieh nur, Lisa, das ist doch neu hier, oder?“
Elisabeth Grüning sah zu ihrem kleinen Bruder Ferdinand hinüber, der auf ein Plakat starrte, das vor dem Hotel Zum gelben Dragoner in Wölfelsgrund an einer Litfaßsäule ausgehängt war. „Ich habe es auch noch nicht gesehen, Ferdi. Um was geht es denn?“
„Um Spione“, flüsterte er atemlos. „Bei uns im Grenzgebiet sollen sich österreichische Spione herumtreiben!“
Lisa trat neben ihn und legte ihm den Arm auf die Schultern. Sie verstand, dass den 13-jährigen Jungen allein schon das Wort Spion faszinierte.
„Jetzt begreife ich endlich, warum ich im Wald schon seit Wochen ständig auf Soldaten treffe.“ Die Augen ihres Bruders funkelten. „Bestimmt sind sie unterwegs, um die Spione zu fangen.“
„Du meinst die Patrouillen, über die Vater sich immer aufregt, weil sie seine Setzlinge zertreten?“ Lisa hatte auch schon oft genug Soldaten im Wald gesehen, aber sie war ihnen soweit wie möglich ausgewichen. Man konnte nie wissen, was diese kecken Männer mit einem jungen Mädchen anstellen würden.
„Ja. Ich habe sogar einen von ihnen gefragt, was sie in unserem Wald wollen. Aber er hat mich nur angebrüllt, ich solle nicht immer herumschnüffeln.“
„Das ist auch besser so, Ferdi.“ Lisa zog ihn von der Litfaßsäule fort. „Nicht, dass wir noch in einen Kampf zwischen den Soldaten und den Spionen verwickelt werden.“
„Ich hätte keine Angst“, behauptete der Junge, und Lisa verdrehte die Augen. Ferdi dachte wieder nur an das Abenteuer und nicht an die Gefahr.
„Komm, wir müssen jetzt endlich zum Krämer. Und danach wollen wir doch auch noch Tante Rosina besuchen.“
Sie hatten sich gerade erst einige Schritte von dem Plakat entfernt, als vor ihnen ein junger Mann von etwas über 20 Jahren um die Ecke bog. Lisa ließ ihren Bruder los und hielt inne. „Oh nein!“
„Was denn?“ Fragend sah Ferdi sie an.
„Gustav Elzner.“ Lisa wies mit dem Kopf auf den jungen Mann, der ihnen auf dem Trottoir mit großen Schritten entgegenkam.
„Lisa Grüning – welch erfreuliche Begegnung!“, rief Elzner schon von Weitem.
Als sie sein selbstgefälliges Lächeln sah, schüttelte sie sich. Wie er sich wieder herausgeputzt hatte! Sein blondes Haar glänzte vor lauter Pomade und sein Anzug war für einen Mann, der kürzlich erst von seinem Militärdienst zurückgekehrt und sicher nicht reich war, eine Spur zu elegant.
Sie versuchte, mit einem knappen Gruß an ihm vorbeizukommen, doch er verstellte ihr breitbeinig den Weg.
Ehe sie aber ein Wort sagen konnte, rief Ferdi: „He! Wirst du uns wohl den Weg freigeben!“
Elzner schien Ferdi gar nicht zu bemerken. Sein Grinsen verbreiterte sich noch, als er sagte: „Was sehen deine hübschen braunen Augen so böse auf mich, Lisa? Ein Lächeln würde dir viel besser stehen.“
„Bitte geben Sie mir den Weg frei“, bat sie mit ruhiger Stimme, ohne ihn anzusehen. Gleichzeitig schickte sie ein Stoßgebet mit der Bitte um Hilfe zum Himmel.
Gustav Elzner hatte schon während seines letzten Urlaubes angefangen, ihr den Hof zu machen, obwohl sie erst 15 Jahre alt war. Und nach seiner Rückkehr nach Wölfelsgrund hatte er gleich wieder damit begonnen.
„Ich kenne einen Schlüssel, der dir den Weg sofort öffnen würde.“ Er legte ihr seinen Zeigefinger unter das Kinn, um sie zu zwingen, ihn anzuschauen. „Nur ein kleiner Kuss ...“
„Finger weg von meiner Schwester!“ Blitzschnell schlug Ferdi ihm auf die Hand, sodass Elzner sie reflexartig zurückzog.
Diesen Augenblick nutzte Lisa, um an ihm vorbeizuschlüpfen.
„Bengel du!“, hörte sie Elzner schimpfen. „Dich werde ich lehren, mich zu schlagen!“
„Und ich werde dich lehren, meine Schwester anzufassen!“, schrie Ferdi zurück.
Lisa blieb stehen und wandte sich um, weil sie fürchtete, ihr Bruder würde gleich in eine Schlägerei verwickelt werden, in der er unweigerlich den Kürzeren ziehen musste. Doch Elzner schien sich eines Besseren zu besinnen.
Mit einer übertriebenen Verbeugung in ihre Richtung sagte er: „Fräulein Grüning, wir werden in der nächsten Zeit des Öfteren das Vergnügen miteinander haben. Bitte bestellen Sie Ihrem Herrn Vater einen Gruß von mir, ich werde mich in drei Tagen wie vereinbart bei ihm vorstellen.“
Sie sah ihn nur verständnislos an. Wovon redete Elzner?
„Hat dir dein Vater noch nicht gesagt, dass ich ihm als Forstgehilfe zugewiesen wurde?“
„Nein, und es interessiert mich auch nicht.“ Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Elzner würde ihr unweigerlich tagein, tagaus begegnen, wenn er bei ihrem Vater als Forstgehilfe diente.
„Ich sehe die Freude in deinem Gesicht, Lisa. Übrigens schimmert dein Haar wie Gold, wenn es von der Sonne geküsst wird.“
Abrupt wandte sie sich ab. „Komm, Ferdi.“
Rasch legte sie mit ihrem Bruder die wenigen Schritte bis zum Krämerladen zurück. Aber die Freude an diesem goldglänzenden Maientag war ihr vergangen. Gustav Elzner im Forsthaus – etwas Schlimmeres hätte kaum geschehen können.
* * *
Lachend sah Gustav Elzner dem hübschen Mädchen nach. Irgendwann würde die frostige Lisa auftauen, dessen war er sich gewiss. Er musste nur den ganzen Charme seiner Männlichkeit ausspielen, dann würde sie anschmiegsam werden wie ein junges Kätzchen. Er hatte ja bald genug Gelegenheit dazu. Und die süße Lisa würde es hoffentlich erträglich machen, bei dem grantigen Oberförster im Dienst zu stehen.
Er wandte sich zurück und wollte seinen Weg fortsetzen, als er einen jungen Mann bemerkte, der ihm entgegenkam, aber in diesem Augenblick gerade in eine Seitengasse einbiegen wollte. „Timothée Ramballe! Wohin mit so großer Eile?“
„Ah, mon ami Güstav Elznère! Ich Sie nicht ’atte gese’en.“
Elzner sah in das lachende Gesicht des französischen Wandergesellen, den er vor vier Wochen am ersten Abend nach seiner Rückkehr vom Militärdienst in der Grafschaft Glatz getroffen und mit dem er seitdem manchen lustigen Abend im Wirtshaus verbracht hatte. „Schauen Sie nur, die süße Kleine, die dort in dem Krämerladen verschwindet – ich werde sie heiraten.“
„Mince alors, warum sie verschwindet so schnell? Aber mir scheint, sie ist ein wenig jung?“
Elzner zuckte die Achseln. „Sie wird auch älter. Man muss einen Blick für die Zukunft haben.“ Er zog seine Taschenuhr hervor, ließ sie aufspringen und warf einen Blick darauf. „Es ist gerade die richtige Zeit für einen Ausflug in die Grafschaft Glatz. Sie haben noch immer nicht Ihr Versprechen eingelöst, ein gutes deutsches Bier zu kosten.“
Ramballe verzog das Gesicht. „Bière? Oh non, gerade ’eute es nicht passt. Ich ’abe ein Rendezvous ...“
„Papperlapapp! Sie wollen sich nur vor dem Bier drücken. Kommen Sie schon, danach trinken wir auch einen guten französischen Wein – denn Wein auf Bier, das rat ich dir.“
„Aber Monsieur Elznère, ich Ihnen sage ...“
Doch Elzner hörte nicht auf den Protest des französischen Wandergesellen. Er zog ihn mit sich fort in die Grafschaft Glatz.
Sie fanden einen Platz in der hintersten Ecke des Schankraums, und Elzner bestellte Bier für sich und seinen Freund. „Sie werden sehen, Herr Ramballe, unser deutsches Bier wird Ihnen schmecken wie ein Getränk des Paradieses. – Was schauen Sie sich denn so um? Es gibt hier keine Weiberröcke.“
Ramballe gab keine Antwort, sondern blickte zum Wirt auf, der soeben die beiden Krüge mit Bier brachte. Sie stießen miteinander an, dann sah Elzner den Franzosen erwartungsvoll an.
„Nun?“
„Parbleu! Es ist schlimmer als ich ’atte gedacht! Dies ist nicht ein boisson sondern ein poison1!“
Elzner wischte sich den Schaum aus dem Bart. „Unsinn! Sie haben nicht richtig probiert. Nehmen Sie einen ordentlichen Zug und überlassen Sie das Nippen den Weintrinkern.“
Doch anstatt den Krug erneut an die Lippen zu führen, sah sich sein Freund schon wieder um, als ob er etwas suche. Was hatte er nur?
„Warum sind Sie so unruhig?“
Der Franzose wandte sich ihm wieder zu und nahm hastig einen Schluck Bier. „Pardon, ich ’atte vermutet, gese’en zu ’aben ein bekannt Gesicht, doch ich glaube, ich mich ’abe getäuscht.“
„So so.“ Elzner hob seinen Krug. „Lassen Sie uns anstoßen. Auf die Frauen.“
„Auf die süße Kleine“, fügte der Franzose grinsend hinzu.
Mit dumpfem Klock stießen die Krüge aneinander.
Ramballe schüttelte sich, doch ehe er etwas sagen konnte, murmelte Elzner: „Dieses Mädchen ist wirklich eine ganz besonders Hübsche. Wenn sie nur nicht so fromm wäre ... und nicht so einen bärbeißigen Vater hätte!“
„Wer ist ihr Vater?“
„Der Oberförster Grüning da oben im Schneeberger Forst.“ Elzner verzog das Gesicht, als habe er sich auf die Zunge gebissen. „Ein unangenehmer Zeitgenosse.“
„Aber sa fille scheint Ihnen zu gefallen umso besser.“
„Noch fährt sie die Stacheln aus, aber das werde ich ihr abgewöhnen, wenn ich erst als Forstgehilfe da oben im Forsthaus bin.“ Wie es dem verwitterten Oberförster gelungen war, so eine hübsche Tochter in die Welt zu setzen, blieb ihm ein Rätsel.
„Wenn Sie wollen ’aben la fille, Sie sich müssen gut stellen mit son père. Sonst Sie werden bekommen sie nie.“ Ramballe nippte an seinem Bier. „Brr! Dégoûtant! – Wann Sie ’aben Ihren ersten Tag bei die Förster?“
„In drei Tagen.“
Ramballe grinste. „Sie mir müssen erzählen, wie war erster Tag. Wir uns wieder treffen ’ier in Grafschaft Glatz?“
„Ich muss um zehn Uhr beim Oberförster sein. Ich denke, dass ich am Nachmittag wieder im Dorf sein kann – es sei denn, dieser pedantische Kerl verpflichtet mich gleich am ersten Tag zum Dienst.“
„Er ist wirklich so terrible?“
Elzner schüttelte sich wie Ramballe nach seinem Schluck Bier. „Dieser Oberförster ist ein Preuße, wie ihn sich unser Bismarck nur wünschen kann: pünktlich, gewissenhaft, unbestechlich, zuverlässig, gottesfürchtig ...“
Ramballe lachte. „Es gibt zu viele von diese perfekte preußische Beamte.“
„Der Kuckuck soll die ganzen Preußen holen!“, entfuhr es Elzner. Erschrocken sah er sich um, ob jemand davon Notiz genommen hatte, aber die Bewohner von Wölfelsgrund wussten ohnehin, dass er nicht gut auf die Regierung zu sprechen war.
„Aber was Sie ’aben, Monsieur Elznère? Sie sind selbst Preuße, oder nicht? Sie waren sogar in Armee – drei Jahre. Soll der coucou etwa auch ’olen Sie?“
Elzner stürzte sein Bier hinunter und winkte dem Wirt, ihm ein neues zu bringen. „Dieses Land – ach, was sage ich Land! Preußen ist kein Land, sondern ein System. Und dieses unfehlbare System hat einmal gefehlt.“
„Pardon, wer tut das nicht?“
„Es hat sich in einer Sache geirrt, in der es sich niemals hätte irren dürfen. Als es um Tod und Leben ging.“
„Ich nicht verste’e. Was Sie meinen?“ Ramballe schob sein Bier beiseite und bestellte ein Glas Wein, während Elzner seinen neuen Krug entgegennahm.
Elzner ballte die Faust. „Ein Staat darf sich nicht irren, wenn es um ein Todesurteil geht! Mein Vater wurde hingerichtet – er wurde gehängt!“ Er spürte, wie die alte Wut in ihm hochkochte, wenn er daran dachte. Sein Vater war unschuldig gewesen, und doch hatte man ihn schmählich aufgehängt. Seitdem hasste er den Staat, die Regierung, kurz: ganz Preußen.
„Warum sie ’aben das gemacht?“
„Die Indizien sprachen gegen ihn. Sie glaubten, er hätte damals, 1848, für die Dänen gearbeitet. Ich war fünf Jahre alt, als sie ihn gehängt haben.“
Ramballe sah ihn gespannt an. „Votre père – er war unschuldig?“
Elzner nickte. „Ein Jahr später kam seine Unschuld ans Licht.“ Er nahm einen großen Schluck Bier. „Ich wünschte, ich könnte seinen Tod rächen. Aber wie? Und an wem? Man kann doch keinen Staat, kein System erschießen?“
„Aber ’at Ihre Familie nicht er’alten eine – wie sagt man? Compensation?“
„Lächerlich.“ Elzner fegte mit der Hand über den Tisch, dass er seinen Bierkrug fast auf Ramballes Schoß gestoßen hätte. „Als ob man mit einigen Talern den Tod des Ehemannes und Vaters ungeschehen machen könnte.“ Seine Mutter hatte es bis heute nicht verwunden. Und auch er bekam die Auswirkungen immer noch zu spüren. „Während meines Wehrdienstes war ich immer der Sohn des Spions. Gab es eine zusätzliche Wache – Gustav Elzner musste sie übernehmen. Der Latrinenreiniger vom Dienst war – Gustav Elzner. War jemandem ein Fauxpas passiert – der Schuldige hieß immer Gustav Elzner.“ Er ballte die Faust. „Und wer ist schuld daran? Dieser perfekt organisierte Staat, in dem keine Fehler geschehen!“
„Ich nicht ’atte geglaubt, dass so etwas ist möglich in Preußen.“ Ramballe warf einen Blick zurück über die Schulter.
Und jetzt sah Elzner den kleinen, runden Mann dort hinter der Säule sitzen, der sich scheinbar angeregt mit dem Wirt unterhielt. Er war ihm unbekannt, aber Ramballes Blick war nicht zum ersten Mal in diese Richtung gewandert.
Plötzlich merkte er, wie dieser geschmeidige Franzose ihn dazu gebracht hatte, seinen Hass auf die preußische Regierung kundzutun. Und der Mann dort hinter der Säule – auch wenn er sich mit dem Wirt unterhielt – saß doch nah genug, dass er jedes Wort verstanden haben musste.
Forschend sah Elzner den Franzosen an, der genüsslich an seinem Wein nippte. Wer war Timothée Ramballe wirklich? Ihm fiel plötzlich auf, wie wenig er über seinen Freund wusste. Und jener Fremde dort hinter der Säule? Hatte man ihn in eine Falle gelockt? Dem perfekt organisierten Staat war das ohne Weiteres zuzutrauen.
Elzner nahm einen Schluck Bier, aber plötzlich schmeckte es noch bitterer als sonst.
* * *
Dieser verflixte Wirt! Seit zehn Minuten überschüttete er ihn nun schon mit seinen Geschichten über die Wölfel, die früher, als es den Staudamm noch nicht gab, regelmäßig das ganze Dorf überschwemmt hatte. Konnte er nicht endlich aufhören, ihn mit seinem belanglosen Geschwätz zu nerven? Da war es ihm glücklicherweise gelungen, diesen lauschigen Platz hinter der Säule zu ergattern, und nun wollte ihn der Wirt nicht aus seinen Fängen lassen.
Ernst Ruberg schielte an der Säule vorbei auf die beiden Männer, deren Gespräch ihn brennend interessierte. Eigentlich sollte Timothée Ramballe bei ihm am Tisch sitzen und mit ihm die politische Lage besprechen. Es war ihm unerklärlich, wie dieser plötzlich an den renitenten Preußen gekommen war. Doch dieser Mann machte den Eindruck, als könnte er sich für seine Pläne eignen.
Ruberg gab dem Wirt eine zerstreute Antwort, worauf dieser gleich den nächsten Redeschwall auf ihn niederprasseln ließ. Er ließ ihn reden und versuchte, sich gleichzeitig auf das Gespräch am Nebentisch zu konzentrieren. Dieser Preuße – Elznère nannte Ramballe ihn – schien einen abgrundtiefen Hass auf seine Regierung zu haben. Wenn er richtig verstanden hatte, war sein Vater zu Unrecht hingerichtet worden. Es müsste doch möglich sein, den Hass dieses Mannes für seine eigenen Pläne zu instrumentalisieren ...
Er versuchte wieder, an der Säule vorbeizuschauen. Dummerweise drehte Ramballe ihm den Rücken zu, sonst hätte er ihm bestimmt einen Wink geben können. Wer war dieser Preuße? Anscheinend stammte er aus diesem Dorf, er sollte sich also hier im Grenzgebiet zu Böhmen auskennen. Aber wie konnte er wissen, ob dieser Mann nicht nur Theater spielte, um ihn und Ramballe ans Messer oder vielmehr an den Strick zu liefern?
Wieder versuchte Ruberg, zwischen dem Gerede des Wirtes hindurch einige Gesprächsfetzen vom Nachbartisch aufzuschnappen. Doch plötzlich fiel der Blick des Preußen auf ihn, und er verstummte jäh. Zu dumm, offenbar fühlte er sich von ihm beobachtet.
Während der Wirt weiter von der Bevölkerungsexplosion in den schlesischen Industriegebieten schwatzte, trank der renitente Preuße sein Bier aus und verließ hastig das Lokal.
Ruberg nippte an seinem Wein. Zu gern hätte er diesen Mann engagiert, denn was konnte er Besseres finden als jemanden aus dieser Gegend, der die Preußen hasste? Und – wie er verstanden hatte – sogar beim hiesigen Oberförster aus- und einging? Aber war dieser Mann echt? Oder vielleicht vom preußischen Geheimdienst? Er musste unbedingt mit Ramballe darüber sprechen.
Mitten in dem ausführlichen Bericht des Wirtes über die neu entstandene Eisenbahn legte Ruberg das Geld für den Wein auf den Tisch und erhob sich.
„Bitte entschuldigen Sie.“ Er deutete dem Wirt gegenüber eine Verbeugung an.
Dann ging er an Ramballes Tisch vorbei, legte ihm kurz die Hand auf die Schulter und raunte ihm zu: „Muss Sie unbedingt sprechen. In einer Stunde am Wölfelsfall.“
Ein kurzes Nicken des Franzosen war ihm Antwort genug, dann verließ auch er das Lokal. Auf der Straße sah er sich um, aber er konnte diesen Elznère nicht mehr entdecken.
Verflixtes Geschäft. Er brauchte einen zuverlässigen Mann mit Ortskenntnis, aber wie sollte er ihn finden, wenn er sich mit Offenbarung seines Auftrags in tödliche Gefahr begab?
Schleinitz’ Hand zitterte, als er das Glas mit dem prickelnden Lambrusco hob. Gebannt wanderte sein Blick von den Spielkarten auf dem Tisch zu denen in seiner Hand und wieder zurück.
„He, Schleinitz! Der Wechsel deines geizigen Onkels – er ist wohl schon wieder aufgebraucht?“ Die mit einem leichten Anflug von Lallen ausgesprochenen Worte Leutnant von Burbachs ließen ihn aufblicken.
„Unsinn“, murmelte er und starrte zurück in seine Karten.
Seine Kameraden hatten ihn erneut gedrängt, auf seine Heldentat von vorgestern eine Runde zu spendieren. Denn Valeria von Mutius hatte ihn heute Nachmittag außerordentlich huldvoll empfangen, als er sich nach ihrem Befinden erkundigt hatte – und einige seiner Kameraden hörten da wohl bereits die Hochzeitsglocken läuten oder sahen im Gegenteil ihre Felle davonschwimmen. Doch mit steigendem Alkoholpegel und wachsenden Spieleinsätzen war das Niveau der Unterhaltung immer weiter gesunken, bis sich die Kameraden schließlich darauf eingeschossen hatten, ihn wegen jeder Belanglosigkeit, die ihnen gerade einfiel, zu foppen.
„Wenn er so brummig antwortet, scheint es um seine Finanzen tatsächlich äußerst knapp bestellt zu sein“, lachte Rittmeister von Mutius.
„Und das – es trifft dich empfindlich, wie, Schleinitz? Wenn du die hochwohlgeborene Schwester unseres Rittmeisters von Mutius wirklich erobern willst – ein Sprung in die Oder reicht da allein nicht aus!“
„Und da es für unseren Grafen natürlich nicht weniger als die entzückende Tochter des Korpskommandeurs sein darf“, fügte Fähnrich von Zabern grinsend hinzu, „muss er sich schon etwas einfallen lassen. Mich dünkt, schöne Frauen lieben nur reiche Helden!“
„Oder solche, die es werden könnten“, warf Mutius ein.
„Ich meine, ich habe gehört – Fräulein von Mutius hat doch bereits einen Bewerber abblitzen lassen. Schleinitz, sollte es etwa wegen – solltest du der Grund sein?“
„Ist das wahr?“ Zabern sah Schleinitz an. „Mich dünkt, dein Herr Onkel wird gewiss die Schatulle öffnen, wenn du ihm eine solch hochwohlgeborene Braut vorstellst.“
Schleinitz warf seine Karten auf den Tisch, dass es klatschte. „Es ist genug, meine Herren. Jeder von uns hatte bereits mit finanziellen Engpässen zu kämpfen.“
Die Neckereien seiner Kameraden wegen seiner Begeisterung für Valeria von Mutius und seiner schlechten Kassenlage wurden ihm langsam zu viel. Dutzende stattliche, aber mittellose Offiziere hatten sich bei der bezaubernden Tochter des Generals schon eine krachende Abfuhr geholt, doch ihm schien sie ein gewisses Wohlwollen entgegenzubringen – und das nicht erst seit vorgestern.
„Ja ja, unser Sold – spärlich ist er. Es sei denn, man macht es wie unser Freund Mutius – aber das ist nicht jedem gegeben – rasant Karriere muss man machen.“ Der kleine blonde Leutnant von Burbach schlug dem Rittmeister lachend auf die Schulter.
„Es kann aber nicht jeder einen General zum Vater haben“, stichelte Schleinitz zurück.
„Aber man kann es über die Tochter des Generals versuchen, dünkt mich.“ Zabern stürzte den Rest seines Weins hinunter.
„Hirngespinste!“, warf Schleinitz dazwischen. „Aus euch spricht der Neid der Besitzlosen, weil das gnädige Fräulein euch bestenfalls einen kurzen Tanz schenkt und dann wieder links liegen lässt.“
„Oho, unser Schleinitz – giftig wird er!“, rief Burbach.
„Mich dünkt, das liegt an den absonderlichen Absichten, die sein Onkel mit ihm verfolgt.“ Zabern musterte Schleinitz. „Nein, zum verstaubten Juristen taugst du wirklich nicht.“
Mutius zündete sich ein Zigarillo an. „Ich kann euch sagen, woher er seine gallige Laune hat.“
Schleinitz seufzte innerlich. Er wusste, was jetzt kommen würde. Aber er wagte nicht, Mutius am Sprechen zu hindern – immerhin konnte der Sohn des Generals für seine Karriere und die Beziehung zu Valeria ungemein nützlich sein.
Mutius beugte sich vor und senkte seine Stimme. „Unser lieber Herr Graf bekam heute Morgen einen Brief.“
„Einen Liebesbrief?“, fragte Fähnrich von Zabern dazwischen, während er sich nachschenken ließ.
„Er war zwar von einer Frau, aber ich fürchte, es handelte sich um etwas weniger Vergnügliches.“
Schleinitz verzog das Gesicht. „Wollen wir nicht mit dem Spiel fortfahren?“
„Damit du noch mehr Geld verlierst, das du frühestens in vier Wochen bezahlen kannst, wenn der nächste Wechsel deines Onkels kommt? Nein, mein Lieber, so lenkst du nicht von meiner Geschichte ab.“ Mutius zog an seinem rechten Ohrläppchen. „Wann wird deine Schwester endlich einsehen, dass ihre Bekehrungsversuche umsonst sind?“
Schleinitz hätte sich ohrfeigen können, dass er Mutius von dem Inhalt des Briefes erzählt hatte. Aber dummerweise hatte der Rittmeister ihn auf seinem Schreibtisch liegen sehen und neugierig nachgefragt. „Das Predigen scheint ihr im Blut zu liegen“, antwortete er schulterzuckend.
Er versuchte, die fragenden Blicke seiner Kameraden zu ignorieren, die offenbar mehr darüber erfahren wollten. So sehr ihm die Bußbriefe seiner Schwester auch auf die Nerven fielen – sie blieb doch seine Schwester. Schließlich hatte sie sich um ihn gekümmert, als sie, nachdem ihre Eltern vor 18 Jahren kurz hintereinander gestorben waren, in die Obhut des frostigen Onkels gekommen waren.
Doch Mutius konnte es selbstverständlich nicht unterlassen, die Neugier der Kameraden zu befriedigen. „Ihr müsst wissen, dass Schleinitz’ fromme Schwester ihn in schöner Regelmäßigkeit zu einem ordentlichen Lebenswandel bekehren will.“
„Dann wird es Zeit – du solltest ihr die Grenzen aufzeigen, weil – sich beherrschen lassen von einer Frau – das sollte man niemals!“
„Es sei denn, man will sie heiraten und sie könnte eine Beförderung mit in die Ehe bringen.“ Zabern klopfte Schleinitz auf den Rücken. „Kopf hoch, lieber Graf, mich dünkt, die schöne Valeria macht dich noch zum Generalfeldmarschall.“
„Aber ein Leutnant – damit wird sich das gnädige Fräulein nicht abgeben.“ Burbach schüttelte den Kopf. „Ein Rittmeister – das muss es wenigstens sein.“
Schleinitz bemerkte, wie Mutius ihn mit hochgezogenen Augenbrauen ansah. „Wenn es wirklich zum Krieg mit Österreich kommen sollte ...“
Hatten diese Worte einen tieferen Sinn? Sollte sein Kamerad eine Verbindung mit seiner Schwester tatsächlich begünstigen? Dann hätten seine notorischen Geldprobleme schlagartig ein Ende.
„Bis zum nächsten Krieg zu warten – das dauert ihm doch viel zu lange, unserem feurigen Liebhaber“, nahm Burbach die Neckerei wieder auf. „Ich meine, jetzt muss er noch einmal auf besondere Weise seine Ergebenheit zeigen – seine Herzensdame erneut beeindrucken.“
„Oh ja!“, stimmte Zabern ein. „Mich dünkt, dass das gnädige Fräulein ihn auch als Leutnant nimmt, wenn er wieder etwas Ausgefallenes für sie tut.“
Schleinitz winkte ab. Wie kam es nur, dass sich seine Kameraden gerade auf ihn eingeschossen hatten? Er mochte es gar nicht, dass seine Schwäche für Valeria von Mutius so breitgetreten wurde. Wenn es allerdings eine Möglichkeit geben sollte ... Bisher hatte er sie für unerreichbar gehalten.
„Ich wette – eine weitere Heldentat muss es sein! Das wird die schöne Valeria vollends von Schleinitz’ Vorzügen überzeugen.“
„Was gibt es im Frieden schon für Heldentaten zu vollbringen?“ Schleinitz nippte an seinem Lambrusco. Ein Krieg wäre allerdings die beste Möglichkeit, um befördert zu werden, aber ob es tatsächlich dazu kommen würde?
„Du hast doch erst vorgestern selbst gezeigt, dass man auch im Frieden ein Held werden kann“, meinte Zabern und nahm einen großen Schluck aus seinem Glas. Als er Schleinitz danach wieder ansah, zuckten seine Mundwinkel. „Wie wir alle wissen, liebt das gnädige Fräulein rote Rosen über alles. Wie wäre es, wenn du ihr einen Strauß besorgst?“
Schleinitz zupfte mit Daumen und Zeigefinger an seinem Schnurrbart. „Es ist wohl kaum eine Heldentat, einer Dame Rosen zu überbringen. Selbst wenn ich sie persönlich pflücken würde.“
„Mich dünkt, es kommt auf den Ort an, wo du sie pflückst“, fuhr Zabern mit einem pfiffigen Lächeln fort. „Die Grenze zu Österreich ist nicht weit ...“
Die Kameraden brachen in lautes Gejohle aus. „Das ist gut“, schrie Burbach und schlug sich auf die Schenkel. „Schleinitz – er reitet in Uniform über die Grenze und bringt seiner Angebeteten einen Strauß roter Rosen mit!“
„Wenn dir das gelingt, Schleinitz, sind dir alle Schulden erlassen“, grölte Zabern und hob erneut sein Weinglas. „Darauf müssen wir anstoßen.“
Schleinitz starrte seine Kameraden fassungslos an. Sie wollten ihn in preußischer Uniform über die Grenze nach Österreich schicken? In das Land, mit dem ein Krieg drohte? Nur um einen Strauß Rosen zu holen? Das grenzte an Wahnsinn! Wenn er an der Grenze oder in Österreich erwischt würde, würde man ihn ohne Prozess als Spion erschießen!
Er sah in die lachenden Gesichter seiner Kameraden, die ihm ihre Gläser entgegenhielten.
„Los, Schleinitz, stoß an! Oder hast du etwa nicht den Mut dazu?“
Es gehörte in der Tat eine ordentliche Portion Mut dazu. Aber seine Kameraden hatten recht: Damit würde er Valeria wahrscheinlich noch mehr beeindrucken als durch den Sprung in die Oder – und wenn sie sich erst einmal auf ihn einließ, stand ihm als Schwiegersohn des Generals eine steile Offizierskarriere bevor. Dazu wäre er noch seine Schulden auf einen Schlag los – davon hatte er schließlich mehr als Haare auf dem Kopf, solange sein Onkel noch lebte.
Schleinitz sprang auf und ergriff sein Weinglas. „Die Wette gilt: Ihr erlasst mir alle Schulden, wenn ich nach Österreich reite und einen Strauß roter Rosen für Valeria von Mutius hole.“
Klingend stießen die Gläser aneinander, und Schleinitz stürzte den Lambrusco hinunter, um die Angst, die trotz allen Mutes – oder war es Leichtsinn? – an ihm nagte, zu ertränken.
Oberförster Albert Grüning schob die Papiere, die ihn wieder einmal an den Schreibtisch fesselten, weit von sich und sah zu Pollux, seinem Jagdhund, hinüber, der sich behaglich auf der Decke vor dem Kamin zusammengerollt hatte. Sein Blick wanderte weiter zum Fenster und dann sehnsüchtig in seinen frühlingsgrünenden Wald hinaus. Durch die geöffneten Flügel drangen der Maienduft und das Jubilieren der Vögel herein. Wenn der Termin mit seinem neuen Forstgehilfen gleich erledigt war, hielt ihn nichts mehr an seinem Schreibtisch.
Die kleine Uhr zwischen den Geweihen und Gehörnen verkündete soeben durch ein feines Ping-ping die zehnte Stunde des Tages, als an die Tür seines Arbeitszimmers geklopft wurde. Sofort hob Pollux den Kopf und knurrte.
„Donnerwetter.“ Grüning rief den Hund an seine Seite. „Das nenne ich pünktlich.“
Er wartete, bis das letzte Ping der Uhr verklungen war. „Herein!“
Sofort schwang die Tür auf und ein junger Mann trat ein. Zwar kannte Grüning den Burschen aus dem Dorf, doch hatte er ihm nie größere Beachtung geschenkt. Aber als er ihn nun genauer musterte, gefiel ihm die schmucke Gestalt sofort. Er war groß und breit, hatte sorgfältig gescheiteltes Haar und ein offenes Gesicht – er konnte sich ihn gut in Jägeruniform vorstellen.
Grüning neigte kurz den Kopf und wies auf den Stuhl auf der gegenüberliegenden Seite seines Schreibtisches.
Der Mann verbeugte sich. „Guten Morgen, Herr Oberförster. Gustav Elzner mein Name. Ich wurde Ihnen vom Forstministerium als Gehilfe zugeteilt und möchte mich bei Ihnen vorstellen.“
„Schon gut.“ Grüning wies erneut auf den Stuhl. „Nicht so viele Förmlichkeiten.“
Elzner nahm Platz. „Ich danke Ihnen, Herr Oberförster, dass Sie mir Ihre kostbare Zeit zur Verfügung stellen.“
„Lassen Sie das Gefasel.“ Grüning fixierte sein Gegenüber, während er sich in seinem Sessel zurücklehnte. „Wie kommen Sie dazu, sich für den Forstberuf zu entscheiden?“
„Das liegt für jemanden, der in Wölfelsgrund am Fuß des Hochwaldes aufgewachsen ist, nicht fern.“ Elzner lächelte verbindlich. „Schon als Kind hat mich der Wald fasziniert. Deshalb möchte ich diese meine Liebe zum Beruf machen.“
„Werden sich mehr mit Schreibkram herumplagen müssen, als Ihnen lieb ist.“ Grüning wies auf die verhassten Papierstapel auf seinem Schreibtisch. „Ihr Studium beginnt wann?“
Elzner zog seine Taschenuhr hervor und ließ sie an der Kette pendeln. „Mit dem Wintersemester am 1. Oktober.“
„Bleiben also vier Monate. Werde einen tüchtigen Forstbeamten aus Ihnen machen.“ Zuerst hatte es ihm gar nicht gefallen, dass er auf Anweisung des Ministeriums einen neuen Forstgehilfen einarbeiten sollte, aber dieser waldverbundene junge Mann gefiel ihm besser als erwartet. Vielleicht war er es tatsächlich wert, dass er ihn förderte. „Studium in Breslau?“
„Jawohl, Herr Oberförster.“
„Gute Universität.“ Grüning strich Pollux, der sich zu seinen Füßen niederließ, über den Kopf. „Habe Ihrem Bewerbungsschreiben entnommen, dass Sie Ihre Wehrpflicht in Glatz abgeleistet haben?“
„Beim 1. Oberschlesischen Infanterieregiment.“
Grüning nickte. „Sie wohnen jetzt wieder im Dorf bei Ihrer Mutter?“
„Ja, aber ... ist es nicht im Sinne meiner Dienstobliegenheiten hilfreich, wenn ich ein Zimmer im Forsthaus beziehe?“ Elzner ließ den Deckel seiner Taschenuhr aufspringen.
Grüning kniff die Augen zusammen. Eigentlich war es nicht seine Absicht gewesen, dem Forstgehilfen auch noch ein Zimmer im Forsthaus einzuräumen. Jedoch bot es unbestreitbare Vorteile, wenn Elzner nicht jeden Tag den Weg von Wölfelsgrund bis hier herauf machen musste. „Hm“, brummte er.
„Ich stehe dann selbstverständlich auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten jederzeit zu Ihrer Verfügung“, fügte Elzner eifrig hinzu. „Vier Monate sind nicht lang, und ich möchte bis zum Beginn des Studiums möglichst viel von Ihnen lernen.“
„Hm.“ Grüning griff zum Bleistift und kritzelte irgendwelche wirren Figuren auf den Brief einer Holzhandlung. „Sie müssten sich nach den Regeln des Hauses richten: Pünktlich zu den Mahlzeiten erscheinen ...“
„Selbstredend.“ Elzner nickte.
„... kein Alkohol, sonntagmorgens gehen wir gemeinsam zum Gottesdienst nach Wölfelsgrund ...“
Elzner schluckte, dann nickte er lächelnd.
„Hm“, brummte Grüning noch einmal. Sollte dieser junge Mann anders als die meisten seiner Altersgenossen noch einen rechtschaffenen Lebenswandel führen? Sie würden es sehen. Wenn er sich nicht einfügte, würde er ihn einfach wieder hinauswerfen. „Könnte Ihnen das Gästezimmer im Obergeschoss anbieten.“
„Das wäre großartig“, strahlte Elzner.
„Allerdings ist das Zimmer meiner Tochter ebenfalls im Obergeschoss. Sie können unmöglich mit ihr auf einer Etage wohnen.“
„Selbstverständlich. Das wäre unschicklich.“
Der Bursche schien sogar Anstand zu besitzen. „Meine Tochter kann aber gut nach unten ziehen. Haben hier noch eine Kammer.“
Elzner klappte den Deckel seiner Uhr zu. „Oh, bitte, Herr Oberförster. Ich möchte keine Umstände bereiten.“
„Unfug.“ Was der junge Mann bloß mit seiner Uhr hatte? „Es wird Elisabeth nichts ausmachen.“
„Nun, wenn das so ist … dann nehme ich gerne an.“ Elzner lächelte.
„Gut. Sie wohnen also hier im Haus. Können gleich heute einziehen.“ Grüning stand auf, woraufhin Elzner seine Uhr einsteckte und ebenfalls aufsprang. „Kommen Sie. Werde meine Familie informieren.“
Sie fanden Rahel in der Küche, wo sie zusammen mit Elisabeth das Mittagessen vorbereitete. Grüning musste immer wieder lächeln, wenn er seine Frau sah. In seinen Augen war sie, seitdem er sie vor 17 Jahren kennengelernt hatte, kaum gealtert. Ihr Haar war noch ebenso blond wie damals und ihre Augen so klar wie der Frühlingshimmel. Sogar ihre schlanke Figur hatte sie bewahrt, während er sich ein kleines Wohlstandsbäuchlein zugelegt hatte.
„Rahel, Elisabeth – möchte euch mit unserem neuen Hausbewohner bekannt machen.“ Er wies auf Elzner. „Sicherlich kennt ihr Gustav Elzner. Er ist mein neuer Forstgehilfe und wird bei uns wohnen.“
Rahel legte die Topflappen beiseite und reichte Elzner die Hand. „Herzlich willkommen im Forsthaus, Herr Elzner.“
Elzner machte eine tadellose Verbeugung. „Vielen Dank, gnädige Frau. Ich hoffe sehr, dass ich Ihnen keine Umstände bereite.“
„Mein Sohn Ferdinand ist leider nicht anwesend, weil ihn noch die Schulpflicht ruft“, fuhr Grüning fort. „Aber Sie kennen ihn sicher auch.“
Elzner nickte. „Sehr wohl.“
Elisabeth, die weiterhin geflissentlich den Salat geputzt hatte, fragte nun ohne aufzusehen: „Wo möchtest du ihn denn wohnen lassen, Vater? Das einzige freie Zimmer ist das Gästezimmer gegenüber von Ferdis und meinem im Obergeschoss.“
„Richtig. Dieses Zimmer wird er bekommen. Du kannst gut in die Kammer neben der Wohnstube ziehen.“
Sie hielt mitten in ihrer Beschäftigung inne und sah ihn mit großen Augen an. Er wunderte sich immer wieder neu über die warmen, braunen Augen seiner Tochter. „Ich soll mein Zimmer räumen?“
„Richtig, Elisabeth.“
Wieder machte Elzner eine tadellose Verbeugung. „Ich hoffe, das gnädige Fräulein ...“
„Meine Tochter wird ihr Zimmer gerne für Sie räumen, Herr Elzner.“ Grüning warf ihr einen Blick zu, der sie eigentlich zum Schweigen bringen sollte, aber seine sonst so sanftmütige Tochter erwies sich heute als erstaunlich widerspenstig.
„Aber könnte Herr Elzner nicht weiterhin im Dorf wohnen? Schließlich muss Ferdi auch jeden Tag den Weg dorthin zurücklegen.“
„Genug.“ Grüning wandte sich Elzner zu. „Bitte verzeihen Sie. Sie sind selbstverständlich willkommen im Forsthaus. – Elisabeth, du wirst jetzt gleich nach unten ziehen.“
Wort- und grußlos verließ das Mädchen die Küche, wenige Augenblicke später ging die Haustür, dann eilte sie draußen am Küchenfenster vorbei und in den Wald hinein. Grüning glaubte beinahe, Tränen in ihren Augen entdeckt zu haben – waren es Tränen der Wut? Nur wegen des Zimmerwechsels? Das sah seiner Tochter gar nicht ähnlich. Aber was sollte es sonst sein? Er warf Rahel einen fragenden Blick zu, die mit den Schultern zuckte und ebenfalls ratlos schien.
„Entschuldigen Sie, Herr Elzner.“ Grüning räusperte sich. „Kommen Sie heute Abend um sieben Uhr mit Ihren Effekten. Bis dahin hat Elisabeth ihr Zimmer geräumt. Können dann gleich einziehen, und morgen früh werden wir mit Ihrer Ausbildung beginnen.“
* * *
Auf der Gartenseite des Gutshauses von Spieglitz sprang Graf Ludwig von Schleinitz aus dem Sattel. Bis jetzt war sein wahnwitziger Ritt über die Grenze nach Böhmen ohne jeden Zwischenfall verlaufen – aber den gefährlichsten Teil seiner Aufgabe hatte er schließlich noch vor sich. Abseits der Wege über die Grenze zu gelangen und über verschlungene Waldpfade ins Tal nach Spieglitz zu reiten, war für einen Offizier der preußischen Kavallerie keine große Herausforderung. Jetzt aber hieß es, in den Garten eines Gutshauses einzudringen und im Blickfeld der Fenster einige Rosen abzuschneiden.
Er musste verrückt gewesen sein, als er sich auf diese Wette, die äußerst unliebsam enden konnte, eingelassen hatte. Obwohl ... wenn er sich Valeria von Mutius’ Bild ins Gedächtnis rief ... Für sie lohnte es sich schon, dieses gefährliche Abenteuer zu wagen. Es war schließlich nicht nur die Tatsache, dass sie die Tochter seines Generals war. Sie besaß genug andere Eigenschaften, die sie für einen Mann attraktiv machten: Sie war jung, bildschön, weltgewandt ... und sie schien ihn allen anderen Bewerbern vorzuziehen.
Doch rasch richtete Schleinitz seinen Blick wieder auf das, was gegenständlich vor seinen Augen war: die roten Rosen im Garten des Gutshauses von Spieglitz.
Er band sein Pferd an den niedrigen Zaun, der den Park umgab. Mit einem Satz überwand er den Zaun, betrat den Garten und eilte den Weg entlang auf einen Rosenstrauch zu. Das Knirschen des Kieses unter seinen Stiefeln klang in seinen Ohren wie Donnergrollen, und er war sich beinahe sicher, dass es bis ins Innere des Hauses zu hören war.
Aber zum Zögern blieb ihm keine Zeit mehr. Er übersprang eine niedrige Buchsbaumhecke, die den Kiesweg säumte und hinter der ihn der Duft der Rosen verheißungsvoll empfing. Ohne sich umzusehen, zog er sein Messer hervor und begann, einige aufbrechende Rosen abzuschneiden. Ihm fuhr ein Dorn in den Finger, aber er ignorierte den Schmerz.
Gerade griff er nach einem auffallend schönen Exemplar, das sich eben seiner grünen Knospenhülle entledigte, als eine sich überschlagende Stimme an sein Ohr drang. „He! Sie!“
Er erstarrte in seiner Bewegung, dann warf er einen Blick in die Richtung, aus der die Stimme kam. Ein Mann in grüner Schürze rannte auf ihn zu, wild mit den Armen rudernd, als wollte er die Schnelligkeit seiner kurzen Beine durch die Armbewegungen steigern.
Schleinitz drückte die Rosen, die er bereits abgeschnitten hatte, fest an sich. Hoffentlich kannte sich dieser Hüter der gutsherrlichen Rosen nicht mit Uniformen aus, sonst geriet er noch in ernsthafte Schwierigkeiten.
„Was fällt Ihnen ein!“, brüllte der Mann.
Als im oberen Stockwerk ein Vorhang beiseitegeschoben wurde und eine männliche Gestalt ans Fenster trat, sprang Schleinitz über die Buchsbaumhecke zurück auf den Kiesweg und trat den Rückzug an.
„Unerhört!“ Der Gärtner überschlug sich fast in seiner Hast. „Ein Saupreuß’ in unserem Park!“
Er kannte sich also doch aus. Kein Wunder, lag die Grenze doch nur wenige Meilen entfernt.
Blitzschnell war Schleinitz über den Zaun und versuchte, den Knoten in den Zügeln zu lösen. Mit den Rosen in der einen Hand gestaltete sich das aber äußerst schwierig. Der Mann mit der grünen Schürze, der sich beim Laufen fast die Arme aus den Schultern kugelte, hatte ihn bald schon erreicht, als Schleinitz endlich im Sattel saß.
„Los, Wothan!“ Jetzt kam es nur noch auf Schnelligkeit an. Er musste einen ausreichenden Vorsprung haben, ehe der Wächter des Parks ihm ernstzunehmende Verfolger auf den Hals hetzte.
Unglücklicherweise musste er auf seinem Weg zur Grenze das Dorf durchqueren. Auf dem Hinweg hatte er es südlich umgangen, aber jetzt konnte er sich keinen Umweg erlauben. Zwar würde ein Reiter im vollen Galopp, noch dazu in fremder Uniform, unweigerlich helle Aufregung im Dorf erzeugen, aber das war immer noch sicherer, als den Verfolgern die Möglichkeit einzuräumen, ihm den Weg abzuschneiden.
Tief beugte er sich über den Hals seines Hengstes, der an dem rasenden Galopp offenbar seine Freude hatte. Allerdings wusste er, dass das Tier diesen Kraftakt nicht lange durchhalten würde, schließlich waren sie schon den ganzen Tag unterwegs. Und der Weg bis in das erste Dorf auf preußischem Boden, dessen Namen er vergessen hatte und in dem Fähnrich von Zabern auf ihn wartete, war ziemlich weit.
In der Tat dauerte es nicht lange – er hatte noch nicht einmal das Dorf Spieglitz erreicht –, da hörte er schon Hufschlag hinter sich.
„Wothan, es geht um unser Leben!“, keuchte er seinem Pferd ins Ohr.
Die ersten Häuser des Dorfes flitzten rechts und links an ihm vorbei. Dort kam die Kirche mit dem kurzen Zwiebelturm. Beinahe hätte er eine Frau, die einen Kinderwagen vor sich herschob, über den Haufen geritten, doch Wothan wich im letzten Augenblick aus. Schreiend spritzten einige Kinder auseinander, ein alter Herr schwang drohend seinen Knotenstock.
Schleinitz drückte seinem Pferd die Sporen in die Weichen, dass es empört schnaubte und den Kopf nach hinten warf. Solch rüde Behandlung war es von seinem Herrn nicht gewohnt.
Der Marktplatz lag schon hinter ihm, er jagte durch die schmale Dorfgasse. Zwischen den Häusern hörte er deutlich die Hufschläge seiner Verfolger widerhallen. Dem Klang nach waren es zu viele, als dass er es mit ihnen aufnehmen könnte.
Schaumflocken flogen Wothan vom Maul – und dabei lag der anstrengendste Teil des Rittes noch vor ihnen. Die Grenze zu Preußen verlief über die Kuppe des Spieglitzer Schneegebirges, bevor es dann auf preußischer Seite wieder abwärts ging in jenes Dorf mit dem vergessenen Namen. Wie lange sein Pferd den wilden Ritt bergauf durchhalten würde? Zumal er irgendwo von den Wegen abweichen musste, da er unmöglich den bewachten Grenzübergang passieren konnte.
Endlich hatte er den Dorfausgang erreicht, nun ging es durch grüne Felder hinauf zum Wald, der die Abhänge des Schneegebirges bedeckte. Immer noch drückte er seine Rosen fest an sich, um nur ja nicht die hart eroberte Trophäe zu verlieren. Wenn es ihm gelang, diese Blumen der schönen Valeria von Mutius zu Füßen zu legen, waren seine Schulden getilgt und seine Karriere würde – allen Unkenrufen seines Onkels zum Trotz – einen glänzenden Fortgang nehmen. Doch dazu musste er erst einmal den Verfolgern entkommen.
Er warf einen Blick über die Schulter zurück. Anscheinend hatten sie im Dorf einige Gendarmen hinzugezogen, die, gut ausgebildet und auf frischen Pferden, gefährlicher werden konnten als irgendwelche Diener auf wegen der Eile wahrscheinlich ungesattelten Pferden. Zum Glück lagen sie noch so weit zurück, dass sie wohl kaum auf ihn schießen würden.
Als ihn der schattige Wald aufnahm und der Geruch von Harz umfing, atmete er wie befreit auf. Hier fühlte er sich um einiges sicherer als auf freiem Feld. Jetzt musste es ihm nur noch gelingen, an geeigneter Stelle kurz vor der Grenze vom Weg abzubiegen.
Mittlerweile lief Wothan merklich langsamer. Er war zwar ein exzellentes Kavalleriepferd, aber der lange Ritt forderte seinen Tribut. Erneut warf Schleinitz einen raschen Blick zurück.
Seine Hoffnung, die Verfolger würden umkehren, wenn sie näher zur Grenze kamen, erfüllte sich nicht. Sie waren im Gegenteil gefährlich nahe. Sobald ihn eine scharfe Wegbiegung vor ihren Blicken verbarg, musste er schleunigst in das Unterholz abbiegen, um dann ungesehen und so schnell wie möglich die Grenze zu erreichen. Sonst konnte er Valeria, seine Karriere und vielleicht sogar sein Leben vergessen.
Als er die nächste Kurve, die ihn hoffentlich den Blicken seiner Verfolger entzog, hinter sich hatte, zügelte er Wothan abrupt und jagte ihn mit einem kühnen Satz über den Graben am Wegesrand in das Unterholz. Das Rascheln des vorjährigen Laubes und das Bersten trockener Äste ließ Schleinitz ahnen, dass er den Gendarmen auf diese Weise nicht entkam. Er drückte Wothan abermals die Sporen in die Seiten, dass er trotz des unebenen Untergrunds in großen Sätzen vorwärtssprang, doch schon hörte er hinter sich die brechenden Äste. Seine Häscher folgten ihm offenbar ins Unterholz.
Schleinitz fluchte leise vor sich hin. Sie waren wirklich hartnäckig. Ein weiterer Blick über die Schulter zeigte ihm, dass sie nur noch wenige Pferdelängen zurück waren.
„Halt!“, brüllte jemand hinter ihm. „Bleiben Sie stehen!“
„Von wegen“, murmelte Schleinitz. Es konnte nicht mehr weit bis zur Grenze sein, und dann mussten die Verfolger zwangsläufig umkehren, um nicht selbst in Gefahr zu geraten.
„Stehen bleiben! Sonst schießen wir!“
Er beugte sich tief über den Hals seines Pferdes. Sollten sie doch schießen. Bei dem rasenden Ritt zwischen den Stämmen hindurch würden sie ihn ohnehin nicht treffen.
Seine Zuversicht schwand jedoch, als die ersten Schüsse an ihm vorbeipeitschten. Sie schossen zwar nur mit Pistolen, die man vermutlich besser als Wurf- denn als Schusswaffe gebrauchen konnte, die jaulenden Querschläger konnten ihm jedoch gefährlich werden.
Nahm dieser steil ansteigende Wald denn nie ein Ende? Wothan wurde immer langsamer, er schnaufte wie eine der neumodischen Dampfmaschinen. Die Pferde der Verfolger dagegen schienen immer noch frisch zu sein, denn bei einem erneuten Blick zurück sah er, dass sie ihm bedenklich nahe gekommen waren.
Da! Endlich hatte er es geschafft. Durch das Unterholz ragte ein verwitterter Grenzstein – er war in Preußen! Jetzt mussten die Österreicher umkehren.
Er gab Wothan noch einmal die Sporen. „Komm, nur noch wenige Ellen, dann kannst du ausruhen“, feuerte er das Tier an.
Gerade wollte er vom Galopp in den Trab übergehen, als wieder Schüsse fielen. Er sah zurück und konnte es nicht glauben. Die Gendarmen hatten ebenfalls die Grenze passiert und dachten offenbar gar nicht daran, umzukehren. Wollten sie ihn etwa bis in dieses verlassene Kaff irgendwo dort unten im Tal verfolgen? Das würde sein Wothan nicht mehr durchhalten.
Tränen trübten Lisas Blick, als sie durch den Hochwald stürmte. Nun war es noch schlimmer gekommen, als sie befürchtet hatte: Sie musste monatelang mit diesem Windhund Elzner unter einem Dach wohnen. Wie viele tausend Gelegenheiten würde er finden, um sich ihr zu nähern und sie zu belästigen!
Sie schlug den schmalen Fußpfad ein, der an der Wölfel entlang zur Altenburg führte. Wie war ihr Vater bloß darauf gekommen, Elzner ein Domizil im Forsthaus anzubieten? Solange sie denken konnte, hatte er noch nie zugestimmt, dass einer seiner Angestellten im Forsthaus wohnte. Aber an Elzner schien er seinen Narren gefressen zu haben. Ausgerechnet an Elzner, der ihr immer anzügliche Bemerkungen nachrief.
Und nun kam genau dieser Elzner, dem sie um jeden Preis ausweichen wollte, ins Forsthaus! Als ob er ihr in Wölfelsgrund nicht schon nahe genug gewesen wäre!
Lisa zog ihr Schnupftuch hervor und wischte sich die Tränen von den Wangen. Sie hatte ihren Lieblingsplatz erreicht: die Ruine der Altenburg. Weil sie abseits des Hauptweges lag, kam nur selten ein Mensch hierher.
Nahe bei der baufälligen Ringmauer stand eine prächtig gewachsene Eiche, unter die Lisa sich ins Moos legte. Durch die saftiggrünen Blätter sah sie zum frühlingsblauen Himmel hinauf. Leise spielte der Wind mit den Zweigen, sodass ein feines Raunen entstand, das sich mit dem Murmeln der Wölfel zu einer Sinfonie des Frühlings vereinte.