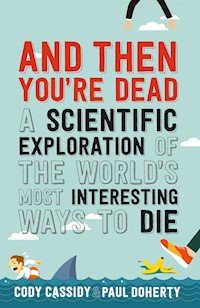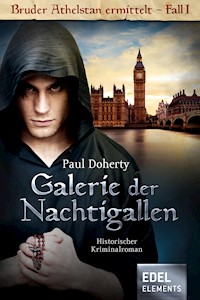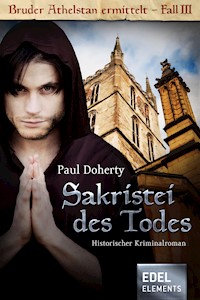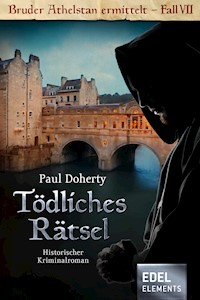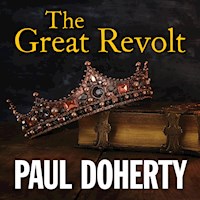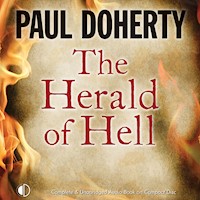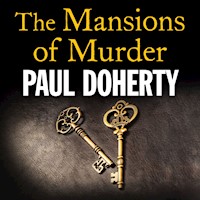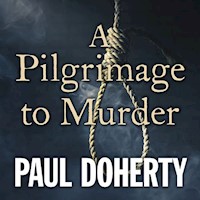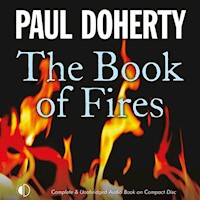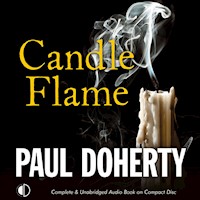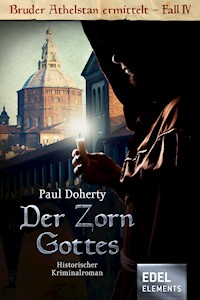
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bruder Athelstan
- Sprache: Deutsch
London im Jahre 1379: Die Stadt steht kurz vor einer Revolte, ein Goldschatz ist verschwunden, zudem gilt es etliche mysteriöse Morde aufzuklären. Wer wäre in diesem Fall besser geeignet, dem Statthalter John de Gaunt aus der Patsche zu helfen als Coroner Cranston und sein Gehilfe Athelstan? Also begibt sich das ungleiche Paar erneut auf Mördersuche …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch:
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2016 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edelelements.de
Copyright © 1993 by Paul Harding Die Originalausgabe erschien unter dem Titel „The Anger of God“. Ins Deutsche übertragen von Rainer Schmidt Die deutsche Erstausgabe erschien unter dem Pseudonym Paul Harding. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Designomicon Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Prolog
Der Mann, der in der Ecke des verlassenen Friedhofs zwischen der Poor Jewry und der Sybethe Lane wartete, zuckte zusammen, als eine Eule in der alten Eibe über ihm mit klagendem Ruf ihre Geisterschwingen ausbreitete und wie ein dunkler Engel über wucherndes Gras und Dornengestrüpp davonschwebte. Der Beobachter sah, wie der Vogel sich auf sein kreischendes Opfer stürzte und dann wieder mühelos wie eine Rauchwolke zum sternenklaren Himmel aufstieg. Den Mann schauderte, und er fluchte. Geschichten aus seiner Kindheit fielen ihm ein, Geschichten von Gestaltwandlern, jenen Hexen und alten Weibern der Finsternis, die ihr Aussehen verändern konnten und dann solche verlassenen, einsamen Orte heimsuchten. Die Nacht war warm, aber dem Mann war kalt. Die Zeiten waren unruhig. Tagsüber lachte er über die Klatschgeschichten von einem Anker an einem Seil, der aus einer Wolke herabhing und in einem Erdhügel bei Tilbury steckte. Oder vom König der Pygmäen mit seinem großen Kopf und feurigen Antlitz, den man gesehen hatte, wie er auf einer Ziege durch die Wälder im Norden der Stadt geritten war. Lachende Teufelchen, so klein wie Spitzmäuse, sprangen wie Fische im Netz im Gras um den Galgen zu Tyburn herum. Solche Geschichten waren nur ein Spiegel der Zeiten, Widerhall des Prophetenwortes: »Wehe dem Königreich, dessen König ein Kind ist!«
Eine Prophezeiung, die jetzt in England wahr wurde: Der goldhaarige Richard war nur ein Knabe, und die Staatsgeschäfte lagen in den Händen seines raffgierigen Onkels, des Regenten John von Gaunt, des Herzogs von Lancaster, der unfähig schien, Balsam in die Wunden des Reiches zu gießen. Französische Galeeren überfielen und plünderten die Städte an der Kanalküste. Im Norden drängten die Schotten über die Grenze und feierten Orgien des Brandschatzens und Plünderns, und in den Grafschaften rings um London protestierten die Bauern, unter der Steuerlast ächzend und an die Scholle gefesselt, erbittert gegen die Herren des Landes und planten blutige Aufstände.
Gaunt aber war glitschig wie ein Fisch: Außerstande, dem rebellischen Volk noch weitere Steuern abzupressen, hatte er jetzt das Wunder vollbracht, die in Auseinandersetzungen verstrickten Gilden von London zu einen, um Geld von den reichen Bürgern und Kaufleuten zu bekommen. Dem mußte ein Ende gemacht werden. Der Beobachter im Dunkel wünschte nur, es gäbe einen leichteren Weg, das zu bewerkstelligen. Er nagte an seiner Unterlippe. Gaunt mußte vernichtet werden, das war das Wichtigste. Mit der Revolte würde im Königreich eine neue Ordnung errichtet werden, und die »Große Gemeinschaft«, wie die Bauernführer sich selbst nannten, würde entscheiden, wer leben und wer sterben sollte, wer Macht bekommen und wer Handel treiben würde. Die Umsichtigen in der Stadtregierung machten bereits Anstalten, mit diesen Männern Freundschaft zu schließen.
»Ich bin hier.«
Der Mann schrak zusammen. Hörte er Gespenster?
»Ich bin hier«, wiederholte die Stimme, leise und kehlig.
»Wo bist du?«
»Wir haben dich umzingelt. Beweg dich nicht. Lauf nicht weg. Höre, was ich dir zu sagen habe.«
»Wie heißt du?« fragte der Mann und versuchte, seinen rasenden Herzschlag zu bremsen und die Panik, die ihm die Gedärme zusammenknotete.
»Ich bin Ira Dei«, antwortete die Stimme aus der Dunkelheit des Friedhofs. »Ich bin der Zorn Gottes. Und Gottes Zorn wird sich ergießen über jene, die ernten, wo sie nicht gesät haben, die Gewinne sammeln, wo sie kein Recht dazu haben, und die die Armen der Erde unterdrücken, als wären sie Würmer und sonst nichts.«
»Was wollt ihr?«
»Alles neu machen. Dieses Königreich in ein Zeitalter der Unschuld führen, denn
als Adam grub und Eva spann,
wo war da der Edelmann?«
Der Mann nickte. Er hatte diesen Knittelvers schon von den Bauern gehört, die ihn wie eine Hymne beständig sangen; sie wollten auf London marschieren, die Stadt in Schutt und Asche legen, den Onkel des Königs ergreifen, ihm den Kopf abschlagen und auf eine Stange stecken und dann eine Prozession veranstalten.
»Bist du für uns?« fragte die Stimme.
»Natürlich!« stammelte der Mann.
»Und machen die Pläne des Regenten Fortschritte?«
»Das Bankett ist morgen abend.«
»Dann mußt du handeln. Tu, was wir wollen, und wir betrachten dich als Freund.«
»Ich habe einen Plan«, antwortete der Mann. »Hört zu …«
»Still!« schnarrte die Stimme. »Wenn du zu uns gehören willst, dann mußt du Gaunts Pläne durchkreuzen. Wie du das tust, ist uns gleich, aber wir werden dich beobachten. Adieu.«
Der Mann spähte angestrengt in die Dunkelheit. Ein Zweig knackte, eine Eule schrie, aber als er rief, hallten seine Worte hohl durch die Stille.
Eine Meile weiter südlich glitt über das schwarze, stinkende Wasser der Themse ein kleines Ruderboot mit einer verhüllten Gestalt zwischen die Strombrecher der London Bridge. Der Mann band die Leine sorgfältig an einen rostigen Ring und kletterte dann den Balken hinauf zu dem blutgetränkten Gitter, wo auf Stangen die abgeschlagenen Häupter blicklos über den Fluß starrten. Der Mann fluchte und grinste dann.
»Wie kann man sich eine solche Nacht aussuchen?« wisperte er. Der Fluß stank wie ein Abort, weil die Müllbarken voller Dreck und menschlicher Abfälle den ganzen Abend fleißig ihre Jauchemassen ins Wasser gekippt hatten; der Gestank würde tagelang nicht vergehen. Dennoch mußte der Dieb rasch handeln: Der französische Pirat war am Nachmittag hingerichtet worden, sein Kopf noch frisch, die Haut sauber, die Augen noch nicht von den Krähen ausgehackt. Vorsichtig sein mußte er trotzdem. Schon ging das Gerücht, die Verwaltungsbehörden und ganz besonders dieser dicke Riese, Sir John Cranston, der königliche Coroner der Stadt, seien mißtrauisch geworden angesichts der vielen Gliedmaßen und abgeschlagenen Köpfe, die von der London Bridge verschwanden.
Der Dieb, ganz in Schwarz gekleidet und mit schweren Stiefeln, die ihm auf dem glitschigen Holz besseren Halt gaben, hatte jetzt den Vorsprung unter den blutverschmierten Stangen erreicht. Er kauerte im Dunkeln und spitzte die Ohren, um die verschiedenen Geräusche zu unterscheiden: Eine Barke mit ausgelassenen Männern, die betrunken wie die Lords von den Bordellen in Southwark nach Botolph's Wharf zurückfuhren; das Plätschern und Murmeln des Flusses und fernes Rufen an den Ufern; der Lärm von Schiffen, die zum Auslaufen mit der morgendlichen Flut klargemacht wurden – und vor allem die schweren Schritte der Wachen, die am Aufgang der Brücke hin und her gingen.
Der Dieb wartete eine Weile und atmete geräuschlos; endlich schienen die Wachen müde zu werden und kehrten zu ihrem kleinen Kohlenbecken zurück, um sich aufzuwärmen. Da kletterte er auf die Brücke und tappte leise wie eine Katze zu den langen Stangen, die mit ihrer grausigen Zier in den Himmel ragten. Er spähte hinauf in die Dunkelheit. Er mußte achtsam sein. So viele Hinrichtungen, so viele abgeschlagene Köpfe – er wollte nicht den falschen nehmen. Er war am Abend dagewesen, als die Köpfe aufgestellt wurden, aber seitdem konnten sie vertauscht worden sein. Dann sah er die kleine Blutpfütze am Fuße einer Stange. Er lächelte, hob sie behutsam aus ihrer Halterung, nahm den Schädel von der Spitze, steckte ihn in einen Beutel und kletterte am Balkenwerk hinunter in sein Boot.
Am Südufer der Themse, im Labyrinth der tristen, schmutzigen Gassen von Southwark, waren die Schenken noch hell erleuchtet, während die Meisterdiebe mit ihren Gaunerbanden ihrem üblen Geschäft nachgingen: Fälscher, Betrüger, Taschendiebe und Räuber wollten die Nacht möglichst gewinnbringend nutzen. Auch andere arbeiteten: Katzenfänger, die auf der Jagd nach billigem Pelz waren und Fleisch, das sie verkaufen konnten, Hundekotsammler, die Säcke mit stinkender Ware an die Gerber verkaufen wollten, und die Gelegenheitsarbeiter, die von Bierschenke zu Bierschenke zogen und Arbeit suchten, noch ehe der Tag begann. In den Straßen herrschte geschäftiges Treiben, aber in einem großen, dreigeschossigen Fachwerkhaus, das ganz offensichtlich bessere Zeiten gesehen hatte … war es dunkel und still.
Der Hausbesitzer und seine Frau standen stumm und wie versteinert in der Tür zur Kammer ihrer Tochter. Sie sahen sie im Licht einer einzelnen Kerze aufgerichtet in den Polstern sitzen. Die Bettvorhänge waren weit zurückgezogen. Die beiden warteten darauf, daß das Grauenvolle begann, und der Mann schaute das Mädchen beschwörend an.
»Elizabeth, wird es wiederkommen?« fragte er flehentlich.
Seine bleiche Tochter starrte ihn nur an; ihre Augen waren glasig und blicklos.
»Oh, Elizabeth«, hauchte der Mann, »warum tust du uns das an?«
»Du weißt, warum!« kreischte das Mädchen plötzlich und beugte sich vor. »Du hast meine Mutter umgebracht, um diese Hure zu heiraten.« Ihre Hand schoß vor und deutete auf die goldblonde, hübsche zweite Frau ihres Vaters.
»Das ist nicht wahr«, antwortete er. »Elizabeth, deine Mutter ist krank geworden und gestorben. Ich konnte nichts dagegen tun.«
»Lügen!« kreischte das Mädchen.
Sprachlos vor Entsetzen starrten der Mann und seine Frau das Mädchen an, das immer, wenn es dunkel wurde, ein anderer Mensch wurde, ein wahres Zankweib, eine Hexe der Nacht, die behauptete, daß der Geist ihrer Mutter sie besuche, und beide als Mörder, Attentäter und Giftmischer beschimpfte.
»Hört nur!« zischte sie. »Mutter kommt wieder!«
Der Mann ließ den Arm von den Schultern seiner Frau sinken; ein Schauer lief ihm über den Rücken, und seine Nackenhaare sträubten sich angstvoll. Und richtig, im ganzen Haus begann es zu tappen und zu klopfen. Erst im Erdgeschoß, dann immer weiter oben, als krieche etwas zwischen Wand und Täfelung herauf; langsam und vorsichtig wie eine von der Hölle ausgespuckte Kreatur, bahnte es sich seinen scheußlichen Weg zu dieser Schlafkammer. Immer lauter wurde das Klopfen und erfüllte bald den ganzen Raum. Der Mann hielt sich die Ohren zu.
»Aufhören!« schrie er. Er riß sich das Kruzifix vom Gürtel und streckte es seiner bleichen Tochter entgegen. »Im Namen Jesu Christi, ich befehle dir, aufzuhören!«
Aber das Klopfen ging weiter – ein ratterndes Geklapper, das ihn um den Verstand zu bringen drohte.
»Ich kann nicht mehr«, flüsterte die Frau an seiner Seite. »Walter, ich kann nicht mehr.«
Sie rannte die Treppe hinunter und ließ ihren schreckensstarren Mann stehen. Plötzlich hörte das Klopfen auf. Das Mädchen beugte sich vor, und ihre Gesichtshaut war nicht nur weiß, sondern so straff, daß ihr Kopf wie ein Totenschädel wirkte; ein Eindruck, der durch das rabenschwarze, am Hinterkopf zu einem festen Knoten gebundene Haar noch verstärkt wurde. Der Mann tat einen Schritt nach vorn und schaute seiner Tochter in das fahle Gesicht. Ihre Augen waren leblos, zwei kleine Punkte aus schwarzem Obsidian, die ihn haßerfüllt anfunkelten, und die roten, weichen Lippen kräuselten sich in bitterem Hohn.
Er wollte noch einen Schritt machen, als das Rattern wieder begann, ein kurzer, heftiger Lärm, der gleich wieder erstarb. Der Mann roch den furchtbaren Gestank, an den er sich noch gut erinnern konnte. Sein Mut verließ ihn; er fiel auf die Knie und starrte seine Tochter mitleidheischend an.
»Elizabeth!« flehte er. »Im Namen Gottes!«
»Im Namen Gottes, Walter Hobden, du bist ein Mörder!«
Der Mann hob den Kopf. Seine bleiche Tochter starrte ihn an; ihre Lippen bewegten sich, aber die Stimme war die seiner toten Frau – genau ihre Intonation, die Art, wie sie das »R« in seinem Vornamen betonte.
»Walter Hobden, Fluch über dich für den Wein, den du mir gegeben hast, und das rote Arsen, das er enthielt – ein tödlicher Trank, der meinen Magen zerfraß und mein Leben vorzeitig beendete, damit du dich ungehindert deinen schmutzigen Gelüsten und heimlichen Wünschen hingeben konntest. Ich war deine Frau. Ich bin deine Frau. Und ich komme aus dem Fegefeuer, um dich zu warnen. Solange deine Seele mit meinem Blut besudelt ist, werde ich dich heimsuchen. Glaube mir, ich habe den Ort gesehen, der in der Hölle auf dich wartet Du mußt gestehen! Ich will Gerechtigkeit – erst dann bekommst du deine Absolution.«
Walter Hobden duckte sich, zitternd vor Angst.
»Nein! Nein! Nein!« murmelte er. »Das ist nicht wahr! Es ist eine Lüge!«
»Keine Lüge!« kreischte die Stimme.
Hobden konnte nicht mehr. Er drehte sich um, kroch wie ein geprügelter Hund aus dem Raum und rannte die Treppe hinunter, während seine Tochter erzitterte, die Augen schloß und in die Kissen zurücksank.
Hobden schloß seine Kammertür von innen, lehnte sich dagegen, atmete tief ein und starrte mit wildem Blick in das angsterfüllte Gesicht seiner zweiten Frau. Sie reichte ihm einen Becher Wein.
»Trink, Gemahl.«
Er taumelte auf sie zu, riß ihr den Becher aus der Hand und stürzte den schweren, süßen Wein hinunter.
»Was soll ich tun?« fragte er mit rauher Stimme. »Warum tut Elizabeth mir das an?«
Er setzte sich neben sie auf die Bettkante, und sie hielt seine Hand, während er den Wein schluckte; seine Finger waren kalt wie Eiszapfen.
»Eleanor?« Er starrte über den Becherrand. »Was sollen wir tun? Ist sie besessen? Hat irgendein Dämon von ihrer Seele Besitz ergriffen?«
Eleanors scharfe Augen flackerten verachtungsvoll. »Sie lügt und verstellt sich!« versetzte sie. »Deine Tochter hat sich mit einer eingebildeten Krankheit ins Bett gelegt.« Sie wischte ihrem Mann den Schweiß von der Stirn. »Walter, sie täuscht dich. Sie spielt ein übles Spiel mit dir.«
»Wie kann das sein?« antwortete er. »Du hörst doch das Klopfen. Ich habe ihre Hände beobachtet. Sie liegen auf der Decke. Wie soll sie das einfädeln, hm? Und wie bringt sie den gräßlichen Geruch zustande und die Stimme? Ich habe ihr Zimmer durchsucht, als sie schlief. Ich kann nichts finden.«
»Wenn das so ist«, sagte Eleanor scharf, »dann ist sie besessen und gehört zusammen mit dieser alten Hexe, ihrer Amme, an einen anderen Ort. In ein Spital, oder in ein Haus für Irrsinnige. Oder …«
»Oder?« fragte er hoffnungsvoll.
»Wenn das stimmt, wenn der Geist ihrer Mutter wirklich zurückkommt, dann muß es ein verkleideter Dämon sein, der solche Lügen ausspuckt. Dann müssen sie und die Kammer einem Exorzismus unterzogen und gesegnet werden.«
»Aber wer kann das übernehmen?«
Eleanor entwandt seinen starren Fingern den Weinbecher. »Pfaffen gibt es zwei für einen Penny.« Sie legte ihm die Arme um seinen Hals und küßte ihn sanft auf die Wange. »Vergiß diese Geister. Deine Tochter ist eine Betrügerin«, flüsterte sie. »Und ich werde sie als Lügnerin entlarven!«
1
Sir John Cranston saß auf der Fensterbank eines Schlafgemachs in einem Haus an der Milk Street am Rande von Westchepe. Er starrte aus dem Glasfenster, das einen guten Blick auf die Kirche von St. Mary Magdalen bot, und beobachtete einen wohlhabend aussehenden Reliquienhändler, der seinen Stand aufbaute und die Kunden zusammenrief. Cranston lächelte ohne Heiterkeit, als er den Burschen krähen hörte; leise klangen die Worte von der Straße herauf.
»Schaut her, ich habe hier Jesu Milchzahn, den er mit zwölf Jahren verlor! Einen Finger vom hl. Sylvester! Ein Stück von dem Sattel, auf dem Christus nach Jerusalem einritt! Und in dieser schön beschlagenen Kiste den Arm des hl. Polycarp – das einzige, was von ihm übrigblieb, nachdem die Löwen ihn in Rom in der Arena in Stücke gerissen hatten. Ihr guten Leute, diese vom Heiligen Vater gesegneten Reliquien können Wunder wirken und tun es auch!«
Cranston sah, wie sich leichtgläubige Zuschauer um ihn drängten. Ein Gauner, dachte er. Er schaute hinüber zu dem Leichnam, der auf dem Vierpfostenbett aufgebahrt lag, sorgsam in ein Leichentuch gewickelt; nur das Gesicht schaute hervor, das mit offenem Mund und halb geschlossenen Augen auf dem Kissen ruhte.
»Es tut mir leid«, murmelte Cranston in das stille Zimmer. Er stand auf, trat an das Bett und betrachtete das graue, eingefallene Gesicht seines ehemaligen Kameraden.
»Es tut mir leid«, wiederholte er. »Ich, Sir John Cranston, des Königs Coroner in London, ein Mann, der mit Fürsten speist, der Gemahl der Lady Maude aus Tweng in Somerset, Vater der beiden Kerlchen, meiner geliebten Söhne Francis und Stephen, ich bin traurig, weil ich dir nicht helfen konnte. Dir, meinem Waffenbruder, meiner rechten Hand in unseren Schlachten gegen die Franzosen. Jetzt liegst du da, ermordet, und ich kann es nicht einmal beweisen.«
Cranston schaute sich in dem Schlafgemach um und betrachtete die kostbare Einrichtung: silberne Becher, ein fein geschnitztes Lavarium, Schränke und taftgepolsterte Stühle, seidene Kissen und Baldachine und einen Kandelaber aus Goldfiligran.
»Was nützt es einem Mann«, murmelte Cranston, »wenn er die ganze Welt gewänne – nur um dann von seiner Frau umgebracht zu werden?«
Er fischte zwei Pennies aus seiner Börse und legte sie dem Toten auf die Augenlider; dann bedeckte er das Gesicht mit dem Leichentuch. Er seufzte und ging zum Fußende des Bettes. Als es plötzlich hinter ihm raschelte, schrak er zusammen.
»Verfluchte Ratten!« knurrte er, als er den geschmeidigen, langschwänzigen, fetten Nager sah, der unter einen Schrank glitt und an der Holztäfelung scharrte. Ein zweites Tier kam unter dem Lavarium hervor und wich mühelos dem Kerzenleuchter aus, den der wütende Cranston nach ihm schleuderte.
»Verdammte Ratten!« wiederholte er. »Die Stadt ist verseucht von ihnen. Die Hitze lockt sie heraus.«
Er betrachtete den einsamen, verhüllten Leichnam seines Freundes. Als er gekommen war, hatte Sir Oliver Ingham schon seit Stunden tot dagelegen, und zwei Ratten nagten an seiner Hand. Cranston hatte Inghams hübsches junges Weib lautstark beschimpft, aber sie hatte nur verschlagen gelächelt und gesagt, sie habe ihr Bestes getan, den Leichnam ihres Gatten zu schützen, seit er vor einer Weile von einem Diener gefunden worden sei.
»Er hatte ein schwaches Herz, Sir John«, hatte sie gelispelt und dabei eine zarte, weiße Hand auf den Arm ihres »guten Vetters« Albric Totnes gelegt.
»Ein feiner Vetter!« knurrte Cranston. »Ich wette, die zwei haben zwischen den Laken getanzt, während Oliver im Sterben lag. Verdammte Mörderbande!«
Er wühlte in seiner Börse und förderte einen kurzen Brief zutage, den Oliver Ingham ihm am Tag zuvor geschickt hatte. Er setzte sich und las ihn noch einmal, und seine großen, vorquellenden Augen füllten sich mit Tränen.
Ich sterbe, alter Freund. Ich habe die größte Torheit begangen, die ein alter Mann begehen kann: Ich habe eine Frau geheiratet, die vierzig Jahre jünger ist als ich. Eine Ehe zwischen Mai und Dezember, fürwahr, aber ich glaubte, sie liebt mich. Ich mußte feststellen, daß sie es nicht tut. Aber ihr Lächeln und ihre Berührung haben mir genügt. Jetzt merke ich, daß sie mich betrogen hat und womöglich meinen Tod plant. Wenn ich plötzlich sterbe, alter Freund, und wenn ich allein sterbe, dann wurde ich ermordet. Meine Seele wird zu Gott um Rache schreien und zu Dir um Gerechtigkeit. Vergiß mich nicht.
Oliver
Cranston faltete das Pergament säuberlich zusammen und steckte es ein. Noch hatte er es niemandem gezeigt, aber er glaubte, daß sein Freund recht hatte. Etwas in seinem Blut flüsterte »Mord!«, aber wie sollte er das beweisen? Sir Oliver war am Vormittag von einem Diener tot in seinem Bett gefunden worden, und man hatte nach Cranston geschickt, weil er sein Freund war und noch dazu der Coroner. Bei seiner Ankunft hatte er Inghams junge Frau Rosamund zusammen mit ihrem »Vetter« auf dem Söller beim Essen vorgefunden, und der Arzt der Familie, ein kahlköpfiger, frettchengesichtiger Mann in stinkenden Gewändern, hatte schlicht erklärt, Sir Olivers schwaches Herz habe versagt und seine Seele sei zu Gott gegangen.
Cranston stand auf und ging wieder zum Bett; dort lag noch immer der Krug, den Oliver im Todeskampf vom Tisch gestoßen hatte.
Auf sein Drängen hatte der Arzt zuerst am Krug, dann an Olivers liebstem Becher geschnuppert und feierlich verkündet: »Nein, Sir John. Nichts als Rotwein und vielleicht ein bißchen von dem Fingerhut, den ich Sir Oliver zur Kräftigung des Herzens verschrieben habe.«
»Könnte jemand mehr davon hineingetan haben?« hatte Cranston gefragt.
»Natürlich nicht!« war die schroffe Antwort gewesen. »Was wollt Ihr damit andeuten, Sir John? Eine größere Dosis Fingerhut, und Becher und Krug würden danach stinken.«
Sir John hatte sich gefügt und nach Theobald de Troyes geschickt, seinem eigenen Arzt – einem Mann, der sich auf seine Kunst verstand und so viele bei Hofe zu seinen Patienten zählte. Theobald hatte Leichnam, Becher und Krug auf das gründlichste untersucht.
»Der Arzt hat recht«, hatte er schließlich gesagt. »Wißt Ihr, Sir John, wenn Sir Oliver zuviel Fingerhut abbekommen hätte, würde sein Leichnam Spuren davon aufweisen. Aber ich kann nur die Wirkung eines plötzlichen Anfalls entdecken, und der Becher enthält nichts als Spuren von Wein und ein wenig Fingerhut, aber nicht mehr, als ein guter Arzt verschreiben würde. Der Krug riecht auch nicht nach Fingerhut.«
»Irgendwelche Spuren von Gewalt?« hatte Cranston gefragt.
»Nicht die geringsten, Sir John.« Theobald hatte den Blick gesenkt. »Nur die Rattenbisse an den Fingern der rechten Hand, Sir John. Als Sir Oliver gestern abend zu Bett ging, fühlte er sich nicht wohl. Seine Diener hörten, wie er über Schwäche, Schwindel und Schmerzen in der Brust klagte. Er schloß seine Kammertür ab und ließ den Schlüssel im Schloß stecken. Die Fenster waren mit Vorhängeschlössern gesichert. Niemand konnte hinein, um ihm etwas anzutun.«
Sir John hatte gegrunzt und ihn verabschiedet. Nun saß er seit zwei Stunden in diesem Gemach und fragte sich, wie der Mord begangen sein mochte.
»Ich wünschte, Athelstan wäre hier«, seufzte er. »Vielleicht würde er wissen, was hier nicht stimmt. Der verdammte Mönch! Und ich wünschte, er würde den verflixten Kater mitbringen!«
Cranston dachte an Athelstans wild aussehenden Kater Bonaventura, den sein Freund und Sekretär für den besten Rattenfänger von ganz Southwark hielt. Cranston seufzte, bekreuzigte sich, senkte den Blick und sprach ein Gebet für den Toten.
»Gewähre meinem Freund Oliver die ewige Ruhe«, murmelte er, und seine Gedanken wanderten um Jahre zurück … Groß und stark stand Oliver an seiner Seite, als die französischen Ritter die Reihen der Engländer bei Poitiers durchbrachen. Das Schlachtgetöse, das Wiehern der Streitrösser, das Klirren der Schwerter, das leise Schwirren der Pfeile, das Stechen und Hauen, als sie und ein paar andere die ganze Wucht eines letzten Verzweiflungsangriffs der Franzosen auffingen. Der Boden unter ihren Füßen war glitschig vom Blute. Cranston stand breitbeinig da und ließ sein Schwert kreisen wie eine mächtige Sense, als die französischen Ritter zum letzten Schlag herandrängten.
Ein ungeheurer Riese stürmte auf ihn zu; sein Helm hatte die Form eines Teufelskopfes mit breit geschwungenen Hörnern, und die gelbe Feder wogte im Abendwind. Cranston sah stahlumhüllte Arme mit einer gewaltigen Streitaxt ausholen; er sprang beiseite, glitt aus und fiel in den Schlamm. Er erwartete den tödlichen Hieb, aber da stand Oliver über ihm, fing die Wucht der Axt mit seinem Schild auf, griff dann den Feind an und stieß ihm seinen kleinen Hirschfänger zwischen Küraß und Helm.
»Ich schulde dir mein Leben«, hatte Cranston später bekannt.
»Eines Tages wirst du die Schuld zurückzahlen können!« Oliver hatte gelacht, als sie auf dem Schlachtfeld saßen und einander mit zahllosen Bechern von dem Rotwein zuprosteten, den sie im französischen Lager erbeutet hatten. »Eines Tages wirst du diese Schuld zurückzahlen.«
Cranston öffnete die tränennassen Augen. Er hob seine rechte Hand und schaute den Toten an. »Verflucht, das werde ich!« knurrte er. Und noch einmal betrachtete er die erbarmungswürdige Gestalt in dem Leichentuch.
»In unseren goldenen Tagen«, flüsterte er, »da waren wir Greyhounds auf der Jagd! Junge Falken, die auf ihre Beute niederstießen! Ah, was für Zeiten!«
Cranston klopfte sich auf den umfangreichen Wanst, zog die Bettvorhänge zu und stapfte aus der Kammer; im Gehen warf er noch einmal einen Blick auf das aufgebrochene Schloß.
Wie ein Koloß stampfte er die Treppe hinunter und marschierte in den Söller, wo Lady Rosamund und ihr »Vetter« Albric auf der Fensterbank saßen und das Maschenspiel spielten. In ihrem schwarzen Damastkleid mit dem sorgfältig geordneten Schleier von gleicher Farbe sah Rosamund jetzt noch schöner aus; ihr schmales Gesicht war zu einer Art Trauermiene verzogen. Cranston funkelte sie nur an, und noch verächtlicher betrachtete er ihren jungen Liebhaber mit seinem glatten Gesicht, den schlaffen Lippen und dem kraftlosen Blick.
»Ihr seid fertig, Sir John?« Rosamund erhob sich, als der glatzköpfige, rotgesichtige Riese auf sie zukam. Sie erwartete, daß er zumindest ihre Hand küssen würde, aber Cranston packte sie und Albric bei den Handgelenken, zog beide von der Bank und mit harter Hand dicht zu sich heran.
»Ihr, Madam, seid ein mordendes Miststück! Nein, Ihr braucht nicht die Augen aufzureißen und um Hilfe zu schreien! Und Ihr, Sir …« Albric wich seinem Blick aus. »Sieh mich an, Kerl!« Cranston drückte noch fester zu. »Sieh mich an, du mieser Hurensohn!«
Albric hob den Blick.
»Du hast mitgemacht. Wenn du den Mut dazu hättest, würde ich dich zu einem Duell herausfordern und dir den Kopf abschlagen. Vergiß nicht, das Angebot wird bestehenbleiben.«
»Sir John, das ist doch …«
»Klappe!« grollte Cranston. »Da oben liegt der treueste Kamerad, den ein Mann sich nur wünschen kann. Ein guter Soldat, ein schlauer Kaufmann und der allerbeste Freund. Oliver mag ein schwaches Herz gehabt haben, aber er hatte den Mut eines Löwen und den Großmut eines Heiligen. Er hat dich angebetet, du bleiche Stute, und du hast ihm das Herz gebrochen. Du hast ihn betrogen. Ich weiß, daß du ihn ermordet hast. Gott allein weiß, wie du es gemacht hast, aber ich werde es herausfinden.« Cranston stieß die beiden zurück auf ihre Fensterbank. »Glaubt mir, ich werde euch beide tanzen sehen: in Smithfield, am Ende eines Stricks.«
Er machte auf dem Absatz kehrt und ging zur Tür.
»Cranston!« rief Rosamund.
»Ja, du Bestie?« antwortete er, ohne stehenzubleiben.
»Ich bin unschuldig am Tode meines Gemahls.«
Der Coroner machte ein unhöfliches Geräusch mit den Lippen.
»In zehn Tagen wird das Testament meines Gatten verlesen werden. All sein Besitz und Reichtum werden mir gehören. Ich werde diesen Reichtum dazu nutzen, Euch vor Gericht zu bringen, wegen Verleumdung und übler Nachrede.«
»In zehn Tagen«, versetzte Cranston, »sehe ich euch beide in Newgate. Den Toten dürft ihr hinausbringen, aber sonst nichts anrühren. Ich habe eine Liste von allem, was da ist!«
Cranston ging in den Korridor hinaus und bemühte sich, seinen Zorn im Zaum zu halten, als er das höhnische Gelächter hinter sich hörte. Inghams alter Gefolgsmann Robert stand an der Haustür; er war bleich wie die Wand.
»Sir John«, flüsterte er, »wie könnt Ihr beweisen, was Ihr da sagt?«
Eine Hand am Türriegel, blieb Cranston stehen und schaute dem Diener in das faltige, müde Gesicht.
»Ich kann und werde es tun«, brummte er. »Aber erzähle mir noch einmal, was gestern passiert ist.«
»Mein Herr war seit Tagen krank und erschöpft, er klagte über Schwindelgefühle im Kopf und Schmerzen in der Brust. Gestern abend stand er vom Essen auf und nahm seinen Weinbecher mit. Ich sah, wie er in die Speisekammer ging und eine kleine Dosis Fingerhut in den Krug gab, die er später mit Wein mischen wollte, wie sein Arzt es ihm verordnet hatte. Dann ging er zu Bett. Er verschloß seine Kammertür, und weil ich mir Sorgen machte, stand ich davor Wache.« Die Stimme des Mannes zitterte. »Ich dachte, ich lasse ihn ausschlafen, aber als die Glocken von St. Mary Magdalen zum Vormittagsgebet läuteten, versuchte ich doch, ihn zu wecken. Ich rief die Diener, wir brachen die Tür auf. Den Rest kennt Ihr.«
»Konnte niemand ihn vor den Ratten bewahren?« fragte Cranston erbost.
»Sir John, das Haus ist voll von ihnen. Lady Rosamund haßt Katzen und andere Tiere.«
Sir John klopfte ihm auf die Schulter. »Deinem Herrn wird Gerechtigkeit werden, dafür sorge ich. Jetzt bete für seine Seele und kümmere dich um seinen Leichnam. Einer meiner Amtsdiener wird kommen und das Zimmer versiegeln.«
Sir John trat auf die Milk Street hinaus. Er ging in die Kirche von St. Mary Magdalen und zündete fünf Kerzen vor der lächelnden Jungfrau mit dem Kinde an.
»Eine für Maude, zwei für die Kerlchen«, flüsterte er und dachte an die prächtigen, stämmigen Söhne, die jetzt schon sechs Monate alt waren. »Eine für Athelstan«, fuhr er fort, »und eine für Sir Oliver, Gott schenke ihm die ewige Ruhe.«
Sir John kniete nieder, schloß die Augen und sagte drei Ave-Maria auf, bevor er merkte, wie durstig er war.
Schwerfällig wanderte er aus der Kirche, die Milk Street hinunter und in die verlassene Cheapside. Die Standbesitzer hatten für heute geschlossen, ihre Waren in die Vorderräume ihrer Läden geschafft, die Stände abgebaut und die breite Straße den Knochen- und Lumpensammlern überlassen. Eine Hure hielt träge nach Kundschaft Ausschau, Köter balgten sich, und fette Straßenkatzen konnten ihr Glück kaum fassen, als Myriaden von Ratten die Berge von Müll und menschlichem Abfall plünderten. Ein paar Kesselflicker und Hausierer versuchten immer noch, Geschäfte zu machen; sie brüllten Sir John gutmütige Schmähungen zu, und der zahlte es ihnen mit gleicher Münze heim, während er schnurstracks seiner Lieblingsschenke zustrebte, dem »Heiligen Lamm Gottes«.
In der stickigen, anheimelnden Wärme des Schankraums hellte Sir Johns Miene sich auf. Ein Büttel saß auf Cranstons Lieblingsstuhl mit der hohen Lehne am offenen Fenster mit Blick auf einen freundlichen Garten. Sir John hustete nur, und der Bursche huschte davon wie ein erschrockenes Kaninchen. Sir John setzte sich, klopfte auf den Tisch und betrachtete beifällig das dunkel polierte Holzwerk und die weiß verputzten Wände seiner allerheiligsten Trinkstätte. Er schmatzte und stieß das rautenförmige Gitterfenster ein Stück weiter auf, um den Duft der Kräuterbeete zu genießen. Manche Leute mieden das »Heilige Lamm«; sie behaupteten, es sei über einem alten Leichenhaus erbaut, und angeblich spukten hier Geister und Gespenster. Aber für Cranston war es sein zweites Zuhause, und die Wirtsfrau verehrte ihn beinahe wie einen Heiligen.
Vor Jahren war sie einmal von einem Betrüger übers Ohr gehauen worden, der behauptete, er könne Rotwein und Weißwein aus demselben Faß zapfen. Dummerweise hatte sie einer Vorführung zugestimmt. Der Mann hatte ein Loch in die Wand des Fasses gebohrt und sie aufgefordert, es mit dem Finger zuzuhalten, während er das zweite Loch bohrte, aus dem der Weißwein kommen sollte. Und dann hatte die unglückselige Frau dagestanden und beide Löcher im Faß zuhalten müssen, während der Gauner sich aus ihrer Geldbörse bediente. Sie war vor Schreck wie gelähmt gewesen, denn wenn sie die Finger herausgezogen hätte, wäre das ganze Faß ausgelaufen und hätte den Schankraum knöcheltief unter Wein gesetzt, und außerdem wäre sie zum Gespött der Leute geworden.
Zum Glück war Sir John gekommen. Er hatte dem Schurken eine Kopfnuß verpaßt, ihr geholfen, das Faß zu verstopfen, und als der Kerl wieder zu sich gekommen war, hatte Cranston ihn mit heruntergelassener Hose draußen vor die Schenke gestellt und ihm ein Schild um den Hals gehängt, das ihn als Lügner und Betrüger bezeichnete.
Eben diese Wirtin kam jetzt geschäftig auf ihn zu mit einem großen Becher Rotwein in der einen und einer Schüssel Zwiebelsuppe in der anderen Hand. Geistesabwesend lächelnd dankte Sir John ihr. Er nahm einen Schluck Wein und überlegte, wie er eine andere Betrügerin, die mörderische Rosamund, ihrer gerechten Strafe zuführen könnte. Olivers einsamer Leichnam dort oben in der trostlosen Kammer ging ihm nicht aus dem Kopf, dazu die kichernde Ehefrau und der speichelleckerische »Vetter« im Söller darunter.
Cranston hörte Stimmen und hob den Kopf, als der Reliquienhändler, den er in der Milk Street gesehen hatte, hereingeschlichen kam.
»Ein sündiger Gauner«, brummte er bei sich.
Der Reliquienhändler war alt und hinkte ein wenig, aber er hatte ein durchtriebenes, kaltes, schmales Gesicht, einen bohrenden Blick und einen Mund, so hart und gespannt wie eine Schraubzwinge. Er war gut gekleidet, trug eine teure Samttunika und weiche rote Lederstiefel, und in der Börse an seinem bestickten Gürtel klimperte schwer das Geld. Grinsend winkte er dem Coroner zu, aber der schaute ihn nur wütend an und senkte den Blick auf seinen Becher. Eigentlich sollte er heimgehen und sich auf den Abend vorbereiten, aber das Haus war leer, denn Lady Maude war mit den beiden Kerlchen zu Verwandten im West Country gereist.
»Oh, komm doch mit, John«, hatte sie gebettelt. »Die Ruhe wird dir guttun. Und du weißt, wie sehr Bruder Ralph sich freuen wird, dich zu sehen.«
Cranston hatte betrübt den Kopf geschüttelt und seine zierliche Frau in seine Bärenarme genommen.
»Ich kann nicht, Lady«, hatte er mißmutig erwidert. »Der Rat und der Regent bestehen ausdrücklich darauf, daß ich in London bleibe.«
Lady Maude hatte sich von ihm gelöst und ihn streng angeschaut.
»Ist das auch wahr, Sir John?«
»Bei den Zähnen Gottes!«
»Nicht fluchen«, hatte sie gemahnt. »Sag’s mir nur.«
Sir John hatte bei seiner Ehre geschworen, aber es hatte doch eine Lüge daringesteckt. Er konnte Bruder Ralph nicht ausstehen; dieser Mann war so ganz anders als seine Schwester. Ehrlich gesagt, Ralph war der langweiligste Mann, den Cranston je kennengelernt hatte. Seine einzige Leidenschaft war der Ackerbau, und Sir John hatte einmal trocken zu Athelstan gesagt: »Wenn du einmal zwei Stunden lang Ralph bei seinem Vortrag über die Zwiebelzucht zugehört hast, dann reicht das für die Ewigkeit.«
Trotzdem hatte Cranston ein schlechtes Gewissen. Ralph hatte ein gutes Herz, und Sir John vermißte seine Frau und die beiden Kerlchen, wie sie dick und rund auf stämmigen Beinchen ihrem Vater entgegenstapften, damit er ihnen die kleinen Kahlköpfe streichelte. Er wunderte sich, weshalb Athelstan immer lachte, aber wenn er den Ordensbruder fragte, machte der immer gleich ein ernstes Gesicht, biß sich auf die Lippe und erklärte kopfschüttelnd: »Es ist nichts, Sir John, gar nichts. Sie sind Euch nur so ähnlich.«
»Sir John! Sir John! Wie geht es Euch?«
Cranston erschrak und blickte auf. Athelstan stand vor ihm; das olivfarbene Gesicht war verschwitzt, das schwarzweiße Habit mit dem schwarzen Strick um den Leib staubig.
»Bei den Zitzen des Satans!« schnaufte Cranston. »Was machst du denn hier, Mönch?«
»Ordensbruder, Sir John.« Grinsend zog Athelstan einen Schemel heran und setzte sich. »Ich bin über die London Bridge gegangen, um meinen Pater Prior in Blackfriars zu besuchen. Er läßt mich wichtige Passagen aus Roger Bacons Werk über die Astronomie abschreiben. Ich war bei Euch daheim, und die Magd sagte, Ihr wäret nicht da. Ach, übrigens frißt Leif, der Bettler, gerade Euer Abendessen.«
Cranston starrte den Bruder an. Du lügst, dachte er. Ich wette, du bist hergekommen, weil du mich suchst. Ich weiß, daß Lady Maude darum gebeten hat. Dennoch war Athelstans Fürsorglichkeit herzerwärmend.
»Du willst mich bestimmt zu einem Becher einladen.«
Geschäftig kam die Wirtin heran.
»Ich habe schon bestellt«, sagte Athelstan. »Rotwein für Mylord Coroner, und einen Humpen vom kühlsten Ale für mich.« Athelstan nippte an dem Schaum und lächelte. »Ihr habt recht, Sir John. Im Himmel muß es Schenken geben.«
»Was machen die Halunken in deiner Pfarrei?« wollte Cranston wissen.
»Sie sind Sünder wie wir alle, Sir John«, antwortete Athelstan. »Bonaventura fängt die Ratten dutzendweise. Benedicta bereitet ein Erntefest vor. Ich habe angeboten, Brot zu backen, bevor mir einfiel, was für ein hoffnungsloser Koch ich bin. Watkin, der Mistsammler, liegt sich immer noch in den Haaren mit Pike, dem Grabenbauer.« Athelstan grinste. »Watkins Frau hat Pike im Kirchenvorraum umgerannt. Sie behauptet, er war betrunken und ist gestolpert. Was beide nicht wissen, ist, daß eine von Watkins Töchtern Pikes ältesten Sohn heiraten will.«
»Wissen die Familien es denn?«
»Noch nicht. Aber wenn sie es erfahren, werdet Ihr das Geschrei bis in die Cheapside hören. Cecily, die Kurtisane, hat einen neuen Beau und deshalb auch täglich ein neues Kleid. Und Huddle bemalt jetzt im neuen Altarraum die Wände.« Athelstan stellte seinen Humpen hin und machte ein ernstes Gesicht. »Da sind noch zwei Angelegenheiten«, fuhr er leise fort und verfiel dann in ein ärgerliches Schweigen.
O nein, dachte Cranston, du willst doch wohl nicht das Rattenloch von Pfarrgemeinde verlassen, das du so sehr liebst? Oder hat man dich etwa von deinem Amt als mein Schreiber entbunden?
Cranston musterte den verträumt blickenden Ordensbruder. Wegen früherer Torheiten war Athelstan zum Gemeindepriester von St. Erconwald und zu Cranstons Secretarius ernannt worden. Als Novize hatte er Blackfriars verlassen und war mit seinem heldengläubigen kleinen Bruder nach Frankreich in den Krieg gezogen. Der Junge war gefallen, und Athelstan war heimgekehrt zu dem Schmerz seiner Eltern und dem wütenden Tadel seiner Ordensoberen.
»Nun, was gibt's denn?« fragte Cranston gereizt.
»Glaubt Ihr an den Satan, Sir John?«
»Jawohl, und da drüben sitzt der Scheißer.« Cranston deutete auf den Reliquienhändler, der mit einem anderen Gauner ins Gespräch vertieft in einer Ecke der Schenke saß. Athelstan lächelte und schüttelte den Kopf.
»Nein, Sir John, ich meine den echten Satan.« Die Worte sprudelten aus ihm hervor. »Glaubt Ihr, daß er jemanden in Besitz nehmen kann?«
Sir John richtete sich auf. »Ja, Pater, das glaube ich. Ich glaube, daß es eine Geisterwelt gibt, in der Wesen gegen Christus und seine Heiligen wüten. Ich glaube allerdings auch, daß der normale Dämon auf seinem Fels in der Hölle hockt und weint, wenn er sieht, zu welchen Schlechtigkeiten der Mensch sich versteigt. Warum fragst du?«
Athelstan spielte mit seinem Humpen. »Vielleicht ist der Satan nach Southwark gekommen. Heute morgen nach der Messe kam eine Frau zu mir und behauptete, ihre Tochter sei besessen. Jede Nacht spreche der Teufel aus ihr und beschuldige ihren Vater, seine erste Frau, ihre Mutter, ermordet zu haben.« Athelstan betrachtete blinzelnd seinen Humpen. »Die Frau hat mich um einen Exorzismus gebeten.«
Sir John bedachte ihn mit einem seltsamen Blick. »Aber Athelstan, mit solchen Dingen hast du doch jeden Tag zu tun.«
»Oh, das weiß ich«, sagte der Bruder und grinste. »Pemel, die Flamin, behauptet, daß Dämonen, so groß wie ihr Daumen, in den dunklen Ecken ihres Hauses lauern und kichern und über sie reden. Vor zwei Jahren glaubten Watkin, der Mistsammler, und seine Frau plötzlich, das Ende der Welt sei nahe; sie setzten sich mit der ganzen Familie auf das Dach ihres Hauses, und jeder hielt ein Kreuz vor sich, um den Dämon abzuwehren. Aber es passierte weiter nichts, nur das Dach stürzte ein. Watkins Knöchel war verstaucht und sein Stolz verletzt.« Athelstan wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Nein, Sir John, diesmal ist es etwas anderes. Ich sehe dieser Frau an, daß in der Familie etwas Böses im Gange ist.«
»Und wirst du den Exorzismus vornehmen?«