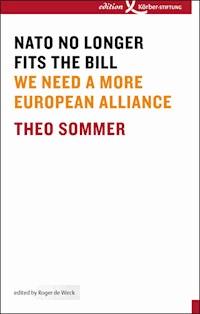9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
«Alles, was überhaupt erfunden werden kann, ist bereits erfunden worden», meinte 1899 der Chef des US-Patentamtes und schlug deshalb vor, sein Amt abzuschaffen. Andere hatten mehr Phantasie. Sie sahen das «drahtlose Jahrhundert» voraus, Menschen, die sich in «Luftautomobilen» auf der «unbegrenzten Himmelsbahn» ergehen und das «Telephon in der Westentasche» tragen. Meist aber stocherten die Zeitgenossen um 1900 im Nebel. Den Untergang der eurozentrischen Weltordnung, die globalen Kriege, die Shoa, die Teilung der Erde in eine amerikanische und eine russische Sphäre – niemand sah es voraus. Was haben die Deutschen aus ihrer Vergangenheit gelernt? Steht das 21. Jahrhundert im Zeichen Asiens, Amerikas oder Europas? Wie sieht die Zukunft des Krieges aus? Was wird aus dem Kapitalismus im Zeichen der Globalisierung? An welche ethischen Grenzen wird der technische Fortschritt den Menschen noch führen? Mit sicherem Blick für die großen Linien und Zusammenhänge führt uns Theo Sommer das Panorama der politischen, geistig-moralischen, ökonomischen und technischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts vor Augen und eröffnet im Anschluß daran den Horizont der Welt von morgen. Ein Blick zurück nach vorn, der Bescheidenheit lehrt: Der Mensch ist nicht der souveräne Produzent seiner Zukunft, als der er sich so gern ausgibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Theo Sommer
Der Zukunft entgegen
Über Theo Sommer
Über dieses Buch
«Alles, was überhaupt erfunden werden kann, ist bereits erfunden worden», meinte 1899 der Chef des US-Patentamtes und schlug deshalb vor, sein Amt abzuschaffen. Andere hatten mehr Phantasie. Sie sahen das «drahtlose Jahrhundert» voraus, Menschen, die sich in «Luftautomobilen» auf der «unbegrenzten Himmelsbahn» ergehen und das «Telephon in der Westentasche» tragen.
Meist aber stocherten die Zeitgenossen um 1900 im Nebel. Den Untergang der eurozentrischen Weltordnung, die globalen Kriege, die Shoa, die Teilung der Erde in eine amerikanische und eine russische Sphäre – niemand sah es voraus.
Was haben die Deutschen aus ihrer Vergangenheit gelernt? Steht das 21. Jahrhundert im Zeichen Asiens, Amerikas oder Europas? Wie sieht die Zukunft des Krieges aus? Was wird aus dem Kapitalismus im Zeichen der Globalisierung? An welche ethischen Grenzen wird der technische Fortschritt den Menschen noch führen?
Mit sicherem Blick für die großen Linien und Zusammenhänge führt uns Theo Sommer das Panorama der politischen, geistig-moralischen, ökonomischen und technischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts vor Augen und eröffnet im Anschluß daran den Horizont der Welt von morgen.
Inhaltsübersicht
Für Katharina und Sabine – die es erleben werden
I. Der Rückblick
«Was geschieht, das ist zuvor geschehen, und was geschehen wird, ist auch zuvor geschehen; und Gott sucht wieder auf, was vergangen ist.»
Prediger, 3,15
«Nie kehrt die vergangene Zeit zurück, noch kann man wissen, was folgt.»
Cato der Ältere
«Wir merken, daß es fast keine Gegenwart gibt, es ist alles gleich gewesen und wird gleich kommen.»
August Everding
Von Weissagung und Wirklichkeit
Ja, ja, die Propheten sind Schwätzer.
Jeremia, 5,13
Drei Jahre vor der letzten Jahrhundertwende malte Paul Gauguin auf der Südseeinsel Tahiti eines seiner schönsten Bilder. Die Szene zeigt Menschen, Tiere, ein steinernes Idol in üppiger Traumlandschaft. Ein Kind ißt einen Apfel; eine Greisin stützt den Kopf in die Hände; ein junges Mädchen blickt versonnen vor sich hin; eine Gruppe von drei Frauen hütet einen Säugling. In die linke obere Ecke hat der Künstler schwarz auf gelb geschrieben: D’où Venons Nous? Que Sommes Nous? Où Allons Nous? Es sind die drei Grundfragen menschlicher Existenz: Woher kommen wir? Was sind wir? Wohin gehen wir? Vom Anbeginn der Zeit haben sie alle Nachdenklichen bewegt. Herkunft, Gegenwart, Zukunft – immer versucht der Mensch, sein Gestern zu erforschen, sein Heute zu begreifen, sein Morgen zu erahnen. Am stärksten jedoch ist seine Neugierde auf das Kommende gerichtet. Wie Ortéga y Gasset gesagt hat: «Nichts hat Sinn für den Menschen außer in Beziehung auf die Zukunft.»[1]
Der Mensch lebt in der Vorausschau. Dies vor allem anderen unterscheidet ihn vom Tier: Er existiert nicht nur dumpf in der Gegenwart, vielmehr sucht er immerfort die Zukunft zu ergründen. Stets ist sein Trachten darauf gerichtet, den Schleier zu lüften, der das Morgen vom Heute trennt. Von den Propheten des Alten Testaments und den Orakeln der Antike, deren vis divinandi Cicero rühmt, führt eine gerade Linie zu den Instituten der zeitgenössischen Futurologie. «Think-tanks» wie die Rand Corporation, das Hudson Institute, die Zukunftslabors von DaimlerChrysler oder das FutureScape Team von Siemens – sie alle und viele mehr stochern rührig mit der Stange im Nebel. Aus Hollywood haben die Möglichkeitsdenker unserer Epoche die Kunstform des Szenariums entlehnt. Unermüdlich basteln sie an den Drehbüchern der Zukunft und schieben die Kulissen der Imagination in der Welt des Wirklichen hin und her.
Besonders dann, wenn sich die Jahre, die Jahrhunderte, gar die Jahrtausende runden und wenden, haben die Auguren Hochkonjunktur. Scharlatane und Schamanen, Hellseher und Handleser, Kassandren, Pythias und Sibyllen, Kartenleger und Kaffeesatzdeuter, Astrologen und Almanach-Schreiber, Wahrsager und Wissenschaftler, Apokalyptiker und Analytiker – Prognostiker aller Art werden bei solchen Anlässen nicht müde, die Gestalt des Künftigen vorauszusagen: the shape of things to come, wie H.G. Wells 1934 eines seiner Bücher betitelte.
Darin spiegelt sich eine gehörige Portion Wunschdenken, wie schon Goethe wußte: «Wir blicken so gerne in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin- und herbewegt, so gern zu unseren Gunsten heranleiten möchten.» Es mag sich darin aber obendrein die vermessene Hoffnung ausdrücken, daß wer die Zukunft erahnen könne, sie auch zu planen vermöge. Ahnung wird da zur Vorstufe der Planung, obwohl doch alle Erfahrung lehrt, daß Planen oft genug nichts anderes heißt, als den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. Wissenschaftler wie Hubert Markl, ehedem Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, nun Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, räumen dies auch in aller Demut ein: «Obwohl die Naturgesetze in Strenge gelten, ist die Zukunft nicht planbar, nicht kalkulierbar, nicht durch absolut gesetzte Welterklärungen beschreibbar, kein Uhrwerk mit vorhersagbarem Zeigerstand. Sie hat die ganze wundervolle Freiheit eines Systems, das noch für ungezählte Überraschungen gut ist, schöne wie freilich auch erschreckende.»[2]
So angestrengt der Mensch auch in die Schusterkugel blickt – mehr als bestenfalls kluge Verlängerungen heutiger Trends in die Zukunft wird er darin nicht entdecken. Nicht, daß etwa Yogi Berra, der legendäre New Yorker Baseballtrainer, mit seiner banalen Spruchweisheit recht hätte: «Die Zukunft ist genau wie die Gegenwart, bloß länger». Die Zukunft wird gewiß anders sein als die Gegenwart. Wie anders, können wir freilich nicht einmal erahnen. Jakob Burckhardts Satz behält da seine immerwährende Gültigkeit: «Wir sind nicht eingeweiht in die höheren Zwecke der ewigen Weisheit und kennen sie nicht.» Wir wissen nur eines: Es gibt kein Ende der Geschichte, sondern immerfort Wandel; kein historisches Endstadium, sondern nur lauter Zwischenstadien; keinen Ruhepunkt, sondern stets unaufhörliche Bewegung. Wie der Historiker Hermann Oncken einmal bemerkte: «Es ist alles nur Durchgang.»
Geschichte: das ist im Wesentlichen das Unvorhersehbare. Bestenfalls ist die Zukunft eine Mischung aus Erwartetem und Unerwartetem; aber das Mischungsverhältnis kennt der Mensch nicht. Soviel wir auch vorauszuahnen und vorauszuplanen suchen – wir wissen mit Sicherheit doch nur, wo wir in den Wald hineingehen, nicht aber, wo wir am Ende herauskommen werden. Wir können wohl die Gegenwartstendenzen ein Stück weit in die Zukunft hineinverlängern, was sich indes noch nicht einmal andeutungsweise im Schoß der Gegenwart abzeichnet, entzieht sich zwangsläufig jeder Prognose, aller kecken Analyse, ja selbst der ahnungsvollen Antizipation. Unser Erkenntnisvermögen ist begrenzt, über mehr oder minder intelligente Spekulation gelangen wir nicht hinaus. Prophezeien ist Glückssache: Orakeln eben. Nur selten erweisen sich überdies die Fachleute als die besten Propheten, und auch die Trefferquote der Philosophen und Historiker ist nicht sehr hoch – unter den Propheten des Untergangs so wenig wie unter den Kündern des Heils.
Seit jeher verbreiten die Weltuntergangspropheten chiliastische Düsternis, von Zoroaster und dem Apokalyptiker Johannes über die lothringischen Mönche, die im Jahre 1000 den Tag des Jüngsten Gerichts gekommen wähnten, und Oswald Spengler, der 1918 den Untergang des Abendlandes an die Wand malte, bis hin zu dem japanischen Aum-Guru Shoko Asahara und dem amerikanischen Waco-Anführer David Koresh. Hingegen verheißen die Vorsänger des Fortschritts eine lichtvolle Zukunft: Hegel den Triumph des Weltgeistes im preußischen Staat als letzter Stufe der geschichtlichen Vernunft, Marx den Aufstieg aus dem Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit nach dem Sieg des Proletariats.
Die Untergangspropheten haben mit ihren Weissagungen noch stets die Wirklichkeit verfehlt. Die Welt drehte sich jedesmal weiter. Aber auch Hegel und Marx irrten: Preußen und die preußische Staatsidee sind tot, die proletarische Revolution ist auf dem Aschhaufen der Geschichte gelandet. Die beiden Philosophen hatten sich einen kapitalen Denkfehler geleistet: Sie unterstellten, daß ihr Gesetz der Dialektik, wonach jede These eine Antithese herausfordert und die Entwicklung schließlich in etwas ganz Neues mündet, die Synthese, außer Kraft trete, sobald ihre Zielpunkte «preußischer Staat» oder «Diktatur des Proletariats» erreicht seien.
Was für die Großpropheten gilt, besitzt Gültigkeit zugleich für die vielen kleineren Lichter unter den Auguren (ganz zu schweigen von den Trendforschern, jenen Künstlern aufgeregter Kurzatmigkeit, die gegen Beratungshonorar jede Marotte, jede Mode zum Zukunftstrend hochstilisieren). Zu den Voreiligen und Übereifrigen gehört auch der späte Hegel-Epigone Francis Fukuyama, der 1989 das «Ende der Geschichte» ausrief und die Endgültigkeit des erreichten Zielstadiums «Liberalismus»: den Sieg der Demokratie und des freien Marktes.[3] Selten ist eine These so schnöde von der Wirklichkeit dementiert und demontiert worden. Zu Recht hat Eric Hobsbawm ihrem Urheber ins Stammbuch geschrieben, «daß es mit Sicherheit eine Zukunft geben wird. Denn die einzig wirklich sichere Allgemeinaussage über Geschichte ist die, daß sie, solange es die Menschheit gibt, weitergehen wird».[4]
Bescheidenheit lehrt uns schon ein Blick auf die Prophezeiungen, die uns zu unseren eigenen Lebzeiten, im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, angedient worden sind. Was haben wir nicht alles an wackeren, im Brustton der Überzeugung vorgetragenen Warnungen oder Versprechungen gehört!
Zu den Warnern zählte in den Sechzigern Jean-Jacques Servan-Schreiber. In «Le défi américain» stellte er den Europäern eine gewaltige «amerikanische Herausforderung» vor Augen. Die Dampfwalze USA sei drauf und dran, Europa mit multinationalen Firmen ungestüm zu überrollen. Die alte Welt müsse sich endlich ermannen, müsse von Amerika lernen. «Sonst ist es gut möglich, daß in fünfzehn Jahren die drittgrößte Industriemacht der Welt, nach den Vereinigten Staaten und Rußland, nicht Europa ist, sondern die US-Industrie in Europa.»[5]
Dann macht sich in den Siebzigern und Achtzigern eine Japan-Panik breit. Bücher des Rette-sich-wer-kann-Genres füllten mehrere Regalmeter. Sie trugen aufreizende Titel wie «Bald werden sie die ersten sein», «Japan as Number One», «Der kommende Krieg mit Japan», «Yen! Japans bedrohliches Finanzimperium», «Was wir von Japan lernen können», «Im Schatten der aufgehenden Sonne». Aus diesen Titeln sprach die Angst, die Fackel der Weltführungsmacht werde bald an Nippon weitergereicht. Im Jahr 2015, so raunten die politischen Kartenleger, werde das fernöstliche Inselreich auf allen Gebieten an der Spitze des technischen und wirtschaftlichen Fortschritts stehen; es werde rings um den Globus die Finanzmärkte beherrschen; es werde Atombomben besitzen und ein Star-Wars-System zur Raketenabwehr aufgestellt haben. Die Welt müsse sich an eine Pax Nipponica gewöhnen.
Der Furcht vor Japan zimmerte 1988 Paul Kennedy, Professor für Geschichte an der Universität Yale, den theoretischen Unterbau. In seinem «Rise and Fall of the Great Powers» argumentierte er, das imperiale Amerika habe den Bogen seiner Kräfte überspannt. Jeder weltpolitische Aufsteiger baue seine Militärmacht aus, um seinen Reichtum zu mehren und zu schützen, doch wenn er zuviel fürs Militär ausgebe, dann untergrabe dies allmählich seine Stärke, und die Nation werde von anderen nachrückenden Wirtschaftsmächten verdrängt. Kennedy prophezeite den Amerikanern einen ähnlichen Niedergang, wie ihn Jahrhunderte früher Spanien und Holland erlebt hatten.[6] Niedergang – the decline of America – wurde zum Leitmotiv eines heftigen Akademikerstreits: Apocalypse now.
In den Neunzigern stand wieder Europa am Pranger. Zerstritten wegen Maastricht, überfordert von den beiden Aufgaben, vor die es sich gleichzeitig gestellt sah, der Vertiefung der Europäischen Union nach innen und ihrer Erweiterung nach Osten, schien es sich endlos in einem sterilen Kreis von Fachkonferenzen, Ministertreffen, Gipfelbegegnungen zu drehen, ohne die Kraft zum Wachstum, zur Überwindung der Arbeitslosigkeit, zur Modernisierung seiner überfrachteten Sozialsysteme aufzubringen. In Asien spielte nun die Musik; die Tigerstaaten zeigten der müden Alten Welt, wie es geht. Auch hierzulande bekam manch einer schimmernde Augen, wenn er die Kurssteigerungen an den asiatischen Börsen verfolgte, und sehnte sich klammheimlich nach den «asiatischen Werten», für die Männer wie Malaysias Premier Mahathir oder Singapurs ehemaliger Regierungschef Lee Kuan Yew unermüdlich die Trommel rührten. Der Europessimismus grassierte. Eurosklerose wurde der Brüsseler Gemeinschaft attestiert. Eurofrust schüttelte die Völker der Alten Welt.
Der Rückblick enthüllt, was aus all diesen Vorhersagen geworden ist: nichts. Der Wind des unaufhörlichen Wandels hat sie verweht. Allenfalls läßt sich von ihnen sagen, daß sie denen, die sich von den Deuterichen auf den absteigenden Ast gesetzt sahen, den Impuls zur Korrektur ihrer Mängel lieferten.
In Japan platzte Ende der achtziger Jahre die Seifenblasenwirtschaft; seitdem steckt das Land in einer schweren Rezession. Aus dem Mirakel ist ein Debakel geworden. Als Modell hat Nippon jegliche Zugkraft verloren. Die Vereinigten Staaten, angeblich dem Untergang geweiht, haben sich in einer beispiellosen nationalen Anstrengung wieder an die Spitze des Fortschritts gesetzt. Die asiatischen Tigerstaaten jedoch, bis vor kurzem als Vorbild gepriesen, sind in ein tiefes Loch gestürzt; mit den Börsenwerten haben auch die konfuzianischen Werte eine kräftige Minderung erfahren. Der Beginn des asiatischen Jahrhunderts, im Überschwang der letzten Jahre voreilig ausgerufen, ist fürs erste verschoben worden. Im Westen sind alle Gurus wie Warren Reed und Reg Little verstummt, die zuvor geraten hatten, dem abendländischen Individualismus – «spirituelle Umweltverschmutzung» – und seiner kalten Rationalität den Rücken zu kehren und lieber das asiatische System zu übernehmen, in dem nicht das Gesetz obwaltet, sondern die Tugend der Herrscher. Niemand betet mehr die These der japanischen Wirtschaftszeitung Nihon Keizai Shimbun nach, daß Globalisierung im Endeffekt Konfuzianisierung bedeute.
Europa aber? Vor dreißig Jahren ist es nach Servan-Schreibers Warnruf mit der amerikanischen Herausforderung fertig geworden. Wer hätte gedacht, daß die Europäer den Spieß je umkehren könnten – daß Daimler-Benz den US-Automobilkonzern Chrysler schluckt oder Bertelsmann sich zum größten amerikanischen Buchverleger mausert? Europa wird auch mit den heutigen Herausforderungen fertig werden. In der Tat gibt es handfeste Anzeichen dafür, daß es auf dem Wege der Erholung schon ein gutes Stück vorangekommen ist. Auf der Welle der Zeit wird es am Ende des Jahrhunderts noch oben getragen. Im Wellental sind derzeit andere.
Soviel zu den Warnungen. Was aber die Versprechungen anbelangt, so steht es um deren Erfüllung nicht viel besser. Ein Mann wie Herman Kahn, der phantasievolle Denker des Undenkbaren, lag mit seinen Prognosen öfter schief als richtig. Dieser Butterberg von einem Mann durchdachte nicht nur die Schrecken des Atomkrieges, er begab sich auch immer wieder auf das Terrain technischer Voraussagen. In The Year 2000 listete er auf vier Buchseiten hundert Innovationen auf, «die im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts sehr wahrscheinlich sind». Zwei Drittel dieser Prognosen sind nicht eingetroffen. Weder hat die Menschheit neue und nützliche Pflanzen- und Tiergattungen hervorgebracht, noch hat sie die Kontrolle über Wetter und Klima gewonnen. Aus den interplanetaren Raumflügen ist bisher ebensowenig etwas geworden wie aus weltraumgestützten Verteidigungssystemen. Desgleichen lag Kahn mit seiner Vorhersage daneben, die ursprünglichen Gründungsstaaten der Europäischen Union würden bis zum Jahr 2000 eine Atomkraftwerksleistung von 370000 Megawatt installiert haben und jedes Jahr aus dem dabei anfallenden Plutonium 35000 bis 70000 Atomwaffen produzieren. Tatsächlich liegt die heutige Leistung bei 91296 Megawatt; weltweit produzierten 433 Kernkraftwerke 1998 ganze 351795 Megawatt. Immerhin prophezeite der «Seher mit den Elektronenaugen» Mobilfunk und Internet halbwegs korrekt, wiewohl vage. Auch den Aufstieg des Tourismus zu einem wichtigen Wirtschaftszweig sah er richtig voraus. Doch insgesamt gelangte Kahn mit seiner wissenschaftlich aufgeputzten Faktenhuberei über die Trefferquote gewöhnlicher Kartenlegerinnen kaum hinaus.[7]
Noch mehr Demut lehrt ein Blick zurück auf das Jahr 1899. Die Auguren, die vor hundert Jahren, Auspizien heischend, in den Eingeweiden der Zeitläufte wühlten, haben viele Voraussagen gewagt, die nicht eingetroffen sind – und es sind unzählige Ereignisse eingetreten, die sie nicht einmal in ihren kühnsten Träumen oder ihren quälerischsten Alpträumen voraussahen.
Seitdem ist das Voraussehen und Voraussagen noch riskanter geworden. Hermann Lübbe hat recht: «Noch nie hat eine Gegenwartszivilisation so wenig über ihre Zukunft gewußt wie unsere. Frühere Generationen wußten Verläßlicheres über ihre Zukunft zu sagen.» Auch seine Begründung leuchtet ein: Ehedem konnte die Menschheit darauf bauen, daß die künftigen Strukturen ihrer Lebenswelt genau so aussehen würden wie die bisherigen. Diese Gewißheit hat der rasante Wandel unserer Zeit zerfressen. Eric Hobsbawm hat diese Einsicht auf den Punkt gebracht: «Am Ende dieses Jahrhunderts war es zum ersten Mal möglich, sich eine Welt vorzustellen, in der die Vergangenheit (auch die Vergangenheit der Gegenwart) keine Rolle mehr spielt, weil die alten Karten und Pläne, die Mensch und Gesellschaft durch das Leben geleitet haben, nicht mehr der Landschaft entsprachen, durch die wir uns bewegten, und nicht mehr dem Meer, über das wir segelten. Eine Welt, in der wir nicht mehr wissen können, wohin uns unsere Reise führt, ja nicht einmal, wohin sie führen sollte.»[8]
Die Lehre, die sich aus der Vergangenheit ziehen läßt, ist ernüchternd: Der Mensch ist nicht der souveräne Produzent seiner Zukunft, als der er sich so gern ausgibt. Er weiß, woher er kommt. Er weiß kaum, wo er steht. Er kann nicht wissen, wohin er geht. Der Blick voraus ist immer ein Blick ins Dunkle – heute erst recht.
Rückblick auf 1900
Tout ce qui arrive, est admirable
Léon Bloy
Das Jahr 1900: In unseren Breiten empfanden viele Menschen es als Gipfelpunkt eines neuen Goldenen Zeitalters. Überall hatten die vorangegangenen drei Jahrzehnte – die Gründerzeit, wie sie in den Geschichtsbüchern hießen – wachsenden Wohlstand gebracht. Die Städte waren größer und schöner geworden. Die Künste und die Literatur blühten. Thomas Mann arbeitete an den «Buddenbrooks»; das Werk erschien 1901. Die Grenzen menschlichen Denkens weiteten sich. Ibsen, Strindberg, Freud (dessen «Traumdeutung» 1900 herauskam) drangen in abgründige Seelenwelten vor, die bis dahin verschlossen geblieben waren. Baudelaires Blumen des Bösen trieben üppige Blüten; die Wilden unter den Malern lösten, unehrerbietig provozierend, die vertrauten Formen auf; Dekadenz wurde der Boheme zum Lebensstil. Ihr Prophet Oscar Wilde starb, ein aufgeschwemmtes Wrack von 44 Jahren, 1900 in Paris. Friedrich Nietzsche, der Herold des «Gott ist tot», starb im gleichen Jahr in Weimar, 55 Jahre alt und dem Wahnsinn verfallen. Zur gleichen Zeit enthüllten sich in Strindbergs «Totentanz» und Gorkis «Nachtasyl» die tiefen Ängste der Epoche. Und Edvard Munch nahm schon 1893 mit seinem gespenstischen Gemälde «Der Schrei» den ganzen Jammer vorweg, der die Menschheit im 20. Jahrhundert anpackte.
Kultur wurde nun allenthalben zur Massenkultur. Mit den gefeierten Stars und den jubelnden Fans traten erstmals zwei Typen der vulgären Moderne auf den Plan. La Goulue tanzte im Moulin Rouge; Marie Lloyd begeisterte die Londoner Music Halls, in den Berliner Varietés sang schon bald Claire Waldoff «Denkste denn, denkste denn / du Berliner Pflanze / denkste denn, ick liebe dir / nur weil ick mit dir tanze?». Die ersten Kinofilme schlugen ein internationales Publikum in ihren Bann. Die Zeitungen entfalteten ihre Breitenwirkung, indem sie den Menschen ein Universum des Gesprächs anboten; mit ihren Berichten über die Pariser Weltausstellung des Jahres 1900 erreichte «Die Gartenlaube» eine Auflage von 250000. Die «harmlosen Gegenwartsmärchen» (Hedwig Courths-Mahler) der populären Frauenliteratur fanden reißenden Absatz. Die neuen Mittelschichten begannen, nicht nur in die Sommerfrische zu reisen, was meistens ja nichts anderes bedeutete als Verwandte besuchen. Carl Stangen’s Reise-Bureau, das erste deutsche Unternehmen dieser Art, offerierte Fahrkarten für Eisenbahnen und Fahrscheine für Dampfschiffe «von und nach allen größeren Orten im Weltverkehr». Noch brauchten die Reisenden keinen Paß, und da alle Währungen an den Goldstandard gebunden waren, konnte jeder sein Geld an den Grenzen ohne Kursverlust einwechseln. Mit dem Nationalismus der Massen – Alldeutscher Verein in Deutschland, die jingoistische Primrose League in England, Action Française in Frankreich, Italia Irredenta südlich der Alpen – ging ein weltoffener Kosmopolitismus der Eliten einher.
Der Fortschritt hatte seine Schattenseiten. Landflucht füllte die in den Großstädten entstehenden Slums; Tagelöhner bemühten sich jeden Morgen um Arbeit; viele Menschen kümmerten in den Rezessionen der Gründerzeit brotlos dahin. Immer wieder kam es zu Demonstrationen, zu Massenstreiks, zu blutigen anarchistischen Anschlägen. Sozialistische Gedanken fanden mehr und mehr Anklang, es bildeten sich Gewerkschaften. Sozialkritik und Sozialprotest breiteten sich aus – Kaiser Wilhelm II. kündigte nach der Uraufführung von Gerhart Hauptmanns Stück «Die Weber» seine Theaterloge. Die Obrigkeit, die zunächst überall mit Verboten und harten Unterdrückungsmaßnahmen reagiert hatte, besann sich nach und nach jedoch eines besseren. Eine Arbeiterschutzpolitik wurde formuliert, eine staatliche Sozialpolitik anstelle der niederdrückenden Armenpflege herkömmlicher Art. Zunächst sollte sie wohl nur den Sozialisten das «Wasser der Unzufriedenheit abgraben», wie Michael Stürmer den Vorgang beschreibt. Doch wurden 1881 mit Bismarcks Unfall-, Haftpflicht- und Krankenversicherung die Fundamente des modernen Sozialstaats gelegt; 1889 folgten die Alters- und Invalidenversicherung. Die «socialdemokratische Frage» lösten diese Ansätze nicht, aber sie bahnten den Weg zu einer allmählichen Entschärfung des Klassengegensatzes. Die Armut verzog sich an die Ränder der Gesellschaft. Zugleich wurde in immer mehr Ländern die Schulpflicht gesetzlich verankert; das Analphabetentum ging in Westeuropa sprunghaft zurück; Erziehung, Bildung und Ausbildung wurden Trumpf – «Wissen ist Macht!» lautete die Losung. Das allgemeine Wahlrecht für Männer gab es fast überall; immer kompromißloser forderten nun auch die Frauen ihre Teilhabe am politischen Prozeß ein. Am 1. Januar 1900 trat das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft. An der Schwelle des neuen Jahrhunderts herrschte Aufbruchstimmung.[1]
Der Leitartikler der Frankfurter Zeitung vom Sonntag, dem 31. Dezember 1899, fing diese Stimmung in seinem Rückblick «An der Schwelle zum zwanzigsten Jahrhundert» trefflich ein:
«Mit hohem Recht gebührt dem neunzehnten Jahrhundert die Bezeichnung des sozialpolitischen … Die Arbeiter-Versicherung, die Deutschland zuerst in bemerkenswerthem Umfange durchgeführt hat, ist eine der größten Thaten des abgelaufenen Jahrhunderts, und zwar nicht blos wegen der Wohlthaten, die sie den Arbeitern erweist, sondern auch aus dem Grunde, weil sie den alten Polizei- und Militärstaat im Sinne sozialer Gerechtigkeit zum wirthschaftlichen Versicherungs- und Solidaritätsstaat fortbildet. Der Staat eine Gegenseitigkeits-Versicherung aller seiner Bürger, welch einen Ausblick in die Zukunft eröffnet dieser neue Grundsatz! Aber große Ideen verlangen auch große Mittel. Nicht groß im materiellen, sondern auch im geistigen Sinne. Eine weitausgreifende Sozialpolitik ist nothwendig für Deutschland, das ein Industriestaat ersten Ranges geworden ist und Weltpolitik treiben will. Je besser die gesammte arbeitende Bevölkerung Deutschlands gestellt, je unterrichteter und aufgeklärter sie ist und je freier sie sich bewegen kann, mit desto größerem Nachdruck kann Deutschland auf dem Weltmarkte und in der Weltpolitik auftreten. Man soll sich nur nicht einbilden, daß man draußen Weltpolitik treiben und zu Hause ein System einseitiger Klassenwirthschaft, polizeilicher Bevormundung, büreaukratischer Bedrückung und kleinlichen Fiskalismus aufrecht erhalten kann! Ohne das ganze arbeitende Volk ist keine Weltpolitik zu machen; will man, daß es für eine große Politik eintrete, dann behandle man es auch in großem Stile: man gebe ihm die Möglichkeit erweiterten Unterrichts und geistiger Genüsse, man erhöhe seine Lebenshaltung, und man gewähre ihm die freie Bewegung auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens! Nur so wird man das Groß-Deutschland schaffen, das unseren Staatsmännern im Zukunftsbilde vorschwebt.»
Revolution? Die Bibelweisheit war in Vergessenheit geraten: «Gut währt nicht ewiglich, und die Krone währt nicht für und für.»[2] Niemand sah voraus, daß binnen kaum zwei Jahrzehnten fünf alte Monarchien gestürzt würden: die Tsching-Dynastie in Peking, die Romanows in Sankt Petersburg, die Habsburger in Wien und Budapest, die Hohenzollern in Berlin, die Osmanen in Istanbul. Keiner hätte einen Heller, Pfennig, Centime oder Farthing darauf gewettet, daß die Staatsgrenzen auf dem europäischen Kontinent mehrmals rüde Verschiebungen erfahren würden. Und wer hätte schon jene Zellteilung der Staatenwelt für möglich gehalten, welche die Zahl der souveränen Länder in Europa von 27 im Jahre 1900 auf 46 an der Schwelle zum dritten Jahrtausend hochschnellen ließ, die Zahl der Staaten rund um den Globus von 48 auf beinahe 200, davon 185 vollgültige Mitglieder der Vereinten Nationen? Dies erschien so undenkbar wie die Vervierfachung der Weltbevölkerung im Laufe des 20. Jahrhunderts von 1,55 auf sechs Milliarden. So unwahrscheinlich übrigens wie die Erhöhung des durchschnittlichen Lebensalters im Norden der Erde von 50 Jahren auf das biblische Alter von fast 80 Jahren. Die Spannungen, die sich im Laufe des Jahrhunderts aus diesen drei Faktoren ergaben, der Vermehrung der Staaten, der Menschen und der Alten, lagen noch weit außerhalb des Gesichtskreises der Zeitgenossen.
Ziemlich blind tapste die Menschheit auch in das Maschinenzeitalter, obwohl die moderne Technik vor aller Augen mit Siebenmeilenstiefeln voranschritt. Dampfschiffe und Eisenbahn hatten längst ihren Siegeszug angetreten. Der Stahl hatte das Schmiedeeisen verdrängt. Es gab schon die Gaslampe, die Glühbirne, die «Elektrische», die allmählich die Pferdebahn ablöste, die ersten Aufzüge in Hochhäusern. Es gab den Telegraphen und das Telephon, die Egreniermaschine zum Trennen der Baumwollfasern vom Samen und eine Vielfalt von Geräten, die dem Menschen die Handarbeit abnahmen. Es gab den Photoapparat; in den 1890ern bot Eastman-Kodak den ersten marktfähigen Film dafür an. Es gab Anästhetika und Antiseptika und seit 1895 die Röntgenstrahlen. Es gab immer mehr Fabriken. Die Chemie revolutionierte das Leben. Die Patente von Alexander Graham Bell und Johann Philipp Reis, von Nikolaus August Otto und Rudolf Diesel waren schon lange angemeldet. Zwar blieben Telephon und Automobile, blieben die Schreibmaschine und sogar das Fahrrad bestaunte Raritäten. Das Flugzeug beschäftigte schon die Phantasie – «Will Man Fly?» war 1895 ein englischer Magazin-Artikel betitelt; doch erst 1903 vollführten die Gebrüder Wright mit der «Kitty Hawk» ihren weltgeschichtlichen Hopser ins Zeitalter der Luftfahrt. Die Erfindungen, die den Alltag rund um die Welt von Grund auf verändern sollten, waren im wesentlichen schon gemacht, zumindest wurde daran gearbeitet. «Wie die Erfindungen und Entdeckungen alle heißen mögen – es sind so viele, um mehrere Jahrhunderte damit versehen zu können», staunte der Leitartikler der Frankfurter Zeitung. Es fehlten nur noch die Atomkraft und der Computer.
Der revolutionäre Wandel aller Lebensverhältnisse, den die Forscher und Ingenieure damit auslösten, entzog sich damals dem Blick selbst der Wissenden. Vollends blieb die Öffentlichkeit skeptisch. «Eine erstaunliche Erfindung», sagte US-Präsident Rutherford Hayes zum Telephon. «Doch wer würde je ein solches Ding benutzen wollen?» Und noch 1910 verlachte der berühmte amerikanische Astronom William Pickering die Idee, das Flugzeug könne je Massen von Menschen preiswert über den Atlantik befördern und so dem Dampfschiff zur Konkurrenz werden.[3] Heute sind rund um den Globus ein Drittel der 1,5 Milliarden Haushalte an das Telephonnetz angeschlossen, Millionen von Mobiltelephonen nicht mitgerechnet. Dem einsamen Transatlantikflug von Charles Lindbergh im Jahre 1927 folgte im Juni 1939 der erste transatlantische Passagierdienst; auf der Nordatlantikroute gab es 1957 zum letzten Mal ebenso viele Schiffspassagiere wie Flugpassagiere. Seitdem spielt sich in der Stratosphäre eine wahre Völkerwanderung ab: 17000 Flugzeuge transportierten allein 1997 über 1,7 Milliarden Fluggäste durch die Lüfte. Wer konnte es ahnen? Die Kraftdroschke, die auf den Prachtstraßen der Metropolen gerade die Pferdedroschke abzulösen begann, reichte der Belle Epoque als Ausweis der Modernität.
Was aber der Epoche ihren goldenen Schimmer gab, war vor allen Dingen eines: Es herrschte Frieden. Gewiß, es grummelte auf dem Balkan, wo die Mazedonische Befreiungsarmee gegen die Türken kämpfte; in Faschoda am oberen Nil waren vor kurzem französische und britische Kolonialtruppen aneinandergeraten; in Südafrika eskalierte der Burenkrieg zwischen den Engländern in der Kapkolonie und den Afrikaaner-Republiken im Landesinneren. Die Russen konzentrierten Truppen an der afghanischen Grenze, Frankreichs Regimenter patrouillierten in den Grenzgebieten Marokkos und Algeriens. Doch zwischen den großen europäischen Mächten herrschte Ruhe. Der deutsch-französische Krieg von 1870/71 lag fast dreißig Jahre zurück, der letzte Konflikt zwischen Rußland und der Türkei schon über zwanzig Jahre. Die erste Haager Abrüstungskonferenz (1899) nährte die Hoffnung, daß der Frieden zwischen den Mächten dauern werde.
Noch beherrschte im Jahre 1900 die europäische Pentarchie den Globus. Hegels Behauptung hatte sich erfüllt: «Die Welt ist umschifft und für die Europäer ein Rundes. Was noch nicht von ihnen beherrscht wird, ist entweder nicht der Mühe wert oder noch bestimmt, beherrscht zu werden.»[4] Nur eine Handvoll Länder entkam der europäischen Kontrolle: Thailand, der Yemen, die Mongolei, Saudi-Arabien, bis zu einem gewissen Grade Persien. Die Weltkarte verriet Europas Vormachtstellung schon durch die dominierenden Farben, in denen auf allen Kontinenten, von der Ostküste Südamerikas bis hin nach Indochina und Insulinde, die Kolonien der Alten Welt gehalten waren: rot für England, violett für Frankreich, blau für das Deutsche Reich, olivgrün für die Niederlande und orange für Belgien. Die Welt war eurozentrisch durch und durch.
Doch kaum vernehmlich noch pochten neue Mächte bereits an den rückwärtigen Eingang zur Weltbühne. Japan hatte fünf Jahre zuvor das riesige China besiegt; es war dies der Beginn von Nippons Aufstieg zur imperialen Macht. Fünf Jahre später schon schickte es bei Tsushima die russische Flotte auf den Meeresboden und zwang das Zarenreich in die Knie. Keine zehn Jahre danach begann es, sich auf dem chinesischen Festland festzusetzen und dem morschen Reich der Mitte Stück um Stück zu entreißen.
Vergebens rührten sich in Peking seit der Niederlage von 1895 die Reformkräfte, die China seinen Platz an der Sonne verschaffen, auf jeden Fall aber verhindern wollten, daß es immer tiefer in den Schlagschatten der Fremden geriet. Seine Stunde schlug noch lange nicht. Alfred Kerrs Angst vor der «Verchinesung Europas und Amerikas» («Sie könnten am Ende wandern, wandern, wandern … Vielleicht arbeiten wir für die Chinesen.») spiegelte die Furcht der Zeitgenossen vor der «gelben Gefahr» wider, die aber nicht mehr war als eine Obsession. Und auch der Fernost-Experte der in Paris erscheinenden Revue des Deux Mondes irrte sich um mindestens hundert Jahre, als er 1899 befand, daß der «Aufbruch des neuen China der bedeutsamste Faktor des Jahrhundertendes» war. Im Kern traf seine Vorhersage jedoch zu: «Wenn sich die wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen einmal voll entfalten, die in dieser Metamorphose des alten Cathay im Keim angelegt sind, wird man erst merken, welcher Platz in der Weltgeschichte diesem beispiellosen Faktum zukommt, das man bei uns noch kaum wahrnimmt.»[5] Bis zur Befreiung Chinas von fremder Vorherrschaft dauerte es freilich noch fünfzig Jahre, und weitere dreißig, bis sich das Reich der Mitte nach Jahrtausenden der Selbstabschließung endgültig zur Welt hin öffnete.
Die Vereinigten Staaten jedoch, die bei ihrem ersten weltpolitischen Auftritt 1898 – vier Monate Krieg, 379 Gefallene – Spanien in der Karibik besiegt und ihm im Pazifik die Philippinen abgenommen hatten, standen am Anfang eines Jahrhunderts, das Henry Luce 1941 mit Fug und Recht das Amerikanische Jahrhundert nannte. Schon vor der Jahrhundertwende hatten die Amerikaner England als größte Wirtschaftsmacht der Erde abgelöst. Für die Außenwelt brachten sie bis dahin indes wenig Interesse auf. Vielmehr waren sie ganz auf ihr manifest destiny konzentriert: auf die gewaltige Aufgabe, den nordamerikanischen Kontinent von Küste zu Küste zu bevölkern. Nach dem spanisch-amerikanischen Krieg änderte sich dies. Von 1917 an war Amerika das Zünglein an der weltpolitischen Waage. Dreimal griff es in der Alten Welt ein, um das Mächtegleichgewicht zu wahren: im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg – und selbst nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ging, wie die Balkankrisen der neunziger Jahre zeigten, nichts oder nur wenig ohne die Amerikaner. Zugleich wurde ihre Kultur zur dominierenden Alltagskultur. Modernisierung bedeutete weithin Amerikanisierung.
Noch war es nicht soweit. Die Welt schien an der Schwelle zum 20. Jahrhundert im Lot. Fürst Metternich war 1900 schon 41 Jahre tot, Karl Marx lag seit 17 Jahren auf dem Londoner Highgate-Friedhof, Otto von Bismarck hatte sich gerade erst zwei Jahre zuvor in Friedrichsruh zum Sterben gelegt. Die Männer aber, die dem neuen Jahrhundert ihren Stempel aufdrücken sollten, waren damals kaum dem Jünglingsalter entwachsen oder steckten noch in den Kinderschuhen. Gandhi wurde 31 Jahre alt, Wladimir Iljitsch Uljanow (später Lenin genannt) 30, Winston Churchill 26, Konrad Adenauer 24, Josef Dschugaschwili (später Stalin genannt) 21, Franklin D. Roosevelt 18, Jean Monnet 12, Adolf Hitler 11, Josip Broz-Tito 8, Mao Tsetung 7. Im Durcheinander und Gegeneinander ihrer Ambitionen gaben sie dem heraufdräuenden Jahrhundert sein Gepräge. Es wurde den Menschen zur Hölle.
Die zeitgenössischen Auguren haben den Schrecken nicht kommen sehen.
Die Illusion des Friedens
History is not kind to the hopeful
Robin Frost
Mit dem 19. Jahrhundert neigte sich auch das viktorianische Zeitalter seinem Ende zu. Victoria, Königin von Großbritannien und Irland und seit 1876 auch Kaiserin von Indien, hatte 1837 den Thron bestiegen. Mittlerweile regierte sie schon 63 Jahre, in denen die Briten ein Weltreich erworben hatten, das den ganzen Erdball umspannte. Sie hatte 229 größere und kleinere Kriege, Schlachten und Scharmützel geführt – mit Chinesen und Russen, mit Pashtunen und Sikhs und Afghanen, mit Zulus und Ashantis, Buren und Iren. Als sie Anfang 1901 starb, wehte der Union Jack über einem Viertel der Erdoberfläche und fast einem Drittel der Weltbevölkerung.[1]
Zu den Trauernden zählte auch der junge Unterhausabgeordnete Winston Churchill. Siebenunddreißig Jahre nach dem Tod der Königin Victoria schrieb er im Rückblick über die seitdem verstrichene Zeitspanne: «Der Maßstab, in dem sich die Ereignisse gestaltet haben, hat die Episoden des viktorianischen Zeitalters zur Unbedeutsamkeit schrumpfen lassen. Dessen kleine Kriege zwischen großen Nationen, seine ernsten Dispute über oberflächliche Dinge, der hochfliegend zupackende Intellektualismus seiner führenden Persönlichkeiten, die nüchterne, frugale, enge Beschränktheit ihres Handelns – all das gehört einer versunkenen Epoche an. Der glatte Fluß mit seinem seichten Wellengekräusel, auf dem wir damals dahinsegelten, erscheint unvorstellbar weit entfernt von dem Katarakt, in den wir mittlerweile gestürzt worden sind, weltenfern auch von den Stromschnellen, in deren gefährlichen Wirbeln wir jetzt kämpfen.»[2] Als Churchill diese Sätze niederschrieb, lag der Absturz in den Katarakt des Zweiten Weltkrieges noch vor der Menschheit.
Dem euphorischen Optimismus des fin de siècle war die Vorstellung gänzlich fremd, daß katarakthafte Entwicklungen bevorstehen könnten. Ivan Bloch, der russische Bankier, Eisenbahnmagnat und Staatsrat polnisch-jüdischer Herkunft, gelangte in seiner 1898 veröffentlichten sechsbändigen Studie «Die Zukunft des Krieges» zu dem Schluß, daß bewaffnete Konflikte zwischen den Mächten nur noch «um den Preis des Selbstmords» geführt werden könnten, da die moderne Technik und Taktik dem Verteidiger einen derartigen Vorteil verschafften, daß niemand mehr einen entscheidenden Sieg erringen könne. Jeder künftige Krieg werde Jahre dauern, er werde aus einer endlosen Kette von Belagerungsunternehmen bestehen, die Soldaten würden sich in einem auszehrenden Grabenkrieg gegenüberliegen. Solch ein Krieg jedoch, so Bloch, werde die Monarchien Europas in Aufruhr und Revolution stürzen. Nur eine neue internationale Ordnung, war Blochs Schlußfolgerung, die auf Gerechtigkeit gründe und auf einer wirksamen Schlichtungsinstanz, könne dies abwenden. Blochs monumentale Studie bewegte den Zaren Nikolaus II., im August 1898 die Mächte zu einer Konferenz über die Begrenzung der Rüstungen nach Den Haag einzuladen. Die Motive des Zaren wurden weithin angezweifelt, doch lag der Friedensgedanke in der Zeit. Alle Völker ächzten unter der Last der Militärausgaben. Niemand konnte es sich leisten, die Einladung abzulehnen.[3]
Am 18. Mai 1899 traten die Vertreter von 26 Nationen im Haager Huis Ten Bosch zusammen, der Sommerresidenz der Oranier: Europäer, Amerikaner, auch Türken, Japaner und Chinesen. Die Delegierten verhandelten in drei getrennten Ausschüssen über Rüstungsbegrenzung, Regeln der Kriegführung und Schlichtungsmöglichkeit; wobei sie in zeitgemäßer Schizophrenie in einem Atemzug über die Ächtung des Krieges und über seine Humanisierung redeten. Am 29. Juli schloß die Konferenz ihre Arbeit mit einem dürftigen Ergebnis ab. Kein Moratorium für neue Waffen; kein Verbot des Luftkrieges (damals noch als Ballonkrieg gedacht); keine Ächtung von Giftgas; keine obligatorische Schlichtung von Streitigkeiten, die zum Kriege führen konnten. Neben einem Verbot von Dumdum-Geschossen und der Absichtserklärung, das Konferenzthema weiteren Studien zu unterziehen, ragte nur der Beschluß hervor, ein internationales Schlichtungstribunal einzurichten, dem sich die Staaten freiwillig unterwerfen mochten – oder auch nicht. Außerdem wurde der Wunsch protokolliert, zu einem späteren Datum eine zweite Konferenz einzuberufen. Noch war der Friedensengel nicht flügge.[4]
Zwei Welten prallten im Haag aufeinander. Auf der einen Seite die Militärs und Diplomaten sämtlicher Nationen, die alle dem Gedanken abhold waren, ihre Handlungsfreiheit einengen zu lassen – so der amerikanische Theoretiker der Seemachtstrategie, Alfred Mahan; für das Deutsche Reich Graf Münster («Rüstungsbegrenzung ist ausgeschlossen»); für Königin Victoria ihr Dritter Seelord John Fisher (Wahlspruch: «Ut veniant omnes» – sollen sie doch alle kommen!). Auf der anderen Seite die Vertreter der Friedensbewegung: der unermüdliche Ivan Bloch, der während der Konferenz vier öffentliche Dia-Vorträge hielt; die österreichische Pazifistin Bertha von Suttner, die 1889 mit ihrem Appell «Die Waffen nieder!» die Welt aufgerüttelt hatte und nun als Korrespondentin der Wiener Zeitung Neue Freie Presse Teestunde in ihrem Haager Salon hielt; der englische Pazifist und Journalist William Stead; der Quäker Dr. Trueblood, Sekretär der Amerikanischen Friedensgesellschaft; und Charles Richet, der Direktor der Französischen Friedensgesellschaft.[5]
Wie sich diese beiden Lager im Haag gegenüberstanden, so konfrontierten sie einander auch in den nächsten anderthalb Jahrzehnten. «Ich habe diesem Blödsinn allein zugestimmt, damit der Zar in Europa nicht an Gesicht verliert», kritzelte Wilhelm II. an den Rand eines Berichts über die Haager Zusammenkunft. «In der Praxis werde ich jedoch auf Gott und die Schärfe Meines Schwertes vertrauen und Mich einen Scheißdreck um ihre Beschlüsse kehren.» Nicht ganz so zynisch, doch ähnlich schnöde reagierten auch die Staatsmänner der anderen Mächte. Die Pazifisten bauten demgegenüber auf die Kraft der Vernunft. Weiterhin schworen sie mit Ivan Bloch darauf, daß die Furchtbarkeit der neuen Waffen die Staaten zwingen werde, Frieden zu halten. So prophezeite Alfred Nobel, der Herr des Dynamit-Imperiums: «An dem Tag, an dem zwei Armeen imstande sein werden, sich innerhalb einer Sekunde gegenseitig zu vernichten, werden alle zivilisierten Nationen vor Entsetzen erschauern und ihre Armeen verabschieden.» Der Friedensnobelpreis, den er, der Freund und Gönner Bertha von Suttners, in später Reue auf ihre Anregung hin gestiftet hatte, wurde 1901 zum ersten Mal verliehen: an Henri Dunant, den Gründer des Roten Kreuzes, und Frédéric Passy, den Vater der französischen Friedensbewegung. Viele sahen in dem Preis die Prämierung einer Idee, die sich durchgesetzt hatte.
Der Leitartikler der Frankfurter Zeitung, der am 31. Dezember 1899 einen Blick in die Zukunft warf, befand zuversichtlich, daß «die Friedensidee große Fortschritte gemacht» habe; Kriege seien sozusagen Spezialfälle geworden. Die vom Zaren berufene Friedenskonferenz werde ihre segensreichen Wirkungen voll ausüben können: «Wenn es schließlich nur noch drei oder vier Großreiche geben wird, von denen jedes sich selbst genügen kann, dann sind die politischen und wirthschaftlichen Reibungsflächen wesentlich vermindert, und den kleinen Störenfrieden wird man das Kriegführen einfach verbieten können.» Der Autor drückte nur die conventional wisdom seiner Zeit aus, wenn er schrieb: «Ein Krieg zwischen den Großstaaten selbst gilt als fast undenkbar, weil die Einsätze zu groß sind gegenüber dem etwa zu erwartenden Gewinn.»
Der Gedanke, daß Krieg sich nicht mehr rentiere, trieb zur gleichen Zeit auch den englischen Schriftsteller Norman Angell um. Die erste Ausgabe seines Buches «The Great Illusion»