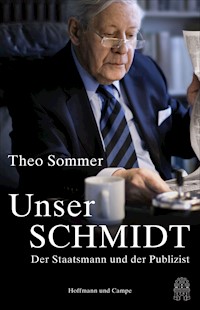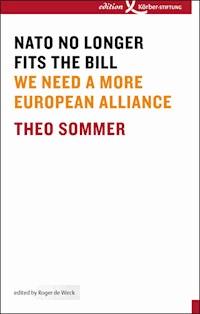11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
CHINAS WEG ZUR GLOBALEN VORMACHT - EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN
China hat sich in wenigen Jahrzehnten vom Armenhaus im Mao-Look zur Hightech-Nation gewandelt. Vielspurige Autobahnen und Hochgeschwindigkeitszüge verbinden die Zentren. Wer aus Schanghai nach Berlin kommt, erlebt eine Reise in die Vergangenheit. Oft heißt es, die Technologie sei nur importiert, ja geraubt, und die sozialen und ökologischen Probleme seien übermächtig. Doch das ist ein gefährlicher Irrtum. Das chinesische Jahrhundert hat bereits begonnen.
Theo Sommer blickt in diesem Buch hinter die Kulissen der chinesischen Expansion, die einem ehrgeizigen Masterplan folgt. Das Seidenstraßen-Projekt stellt wichtige Handelswege zwischen Asien, Afrika und Europa unter chinesische Kontrolle. Ebenso planmäßig erfolgen Investments in europäische und gerade auch deutsche Firmen. Außenpolitisch trumpft China immer mehr auf, in Asien auch militärisch. Der neue starke Mann Xi Jinping hat sich eine Machtfülle gesichert, wie sie nicht einmal Mao hatte. Er perfektioniert den Überwachungsstaat mit einem an Orwell gemahnenden «Sozialkreditsystem», in der Provinz Xinjiang gar mit einem Lagersystem. DIe «Corona-App» überwacht den Bürger unter dem Vorwand der Gesundheitsvorsorge auf Schritt und Tritt. Auch in Hongkong sind Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten bedroht. Wer Theo Sommers luzides Buch voller überraschender Fakten und Zusammenhänge gelesen hat, wird China und den Westen mit anderen Augen sehen.
- Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe
- Was die Corona-Pandemie für Chinas Wirtschaft und die Techno-Diktatur Xi Jinpings bedeutet
- Worauf wir uns in Zukunft gefasst machen müssen
- "Wenn heute in China ein Sack Reis umfällt, dann bebt die Erde." Theo Sommer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
China First
Die Welt auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert
C.H.Beck
Zum Buch
Theo Sommer blickt in diesem Buch hinter die Kulissen der chinesischen Expansion, die einem ehrgeizigen Masterplan folgt. Das Seidenstraßen-Projekt stellt wichtige Handelswege zwischen Asien, Afrika und Europa unter chinesische Kontrolle. Ebenso planmäßig erfolgen Investments in europäische und gerade auch deutsche Firmen. Außenpolitisch trumpft China immer mehr auf, in Asien auch militärisch. Der neue starke Mann Xi Jinping hat sich eine Machtfülle gesichert, wie sie nicht einmal Mao hatte. Er perfektioniert den Überwachungsstaat mit einem an Orwell gemahnenden «Sozialkreditsystem», in der Provinz Xinjiang gar mit einem Lagersystem. Die «Corona-App» überwacht die Bürger unter dem Vorwand der Gesundheitsvorsorge auf Schritt und Tritt. Auch in Hongkong sind Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten bedroht. Wer Theo Sommers luzides Buch voller überraschender Fakten und Zusammenhänge gelesen hat, wird China und den Westen mit anderen Augen sehen.
Über den Autor
Theo Sommer, Journalist und Historiker, war zwanzig Jahre lang Chefredakteur der ZEIT und zusammen mit Marion Gräfin Dönhoff und Helmut Schmidt Herausgeber der Hamburger Wochenzeitung. Asien ist eines seiner großen Lebensthemen. Er reist seit fast fünf Jahrzehnten immer wieder nach China, oft als Begleiter hochrangiger politischer Delegationen, und hat vielfach zur Rolle Chinas in Asien publiziert.
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Die Chinesen kommen? Sie sind schon da!
Erster Teil: CHINA ERWACHT
1: Vier Jahrzehnte China im Visier
Die Volksrepublik nach der Kulturrevolution
Das unterschätzte Reich
Das chinesischer Jahrhundert beginnt
2: Und die Menschenrechte?
Das System duldet keine Abweichler
Zensur, Überwachung und die Suche nach dem Rechtsstaat
Humanitäre Gesten mit politischem Zweck
Zweiter Teil: WIRTSCHAFTLICHE SUPERMACHT MIT PLAN
3: Chinas beispielloser Wirtschaftsaufstieg
Von Mao zu Deng
Ein meteorhafter Aufstieg
Vom Fahrrad zum Elektroauto: Wohlstand und Wachstum
China: Größter Automarkt der Welt
Patente und wissenschaftliche Publikationen: China holt auf
Fälschungsweltmeister und Hightech-Entwickler
4: Die Schattenseiten des Aufstiegs
Chinas Schuldenberg drückt
Die Wohlstandslücke zwischen Stadt und Land
Das Paradox der kommunistischen Milliardäre
China wird alt, bevor es reich wird
In die Städte und in die Hochhäuser
Noch macht Stadtluft nicht frei
Xi Jinpings Kampf gegen die Korruption
Rechtsunsicherheit
Vergangenheitsbewältigung? Bloß nicht!
Mangelware: Sauberes Wasser und reine Luft
Billiglohnproduktion wandert aus
5: Chinas rote Magnaten
Kommunistischer Uradel: Wang Jianlin
Jack Ma und Alibaba
Aggressiver Firmensammler: Chen Feng
Schöpfer eines undurchschaubaren Firmengeflechts: Wu Xiaohui
Chinas Warren Buffet: Guo Guangchang
Chinas Zuckerberg: Pony Ma
Vom Bauernsohn zum Autobauer: Li Shufu
Die Partei nimmt die Wirtschaft an die Kandare
6: Die Chinesen auf Einkaufstour
Die Chinesen in Deutschland
Going Global
Pekings Hafenstrategie
Stoßrichtung Balkan
17+1: Chinas Spaltpilz in Europa
Chinas Seiteneingang nach Europa
7: Der Rückschlag: Wie viel China ist zu viel?
Chinesische Investitionen: Chance oder Risiko?
Aggressive Industriepolitik
Umstrittene Ankäufe: Kuka, Aixtron, Osram
Politische Reaktionen in Deutschland und Europa
Weltweite Schranken für chinesisches Geld
Dritter Teil: CHINAS NEUE WELTPOLITIK
8: Außenpolitik: Poltergeist oder Partisan der Besonnenheit?
Das Reich der Mitte, umgeben von fremden Teufeln
Windungen und Wendungen unter Mao
Die eigene Stärke verbergen, den richtigen Zeitpunkt abwarten: Zurückhaltung unter Deng
Xi und die «chinesische Lösung» der Menschheitsprobleme
9: Xi Jinping: Make China great again!
Wer ist dieser Xi Jinping?
Die Partei ist er
Patriotismus als Staatsräson
Chinas autoritäre Demokratie
King of China: Ämterhäufung und Personenkult
Konzentrierte Führung: Politbüro und absolute Macht
Xis großer Plan
10: Die neuen Seidenstraßen
Ein geopolitisches Grand Design
Alte und neue Seidenstraßen
Afrika als Versuchsgelände
Vordringen in der asiatischen Nachbarschaft
«Unentbehrlicher Partner»: Lateinamerika
Singen im Chor der Seidenstraße
Seidenstraße – Seitenhieb für den Westen?
Container statt Containment
«Gürtel und Straße»: Hält der Gürtel?
Europa und die Seidenstraßen
11: China rüstet auf
Die alte Volksbefreiungsarmee: Tofu-Kocher und Balletteusen
Vom Erbfeind Vietnam geschlagen
Xi Jinpings Wehrstrukturreform
Kampf gegen Korruption im Militär
Weltmacht durch Seemacht
Abkehr von Maos Atomdoktrin: «300 Millionen Tote – na und?»
China als größter Truppensteller der UNO
Ein Staatspräsident im Flecktarn
Militärtechnisch aufholen, geographisch ausholen
12: Auftrumpfen im Südchinesischen Meer
Superhighway der Meere
Künstliche Inseln werden Meeresfestungen
Keine Einigung mit ASEAN
Streit mit den Philippinen
Ein Balanceakt auf schmalem Grat
Vierter Teil: GEFÄHRLICHE SPANNUNGSFELDER
13: China und Japan: Ewige Erbfeindschaft?
Hundertfünfzig Jahre Krieg, Krise, Konfrontation
Streit um fünf öde Inseln
Trostlose Aussichten für dauerhaften Frieden?
14: Im asiatischen Spannungsfeld: China und Indien
China dringt in indische Einflusssphären vor
Grenzstreitigkeiten im Himalaya
Die Furcht vor Einkreisung
Scharmützel auf 4000 Meter Höhe
Hürden gegen «Gürtel und Straße»
Zusammenarbeiten oder zusammenstoßen?
15: Eine prekäre Entente: China und Russland
Einhundertfünfzig Jahre geopolitische Achterbahnfahrt
Mao und Stalin: ungleiche kommunistische Brüder
Eiszeit zwischen Moskau und Peking
Mehr Schwierigkeiten als Möglichkeiten?
Die Seidenstraße auf Eis
Russlands Exportschlager: Rohstoffe und Rüstungsgüter
Angst vor chinesischer Überfremdung
Das russisch-chinesische «Great Game» in Zentralasien
16: In der Thukydides-Falle: Krieg zwischen den USA und China?
Die neue Weltmacht und die alte Ordnung
Was ist dran an diesen Hiobsbotschaften?
17: Die Taiwan-Frage: Zeitlupenkrise oder Zeitbombe?
Vorposten des Westens: Die Insel Quemoy
Kompromisse, Kontakte und rote Linien
Aufruhr in Hongkong
Trumps neue Taiwan-Politik
Wachsende Unsicherheiten
18: Donald Trump: Wider die neue «Gelbe Gefahr»
Ein neues Modell der Großmachtbeziehungen
Scharfmacher und Beschwichtiger auf beiden Seiten
USA und China: Ineinander verhakelte Titanen
Trump: «China ist nicht unser Freund»
Feuer und Zorn oder Frieden in Korea?
Vom Zollstreit in den Handelskrieg?
Ein verheerender Handelskonflikt
Weiter im Angriffsmodus
Behält Thukydides recht?
19: Die deutsch-chinesischen Beziehungen
Bewunderung, Angst und gute Geschäfte
Tsingtau-Bier und die Hunnenrede Wilhelms II.
Helmut Schmidt und China
Partnerschaft, Konkurrenz, Rivalität
20: China und der Westen: Keine Illusionen, keine Obsessionen
Keine Illusionen
Keine Obsessionen
Für eine realistische China-Politik
Werte und Interessen
Eindämmen oder Zurückdrängen?
Influencing, die neue Angriffsart
Gesteigerter Unmut in Australien
Einbinden durch Einhegen
Verschiedene Träume im gleichen Bett
Partner, Konkurrent, Rivale, Kontrahent?
Dank
Literatur
Bildnachweis
Register
Meinen Enkelkindern Jan, Jonathan, Freddie, Greta, Rupert und Konstantin, die das chinesische Jahrhundert erleben werden
Vorwort
Dies ist nicht das Buch eines Sinologen. Es ist das Werk eines Journalisten, der seit fast sieben Jahrzehnten die Weltpolitik begleitet, sie an ihren Brennpunkten erlebt und in Aberhunderten von Analysen, Leitartikeln und Vorträgen kommentiert hat. Asien war eines der großen Themen meines Lebens. Den Zugang dazu habe ich mir buchstäblich mit der Brechstange eröffnet: Als ich 1951 einen Sommer-Job in der Bibliothek der University of Chicago fand, musste ich mit diesem Werkzeug riesige Holzkisten öffnen. Sie enthielten die Akten des Tokioter Kriegsverbrecherprozesses, des Gegenstücks zu den Nürnberger Prozessen. Ich las mich fest in den Dokumenten über die deutsch-japanischen Beziehungen während des Dritten Reiches. Zunächst wurde daraus der Entwurf einer Magister-These, dann in Tübingen meine Doktorarbeit: «Deutschland und Japan zwischen den Mächten, 1935–1940». Sie wurde ins Japanische übersetzt und brachte mir 1962 eine erste Einladung ins Reich des Tenno. In den folgenden Jahren flog ich öfter nach Japan, erschloss mir aber nach und nach auch die Nachbarn Korea, Taiwan und Hongkong. Mehrfach berichtete ich für die ZEIT von der Dschungelfront des Vietnamkrieges.
Der Blick auf China faszinierte mich schon damals. Im Tross von Helmut Schmidt kam ich dann bei dessen Staatsbesuch in der Volksrepublik 1975 zum ersten Mal nach Peking, Nanking und Urumtschi. In den nächsten vier Jahren – den Umbruchsjahren nach Maos Tod 1976 und vor dem Beginn der Öffnungs- und Reformpolitik Deng Xiaopings Ende 1978 – war ich regelmäßig dort. Anfang 1979 veröffentlichte ich mein Buch Die chinesische Karte. Noch war China Steinzeit, aber es zeichnete sich bereits ab, dass es sich mit aller Macht in die Moderne und zu neuer weltpolitischer Größe katapultieren würde.
Seitdem war ich immer wieder in der Volksrepublik, meist in politisch-journalistischen Angelegenheiten, das letzte Mal jedoch als touristischer Mitfahrer auf einer Teilstrecke der von der ZEIT und China Tours organisierten Busreise Schanghai–Hamburg. Zugleich jedoch hatte ich China immer aus der Warte seiner Nachbarn im Blick: als Mitglied des Deutsch-Japanischen Forums (seit seiner Gründung 1993), Vorsitzender der Deutsch-Indischen Beratungsgruppe (1996–2007), Mitgründer, Vorsitzender (2002–2007) und bis heute Mitglied des Deutsch-Koreanischen Forums; als Vorsitzender der Gesellschaft für Asienkunde (2003–2007) übrigens auch aus wissenschaftlicher Sicht.
Der Wiederaufstieg des Reichs der Mitte verändert nicht nur das globale Mächtemuster, er hat auch tiefen Einfluss auf das Alltagsleben der Menschen in allen Erdteilen. In diesem Buch erzähle ich die Geschichte des chinesischen Erwachens, schildere das phänomenale Wirtschaftswunder der zurückliegenden vierzig Jahre und beschreibe den unbändigen geopolitischen Ehrgeiz der Pekinger Führungselite. Der Höhenflug Chinas – ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung – stellt den Westen vor eine beispiellose Herausforderung. Noch ist sie nicht ganz in unser Bewusstsein gedrungen. Es ist höchste Zeit, sich darauf einzustellen, wenn wir uns im 21. Jahrhundert behaupten wollen.
Hamburg, im April 2020
Theo Sommer
Einleitung
Die Chinesen kommen? Sie sind schon da!
Die Menschheit erlebt derzeit den dramatischsten geopolitischen, geostrategischen und geoökonomischen Wandel seit einem halben Jahrtausend. Genau genommen ist es die dritte historische Machtverschiebung der neueren Geschichte. Die erste war der Aufstieg Europas, der sich um das Jahr 1500 anbahnte, als Kolumbus Amerika entdeckte und Vasco da Gama über den Seeweg den indischen Subkontinent erreichte. Die zweite Machtverschiebung setzte Ende des neunzehnten Jahrhunderts ein, als die Vereinigten Staaten auf die Weltbühne traten, die sie dann hundert Jahre lang beherrschten – politisch, ökonomisch und militärisch. Heute sind wir Zeugen der dritten historischen Wandlung: einer gewaltigen Verschiebung von Macht und Wohlstand vom Westen zu den aufstrebenden Ländern der übrigen Welt. The West and the Rest, in Niall Fergusons einprägsamer Formulierung, finden sich mit einem Mal in einem völlig neuen Verhältnis zueinander wieder.
Das neunzehnte Jahrhundert war das Jahrhundert Europas, das zwanzigste das American Century. Das einundzwanzigste Jahrhundert, so lauteten die meisten Vorhersagen um die Jahrtausendwende, werde das Jahrhundert Asiens, genauer: das chinesische Jahrhundert.
Immer wieder steht in den Schlagzeilen: «Die Chinesen kommen». Doch die Chinesen sind schon da. In den letzten vierzig Jahren haben sie einen in der ganzen Weltgeschichte beispiellosen Aufschwung genommen. Seit dem Beginn von Deng Xiaopings Wirtschaftsreformen und der Öffnung Chinas zur Welt Ende 1978 ist das Bruttoinlandsprodukt um das Siebzigfache gestiegen, das Pro-Kopf-Einkommen und der Export um das Fünfzigfache. Seit 2010 ist China die größte Handelsmacht und seit 2012 die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde. Im Laufe dieses Jahrzehnts wird es Amerika überholen und seinem Sozialprodukt nach wieder das sein, was es bis Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gewesen ist: die größte Nationalökonomie auf unserem Planeten.
Der Aufbruch hat China verändert: 700 bis 800 Millionen der 1,4 Milliarden Chinesen haben sich über die Armutslinie in den Mittelstand hochgearbeitet, alle, die noch in Armut leben, sollten bis 2020 daraus befreit werden. Die Grundbedürfnisse der Menschen sind erfüllt, für 2021 ist das Ziel ein «umfassender bescheidener Wohlstand» mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 12.000 Dollar. Bis 2035 will das Land sich ins Mittelfeld der starken Industrienationen vorarbeiten, bis 2049 an deren Spitze treten. Von der exportgetriebenen Entwicklung schwenkt China nun um auf einen gesteigerten Binnenkonsum und den Ausbau des «Internets der Dinge». Entschlossene Digitalisierung soll der Wirtschaft einen entscheidenden Schub nach vorn geben. Auf den Forschungsfeldern Künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Big Data prescht das Land machtvoll voran; bis 2030 will China das führende KI-Zentrum der Welt sein.
Im März 2015 veröffentlichte die Regierung ihren Masterplan «Made in China 2025». Es ist ein gigantisches Aufholprogramm, das die alten Industriestaaten bis Mitte des nächsten Jahrzehnts abhängen soll. Zehn Schlüsselindustrien sollen bis dahin an die Weltspitze gehievt werden: Informationstechnologie, Robotik, Luft- und Raumfahrt, Meerestechnik und Schiffbau, Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr, alternative Automobilantriebe, Energieerzeugung, neue Werkstoffe, Landwirtschaftsmaschinen, Biomedizin und medizinische Geräte. So soll 2025 der Anteil der chinesischen Hersteller an Hightech-Produkten auf dem einheimischen Markt 70 Prozent erreichen; auch sollen bis dahin die meisten wichtigen Werkstoffe im Lande produziert werden. Dabei greift der Staat den künftigen global champions mit Fördergeldern in Höhe von vielen hundert Milliarden Dollar unter die Arme. Allein ein Forschungsfonds für Halbleiter erhält über 100 Milliarden Dollar. Der Sektor Künstliche Intelligenz (KI) soll bis 2030 zu einer 150-Milliarden-Industrie hochgepäppelt werden, die weltweit führend ist und auch die Standards für die anderen setzt. «China führte einst die Welt an, und es wird dies bald wieder tun,» prophezeit Tang Xiao’ou, der Gründer des Pekinger KI-Pioniers Sensetime. Darauf ist auch der Ehrgeiz des Staatspräsidenten Xi Jinping gerichtet.
Im April 2018 stand Xi in Yichang auf dem Drei-Schluchten-Damm und erklärte den versammelten Arbeitern im Blaumann, China werde seinen eigenen Weg zur technologischen Supermacht gehen. Das Weiße Haus fest im Blick, sagte er: «In der Vergangenheit haben wir den Gürtel enger geschnallt, die Zähne zusammengebissen, Atombomben, Wasserstoffbomben und Satelliten gebaut. Auch beim nächsten Schritt in die Zukunftstechnologie müssen wir alle Illusionen fahren lassen und uns ganz auf uns selbst verlassen.»
Machen wir uns nichts vor: «Made in China 2025» ist auch eine Kampfansage an die westlichen Industrienationen, die Bundesrepublik eingeschlossen. Zwar darf man wohl bezweifeln, dass die Chinesen ihr Ziel bis 2025 erreichen; es wird mit Sicherheit länger dauern. Das räumt sogar Ministerpräsident Li Keqiang ein. Den deutschen Sorgen, dass chinesische Firmen, wenn sie sich erst einmal die fortgeschrittene Technologie angeeignet hätten, über Nacht zu Konkurrenten würden, hielt er beschwichtigend entgegen, die chinesische Fertigung müsse «bis zum Einstieg in die Middle- und High-End-Produktion noch einen recht langen Weg gehen, und zwischen beiden Ländern wird die Komplementarität in Industrie und Technik noch lange Bestand haben». Aber schaffen werden es die Chinesen am Ende. Und dann?
Torsten Benner vom Berliner Global Public Policy Institute mag übertrieben haben mit seiner Aussage: «Wenn ‹Made in China 2025› gelingt, können wir zusammenpacken und nach Hause gehen.» Das Gleiche gilt für die Aussage von Peter Navarro, dem Handelsdirektor im Weißen Haus: «China hat Amerikas Zukunftsindustrien aufs Korn genommen, und Präsident Donald Trump versteht besser als sonst einer, dass Amerika keine wirtschaftliche Zukunft haben wird, wenn China die neu aufsteigenden Industrien erobert.» Doch dürfen wir die Herausforderung auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. China ist nicht länger nur ein riesiger Absatzmarkt für uns und ein Produktionsstandort mit unerschöpflichen Kapazitäten, es ist ein mächtiger, potentiell erdrückender Konkurrent geworden.
Auch weltpolitisch strebt China an die Spitze. Die Pekinger Führung will die Größe und Würde der chinesischen Zivilisation wiederherstellen und die Demütigung überwinden, die es nach seiner gewaltsamen Öffnung durch den Westen im Opiumkrieg von 1839–1842 rund hundert Jahre lang hat erfahren müssen. Die fremden Mächte zerstückelten das Reich der Mitte in protektoratsähnliche Einflusszonen und überzogen es – erst die Europäer, dann die Japaner – mehrfach mit Krieg. Sie annektierten riesige Gebiete und entrissen der Staatsverwaltung zentrale Bereiche. Bis 1930 übten sie die Zollhoheit aus; das Seezollamt und das Salzinspektorat standen noch länger unter ausländischer Kontrolle. Erst im Zweiten Weltkrieg wurden die juristische Exterritorialität und andere Sonderprivilegien der Westmächte abgeschafft, und noch lange danach wehte die sowjetische Flagge über Port Arthur. Seine Souveränität hat China erst nach dem Sieg der Kommunisten zurückerlangt. Damit war die schmähliche Epoche vorbei, in der jeder nach Lust und Laune durch die «offene Tür» nach China hineinspazieren konnte. In den Schulen werden den Kindern bis heute die vier Zeichen wuwang guochi eingebläut – «Nie die nationale Erniedrigung vergessen!».
Der britische Autor Tom Miller schrieb 2016 das Buch China’s Asian Dream. Die Chinesen träumten davon, war seine These, ihren historischen Status als Asiens Vormacht wiederherzustellen. Doch seitdem ist klar geworden, dass der Traum von neuer Größe weit über die Grenzen der alten Tribut- und Vasallenstaaten hinausreicht. Staatspräsident Xi Jinping macht überhaupt kein Geheimnis daraus. «Die chinesische Nation erhebt sich mit neuem Selbstbewusstsein im Osten der Weltkugel», verkündete er auf dem 19. Parteitag der chinesischen Kommunisten. Und er wirft nun das ganze wirtschaftliche Gewicht seines Landes in die Waagschalen der Weltpolitik. Sein Führungswille verändert das globale Mächtemuster, er hat Großes vor mit der Volksrepublik. Nicht länger sieht er sie als Regionalmacht, vielmehr will er sie ins «Zentrum der Weltbühne» rücken. Zur mächtigsten Militärmacht will er sie machen, zur größten und führenden Wissenschaftsmacht, zur Innovationsgroßmacht, zur Infrastruktur-Supermacht, zum Anführer im Kampf gegen den Klimawandel, zur Weltkulturmacht und zur Weltfußballmacht. Eine «Schicksalsgemeinschaft der Menschheit» will er aufbauen, der er «weise chinesische Ideen für Problemlösungen» anbietet und eine «Harmonie der Vielfalt», was nichts anderes heißt als die kompromisslose Anerkennung aller chinesischen Positionen.
Das alles war so dick aufgetragen, dass es überall im Westen Argwohn und Kritik erregte. Dies veranlasste die Partei Mitte 2018, die Medien anzuweisen, Chinas Ziele und Errungenschaften nicht mehr so überschwänglich anzupreisen. Arroganz mache ein Land nicht mächtig, hieß es nun. Deswegen solle nicht mehr behauptet werden, die Volksrepublik rücke «ins Zentrum der Welt» und sei «in vielen Bereichen die unangefochtene Nummer eins». Auch soll der Masterplan «Made in China 2025», der die alten Industriestaaten zu einschneidenden wirtschaftspolitischen Gegenmaßnahmen bewog, nicht mehr erwähnt werden. Es handle sich dabei nur um das Papier einiger Wissenschaftler, die damit «die Führung, die Öffentlichkeit und sogar sich selbst getäuscht haben». Doch soll Staatspräsident und Parteichef Xi Jinping, der den ganzen Rummel schließlich selbst losgetreten hatte, wirklich von ein paar Ökonomen hereingelegt worden sein? Einleuchtender ist da schon die Erklärung, dass er es angesichts der westlichen Gesetzesinitiativen gegen seinen Technologie-Feldzug angebracht fand, eine verbalkosmetische Korrektur vorzunehmen – ohne freilich im Geringsten von seiner auf Weltgeltung und Innovationsführerschaft angelegten Politik abzugehen.
Ebenso wenig wird Xi von dem neuen Modell der «Großmachtbeziehungen» lassen, das er seit seinem Amtsantritt propagiert. Es verlangt Respekt vor Chinas «Kerninteressen». Dazu gehören Taiwan, Tibet und Xinjiang, die Inbesitznahme der Inselwelt des Südchinesischen Meeres und der aggressiv verfochtene Anspruch auf die von Japan verwalteten Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer, darüber hinaus aber auch Chinas «eigener Entwicklungsweg». «Harmonie» und «Respekt» versteht Xi als Hinnahme, ja: Billigung seines weltpolitischen Konzepts, seiner Ziele, seiner Methoden. Dass auch andere Staaten Kerninteressen haben, die zu respektieren sind, blendet er gern aus.
Unter den Staatslenkern unserer Gegenwart ist Xi Jinping der einzige, der ein weltpolitisches grand design hat und diesen Entwurf mit einer grand strategy zielstrebig zu verwirklichen sucht – nach einer Pentagon-Analyse der «ehrgeizigsten Strategie, der sich ein Staat in neuerer Zeit verschrieben hat». Sein Entwurf wird bewusst oder unbewusst von zwei Theorien unterfüttert, die vor China noch keine andere Nation gleichzeitig zur Grundlage ihrer auswärtigen Politik gemacht hat: den Gedanken des amerikanischen Seestrategen Mahan und des britischen «Herzland»-Theoretikers Mackinder. In seinem 1890 erschienenen Buch The Influence of Sea Power on History hatte der US-Admiral Alfred Thayer Mahan, der «Clausewitz der Meere», die Seemacht zur bedeutendsten geopolitischen Gestaltungskraft erklärt. Hundertzwanzig Jahre danach ließ die chinesische Staatsführung Mahans Ideen wiederaufleben: Wer die Meere beherrscht, der beherrscht die Welt. Zudem griff sie die Heartland-Theorie des Geographen Halford J. Mackinder auf, die der Urheber des Begriffs «Geopolitik» 1904 in seinem Aufsatz «The Geographical Pivot of History» umrissen hatte: «Wer über das östliche Europa herrscht, beherrscht das Herzland» – die Weiten Zentralasiens; «wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel»– Zentralasien plus Afrika. Auf die Beherrschung der Meere und des Herzlandes zielt Xi Jinpings Seidenstraßen-Initiative.
Der geopolitische Entwurf des chinesischen Präsidenten kommt unter dem harmlosen Banner «Belt and Road Initiative (BRI)» daher, «Gürtel und Straße» in Pekings gedrechselter deutscher Übersetzung. Er knüpft an die alten Handelsrouten an, die das Reich der Mitte einst mit dem Westen verbanden, Marco Polos Seidenstraße im Norden und die maritimen Expeditionsrouten des Admirals Zheng He im Süden. Ursprünglich sollten «Gürtel und Straße» nur das pulsierende Wirtschaftszentrum Ostasiens mit dem Wirtschaftszentrum Westeuropa und der Küstenregion Ostafrikas verbinden. Inzwischen hat Xi praktisch die ganze Welt in den Blick genommen. «Alle Länder, ob in Asien, Europa, Afrika oder den Amerikas, können Zusammenarbeitspartner der Gürtel-und-Straße-Initiative sein», heißt es nun. Neuerdings ist sogar der Plan für eine «Polare Seidenstraße» in der Arktis umrissen worden.
So haben die Chinesen rund 150 Länder und Organisationen dazu aufgerufen, sich am Ausbau der neuen Seidenstraßen zu florierenden Wirtschaftskorridoren zu beteiligen. Mit über achtzig Staaten wurden bereits Kooperationsverträge abgeschlossen. «Konnektivität», Vernetzung, ist die Parole, Ausbau der Infrastruktur das Ziel: Eisenbahnen und Straßen, Pipelines, Kraftwerke, Staudämme und Glasfasernetze sollen zur Grundlage für einen beispiellosen Wirtschaftsaufschwung in sechs Korridoren werden, die nach Südostasien und Südasien, nach Eurasien und dem Mittleren Osten, Europa, Afrika und Lateinamerika führen. Insgesamt steht für 900 Seidenstraßen-Vorhaben die gewaltige Summe von rund 1000 Milliarden Dollar bereit. Zum Vergleich: Für den Marshall-Plan genehmigte der US-Kongress 1948 bis 1952 alles in allem 13 Milliarden Dollar, nach heutigem Wert etwa 131 Milliarden. Allerdings gab es in Europa nur sechs Empfängerländer der Marshall-Gelder, China hingegen will über 120 Staaten mit seiner Billion bedenken.
Die Chinesen arbeiten sich dabei Schritt für Schritt vor, Region für Region, Sektor für Sektor – nach dem alten chinesischen Grundsatz «Mit den Füßen nach den Steinen tastend den Fluss überqueren» – anders als Mao, der stets zum Großen Sprung ansetzte und dabei jedes Mal ins Wasser fiel. Und sie denken in langen Zeiträumen. «Zweimal hundert Jahre» ist Xi Jinpings Schlachtruf. Bis zum hundertsten Gründungstag der Kommunistischen Partei im Juli 2021 soll «bescheidener Wohlstand für alle» erreicht sein, ehe dann die sozialistische Modernisierung bis 2035 «im Wesentlichen vollendet» wird. Zum hundertsten Gründungstag der Volksrepublik China am 1. Oktober 2049 soll das Reich der Mitte dann «reich, mächtig, demokratisch, kultiviert, harmonisch und schön» dastehen.
Zweifelsohne sind die Chinesen ausdauernd. Nicht von ungefähr zitierte Xi in einem Toast auf Trump die alte chinesische Weisheit: «Keine Entfernung, auch nicht ferne Berge und weite Ozeane, können Leute mit Beharrlichkeit daran hindern, ihr Ziel zu erreichen.» Einen dazu passenden Spruch Benjamin Franklins brachte er ebenfalls noch an: «Wer Geduld hat, kann kriegen, was er will.» Langmut rühmt er auch in dem Band Xi Jinping erzählt Geschichten als nachahmenswerte Tugend. In einer der 109 Erzählungen geht es um einen alten Mann und einen Berg, der ihm die Aussicht versperrt. Also beginnt er, den Berg mit Schaufel und Eimer abzutragen. Als ihn die Nachbarn verlachen, denn so werde er es nie schaffen, erwidert er, dann würden es eben seine Kinder und Kindeskinder und deren Nachkommen vollbringen. Die Geduld und die Ausdauer des Alten rühren den Allmächtigen so sehr, dass er den Berg versetzt.
Noch gehen bei uns die Meinungen auseinander, wie dem Aufstieg der Volksrepublik zu begegnen sei. Die Einkaufstour der Chinesen, bei der sie sich die Rosinen aus dem westlichen Industriekuchen herauszupicken suchen, wurde lange sehr unterschiedlich beurteilt. Viele Unternehmen sahen chinesische Investitionen als belebende oder gar rettende Finanzquelle. Sie blickten in erster Linie auf China als einen riesigen Absatzmarkt für die eigenen Erzeugnisse, was alle anderen Erwägungen erstickte. Doch immer öfter blitzt nun eine beunruhigende Schrift an der Wand auf: Macht euch nichts vor, ihr seid willkommene Steigbügelhalter, bis China im Sattel sitzt, dann aber werdet ihr an die Wand gedrängt. Überall im Westen wächst die Entschlossenheit, dem chinesischen Eindringen Schranken zu setzen.
Auch Pekings Seidenstraßenprojekt ist nicht so harmlos, wie es aussieht. Mit seinen Zuschüssen, Krediten und kompletten Finanzierungspaketen schafft sich China Einflusssphären rings um den Globus. Es ist überall willkommen, wo das Geld knapp ist und wo politische, besonders menschenrechtliche Auflagen der Geldgeber unwillkommen sind. Den armen Ländern erscheint es wie der reiche Onkel, der keine Fragen stellt. Während der Westen Strukturreformen verlangt, die Beachtung der Menschenrechte einfordert und Freihandelsabkommen als wirksamstes Instrument bevorzugt, setzt China auf den Bau von Infrastruktur. Seine enormen Kapitalreserven, sein Ingenieurs-Knowhow, seine Produktions- und Baukapazität geben der Globalisierung ein chinesisches Gesicht. Dies gestattet Xi Jinping, sich zum Herold des Multilateralismus aufzuwerfen. Dabei ist er kein Multilateralist, sondern ein Mann des Multi-Bilateralismus: Er verhandelt lieber direkt mit kleineren Staaten, die er unter Druck setzen kann, als mit Staatengemeinschaften, die ihm etwas entgegensetzen können.
Weltweit kaufen oder finanzieren und bauen die Chinesen Häfen, Eisenbahnen und Stromnetze. Ihre Hafenstrategie verschafft ihnen mehr und mehr bestimmenden Einfluss auf die Seefrachtrouten rund um den Globus. Eisenbahnen bauen sie in Südostasien, Russland, in der Türkei und im Iran, auf dem Balkan, in Afrika und Lateinamerika. Ferner suchen sie überall Beteiligungen an Stromnetzen. Allein in Europa steckten sie seit 2008 nach der Berechnung von Le Monde 34,5 Milliarden in den Energiesektor. In Portugal gaben sie knapp 10 Milliarden Euro für Anteile am den elektrischen Netzen des Landes aus, in Italien 2,1 Milliarden; bei Eandis in Belgien und 50Hertz in Deutschland kamen sie jedoch nicht zum Zug. In Dänemark investierten sie in die Windkraft, und am britischen Atomkraftwerk Hinkley Point, das von Energie de France (EDF) erbaut wird, übernahmen sie für 7 Milliarden Euro 33,5 Prozent der Anteile. Nicht zuletzt sind sie dabei, eine die eurasische Landmasse umspannende «digitale Seidenstraße» zu bauen.
Zugleich reklamiert China mit seinem Infrastruktur-Kreuzzug Einflusszonen für sich, in denen es nicht nur um Seide und Gewürze oder Fernstraßen, Bahnlinien und Stromnetze geht, sondern um dominierende Gestaltungsmacht. Immer kräftiger rütteln die Chinesen an dem nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen internationalen System. Es geht ihnen um eine neue Weltordnung (siehe Kapitel 10 «Die neuen Seidenstraßen»). Und wo der Westen in Pessimismus versinkt, strotzen sie vor Optimismus. Bei einer Umfrage 2017 sagten 87 Prozent, ihr Land bewege sich in die richtige Richtung (in 27 anderen Ländern lag der Durchschnitt bei 40 Prozent, wobei die Westeuropäer besonders pessimistisch waren).
Von Amerika bis Australien werden Chinas Aufstieg, seine Außenpolitik und seine unaufhörliche Aufrüstung vielfach als potentielle oder gar aktuelle Bedrohung wahrgenommen. Dies gilt zumal für Pekings imperial-expansionistische Strategie in der von mehreren pazifischen Nationen beanspruchten Inselwelt des Südchinesischen Meers und im Ostchinesischen Meer. Auf beiden Konfliktfeldern beschwört das chinesische Vorgehen zudem eine Konfrontation mit den Vereinigten Staaten herauf, bei der es, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, zu bewaffneten Zusammenstößen kommen könnte. In Peking wie in Washington gibt es einerseits Hardliner und andererseits Ausgleichsbefürworter; die Ersteren halten einen regelrechten Krieg zwischen China und den Vereinigten Staaten für unausweichlich, die Letzteren warnen beschwörend vor ihm. Als Deng Xiaoping 1997 starb, flammte in Peking noch einmal die Debatte über seine fundamentale Richtungsentscheidung für Öffnung und Modernisierung auf. Ich habe dies damals bei eine Recherchereise hautnah mitbekommen. Noch waren die Traditionsstränge Antiimperialismus und Antimodernismus ziemlich stark. Von einem China, das Nein sagen kann, und vom Widerstandsvermögen der Jugend gegen die dekadenten Ideen des Westens war die Rede. In einem Buch hieb der General Mi Zhangyu in diese Kerbe: «Im Umgang mit den Vereinigten Staaten müssen wir unsere Rachegelüste pflegen, unsere Fähigkeiten verbergen und uns in Geduld fassen.» Aber es gab auch andere Stimmen. So schrieb die Kantoner Zeitung «Wochenende des Südens», China solle nicht wieder in die törichte Vorstellung verfallen, es sei das Zentrum der Welt. Das Fachblatt «Industrie und Handel» prangerte den «falschen Patriotismus» an. China brauche keine «Kreuzzugsleidenschaft» und «keine krankhaften, selbstverliebten Wahnideen über seine Würde und sein Nationalbewusstsein». Ähnliche Gegensätze gibt es heute nicht mehr, jedenfalls nicht in aller Offenheit. Unter Xi Jinping haben die Hardliner das Sagen – wie auch in Donald Trumps Amerika. Kein Wunder, dass die Spannungen steigen (siehe das Kapitel «Donald Trump: Wider die neue Gelbe Gefahr»).
Viele Beobachter sehen bereits einen neuen Kalten Krieg heraufdämmern. Mit dem Ost-West-Konflikt zwischen Moskau und der freien Welt hätte er freilich wenig gemein. Die Sowjetunion war militärisch und politisch eine Großmacht, doch ökonomisch war sie für den Westen ohne Bedeutung; es tat ihm nicht weh, die UdSSR mit Embargos, Boykotten oder Sanktionen zu belegen. Ganz anders China, dessen Wirtschaft mit den Nationalökonomien der übrigen Welt so eng verflochten ist, dass schon ein Handelskrieg und erst recht ein Kalter Krieg viele im Westen in den Ruin stürzen würde. Auszuschließen ist beides nicht.
Was an Konfrontations-Zunder im Westen bleibt, sind die ideologischen Gegensätze. Die Erwartung, dass China mit wachsendem Wohlstand eine Demokratie werde, wie wir dies in Südkorea und auf Taiwan erlebt haben, hat sich als Illusion erwiesen. Ebenso wenig hat sich die Hoffnung auf Wandel durch Handel erfüllt. Vielmehr hat sich gezeigt, dass der Kapitalismus keineswegs unausweichlich zu einer freiheitlichen Ordnung nach westlichen Begriffen führt; er funktioniert auch ohne Demokratie. Und so schwer uns diese Einsicht auch fallen mag – der wachsende Wohlstand hat die Massen nicht in den Ruf nach Demokratie ausbrechen lassen.
Das Land wird heute von der Partei wieder so fest im Griff gehalten wie zu Zeiten Mao Zedongs. Die Mehrheit der Chinesen jedoch, das ist die durchgängige Erfahrung der in China lebenden und arbeitenden Ausländer, kümmert sich überhaupt nicht um die Partei, solange es weiter vorwärts und aufwärts geht (und soweit sie ihnen nicht als Karriere-Sprungbrett dient). Minxin Pei, Politikprofessor und China-Spezialist am Claremont McKenna College, bestätigt dies: «Die meisten Chinesen, selbst Parteimitglieder, glauben nicht wirklich an irgendeine offizielle Lehre. … Die Kommunistische Partei ist im täglichen Leben der gewöhnlichen Chinesen praktisch irrelevant geworden.» «Es gibt in der Volksrepublik keine mächtige Forderung nach Demokratie», befindet auch der französische Sinologe Jean-Pierre Cabestan. Die neue Mittelklasse sei «lepenisiert» und stelle ihr Bedürfnis nach Sicherheit über das Verlangen nach Freiheit. Wohl gebe es vielerlei örtliche Spannungen, doch habe die Partei die finanziellen Mittel und die Unterdrückungsinstrumente, um damit fertigzuwerden. Die neureiche Wirtschaftselite dringe nicht auf Wandel, sondern sei in die Partei eingetreten und finde dort Gehör und Unterstützung für ihre Anliegen. Die Bildungselite aber sei mehr damit beschäftigt, dem Sozialismus chinesischer Prägung eine intellektuelle Fundierung zu geben, als ihn infrage zu stellen; sie rede den Machthabern nach dem Mund.
Der Pekinger Verfassungsrechtler Xu Zhangrun, Xi Jinpings schärfster Kritiker, der im Juli 2018 mit seinem Essay «Derzeitige Befürchtungen und unsere Hoffnungen» Aufsehen erregte und die Führung in der Corona-Krise scharf kritisierte, sieht dies genauso. Als soziale Wesen genössen die Chinesen Freiheit, schreibt er, nicht jedoch als Bürger: «In der Privatsphäre können die Menschen sich begrenzter persönlicher Freiheiten erfreuen, zumal der normalen Vergnügen wie Essen, seinen täglichen Geschäften nachgehen, sich hinter geschlossenen Türen der Intimität hingeben. Sie können ihre Frisur und ihre Kleidung frei wählen, Massagesalons und öffentliche Bäder besuchen, sich mit Speisen vollstopfen und außereheliche Affären anfangen.» Xu zeigt sogar Verständnis dafür. «Man kann nicht einmal kritisieren», sagt er, «dass die Leute lieber normalen Alltagsvergnügungen frönen als gefährliche Forderungen nach Bürgerrechten zu erheben. Die Achtung der Privatsphäre erklärt zum großen Teil, dass sie sich mit dem gegenwärtigen politischen Arrangement abfinden.»
Dissidenten, denen unser Herz gehört – zwei Prozent oder fünf Prozent des Volkes? –, fallen gegenüber der passiven Mehrheit kaum ins Gewicht. Wohl auch, weil Xi Jinping kein blutrünstiger, ins Chaos verliebter und jegliche Ordnung immer wieder brutal auf den Kopf stellender Despot ist, kein chronischer Zerstörer, Vernichter und Verwüster wie einst Mao Zedong; er ist ein rationaler, kaltblütiger, auf Ruhe und Ordnung bedachter Herrscher. Sein China ist ein anderes als dasjenige Maos, aber auch ein anderes als das China Deng Xiaopings.
In den fünf Jahren seiner ersten Amtszeit hat sich Xi Jinping von Dengs Prinzip der kollektiven Führung abgewandt und einen Personenkult wieder aufleben lassen, der – obwohl das Parteistatut jede Form von Personenkult ausdrücklich verbietet – an die Vergötterung Mao Zedongs erinnert, neben dessen Bildnis er neuerdings gern das seine zeigt. Die Trennung von Wirtschaft und Politik, die es eine Zeitlang in mehr als bloßen Ansätzen gab, hat er abgeschafft. Zielstrebig hat er alles wieder unter Kontrolle genommen: die Partei, die Armee, die Unternehmen, die Medien und das Internet, aber auch die aufblühenden Religionsgemeinschaften. Die Begrenzung der Amtszeit des Staatspräsidenten auf zweimal fünf Jahre hat er aufheben und das «Xi-Jinping-Denken» im Statut der Kommunistischen Partei verankern lassen. Darüber hinaus ist er dabei, die Gesellschaft einer digitalen Gesinnungs- und Tugenddiktatur zu unterwerfen, die Orwells 1984 weit in den Schatten stellt. Unter ihm macht sich China auf den Weg vom autoritären zum totalitären Staat. Zugleich ist das United Front Work Department («Einheitsfront») zu einem machtvollen, technisch und finanziell hervorragend ausgestatteten Propaganda-Instrument zur Beeinflussung des Auslands und der chinesischen Diaspora geworden. Seit 2012, als Xi Jinping Generalsekretär wurde, ist das Department um 40.000 Mitarbeiter verstärkt worden. Mit seiner weltweiten Wühlarbeit erinnert es an die Komintern unseligen Angedenkens.
Vor allem jedoch hat Xi sich von Deng Xiaopings außenpolitischem Grundsatz tao guang yang hui abgewandt: Haltet euch zurück, drängelt euch nicht vor, wartet die Zeit ab. Mit Dengs Kultur der Zurückhaltung hat er Schluss gemacht. Aus einer Status-quo-Macht ist eine auftrumpfende, eine ausgreifende Macht geworden. Auch Xi Jinping will den Frieden, ist er doch die Voraussetzung für Chinas weiteres Aufblühen. Aber er will einen Frieden, den er selbst gestaltet und beherrscht. Außenpolitik heißt für ihn, «Diplomatie als Großmacht» zu betreiben (wobei die Scheckbuchdiplomatie für die Devisengroßmacht China der stärkste Pfeil im Köcher ist). Und wo Deng stets darauf bestand, dass China für niemanden ein Modell sei, preist Xi heute sein System als Vorbild für andere an – als Gegenentwurf zu dem des Westens, der gekennzeichnet sei durch «zerrissene Gesellschaften, endlose Machtübergänge und soziales Chaos».
Friedlich soll sich der Wiederaufstieg des Landes vollziehen, aber seine Interessen wird es beinhart vertreten. China First oder Make China great again könnte die Devise sein, Frieden durch Stärke das Motto. Daher wird auch rasant aufgerüstet. Pekings Sicherheitspolitik scheint auf Chinas Vorherrschaft mindestens im asiatisch-pazifischen Raum hinauszulaufen, was durchaus unfriedliche Konsequenzen haben könnte. Auf jeden Fall wollen die Chinesen mit den Großmächten, zuvörderst mit den Vereinigten Staaten, «auf gleicher Stufe» verkehren (wie Leopold von Ranke zu sagen pflegte, ehe das schiefe Bild von der «Augenhöhe» in Mode kam). Weltmacht zu werden ist Xis Ziel, nicht unbedingt Weltherrschaft. Was er anstrebt, ist regionale Dominanz und globaler Einfluss.
Kulturell will China an die internationale Spitze vordringen. Dafür baut es zielstrebig seine soft power aus. Vor dem 19. Parteitag verkündete Xi hochgemut: «Die Soft Power des Landes im Kulturbereich und der Einfluss der chinesischen Kultur wurden beachtlich verstärkt.» Der Begriff wurde einst von dem Harvard-Politologen Joseph Nye geprägt; er beschreibt die Fähigkeit, politische Ziele ohne Anwendung von Zwang oder Gewalt zu erreichen («Nicht deine Rüstung zählt, sondern deine Story»). Im Zeughaus der soft power gibt es vielerlei Waffen: Handel, Investitionen und Entwicklungsförderung ebenso wie die Entsendung von Ärzten nach Afrika, Werbung für chinesische Heilkunde (etwa Chi-Meds Antikrebsmittel Savolitinib), für Akupunktur oder für Kalligraphie. Auch hat China mit 600.000 Studierenden aus über 200 Ländern inzwischen die drittgrößte Anzahl ausländischer Hochschulbesucher, zehnmal mehr als 2003; weit über hunderttausend erhalten Stipendien. Der Pianist Lang Lang begeistert wie seine Kollegen Haiou Zhang und Yuja Wang in allen fünf Kontinenten das Publikum. Chinesische Artisten fehlen in keinem großen Zirkus. Und in Hongkong hat Alibabas Jack Ma die hoch angesehene South China Morning Post auch zu dem Zweck gekauft, Chinas angeschlagenes Image in der Welt zu verbessern. Er hat viel Geld in die Modernisierung des Blattes und die Aufstockung des Redaktionspersonals gesteckt. Die Zeitung, die in der Volksrepublik legal nicht zu bekommen ist, ist nach wie vor lesenswert objektiv.
Auch mit ökonomischen Argumenten sucht China seine soft power rund um den Globus zur Geltung zu bringen. Beim Davoser Weltwirtschaftsforum Anfang 2017 warf sich Staatspräsident Xi Jinping zum Protagonisten des Freihandels auf und wetterte, ohne ihn beim Namen zu nennen, gegen Donald Trumps protektionistisches Programm: «Protektionismus zu verfolgen, ist wie sich in einer Dunkelkammer einzuschließen. Wind und Regen bleiben draußen, aber auch Licht und Luft. Keiner wird aus einem Handelskrieg als Gewinner hervorgehen.» China habe ursprünglich Vorbehalte gegenüber der Globalisierung gehabt und sei sich nicht sicher gewesen, ob es der Welthandelsorganisation WTO beitreten solle. Aber es habe den Mut aufgebracht, sich in den weiten Ozean des Weltmarktes zu stürzen, habe manches Mal Wasser geschluckt und sei in Wirbel oder kabbelige Wellen geraten, doch es habe dabei Schwimmen gelernt. «China wird seine Tür weit offen halten», beteuerte Xi in seiner charmepolitischen Offensive. «Und wir hoffen, dass auch die anderen Länder ihre Türe offen halten werden.» Im Kongressgebäude des Graubündner Skiparadieses wurde Xis Plädoyer für eine open door policy kräftig bejubelt, wobei den Wenigsten bewusst war, dass genau dies vor 120 Jahren der Kernbegriff der amerikanischen Chinapolitik war. Erste Schritte zu weiterer Öffnung folgten der vollmundigen Ankündigung Xis allerdings erst nach über einem Jahr, als Trumps Androhung eines Handelskrieges Peking zu zaghaftem Einlenken brachte.
Im Dienste der chinesischen soft power stehen selbst die niedlichen, wiewohl in der Wildnis nicht ungefährlichen Panda-Bären, von denen noch fast 2000 in den tropischen Bambus-Dschungeln Chinas leben. Peking verschenkt oder verleiht die seltenen Tiere, Letzteres oft auch gegen eine Gebühr von 1 Million Dollar im Jahr pro Pärchen und mit der Auflage, eventuellen Nachwuchs zu repatriieren. Für die einzelnen Panda-Übergaben behält sich Xi Jinping die letzte Entscheidung vor; sie sind jedes Mal ein politisches Statement. Die Zwillinge Meng Meng («Träumchen») und Jiao Qing («Schätzchen») entzücken seit 2017 die Besucher des Berliner Zoos; Anfang 2020 wurden sie Eltern zweier Junger.
Immer massiver setzt das Regime jedoch ohne Skrupel seine sharp power ein. Sie ist weniger als militärische hard power und mehr als soft power, kulturelle Anziehungskraft. In letzter Zeit hat sich dafür auch der Ausdruck «Influencing» eingebürgert. Nach den Lehranweisungen der Partei soll die Einheitsfront, in der auch die Konfuzius-Institute eine Rolle spielen, «freundlich und inklusiv alle Kräfte vereinen, die vereint werden können», doch zugleich rücksichtslos «eine eiserne Große Mauer» bauen gegen feindliche Kräfte im Ausland, die darauf aus seien, Chinas Territorium aufzusplittern oder seinen Aufstieg zu behindern. «Die Einheitsfront», heißt es in dem Manual, «ist eine große Zauberwaffe, mit der wir 10.000 Probleme loswerden können, um den Sieg zu erringen».
Seit China sich Ende der 1970er-Jahre zu öffnen begann, hat der Westen darauf gesetzt, dass es sich einfügen werde in die nach 1945 entstandene Weltordnung. Auch dies könnte sich noch als Illusion entpuppen. Die Volksrepublik wurde 1971 in die Vereinten Nationen aufgenommen, spielte dort indes lange nur eine eher unauffällige, rein reaktive Rolle. In den frühen Jahren ihrer Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat legte sie nur dreimal ein Veto ein, und es dauerte dreiundzwanzig Jahre, bis sie zum ersten Mal einen eigenen Antrag einbrachte. Mittlerweile greifen die Chinesen immer öfter zum Veto. Sie sind nach den USA und Japan zum drittgrößten Beitragszahler geworden und stellen seit einigen Jahren die meisten Friedenstruppen. Seit 1980 ist China Mitglied der Weltbank und des Weltwährungsfonds, der 2015 den Yuan als eine der fünf Reservewährungen anerkannte; 2001 trat es dem Atomwaffensperrvertrag bei und wurde Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO); seit 1999 ist das Land Mitglied der G-20.
Es profitierte enorm von diesen Mitgliedschaften; so wurde es zum größten Kreditnehmer der Weltbank (was Donald Trump weidlich ärgert). Beim Londoner G-20-Gipfel im Jahre 2009 beteiligte sich China zum ersten Mal an einem internationalen Finanzrettungspaket; es kaufte für 50 Milliarden Dollar IWF-Bonds. 2015 gründete es die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Über 80 Länder, auch westliche, beteiligen sich daran. Die Bank ist eine multilaterale Einrichtung, wiewohl China de facto gegen einzelne Projekte sein Veto einlegen kann. Freilich ist die Zweifelsfrage nie ganz erloschen, ob China damit die bestehenden Finanzinstitutionen ergänzen oder aber ihnen Konkurrenz machen wolle. Überdies könnte sich das Seidenstraßenprojekt durchaus zum Gerüst eines Parallel-Netzwerks zur Weltbank ausbauen lassen, wenn die Entfremdung zwischen Peking und dem Westen dramatische Dimensionen annähme.
Fünf Leitlinien bestimmen nach Jürgen Osterhammel, dem Konstanzer Globalhistoriker und Asienfachmann, die «chinesische Weltordnung 2.0». Erstens: China, das über ein Jahrtausend an der Spitze der internationalen Hierarchie stand, hat das Recht, aufs Neue seinen «natürlichen» Platz als gleichberechtigte Großmacht und wohlmeinender asiatischer Hegemon einzunehmen. Zweitens: Die territoriale Einheit des Staates steht nicht zur Disposition; seine Grenzen umschließen auch die spät erst ins Reich eingegliederten Gebiete Taiwan, Tibet und Xinjiang. Drittens: Es ordnet sich nicht folgsam in die bestehenden Macht- und Institutionsstrukturen ein, sondern will Normen und Regeln nun selbst mitgestalten. Viertens: Der Wohlstand, dessen Vermehrung und Sicherung die wichtigste Legitimationsquelle der Partei ist, wird durch Expansion über die eigenen Grenzen hinaus zum Leitwert der chinesischen Außenpolitik. Fünftens: China strebt wirtschaftlich und strategisch Parität mit den USA an.
Kevin Rudd, der frühere australische Premier, heute Präsident des Asia Society Policy Institute in New York und einer der führenden Sinologen der westlichen Welt, hat Osterhammels fünf Leitlinien zu einer Liste der zehn Prioritäten Xi Jinpings erweitert. Dessen oberste Priorität ist es danach, die Kommunistische Partei an der Macht zu halten; seinen autoritären Kapitalismus betrachtet er als Fundament des chinesischen Großmachtstatus, nicht irgendeine Art von Demokratie oder Halbdemokratie. Zweitens hält er die nationale Einheit für unabdingbar, da die Legitimität der Partei entscheidend auf ihrer Bewahrung ruht; daher das scharfe Durchgreifen in Tibet und Xinjiang und die Verhärtung im Verhältnis zu Taiwan. An dritter Stelle folgt das langfristige Wirtschaftswachstum, die Voraussetzung, dass das Pro-Kopf-Einkommen steigt und die Volksrepublik eine technologische Supermacht wird. Die vierte Priorität ist neuerdings die Umweltpolitik samt Bekämpfung des Klimawandels; das Volk verlangt, der Verseuchung von Luft, Wasser und Boden ein Ende zu setzen. Priorität Nummer 5 ist die Modernisierung der Armee und ihr Ausbau zu einer Weltklasse-Streitkraft, die «Kriege führen und gewinnen» kann. Das sechste Ziel ist die Herstellung ersprießlicher Beziehungen zu Chinas vierzehn Landnachbarn und den sechs Anrainern auf See – allerdings ohne die Bereitschaft, Abstriche zu machen an Pekings Territorialforderungen im Südchinesischen und Ostchinesischen Meer. Siebtens ist Xi bestrebt, die Amerikaner hinter die zweite Inselkette zurückzudrängen, die von Japan bis zu den östlichen Philippinen verläuft, und die Allianzen der USA mit Seoul, Tokio und Manila zu schwächen – auch, um für die notfalls gewaltsame Wiedereingliederung Taiwans ins Reich der Mitte freie Hand zu bekommen. Achtens: Um die Kontinentalgrenze der Volksrepublik zu sichern, will Xi Jinping die eurasische Landmasse in einen Markt für chinesische Güter, Dienstleistungen, Technologie und Infrastrukturinvestitionen verwandeln; sein Seidenstraßenprojekt soll dafür sorgen, dass Zentralasien und der Mittlere Osten, doch darüber hinaus auch die Europäer sich den chinesischen Interessen gewogen und förderlich erweisen. Ähnlich soll, neuntens, die Maritime Seidenstraße Asien, Afrika und Lateinamerika dem Einfluss Pekings öffnen. Zehntens schließlich will Xi das globale Mächtemuster von Grund auf umgestalten. Dabei verfolgt er eine zweigleisige Strategie: In den Institutionen der nach 1945 von den westlichen Siegermächten geschaffenen liberalen Weltordnung sucht er Chinas Einfluss, seine Personalpräsenz und sein finanzielles Gewicht zu erhöhen, gleichzeitig jedoch baut er parallel dazu neue internationale Einrichtungen wie die Shanghai Cooperation Organization (SCO), sein Seidenstraßen-System «Belt and Road» (BRI) oder die Asiatische Infrastruktur-Investitions-Bank (AIIB) auf – erste Ansätze zu einer sino-zentrischen Weltordnung.
Was das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten angeht, so bleibt abzuwarten, ob sich die Chinesen mit Parität begnügen werden. Die Art, wie sie selbst ihre Ambitionen formulieren, legt den Schluss nahe, dass sie die Vereinigten Staaten als Weltführungsmacht ablösen wollen. Das Silicon Valley auf dem Feld der digitalen Technologie abzuhängen, ist dabei ein Schlüsselelement ihrer Strategie. Deswegen investieren sie massiv in Forschung und Entwicklung und subventionieren ihre Hightech-Industrie mit Hunderten von Milliarden. Durch Wirtschaftsspionage und Cyber-Diebstahl verschaffen sie sich weitere ihrer Entwicklung förderliche Erkenntnisse. Auf diese Weise haben sie sich mit der Installation von knapp 50 Milliarden Gigawatt im Jahr schon an die Spitze der Solarindustrie gesetzt und ihre Internet-Giganten Baidu, Alibaba und Tencent – ursprünglich chinesische Kopien von Google, Amazon und Facebook – herangezüchtet. Dabei wurden immer wieder die WTO-Regeln verletzt, ohne dass dies negative Folgen für China gehabt hätte. Die beschleunigte Digitalisierung aller finanziellen Vorgänge und gesellschaftlichen Beziehungen verschafft dem Staat nun riesige Mengen personalisierter Daten und damit auch beispiellose Möglichkeiten, seine Bürger unter ständiger und lückenloser Kontrolle zu halten: Big Brother trifft Big Data. Dies perfektioniert und sichert die Herrschaft des Regimes. Sigmar Gabriel traf den Nagel auf den Kopf, als er sagte: «Die digitale Revolution erlaubt es autoritären Regimes, noch autoritärer zu werden.»
«So wie Amerika an Anwälte glaubt, glaubt China an Ingenieure», sagt Pedro Domingo, dessen Buch The Master Algorithm, ein Standardwerk über Künstliche Intelligenz, im Bücherregal hinter Xis Schreibtisch im Regal zu sehen war. «Einige von Chinas Führern sind Ingenieure. Für sie ist die Gestaltung einer Gesellschaft ein technisches Problem: Wir programmieren sie so, dass sie sich verhält, wie wir wollen.»
Ganz in diesem Sinne baut China einen Überwachungsstaat auf. Seit 2014 erprobt es ein «Sozialkreditsystem» oder «Bonitätssystem» – eine von Algorithmen gesteuerte Maschinerie, die das Verhalten aller Bürger, Unternehmen, Institutionen und Behörden überwacht, bewertet und, je nachdem, belohnt oder bestraft. In diesem «System der gesellschaftlichen Vertrauenswürdigkeit» erfasst der staatliche Datenkrake sämtliche Lebensbereiche. Als sich Bundeskanzlerin Merkel im Frühsommer 2018 über Chinas Digitalisierungs-Strategie informierte, entfuhr ihr beiläufig der Kommentar, George Orwells 1984-Fantasien seien gegen die chinesische Realität bloß «ein laues Lüftchen» (siehe S. 53 ff.). Das Kontrollmonstrum wird derzeit in 43 Gemeinden und Bezirken getestet. Der Staatsrat will es 2020 landesweit einführen.
Im Niemandsland südwestlich von Peking baut sich Xi Jinping ein 300 Milliarden Dollar teures städtebauliches Denkmal – die Großstadt des 21., ja des 22. Jahrhunderts: durchdigitalisiert, mit sauberen Industrien, Supermärkten, die per Gesichtserkennung Zugang gewähren, Parkplätzen für selbstfahrende Autos und mit öffentlicher Kontrolle durch zigtausend Kameras – ein Prototyp überwachter Urbanität. Der Aufbau des chinesischen Techno-Polizeistaates mithilfe digitaler Bilderfassung, verbesserter Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz ist nicht nur ein innerchinesischer Vorgang, er eröffnet auch eine neue Front geopolitischer Rivalität. Die Autokraten der Welt werden Chinas Orwell-Technologie begierig übernehmen, um ihre Bürger schärfer an die Kandare zu nehmen. Laut Freedom House haben mindestens 18 bereits chinesische Überwachungstechnologie importiert.
Im neunzehnten Jahrhundert standen die europäischen Mächte als Imperien-Bauer im Wettbewerb miteinander. Fast der ganze Weltatlas färbte sich in den verschiedenen Farben der Kolonialstaaten: rot für England, blau für Frankreich, grün für Portugal, ockerfarben für Belgien, braun für Deutschland. Sie eroberten, besetzten, unterdrückten riesige Landstriche. Dies verbietet sich heute. Die Chinesen haben jedoch eine zeitgemäße, dem Zeitalter der Globalisierung angemessene Form des Imperialismus gefunden: ökonomische Durchdringung. Es ist ein Mittelding zwischen hard power und soft power, nämlich smart power. Sie verlassen sich auf die Verlockung ihrer vollen Schatztruhen; deren Anziehungskraft enthebt sie der Notwendigkeit, Zwang auszuüben. Hinzu kommt, was in jüngster Zeit auch sharp power genannt wird: der Versuch, mit ausgefeilten Taktiken der Einflussnahme, subtilen Druckes und klandestiner Zersetzung Gewicht und Geltung zu gewinnen. Wie der Economist unnachahmlich britisch formulierte: Man erobert nicht mehr foreign countries, sondern foreign minds, fremde Geister statt fremde Länder.
Während der Westen sich immer verbissener nach innen wendet, bricht China mit dreitausend Jahren Geschichte und wendet sich entschieden nach außen. Wo Amerika unter Präsident Obama den pivot to Asia vollzog, eine geopolitische Achsendrehung in Richtung Osten, vollzieht China unter Xi Jinping einen Schwenk nach Westen. Dabei handelt er nach der Anweisung des Militärstrategen Sunzi aus dem fünften Jahrhundert: «Vermeide die Hauptmacht, dringe in die offenen Räume.» Es ist dieselbe Regel, die Yang Yuanqing, Chef des Computerherstellers Lenovo, seinem Unternehmen verordnet hat: White attack – «Wir greifen dort an, wo weiße Flecken sind».
Weder Amerika noch Europa weiß, wie es dem dynamischen Aufsteiger China begegnen soll. Donald Trump hat sich in Asien wie in Europa aus der amerikanischen Führungsrolle zurückgezogen und damit Leerräume geschaffen, in die China lustvoll hineinstößt. Eine seiner ersten Amtshandlungen als Präsident war es, die Transpazifische Partnerschaft (TPP) aufzukündigen, wodurch im Pazifik ein Vakuum entstand, das die übrigen elf Partner unter japanischer Führung nur mühsam ausfüllen konnten. Die Verwässerung seines transatlantischen Engagements und der Handelskrieg, den Trump auch gegen die europäischen Verbündeten vom Zaun brach, spielen China ebenfalls in die Hände. Die Europäische Union ist der chinesischen Herausforderung erst spät gewahr geworden. Sie hat bis heute keine einheitliche China-Politik. Vielmehr hat sie es zugelassen, dass Peking mit seinen Milliarden einen Keil in sie treibt. Mehrere EU-Mitglieder – allen voran Ungarn, Tschechien und Polen, aber auch Griechenland – haben nicht die Kraft aufgebracht, der dollarbewehrten autoritären Verlockung zu widerstehen. (siehe S. 139 ff. und S. 443 ff.)
In Wahrheit befinden wir uns nicht schon wieder in einem Kalten Krieg, wohl jedoch abermals in einem Wettbewerb der Systeme. Diesmal zählen nicht die Armeen und nicht die Atomarsenale, es zählt das Geld. Xi Jinping hat Handel und Investitionen zu Waffen gemacht. Seine Seidenstraßeninitiative schafft ihm eine Einflusssphäre vom Gelben Meer bis nach Europa und Afrika, während seine Hafenerwerbsstrategie die Handelsrouten weltweit unter chinesische Kontrolle zu bringen droht. Es ist höchste Zeit, dass die Brüsseler Gemeinschaft in aller Nüchternheit die wirtschaftlichen Chancen, die der Aufstieg Chinas bietet, abwägt gegen die allgemeinpolitischen und sicherheitspolitischen Risiken, die er heraufbeschwört. Wir dürfen die Augen nicht länger vor der chinesischen Herausforderung verschließen. Während sich Europa zerfasert, geplagt von dem Brexit-Trauma, EU-Skepsis und Nationalpopulismus, verfolgt Chinas roter Kaiser mit seiner konfuzianischen Einheitspartei einen auf Jahrzehnte angelegten Plan, der sich neu herausbildenden Weltordnung ein chinesisches Gepräge zu geben.
Was kümmert es uns, wenn in China ein Sack Reis umfällt, pflegten wir früher zu sagen. Was im Reich der Mitte geschah, war für uns ohne Belang. Diese Zeiten sind vorbei. Wenn dort die Schweinepest wütet, wird bei uns das Fleisch teurer. Wenn in der Provinzhauptstadt Wuhan das Corona-Virus ausbricht und eine Pandemie verursacht, gerät die gesamte Weltwirtschaft in die Krise. Fällt heute in China ein Sack Reis um, dann bebt die Erde.
Erster Teil
CHINA ERWACHT
1
Vier Jahrzehnte China im Visier
Zum ersten Mal war ich 1975 in China. Im Pressetross begleitete ich Helmut Schmidt beim allerersten Staatsbesuch eines deutschen Bundeskanzlers in der Volksrepublik. Es war noch ganz das alte China. Am Flughafen rollte die Maschine endlos aus, vorbei an Lehmziegelhäuschen, Kohlbeeten und Baumwollfeldern, aber daneben wurde schon an einem riesenhaften neuen Terminal gebaut, das 1979, zum dreißigsten Jahrestag der Volksrepublik China, eröffnet werden sollte. Bis dahin musste noch das alte, recht schäbige Empfangsgebäude herhalten. Im VIP-Saal, wo zur Begrüßung Tee gereicht wurde, prangten an der einen Stirnseite die beiden deutschen Rauschebärte Marx und Engels neben Lenin (in Zivil) und Stalin (in Marschallsuniform). Die gegenüberliegende Wand schmückten Gemälde Mao Zedongs und Hua Guofengs, beide gleich groß, gleich rosig und rundlich. Im Foyer staubte eine beflissene Seele das überlebensgroße Mao-Standbild ab.
Die Fahrt in die Stadt führte durch ein Spalier von Weiden und Akazien, vorbei an Äckern, Lehmhütten und Teichen. Rostige Laster, vollgepackt mit Gemüse oder mit Menschen, die so dicht aneinandergedrängt standen, dass auch in den Kurven niemand umfallen konnte, tuckerten mit sechzig Kilometern pro Stunde in Richtung Hauptstadt. Pferdekarren, Lastrikschas, Bauersfrauen mit wippenden Nachtkübeln an ihren Tragestangen zogen am Straßenrand dahin, ununterbrochen angehupt von den Truckern. Zur Stadt hin verdichteten sich die Schwärme von Radfahrern. Dann tauchte der markante Turm der sechshundert Jahre alten Sternwarte auf, deren Instrumentarium der flämische Jesuit Ferdinand Verbiest im siebzehnten Jahrhundert modernisiert hatte (nach dem Boxeraufstand waren Teile nach Berlin gebracht und erst 1921 nach Peking zurückgeschafft worden). Wir bogen ein in die Prachtstraße Chang’an («Ewiger Frieden»), hinter deren Nobelfassaden sich noch die engen Gängeviertel mit ihren hutongs hinzogen, ein gepflasterter, grau ummauerter Hof neben dem anderen. Doch war bereits abzusehen, dass die Stadtplaner sie nicht lange würden stehen lassen; schon wuchs um die Altstadt ein Ring von Hochhäusern empor, der ihren baldigen Abriss ankündigte.
Peking hatte zu jener Zeit noch keine 23 Millionen Einwohner, es war eine eher ländliche Siebenmillionenstadt. Das typische Bild: Fahrräder wie Heuschreckenschwärme, kaum Autoverkehr; frühmorgens wurde man vom Geklingel Zigtausender von Radlern aus dem Schlaf gerissen. Berge von Chinakohl türmten sich auf den Gehwegen; die Läden waren höchst spärlich bestückt. Die Menschen trugen alle die blaue oder graue Mao-Einheitskluft, die Offiziere Uniformen ohne Rangabzeichen, von den Gemeinen nur dadurch zu unterscheiden, dass sie vier Taschen am Rock hatten statt zwei. Die Leute auf der Straße wirkten angespannt, niedergedrückt, unfrei. Riesige Propagandaplakate mit Mao-Sprüchen prangten an den Straßen und Häuserwänden. In den Volkskommunen hieß es: «Lieber sozialistisches Unkraut als kapitalistisches Korn.»
Die Volksrepublik nach der Kulturrevolution
Damals lebte Mao Zedong noch. Die Kulturrevolution, die das Reich der Mitte fast ein Jahrzehnt lang erschüttert hatte und in der an die zwei Millionen Menschen dem Mob-Terror der Roten Garden zum Opfer fielen, verebbte langsam, doch die Viererbande um Maos Frau Jiang Qing hatte immer noch großen Einfluss. Jegliche Entspannungs- und Gleichgewichtspolitik bezeichnete sie als «Vogel-Strauß-Politik». Der «Große Steuermann» selbst versuchte Bundeskanzler Schmidt einzureden, die Sowjets würden China eines Tages mit einem Atomkrieg überziehen. Nach seiner Begegnung mit Mao gehörte ich zu einer kleinen Gruppe, der er abends in der Botschaft darüber berichtete.
Mao, zweiundachtzig Jahre alt, war schon höchst hinfällig. Apoplektischer Insult, altersbedingte Zerebralsklerose, möglicherweise Parkinson, diagnostizierte Schmidts Leibarzt, als er die Schilderung des Kanzlers vernahm. Das war keine üble Ferndiagnose; heute wissen wir, dass es Amyotrophische Lateralsklerose war, ALS. Mao zeigte alle Anzeichen dieser seltenen Krankheit: Sein Mund stand offen, die Kinnlade hing herunter; wenn er sich setzen oder erheben wollte, musste er sich helfen lassen. Viel Stimme hatte er nicht mehr, nur mühevoll krächzend konnte er sprechen. Dies zwang ihn zu gedanklicher und sprachlicher Ökonomie. Drei Frauen, die zugegen waren, seine Nichte, die stellvertretende Außenministerin und seine Dolmetscherin, lasen ihm die Worte von den Lippen ab und vergewisserten sich dann bei ihm, ob sie ihn richtig verstanden hätten. Bestanden Unklarheiten, schrieb Mao mit weichem Bleistift auf einen Zettel, was er gemeint hatte. Ein Hustenanfall setzte der Unterhaltung nach hundert Minuten ein Ende. Im kleinen Kreis erzählte Helmut Schmidt hinterher, Maos Gabe, die Dinge auf die großen Linien zu reduzieren, habe ihn an de Gaulle erinnert. Ein paar Wochen später, im persönlichen Gespräch, fiel sein Urteil schärfer aus: «Mao war klug, aber Vernunft war seine Stärke nicht.»
Eine halbe Stunde lang hatten sie sich im philosophischen Disput über Kant, Haeckel und Clausewitz unterhalten. Zuweilen scherzte Mao. «Man hört nicht auf mich», klagte er. Schmidt zitierte zum Trost das deutsche Sprichwort «Steter Tropfen höhlt den Stein». Darauf Mao, leicht anzüglich: «Ich habe selbst nicht mehr genug Wasser. Aber vielleicht kann ja der Kanzler seines dazugeben …». Dann ging es um Weltpolitik. Die Amerikaner verzettelten ihre Kräfte, indem sie versuchten, an zu vielen Stellen auf einmal anwesend zu sein, dozierte Mao: «Das ist so, als ob man mit zehn Fingern zehn Flöhe fangen will.» Die Russen jedoch? Sie seien keine Leninisten mehr. Sie besäßen zu viele Atombomben, das korrumpiere. Eines Tages werde die Versuchung übermächtig, sie auch einzusetzen. An China würden sich die Sowjets jedoch die Zähne ausbeißen. «Hören Sie auf mich», insistierte Mao: «Es wird Krieg mit der Sowjetunion geben. Ihre Abschreckungsstrategie ist nur hypothetisch … Idealismus ist nichts Gutes.» Vergeblich widersprach ihm der Kanzler.
Der Vizepremier Deng Xiaoping, während der Kulturrevolution aufs Land verbannt und eben erst aus dem Schweinekoben freigelassen, spitzte diese Analyse im Blick auf Deutschland noch zu. Zu seinem Gespräch mit ihm nahm mich Schmidt, dem ich fünf Jahre zuvor den Planungsstab im Verteidigungsministerium aufgebaut hatte, in seiner Delegation mit. Ich notierte mir: «Es muss eines Tages in Europa zum Krieg kommen.» Schmidt entgegnete, niemand brauche die Europäer über die Gefährlichkeit der Sowjets zu belehren, sie hätten schließlich Deutschland geteilt. Die Verteidigungsfähigkeit und der Verteidigungswille der NATO seien intakt. Er glaube nicht, dass die Kremlführer einen Krieg vom Zaun brechen wollten, es müssten denn Verrückte sein. Im Übrigen wisse er, dass die Sowjets ihrerseits Angst vor einem chinesischen Angriff hätten. Mao und Deng blieben freilich bei ihrer Ansicht. Es galt die Devise: «Tiefe Tunnel graben, überall Getreidevorräte anlegen, niemals nach Hegemonie trachten.»
Ich machte – wie Max Frisch – damals die ganze Wirbelwindtour des Bundeskanzlers mit, die uns auch nach Nanjing und Urumqi führte. Zum ersten Mal der Kaiserpalast, die Verbotene Stadt, die Große Mauer – Denkmäler der alten Zeit. Dann in Loki Schmidts Damenprogramm die Musterkommune Roter Stern, wo der Weizen des höheren Ertrags wegen von Hand gesetzt wurde, nicht gesät, und wo die Mastenten, eingeklemmt zwischen die Beine einer stämmigen Bauernmagd, für die zu Recht berühmte Peking Duck maschinell genudelt wurden: 400 Gramm Kraftfutter bekamen sie binnen drei Sekunden durch einen Schlauch in den Schlund geschossen – Ausweis dafür, dass angeblich niemand mehr zu hungern brauchte, jedenfalls die Funktionäre nicht. Nicht zu umgehen war die Besichtigung der fast sieben Kilometer langen, erst 1968 fertiggestellten Brücke über den Jangtse in Nanjing als Denkmal der neuen Zeit (nahebei hatte Mao im Sommer 1966 den Fluss durchschwommen, Mutprobe und Kraftbeweis zugleich). Die naturalistische Agitationsoper «Der Azaleenberg» in Peking und der vaterländisch eingefärbte Heimatabend im fernen Urumqi («Wacht am Pamir» und «Preis dem Vorsitzenden Mao») erlebten wir als Zeugnisse einer raffiniert-perfekten Propagandakunst.
In den vier Jahren nach diesem ersten Besuch war ich mehrere Male in China. Einmal besichtigte ich die erst 1974 entdeckte Terrakotta-Armee, die seit zwei Jahrtausenden das Grab des Kaisers Qin Shi Huang-di bewachte. Bauern, die einen Brunnen bohren wollten, um ihre Granatäpfel- und Persimonenbäume zu wässern, waren zufällig auf sie gestoßen. Noch gab es kein Dach über dem Ausgrabungsort, geschweige denn ein Museum; noch steckten die wenigen bis dahin ausgegrabenen Tonsoldaten bis zu den Knien im Lehm; und noch war die volle Stärke der Wachdivision – 8000 Mann, 520 Pferde und 130 Kampfwagen – unter dem Weizenfeld kaum zu ahnen. Bei anderer Gelegenheit besuchte ich das chinesische Atomforschungszentrum in Lanzhou, inspizierte die 196. Infanteriedivision bei Tianjin und bewunderte die Wandmalereien in den Grotten von Dunhuang. Dreimal hatte ich im Laufe weniger Jahre das Glück, an mehrstündigen Gesprächen mit Deng Xiaoping teilzunehmen, der – nach einer neuerlichen Verbannung – 1977 endgültig das Ruder übernahm und im Dezember 1978 die Öffnung zur Welt und die Transformation der kommunistischen Kommandowirtschaft in eine kapitalistische Marktwirtschaft in Gang setzte. Ministerpräsident Zhou Enlai hatte schon drei Jahre zuvor die Ziele der «Vier Modernisierungen» gesetzt – der Landwirtschaft, der Industrie, der Wissenschaft und Technik und der Landesverteidigung. Sie sollten China bis zum Ende des Jahrhunderts zu einem «modernen und starken sozialistischen Land» machen und es wirtschaftlich «in die Spitzengruppe der Welt» einrücken lassen. Damals war die Viererbande Zhou in den Arm gefallen. Doch nun hatten sein Nachlassverwalter Deng Xiaoping und dessen Nachfolger Jiang Zemin freie Hand.
Besuch im Reich der Mitte: Theo Sommer wird im September 1984 von Deng Xiaoping begrüßt.
Journalistenpass für Ausländer: Theo Sommer konnte mit diesem Presseausweis im Herbst 1975 im Tross von Bundeskanzler Schmidt fünf Tage lang in die noch weitgehend verschlossene Volksrepublik reisen.
Das unterschätzte Reich
Der Zufall wollte es, dass mich unser Botschafter Erwin Wickert, der Vater des früheren Tagesthemen-Moderators Ulrich Wickert, ausgerechnet im Oktober des Scharnierjahres 1978 mit neun deutschen Kollegen zu einer fünfzehntägigen Reise durch China einlud. Sie führte uns bis in die Taklamakan-Wüste, wo wir als erste Ausländer nach langen Jahren wieder in die Buddha-Höhlen von Dunhuang durften. Wohin wir auch kamen, überall war zu spüren, dass der politische Wind sich drehte.
Damals habe ich mich erkühnt, ein Buch über das erwachende China, Die chinesische Karte, zu schreiben. Darin machte ich, wie viele andere auch, einen gewaltigen Fehler. Ich sah wohl, dass die Entwicklung des Landes eine neue Richtung nahm, aber ich traute meinem Urteil nicht so recht. «Ob die Öffnung zur Welt, das Abenteuer der Modernisierung, der zaghafte Ansatz zur Liberalisierung von Dauer sein werden», schrieb ich, «oder ob sich, was wie eine historische Wende wirkt, bald wieder als bloße taktische Wendung entpuppt – ich wage es nicht zu sagen. Mir scheint, der Wille zum grundsätzlichen Wandel ist diesmal stärker als je zuvor. Garantien gibt es dafür indes nicht.»
Ich berichtete seinerzeit auch über die verblüffenden Zukunftsvorstellungen des chinesischen Reporters Yen Jiachi, veröffentlicht unter dem Titel «Religion, Vernunft, Praxis» in der Guangming Ribao vom 4. September 1978. Es war einerseits eine scharfe Verdammung der Viererbanden-Ideologie und indirekt auch eine Kritik an der Politik des 1976 verstorbenen Mao Zedong («Wie konnte der Sozialismus zu solch finsteren mittelalterlichen Ketzergerichten führen?»), andererseits ein Loblied auf den neuen Pragmatismus, wie er in Deng Xiaopings Leitspruch zum Ausdruck kam: «Egal, ob eine Katze schwarz ist oder weiß; Hauptsache, sie fängt Mäuse.» Zugleich jedoch ließen sich an dem Artikel die heimlichen Sehnsüchte der jahrzehntelang von Krieg und Bürgerkrieg gebeutelten, von brutalen Ideologen und dem sprunghaften Mao kujonierten Chinesen ablesen.
Auf einer Zeitreise in die Vergangenheit und Zukunft fliegt der Reporter Yen zuerst in das Rom des Jahres 1633 und beobachtet dort den Ketzerprozess gegen Galileo Galilei – die Analogie zielt auf die Viererbande, deren Wissenschaftsfeindlichkeit jener der katholischen Kirche zu Galileis Zeit nicht nachstand. Dann besteigt er ein Flugzeug nach Fu-er-na, dem Städtchen Ferney an der französisch-schweizerischen Grenze; dort langt er 1755 an, wird von Diderot abgeholt und nimmt in einer Rokoko-Halle – lo-ko-ko auf Chinesisch – an vielen philosophischen Disputationen zwischen Voltaire und Montesquieu teil; Voltaire predigt ihm die Religion der Vernunft, Montesquieu den Geist der Gesetze und den Sinn der Gewaltenteilung. Danach jedoch fliegt er in 42 Stunden aus dem Ferney des Jahres 1755 in das Peking des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts. Seine Reiselektüre ist der Anti-Dühring von Friedrich Engels, der den Übergang «von der Herrschaft über Menschen zur Verwaltung der Dinge» als Ziel des Kommunismus definiert. Am 4. Mai 1994 trifft Yen wieder in Peking ein. Und so beschreibt er seine Eindrücke und Erlebnisse: