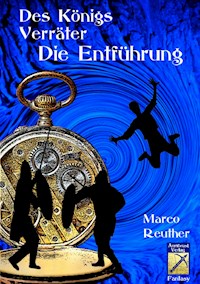
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Des Königs Verräter
- Sprache: Deutsch
Kein guter Start ins Wochenende, wenn man kurz nach seinem 13. Geburtstag in eine fremde Welt entführt wird, in der einem ein paar unfreundliche Attentäter auf den Fersen sind, nur weil man ein Orakel betrügen soll, um gegen haushoch überlegene Feinde kämpfen zu dürfen ... Bei der Entführung Peters ins Reich der Elf Stämme ist eine winzige Kleinigkeit schief gegangen, und so hat der Junge nicht nur seine Welt, sondern auch seinen Körper getauscht - leider mit einem Pferdedieb, der in eine Verschwörung gegen das Königshaus hineingeschlittert ist, so dass Peter einen der mächtigsten Männer des Reiches, eine finstere Bruderschaft und den ein- oder anderen Mörder im Nacken sitzen hat. Seine Verbündeten sind eine zickige Prinzessin und ein alter Halbzauberer, der ihm den ganzen Schlamassel eingebrockt hat ... Unterdessen muss sich Prinz Rétep, Schuhputzer und auf Rang 57.862 der Thronfolge im Elf-Stämme-Reich, in unserer Welt zurechtfinden, ohne sich überfahren, von Peters Schwester enttarnen oder von einem Attentäter ermorden zu lassen - jedenfalls muss er sich nicht davor fürchten, dass die kommenden Jahre langweilig werden. - Der All-Age-Fantasyroman ist der erste Teil einer neuen Reihe, die mit viel Fantasie, Spannung und Witz zwei Welten aufeinander prallen lässt - und das darf man durchaus wörtlich verstehen. "Eine Prophezeiung erfüllen? - Alter Hut! - Aber ein Orakel dazu bringen, dass es die gewünschte Prophezeiung macht - das ist neu!" (N.O.Pity) Im Internet: www.armbrustverlag.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung
zu zertrümmern, als ein Atom.«
Albert Einstein,
Physiknobelpreisträger
»He, isst dieses Eichhörnchen noch jemand?«
Xavox,
Halbzauberer
GEWIDMET
meine Schwester meinen Bruder
Jasmin MoritzAlexander Reuther
Kapitelübersicht
Karte des Elf-Stämme-Reichs
Prolog: Außergewöhnlich gewöhnlich
Ein Geburtstag zum Aussterben
Zielscheibe für eine Armbrust
Der hölzerne Junge
Mode und Tote – Wie alles begann, erster Streich
Letzte Ruhe in der Truhe – Wie alles begann, zweiter Streich
Ein Stück vom Kuchen – Wie alles begann, dritter Streich
Flucht – Wie alles begann, letzter Streich
Drei Diebe und ein Mörder
Der Tote in der Kugel
Paulas Zweifel
Eine Taube, zwei Stinker und Ärger für Olaf
Zweikampf mit Leiter
Eine sonderbare Entführung
Der Attentäter
Das Orakel von Nekis
Die Schlacht im Tempel
Neue Verbündete, getrennte Wege
Anhang 1: Die 23 Sämme des Elf-Stämme-Reichs
Anhang 2: Die Währung des Elf-Stämme-Reichs
Anhang 3: Zeittafel zur Geschichte des Elf-Stämme-Reichs
Wie es weiter geht
Der Autor
Prolog
Außergewöhnlich gewöhnlich
»TZZZZZSSt«, der Pfeil schnellte von der Armbrust und raste, die noch reine Stahlspitze in der Sonne blitzend, von hinten auf den fliehenden Jungen zu.
Dann floss Blut.
Nein, nein, nein. Dieser Anfang ist zu gewalttätig. Sie, mein Leser, sollen sich nicht vor Grauen abwenden. Nein, das Grauen darf Sie erst erreichen, wenn Sie gefangen sind. Wenn Sie das Buch, selbst wenn Sie es möchten, nicht mehr weglegen können.
Beginnen wir also behutsamer. Viel behutsamer. Beginnen wir mit... Peter.
»Peter war ein ungewöhnlicher, ja geradezu außergewöhnlicher Junge...« – Das wäre doch ein verheißungsvoller Anfang, oder? Tja, wäre es... Aber wir wollen doch lieber bei der Wahrheit bleiben. Denn, nein, etwas Besonderes war Peter nicht. Schon sein Name war, in Erinnerung an seinen Urgroßvater mütterlicherseits gewählt, alles andere als ungewöhnlich und – seien wir ehrlich – doch eher etwas altbacken. Peter umgab nicht mal ein Hauch irgendeines Geheimnisses. Er war kein Waisenjunge unbekannter Herkunft. Seine ihm sehr wohl bekannten Eltern – Vater: Finanzbeamter, Mutter: Hausfrau – erfreuten sich vielmehr bester Gesundheit. Und Peter war weder ein Kampfsport-Ass noch ein Computer-Genie. Oh, bitte! Nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen! Dumm war er nicht. Tatsächlich war er sogar recht intelligent für sein Alter, aber eben nicht brillant. Und nirgendwo schlummerte in irgendeinem geheimen Winkel der Erde eine Prophezeiung, die er zur Rettung der Welt erfüllen musste. Es gab nicht einmal eine zur Errettung von Liechtenstein.
Peter war also – was inzwischen wohl unmissverständlich klar geworden sein dürfte – alles andere als ungewöhnlich. Er spielte gerne Fußball, hing mit seinen Freunden rum, begann, nach Mädchen zu schauen, konnte Physik nicht leiden und hatte noch voriges Jahr seine hübsche Kunstlehrerin angehimmelt, was immerhin dafür gesorgt hatte, dass er seither jeden Morgen sein braunes Haar kämmte.
Falls es überhaupt irgendetwas Ungewöhnliches an Peter gab, dann allenfalls, dass er für einen Jungen seines Alters ziemliches Interesse an Geschichte zeigte.
Jetzt fragen Sie sich natürlich: Wenn dieser Peter so verdammt normal ist und es nichts Spannenderes als seine Vorliebe für die Historie zu berichten gibt, warum, in drei Teufels Namen, dann diese Geschichte? Noch dazu eine, die so groß ist, dass sie bis zum Ende dieses Buches führt?
Nun. Spätestens wenn Sie ein paar Seiten weiter gelesen haben, werden Sie mir zustimmen: Mit Abenteuern ist das so eine Sache.
Man muss sie nicht unbedingt suchen.
Um sie zu finden.
Und so geschah es.
Das Unglaubliche.
Freunde des Dramatischen mögen jetzt hoffen, dass wenigstens dieser Tag mit schicksalsschwanger dräuenden Wolken begann. Doch es war ein angenehmer Frühlingstag. Und nichts, wirklich rein gar nichts kündigte Peter auch nur im Allergeringsten an, was ihn in den nächsten Sekunden erbarmungslos aus seinem bisherigen Leben reißen, ihn in schier ausweglose und – ja, bedauerlicherweise müssen wir dies feststellen – auch leidvolle Abenteuer schicken würde. Es geschah nämlich, dass ...
Aber halt.
Wenn Sie Peter schon auf seiner gefahrvollen Reise begleiten, dann schulde ich es Ihnen – und nicht zuletzt auch ihm –, ihn etwas genauer vorzustellen. Also springen wir nicht gleich mitten rein, sondern fangen nochmals an (das letzte Mal, versprochen), steigen etwas früher in die Geschichte ein, sagen wir... ja, das sollte genügen... zwei Wochen früher, an seinem 13. Geburtstag...
1. Ein Geburtstag zum Aussterben
Peter brachte es nicht übers Herz.
Er konnte seinen Eltern einfach nicht sagen, dass es nicht unbedingt seine Vorstellung von einer Geburtstagsfeier war, mit ihnen, seiner Schwester, Opa, den beiden Omas und zwei Großtanten bei Kaffee und Kuchen zu sitzen. Jetzt bitte keine Missverständnisse: Peter mochte seine Großeltern, und selbst zu seinen Großtanten hatte er ein gutes Verhältnis, auch wenn die inzwischen mitunter erstaunlich hohe Werte auf der nach oben offenen Peinlichkeitsskala erreichten.
Aber das war genau sein Problem: Weil er seine Familie mochte und wusste, dass sie ihn mochte, brachte er es einfach nicht fertig, rundheraus zu erklären, dass er durchaus auf den Kaffeenachmittag verzichten konnte und viel lieber schon heute statt kommendes Wochenende mit seinen Freunden feiern würde.
Während er sich, gute Miene zum bösen Spiel machend, ein weiteres Stück Käsekuchen in den Mund schaufelte – immerhin, Mamas Käsekuchen waren einfach unübertroffen –, kam ihm der Gedanke, dass er doch jetzt eigentlich so langsam mal mit dem Rebellieren beginnen sollte. Von wegen Pubertät, und so... Ob er vielleicht mit Rauchen anfangen sollte...? Aber wenn er daran dachte, wie die Klamotten seines Vaters stanken, wenn der von seiner wöchentlichen Skat-Partie zurückkam... nein danke. Vielleicht brauchte man ja auch, um rebellisch zu werden, einfach mehr Pickel? Davon blieb er, bisher zumindest, einigermaßen verschont. Auch hatten ihn weder hilflose Schlaksigkeit noch whoppergenährte Breite ereilt.
»He, wo bist du denn mit deinen Gedanken? Du solltest die Kuchengabel wieder aus deinem Mund holen, bevor du sie noch verschluckst.«
Ertappt schaute Peter zu seiner fünf Jahre älteren Schwester hinüber. Wie schaffte es Paula bloß, selbst unter dieser verschärften Langeweile einfach nur cool und gelassen auszusehen? Es gab eigentlich nur eines, das sie ausflippen ließ: wenn man sie bei ihrem Spitznamen rief. Das verstand Peter. Wer wollte schon »Sissi« gerufen werden? Irgendjemand hatte mal gesagt, sie sehe aus wie die junge Romy Schneider, was ziemlicher Quatsch war, denn Paula hatte – wie ihr Vater – schwarze Haare, nicht so dicke Backen, eine viel hübschere Nase, eindeutig nicht so viel Babyspeck und bestechend meergrüne Augen. Die hatte sie, genau wie ihr Bruder, vom Vater geerbt (aber ihre Augen, fand Peter, waren eindeutig die schönsten).
Kein Zweifel, Peter liebte seine große Schwester sehr. Auch wenn es ihm natürlich nie eingefallen wäre – Himmel, was ein Kitsch! –, das laut zu sagen.
Neben Peter ging die Unterhaltung weiter: Sein Vater Paul und dessen Vater Paul sen. diskutierten ihren jüngsten Kampfeinsatz gegen die neuesten Maulwurfshügel. Paul Eifel (junior), 47 Jahre alt, war seit 23 Jahren Sachbearbeiter im Finanzamt von Großnordfurth, dafür aber von erstaunlich sportlicher Gestalt. Paul Eifel (senior) war, nach einer Laufbahn im mittleren Polizeidienst, vor drei Jahren pensioniert worden
Mariana Eifel, 43 Jahre, Hausfrau, Gelegenheits-Mitarbeiterin der Lokalredaktion des Großnordfurther Tageblatts, noch gelegentlicher Tupper-Party-Gastgeberin und an den meisten Tagen nach wie vor ziemlich verliebt in Paul Eifel jun., konnte sich an der derzeit beliebten Maulwurf-Diskussion nicht beteiligen. Sich leicht genervt einen Strähne ihrer langen, kastanienbraunen Haare aus dem Gesicht pustend, war Peters Mutter gerade vollauf damit beschäftigt, sich tapfer verbal zwischen Tante Lina und Tante Helene zu drängen, die sich seit etwa fünf Minuten mit kleinen, wohl dosierten Sticheleien beharkten – ein Zeitvertreib, den man ihnen einfach nicht mehr abgewöhnen konnte.
Na ja. Selbst wenn für Peter die gefühlte Zeit ausreichte, um Saurier aussterben und neue Arten entstehen zu lassen, so würde doch auch dieser Geburtstag vorübergehen. Immerhin war der Nachmittag ja nun schon etwas vorangeschritten.
Und während Peter, verstohlen gähnend, die aufsteigenden Bläschen in seiner Limonade verfolgte, geschah es im gleichen Moment, jedoch keineswegs in der gleichen Welt, dass ein Junge sterben sollte.
2. Zielscheibe für eine Armbrust
»Autsch!«
Das hatte wehgetan.
Dabei war der kleine Schnatz oben an der rechten Ohrmuschel, obwohl die Wunde ziemlich heftig blutete, eigentlich gar nicht so schlimm. Jedenfalls nicht im Vergleich zur Ursache dieser frischen Kerbe im Ohr. Die Ursache war ein Armbrustbolzen, der um Haaresbreite an Prinz Réteps Kopf vorbeigezischt war – oder eben doch nicht so ganz vorbei. Für den Flug des Bolzens verantwortlich war ein hünenhafter Kerl, ganz in schwarzes Leder gekleidet und mit einer Klappe über seinem linken Auge, der auf den Prinzen geschossen hatte. Das wiederum hatte der Mann in der eindeutigen Absicht getan, den Jungen umzubringen. Und auch der Grund, warum ihn die Auftraggeber des Ledermannes zu den Ahnen schicken wollten, schien dem jungen Prinzen ziemlich klar... immerhin so klar, dass er keinen Zweifel hegte, wie seine Zukunft aussehen würde. Denn selbst falls noch ein bisschen Zukunft für ihn übrig sein und er heute noch einmal entkommen sollte: Seine Gegner würden es wieder versuchen. Und wieder. Und wieder. Und... so lange, bis sie Erfolg hatten, mit der Ahnenschickerei.
Es war also wohl doch angebracht, Xavox´
Plan näher ins Auge zu fassen. Auch wenn dieser Plan, gelinde gesagt, ein wenig verrückt erschien. So verrückt eben wie der alte Halbzauberer selbst. Doch im Augenblick sollte sich Rétep vielleicht lieber mit seinen aktuellen Problemen befassen.
Um besser auf den Jungen mit den kurzen, dunkelbraunen Haaren zielen zu können, hatte der Ledermann sein Pferd gezügelt gehabt, aber gleich nach dem Fehlschuss war er wieder losgeprescht, dem jungen Prinzen hinterher. Immerhin hatten diese wenigen Sekunden des Innehaltens Rétep vielleicht die nötige Zeit für ein bisschen Zukunft verschafft, die Zeit nämlich, um den hoffentlich rettenden Wald zu erreichen. Und die Armbrust konnte der Ledermann im Reiten auch nicht erneut spannen. Ebenso wenig wie seine drei Spießgesellen, die in nur wenigen Metern Abstand ihrem Anführer hinterherjagten.
Die drei anderen hatten ihre Bolzen schon auf den Flüchtenden abgefeuert, ohne dass es ihn Blutzoll gekostet hatte. Jedenfalls nicht ihn selbst, doch der vorletzte Schuss hatte den rechten Hinterlauf seines Schecken glatt durchschlagen. Und das Pferd hatte sich im vollen Galopp überschlagen. Hätte Rétep die Zeit dazu gehabt, so würde er sich noch immer wundern, warum er nicht mit gebrochenem Genick auf dem Boden lag. Lediglich um ein paar blaue Flecke reicher, war er aus dem Sturz und einem Purzelbaum-ähnlichen Doppelüberschlag heraus gleich wieder aufgesprungen und weitergerannt. Er hing halt an seinem Leben. Mutter Erde durfte ruhig noch etwas warten, bis er ihr sein Blut anvertraute. Das Tier hatte weniger Glück gehabt. Aber mit dem braun gescheckten Pferd hatte er nur einen leichten Anflug von Mitleid verspürt. Er kannte den Zossen ja kaum, schließlich hatte er sich das Tier erst ein paar Tage zuvor ausgeborgt. Der junge Krieger, dem es gehört hatte, hätte vermutlich eher von »gestohlen« gesprochen, doch so kleinlich wollte Rétep da nicht sein.
Für Mitleid war auch wenig Zeit. Denn jetzt, in diesem Moment, raste der Junge mit brennender Lunge auf den Waldrand zu, hörte den schweren Hufschlag immer näher kommen, hörte aber auch etwas, das ihm Auftrieb gab und ihn, trotz schmerzender Beine und unerträglichem Seitenstechen, noch etwas schneller auf die nun so nahen Bäume zu jagen ließ: Er hörte den Anführer der Verfolger laut fluchen. Der hatte wohl gemerkt, dass er die Zeit besser nicht mit einem Schuss vergeudet hätte, statt den nun zu Fuß flüchtenden Jungen einfach über den Haufen zu reiten. – Tja, die Lederkrieger waren zwar für Stärke, Mut und bedingungslose Hingabe an den Kampf, jedoch nicht unbedingt für Klugheit bekannt. Wären seine Verfolger vom Stamm der Attentäter gewesen, Rétep hätte sicher nicht so viel Glück gehabt – wenn man in seiner Situation überhaupt von Glück spreche konnte.
Aber jetzt tauchte Rétep tatsächlich unter die ersten Zweige des Waldes, und, den Göttern sei Dank, der Wald war schon von Beginn an dicht, das Unterholz eng und hoch wuchernd. Seine Lungen schienen zwar kurz vor dem Bersten zu stehen, doch dank des mörderischen Ansporns genügten Prinz Réteps Kraftreserven noch, um sich wieselflink durch das Unterholz zu schlängeln.
Seine vier Verfolger, die nur wenige Sekunden nach ihm den Waldrand erreicht hatten, wollten es ihm gleichtun. Noch bevor sein Rappe richtig stand, war der Anführer abgesprungen, zückte mit der Rechten sein Kurzschwert und schob sich mit der Linken seinen fast bis zur Hüfte reichenden, aus drei Haarsträngen dünn geflochtenen Zopf zwischen die Zähne, damit er nicht im Unterholz hängen bleiben sollte. Aber während er wie eine wütende Wanz-Echse ins Unterholz walzte, wurde sein kantiges Gesicht noch düsterer, als es ohnehin schon war: Bei einer Verfolgungsjagd in diesem Gelände waren die großen, überaus kräftigen Männer doch tatsächlich im Nachteil gegenüber dem dreizehnjährigen Jungen, der noch dazu eher klein für sein Alter war. Bald hatte der Prinz den Abstand zu seinen Verfolgern wieder vergrößert. Zwei Mal wechselte er bei seiner Flucht die Richtung, und als er schließlich an einen kleinen, sich zwischen den Bäumen hindurch windenden Bach kam, dem die Natur zu Réteps Glück ein steiniges Bett bereitet hatte, flitzte er noch gut 500 Meter, ohne Spuren zu hinterlassen, das Bachbett entlang, um sich schließlich auf einen überhängenden Ast zu ziehen. Geschickt kletterte er dann durch ein paar Baumkronen hindurch tiefer ins Innere des Waldes, um schließlich den Stamm einer alten Buche nach oben zu robben und sich in etwa 17 Metern Höhe in deren Krone zu verbergen. Normalerweise war sein Teint, zumal er sich oft im Freien aufhielt, eher dunkel, doch nun war der Junge blass und erschöpft, die braunen Augen müde. Aber hier oben war er wohl fürs Erste in Sicherheit. So beschloss Prinz Rétep, etwa sechs Stunden auszuharren – dann würden die Lederkrieger sicher wieder abgezogen sein.
Sechs Stunden auf einem Baum, das war lang, und Rétep war nicht gerade für seine Geduld bekannt. Vermutlich hätten es auch drei Stunden getan, schließlich hatten die Lederkrieger glücklicherweise keinen Finder der Bruderschaft dabei gehabt, und auch die schwarzen Männer waren nicht so dumm, dass sie ihre Grenzen nicht kannten. Aber er würde diese sechs Stunden abwarten. Denn, das musste sich wiederum der Prinz eingestehen, er hatte... Angst. Richtige Angst. Was ihm vor wenigen Wochen noch völlig unbekannt gewesen war, das kannte er inzwischen nur zu gut: Todesangst.
Seit vor etwa sieben Wochen die Jagd auf ihn begonnen hatte, waren sie ihm noch nie so nahe gekommen. Sicher, als Schuhputzer- und Lederflicker-Junge, der sich auch manchmal, na ja, einen kleinen Nebenverdienst im Transportgewerbe gönnte (er transportierte Münzen aus fremden Taschen in seine eigene), war der Prinz sehr geschickt darin geworden, rechtzeitig in Deckung zu gehen. Und auch seine ungewöhnlich kräftig ausgeprägte Mondlichtseele hatte ihn schon aus so mancher Schwierigkeit befreit. Aber was bei Marktfrauen, Kaufleuten und einfachen Soldaten half, das würde ihn nicht mehr allzu lange vor gedungenen Killern und Schlimmerem schützen. Wobei ihm vor allem die »Schlimmeren« Sorgen machten, denn ihre unheimlichen Helfer in ihren stinkenden Kutten würden immer wieder aufs Neue die Spur des Jungen aufnehmen. Der Prinz seufzte in seinem Versteck und dachte daran zurück, wie er in den ersten Tagen des Frühlings auch die ersten Schritte getan hatte, um sich munter in diese ausweglose Situation zu manövrieren. Für unbesiegbar hatte er sich gehalten – und sich eindeutig übernommen. Auf fette Einnahmen hatte er gehofft, sich aber ganz ohne Zweifel mit den Falschen angelegt.
Und während der junge Prinz einsam, müde, durstig und mit bangen Gedanken an die Zukunft darauf wartete, wieder auf den Boden klettern zu können, ist vielleicht ein Wort der Erklärung angebracht: Wie kann ein Junge ein Prinz sein – denn das war Rétep tatsächlich – und gleichzeitig ein Schuhputzer und Lederflicker? Um das zu verstehen, muss man keine geheimnisvolle Geschichte, sondern nur die Geschichte kennen: Man muss bloß ein ordentliches Stück weit in die Vergangenheit wandern. In jene Zeit, als das Elf-Stämme-Land noch nicht das Elf-Stämme-Land war.
23 Fürstentümer verschiedener Größen hatte es, soweit den Historikern bekannt, im Gebiet der heutigen Elfen-Nation gegeben. Über die Zahl der kleinen und großen Kriege unter diesen Stämmen hatte kaum noch jemand den Überblick. Allianzen wurden geschmiedet und zerfielen wieder. Manche Häuptlinge waren mächtig geworden, doch keiner mächtig genug, um die Stämme mit Feuer und Schwert zusammenzuschweißen. Rigbert der Krieger soll im Jahr 328 immerhin neun Stämme gewaltsam geeint haben, doch unter Rigbert dem Merkwürdigen, seinem Enkel, war das Kleine Reich, wie es die Gelehrten heute nannten, in blutigen Aufständen wieder zerfallen. Zweihundertfünfzig Jahre später war Halla die Schreckliche, nach zunächst kleineren Eroberungen im Westen, bei ihren südlichen Nachbarn eingefallen und hatte in nur sieben Wochen sowohl den Stamm der Fischesser als auch den Stamm der Kampfsänger nahezu komplett ausgelöscht, um deren Gebiete zu annektieren. Ihre Erbarmungslosigkeit erschreckte sogar das eigene Gefolge – und es waren keine zimperlichen Zeiten. Als aber herauskam, dass sich Halla für ihren Sieg auch der schwarzen Magie und der Hilfe dunkler Wesen bedient hatte, da war es genug: Sie wurde von ihren eigenen Leuten in ein Fass mit Nägeln und Glasscherben gesteckt und einen Berg – einen langen Berg – hinunter gerollt. Danach, so notierte es jedenfalls der zeitgenössische Hofschreiber Hanno Pelavis, war das einzig Schreckliche an der nun ziemlich toten Herzogin ihr Anblick gewesen. Seit jener Zeit galt auch der Beruf des Zauberers als, na ja, recht suspekt und nicht mehr sehr ehrenwert, und diese Profession war auf den absteigenden Ast geraten.
Da bereits Anfang des 3. Jahrhunderts der kleine, heute fast vergessene Gebirgsstamm der Yetirti vier aufeinanderfolgende harte Winter nicht überlebt hatte, waren nach der Zeit Hallas noch 20 Stämme übrig gewesen. Von diesen gingen vier in Kriegen unter, zwei wurden durch die Heirat von Freiwinde der Prächtigen mit Eromund dem Müden geeint, einer von der Pest entvölkert. Die große Hungersnot, die 1090 begann und vier Jahre anhielt, brachte mehrere Stämme an den Rand der Vernichtung, allerdings verschwand nur einer – und das wörtlich: Eine Handelskarawane der Kohleschürfer fand das Land der Katzenkrieger im Sommer 1093 vollkommen entvölkert vor; kein einziger Geschichtsschreiber gab Auskunft, was aus ihm geworden war, sodass mancher schon zweifelte, ob es diesen Stamm jemals gegeben hatte. Einer der restlichen Stämme, der Stamm der Meeresspringer, wurde in alle Winde zerstreut und ein weiterer von Fürst Ludgar dem Glücklosen beim Glücksspiel an zwei benachbarte Fürstenhäuser verloren (es heißt, Ludgars Söhne wären danach mit ihrem Vater ähnlich verfahren wie Hallas Leute mit ihrer Fürstin, aber das ist historisch nicht ganz gesichert).
Nach etlichen weiteren Kriegen mit wechselndem Kriegsglück – ein sonderbares Wort: als ob es im Krieg jemals Glück geben könnte – lagen die Stämme oder Herzogtümer, wie man sie jetzt auch nannte, danieder und waren kaum noch in der Lage, sich gegen äußere Feinde zu behaupten, als eine glückliche Fügung und ein Geistesblitz von Prinz Dorian dem Libidinösen die Wende brachte. Vor gut siebenhundert Jahren war es gewesen, als es das Schicksal so wollte, dass in zehn der damals verbliebenen elf Fürstentümer die Erstgeborenen der herrschenden Fürstenpaare Mädchen waren. Allein dem Stamm der Eisenmarschen war ein Junge als künftiger Herrscher geboren worden – Prinz Dorian. Um das Weitere zu verstehen, muss man zwei Dinge wissen:
a) Für die Erbfolge spielte das Geschlecht keine Rolle, die Herrschaft ging immer an das älteste Kind über (wenn es nicht zuvor im Krieg gestorben, von der Pest dahingerafft oder von einem Nachrücker in der Erbfolge vergiftet worden war).
b) In jenen Zeiten durfte sich eine Fürstin noch mehrere Gatten, ein Fürst mehrere Frauen zur Gemahlin nehmen (während heutzutage die als schicklich geltende Obergrenze von drei Ehepartnern beim Adel nur selten überschritten wird). – Der stattliche Dorian erinnerte sich nun daran, dass schon einmal zwei Stämme durch eine Heirat friedlich geeint worden waren, und warum sollte das nicht auch im großen Stil gelingen? Also hielt er bei zehn Fürsten und Fürstinnen um die Hand der jeweiligen Tochter an. Tatsächlich kostete es ihn nur ein gerüttelt Maß an Überredungskunst, einige an den richtigen Stellen platzierten Goldstücke und in zwei Fällen ziemliche Überwindung und Selbstdisziplin (dass von jenen beiden Prinzessinnen kein einziges Bild überliefert wurde, spricht wohl für sich), um nach zehn Hochzeiten in nur knapp drei Jahren aus den elf Stämmen das Land der elf Stämme zu machen.
Der ungewohnte Frieden unter den Stämmen, die Last, die den Menschen von den Schultern fiel, brachte dem neuen Reich Wohlstand und eine nie erwartete Blütezeit. Der als Friedensbringer verehrte Prinz und spätere König Dorian wusste die Zeit auch persönlich überaus friedlich zu nutzen: Mit seinen zehn Frauen zeugte er, abzüglich der tot geborenen oder früh verstorbenen, insgesamt 49 Kinder. Und weil er so schön in Übung war, heiratete er noch vier weitere Frauen, die ihm 17 Kinder schenkten. Fast unglaublich, dass er daneben noch die Zeit zum Regieren hatte – und die Zeit, 57 weitere, illegitime Nachfahren in die Welt zu setzen, die ebenfalls allesamt – schließlich war ihr Erzeuger der Stammvater des neuen Reiches – den Status eines Prinzen oder einer Prinzessin erhielten.
Somit hatte Dorian bis zum Ende seines langen Lebens 123 Prinzen und Prinzessinnen das Leben geschenkt. Vielleicht waren nicht wirklich alle von ihm, aber wer wollte behaupten, in all dem königlichen Kinder-Gewimmel den Überblick zu bewahren? Zuletzt hatte Dorian einen Kammerdiener eingestellt, dessen einzige Aufgabe darin bestand, den König an die Geburtstage seiner Kinder und Enkel und an deren Namen zu erinnern (und es war ein offenes Geheimnis, dass jener Diener dem König schließlich auch die Namen seiner Kurtisanen zuflüstern musste, was dem König, da er seit seinem 85. Lebensjahr an Schwerhörigkeit litt, etliche böse Blicke seiner Gespielinnen einbrachte –, aber da er auch nicht mehr so gut sah, war das nicht weiter schlimm).
Viele seiner Kinder schienen Dorians Hang zur Fruchtbarkeit geerbt zu haben und gaben ihn an die eigenen Nachkommen weiter. So kam es, dass Prinz Rétep, Schuhputzer und Lederflicker, einer von etwa zwölf Millionen offiziellen Prinzen und Prinzessinnen in einem riesigen Reich mit knapp 40 Millionen Einwohnern war. Hätte sich Rétep einmal die Mühe gemacht nachzurechnen, an welchem Platz in der Erbfolge er stand, hätte er erstaunt festgestellt, dass er ziemlich weit oben rangierte, nämlich auf Rang 57862. Von irgendeinem praktischen Nutzen war dies natürlich nicht, denn die 57861 potenziellen Thronfolger vor ihm würden Prinz Rétep wohl kaum den Gefallen tun und tot umfallen oder auf das Amt verzichten. Und eine stattliche Apanage gab es nur für die ersten zehn möglichen Thronfolger, für weitere zwanzig – man konnte ja nie wissen – ein kleines Zubrot.
Noch zu Zeiten von Dorian dem Libidinösen selbst war es, trotz allen Aufschwungs, kaum möglich gewesen, allen Prinzen und Prinzessinnen ein angenehmes Leben zu finanzieren. Schon eine Generation später setzte es der Rat der Stämme – verständlicherweise gegen den Widerstand der meisten Prinzen und Prinzessinnen – durch, dass man künftig nicht mehr alle Nachfahren Dorians auf Staatskosten durchfüttern würde. So kam es, dass es – abgesehen von den wenigen Hochprinzen – bald kaum noch Unterschiede zwischen den einfachen Bürgern und der Schar der Prinzen und Prinzessinnen gab. Genau genommen gab es sogar nur zwei offizielle Unterschiede: Die Prinzen und Prinzessinnen hatten erstens das Recht, ihren Titel vor den Namen zu stellen, und sie hatten zweitens das Recht, falls sie aus irgendeinem Grund zu einer Kerker-, Arbeits- oder Fronstrafe verurteilt werden sollten, statt des Kerkers den Galgen zu wählen.
Während das erstgenannte Recht sehr häufig genutzt wurde, war die Inanspruchnahme des zweiten doch eher gering. Genau genommen waren nur drei solche Fälle verzeichnet: Vor gut hundert Jahren hatte Prinz Aram Harup, verurteilt wegen schwarzmagischer Umtriebe, den Tod der lebenslangen Einkerkerung vorgezogen. Nur wenige Jahre später hatte es ihm ein gewisser Prinz Randolfini gleichgetan, der gemeinsam mit seiner Frau des schweren Betrugs überführt worden war. Allerdings war Randolfini damals schon 80 Jahre alt gewesen, und er hatte sich erst für den Galgen entschieden, nachdem er erfahren hatte, dass er die Zelle mit seiner Frau teilen sollte. Zu guter Letzt hatte vor etwa 50 Jahren ein zu fünf Monaten Haft verurteilter Hühnerdieb den Galgen vorgezogen – wobei sich in diesem Fall hartnäckig das Gerücht hielt, dass lediglich das Lispeln des Angeklagten und die Schwerhörigkeit des Richters für dieses Urteil gesorgt hatten –, na ja, Schnee von gestern.
Des Weiteren gab es noch zwei inoffizielle Unterschiede zwischen den Nachfahren Dorians und der einfachen Bevölkerung: Der Anteil der Reichen war im Adel noch immer deutlich größer als bei den Normalsterblichen – leider gehörte Prinz Rétep nicht zu dieser Gruppe. Und ebenso war auch der Anteil derjenigen, die sich für etwas Besseres hielten als der Rest der Welt, im Adel stärker verbreitet. Aber zum Glück: Hier gehörte Rétep ebenfalls nicht dazu – wenn er auch ansonsten durchaus einen gewissen Abstand dazu hatte, fehlerfrei zu sein.
3. Der hölzerne Junge
Der Geburtstag war vorüber. Auch das Fest eine Woche später, mit seinen Freunden und Freundinnen, war gekommen und gegangen. Jetzt, wiederum eine Woche später, hatte ihn der Alltag längst wieder. Aber der sah am heutigen Samstag eigentlich gar nicht so übel aus: Man konnte Peter an jenem sonnigen Frühlingstag auf dem Weg zum Sportplatz sehen. Wie immer nahm er die Abkürzung durch den lichten Wald. Die Landschaft schien aus allen Poren den Frühling zu verströmen: Der Himmel war blau, das Gras am Rande des breiten Waldweges war von kräftigem, frischen Grün, an unzähligen Stellen von kleinen Wildblumen durchbrochen. Überall summte und brummte und krabbelte es, und Peter freute sich schon auf einen Schluck frischen Quellwassers: Etwa auf der Hälfte der Strecke kreuzte der Waldweg eine Lichtung, in deren Mitte eine einsame, uralte Eiche einer hölzernen Sitzbank und einem kleinen Brunnen Schatten spendete. Der Brunnen wurde von einer kühlen Quelle gespeist, und Peter versäumte es nie, hier einen ordentlichen Schluck zu nehmen.
Der Frühling schien auch in Peter selbst zu stecken. Er war ausgesprochen guter Laune, freute sich auf seine Kumpel und die Bewegung beim Fußballspielen. Er erreichte die Lichtung, begleitet nur von einer angenehmen Brise, die durch die Bäume strich, und von einer dicken Hummel, die ihm brummend ein kleines Stück des Weges gefolgt war. In der Eiche lieferten sich drei Rotkehlchen einen Sängerwettstreit, und in der Ferne hämmerte ein Specht. Peter trat schließlich in den Schatten der Eiche, erreichte den einer alten Viehtränke ähnelnden hölzernen Trog, in den, gefasst in ein stählernes Rohr, munter die kleine Quelle plätscherte. Aaaah! Das frische Wasser! Peter legte die Hände zu einer Mulde zusammen, schob sie unter den Strahl – oder wollte es zumindest...
Doch da war nichts mehr, unter das er seine Hände hätte halten können. Von einer zur anderen Sekunde war das Wasser versiegt. Nicht ein einziger Tropfen baumelte mehr am Ende des Wasserspeiers. Verdutzt schreckte Peter hoch, die Augen weiterhin auf den nun wasserlosen Wasserspeier gerichtet, das Echo des Plätscherns noch im Kopf. Doch tatsächlich hörte er... er brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, was es war… Nichts!
Absolut.
Nichts.
Nicht nur das Plätschern war verschwunden, auch das Brummen und Summen der Insekten, ebenso das Hämmer des Spechtes und das Zwitschern der Vögel. Ja selbst das Rascheln des leichten Windes in Blättern und Ästen war erloschen, nicht das leiseste Lüftchen regte sich.
Nie im Leben hatte Peter eine solche Stille gespürt, und er war viel zu verblüfft, um über das ungewöhnliche Ereignis besorgt oder gar beunruhigt zu sein. Aber er stand erst ganz am Anfang der Verblüffungen. Beunruhigung und Angst sollten bald folgen.
Vor Peters Augen verschwand nun auch das Wasser, das gerade noch den Brunnentrog gefüllt hatte. Nicht etwa, dass es irgendwo ausgelaufen wäre, nein, es… verschwand! Schien in Windeseile und absoluter Stille, ohne auch nur einen Tropfen zurückzulassen, in den Boden des Troges hineinzugleiten. Und jetzt konnte Peter innerhalb weniger Sekunden beobachten, wie das Holz des Troges spröde und rissig wurde, als hätte es zehn Jahre lang in der Wüstensonne gelegen. Dann machte Peter einen erschrockenen Luftsprung, denn unvermittelt spürte er ein Zittern unter seinen Füßen, als würde die Erde zerkrümeln. Denn auch der Boden unter ihm, ja auf der ganzen Lichtung trocknete aus, bekam Risse, die alle auf ein Ziel zuliefen: die alte Eiche, die, noch unberührt, nur zwei Meter von Peter entfernt stand. Mit offenem Mund beobachtete der Junge, wie die Risse den Baum erreichten, der jetzt wohl auch austrocknen musste… Doch mit dem Baum geschah etwas anderes: Als würde ein Aufzug in ihm aufsteigen, füllte sich der Stamm des Baumes bis in eine Höhe von etwa zwei Metern mit Wasser.
Nein, das war falsch, musste sich Peter entsetzt korrigieren. Der Eichenstamm füllte sich nicht mit Wasser, er wurde zu Wasser, war einen Moment durchsichtig, bis darin, erst verschwommen, doch dann deutlicher werdend, eine Kontur auftauchte. Eine Kontur, die… menschlich…? Und als diese Kontur in etwa Peters Größe erreicht hatte… trat ein hölzerner Junge aus der Wassersäule heraus, direkt in Peters Richtung.
*
Die Stille war beendet, als der Holz-Junge fürchterlich zu husten begann, Peter eine ordentliche Ladung Wasser vor die Füße spuckte und, mit absolut menschlicher Stimme, »Tag, Peter« sagte. Was Peters Entsetzen allerdings nicht steigern konnte, da er die Obergrenze des möglichen Schreckens – für den Augenblick – bereits erreicht hatte.
Seine Sporttasche war ihm schon lange von der Schulter gerutscht, seine weit aufgerissenen Augen starrten fassungslos auf den Jungen, dessen hölzerne Kleidung seltsam altertümlich wirkte, und dem offenbar ein kleines Stück des rechten Ohres fehlte.
Der Junge sprach nun mit schnellen Worten und eindringlich auf Peter ein: »Ich weiß, das wird jetzt etwas überraschend für dich kommen...« hatte der Kerl gerade »etwas« gesagt??? »...aber ich habe nicht viel Zeit, es dir zu erklären, also hör genau zu: Das Elf-Stämme-Land ist in Gefahr. Eine Seherin von Nekis hätte es fast mit ihrem Augenlicht bezahlt, dass sie uns schließlich den einzigen Ausweg in einer Prophezeiung offenbarte: ›Ein dreizehnjähriger Junge aus der anderen Welt kann die Rettung bringen‹ – ja, hört sich ziemlich wild an, oder? Und von den wenigen, die es gehört haben, glauben wohl einige noch heute nicht daran. Doch unseren Zauberern...« Hatte der Kerl gerade »Zauberer« gesagt?!?! »...ist es endlich, unter vielen Mühen und Gefahren gelungen, einen Weg zu finden, um einen Boten – nämlich mich – zur richtigen Zeit und an den richtigen Ort in die andere Welt zu schicken. Um dich zu holen...«
»Mich? Zu holen??«, wandte Peter lahm ein.
»Ja, du heißt doch Peter?«
»Äh, jaaa...«
»Na also. Wo war ich? Ach ja: Wenn du ins Elf-Stämme-Land kommst, traue niemandem. Es ist, äh, nicht ganz ungefährlich dort für dich – na ja, eigentlich für niemanden. Die einzigen, auf die du dich uneingeschränkt verlassen kannst, sind mein Freund Tulpe und der Halbzauberer Xavox. Beide wissen, dass du kommst. Tulpe wirst du entweder bei meinem Onkel, Prinz N’Ky finden – aber hüte dich vor meiner Cousine Prinzessin Ky, sie ist die echte Pest! –, oder frag irgendeinen Straßenjunge in Rú-tan nach ihm. Xavox findest du in Rútan im Tanzenden Einhorn. Ah, wunder dich nicht über ihn, er scheint manchmal etwas... sonderbar, vielleicht könntest du auch denken, dass er... nicht ganz nüchtern ist, aber in diesem Krieg brauchen wir alle unsere Tarnung. Xavox und Tulpe werden dir auch deine Aufgabe genauer erklären, denn ich fürchte, wir haben leider nicht mehr viel Zeit – was ich sehr bedauere –, unser interessantes Gespräch noch länger fortzusetzen. Du wirst nämlich in den nächsten Sekunden abreisen müssen, während ich zum Ausgleich hier bleibe. Der Holz-Zauber lässt jeden Moment nach, und beide können wir nicht in dieser Welt existieren.«
Jetzt stammelte Peter fassungslos: »Wie? Was? Abreisen? Aber ich will doch gar nicht... Eine Prophezeiung? Welches Land soll ich retten??? Will mich hier jemand verarschen? Und wer bist du überhaupt?«
»Nun, das sind ziemlich viele Fragen auf einmal, was? Na gut, also ich bin Prinz... oh, zu spät. Es geht los. Erschrick nicht.«
Damit packte der Junge Peter mit kräftigen und sich überraschend menschlich anfühlenden Händen an den Armen, in denen er augenblicklich ein seltsames Ziehen und Reißen spürte, das nichts mit den fest zudrückenden Fingern zu tun hatte. Entsetzt merkte Peter, dass er auf seinen Wangen plötzlich das Sonnenlicht tief in sich eindringen fühlte, und irrerweise hatte er mit einem Mal das unbändige Verlangen, seine Schuhe abzustreifen, um seine Zehen tief in den Boden zu graben. Doch noch bevor diese verrückten Gedanken weitergedacht werden konnten, hatte der fremde Junge, dessen hölzerne Haut nun irgendwie in Bewegung geraten war und ihre Farbe zu ändern schien, Peter erbarmungslos herumgewirbelt und drückte ihn in die Wassersäule, die kurz zuvor noch der Stamm einer Eiche gewesen war und auf der immer noch, entgegen jedem physikalischen Gesetz, die Krone einer Eiche wuchs.
In der Wassersäule war Peter augenblicklich bis auf die Borke... bis auf die Haut durchnässt, und, viel schlimmer, er bekam keine Luft mehr. Panisch wollte er sich wieder aus dem Wasser-Baum herausdrücken, doch der Junge, den Peter nun nur noch verschwommen erkennen konnte, hatte seine Hände mit in die Wassersäule geschoben und hielt Peter eisern fest. Vielleicht hätte der es trotzdem, vereint mit den Kräften seiner Angst, geschafft, sich loszureißen, doch nun schien das Wasser erbarmungslos von unten an ihm zu saugen, riss an ihm, wollte ihn hinabziehen – und dann plötzlich auch das Gefühl, von etwas im Wasser beobachtet zu werden, während seltsam gedämpfte Schreie wie die Echos weit entfernter Hilferufe in sein Hirn schnitten.
Der Sog wurde nun immer stärker, Peter klammerte sich verzweifelt an den Händen fest, die er gerade noch abschütteln wollte, doch draußen warf sich der Junge mit einem Ruck zurück, und Peter war allein, haltlos, wurde vom Wasser aufgesogen, wurde Wasser, wurde in Holz gedrückt, wurde zerquetscht, wurde durch Adern gepresst, in die Erde gesaugt, erstickte, zerwirbelte, wurde Nichts, wurde...
...ausgespuckt.
Erschöpft, hustend und spuckend und ohne mit Sicherheit sagen zu können, ob er gerade ohnmächtig gewesen war oder nicht, lag er auf einer großen Weide direkt neben einem einsamen, gut drei Meter hohen Menhir. Es roch hier so anders...
***
Prinz Rétep war zufrieden. Vor seiner Ankunft hatte er befürchtet, dass dieser Tölpel vielleicht Widerstand leisten könnte. Doch nein, es war alles glatt verlaufen. Nun würde er sich in Ruhe und frei von irgendwelchen Verfolgern an seine neue Heimat gewöhnen können. Tulpe und Xavox würde er vielleicht vermissen. Und Ky...? Die hatte er hinter sich. Hoffte er.
Hmmm... Es roch hier irgendwie anders als im Elf-Stämme-Land, und die Luft hatte einen sonderbaren Geschmack. Seltsamerweise schien sich sogar seine Wahrnehmung irgendwie geändert zu haben, jedenfalls kam sich Rétep ein wenig größer vor als noch jenseits der Wassereiche... Merkwürdig. Er kratzte sich am Ohr. Und seine Augen wurden groß. Das Ohr war wieder komplett! Schlagartig dämmerte dem jungen Prinzen, dass womöglich doch nicht alles so glatt gelaufen, ja dass vielleicht sogar etwas ganz fürchterlich schiefgegangen war. Der Brunnen-Trog war inzwischen von der jetzt wieder munter plätschernden Quelle gefüllt, und so blickte Rétep in das Wasser, um sich darin zu spiegeln – und stieß einen Entsetzensschrei aus. Augenblicklich wirbelte er herum, machte den größten Satz seines Lebens... und brach sich das Nasenbein, als er mit dem Gesicht gegen den Baum knallte – es war ganz eindeutig zu spät, um wieder in die Wassersäule des Eichenstammes zu springen: Da stand ein ganz normaler Baum, so als hätte es nie etwas anderes gegeben. Rétep fluchte aus vollem Herzen, während das Blut aus seiner Nase schoss, eine ordentliche Beule auf seiner Stirn erblühte und er innerlich alle Götter anflehte, dass der andere nun doch mit heiler Haut davonkommen möge – was bei der Aufgabe, die er bewältigen sollte, aber ziemlich unwahrscheinlich war.
***
Peter blieb gut zehn Minuten liegen, ohne sich zu rühren. Dafür bewegten sich seine Gedanken umso heftiger – sie waren das reinste Chaos. In diesem Augenblick war er nicht mal entsetzt, denn dazu hatte er keine Kraft mehr. Sein Körper war bis an die Grenzen des Möglichen erschöpft, sein Geist so weit entfernt davon, auch nur ansatzweise zu begreifen, was gerade passiert war, dass in der ganzen Verwirrung für Entsetzen kein Eckchen mehr frei blieb.
Schließlich rappelte er sich ächzend in sitzende Position hoch, wälzte sich auf die Knie und musste sich, heftig hustend, übergeben. Nach gut weiteren fünf Minuten umrundete er auf den Knien rutschend das Erbrochene, bis er sich an dem Menhir abstützen und langsam hochrappeln konnte. Der Stein war sonnenwarm unter seinen tastenden Händen. Konnte man so etwas in einem Traum spüren? Konnte man in einem Traum Gras riechen? Konnte man in Träumen kotzen wie ein Reiher? Aber abgesehen davon, dass alle seine Muskeln schmerzten, schien er nicht verletzt zu sein. Nun ja, sein Nasenrücken schmerzte, da musste er bei seiner sonderbaren Reise wohl irgendwo dagegen gerummst sein. Außerdem spürte er am rechten Ohr ein heftiges Ziehen und ertastete vorsichtig an dessen Oberkante eine ordentliche Kerbe. Gemerkt hatte er es jedenfalls nicht, wie er sich da verletzt hatte, und seltsamerweise blutete die Wunde auch nicht, schien sogar schon verkrustet – er musste also wohl doch ohnmächtig gewesen sein.
Nun lehnte sich Peter mit dem Rücken an den großen Steinblock – die Wärme tat gut – und betrachtete sich die Gegend eingehender. Ja, er war hier tatsächlich auf einer großen, saftigen, grünen Weide gelandet – wie das geschehen war?, nein, darüber lieber später nachdenken, damit die Übelkeit nicht zurückkam. Von rechts glotzten ihn jedenfalls aus fünf Metern Entfernung zwei Kühe blöde an. Verteilt über das riesige Areal waren noch etliche ihrer Kolleginnen mit Grasen oder Wiederkäuen beschäftigt. Etwa 20 Meter vor ihm war ein grober Holzzaun, der die Weide von einem staubigen, mit tiefen Fahrrinnen versehenen Weg trennte. Jenseits des Weges reckten sich auf einem Feld junge Pflanzen in den Himmel – vielleicht Weizen? Obwohl Weizen doch ein bisschen anders aussah. Ein gutes Stück weiter weg schien, mitten im Weizen-oder-was-auch-immer-Feld, ein kleines Gehöft zu stehen, das aber einen ziemlich heruntergekommenen Eindruck machte. Zur Linken erreichte der Weg nach etwa einem Kilometer einen gigantischen Wald, der sich über den ganzen Horizont erstreckte, zur Rechten gingen die Felder und Wiesen über sanfte Hügel immer weiter, doch in der Ferne, auf einer etwas größeren Anhöhe – Peter konnte schlecht schätzen, wie weit sie entfernt war – zeichneten sich die Konturen einer kleinen, von Mauern umgebenen Stadt ab.
Soviel also zur Landschaft. Und was jetzt??? Vielleicht müsste er ja auch einfach überhaupt nichts tun, weil er in Wirklichkeit gar nicht auf dieser Wiese, sondern in einer netten Gummizelle saß?
Aber selbst wenn er irre geworden war, dann bräuchte er innerhalb seines Irrsinns irgendeine Erklärung. Vielleicht sollte er also wirklich nach diesem »Halbzauberer« – unglaublich, dieses Wort auch nur zu denken – Ausschau halten. Nicht etwa, weil er diesem hölzernen Jungen getraut hätte – schließlich: Eine Person, die einen beinahe in einem Baum ertränkt und ohne Vorwarnung in eine andere Welt schickt, ist ja wohl kaum sehr vertrauenswürdig –, doch er wusste sich einfach keinen anderen Rat. Also: Da vorne war der Weg. Nach links, in den Wald, wollte er nicht, der einsame, geduckte Hof war ihm nicht geheuer. Somit blieb die Stadt. Wie war das noch mal? In Rú-tan im Tanzenden Einhorn sollte dieser Xavox zu finden sein? Nun denn. Schnell noch einen Blick auf die Uhr... Die Uhr war weg. Und sein lockeres Sweatshirt war auch verschwunden. Stattdessen trug er eine kurzärmelige Lederweste und eine nicht sonderlich saubere Hose aus grobem, braunem Stoff, die Füße steckten in speckig glänzenden Wildlederstiefeln, die bis über die Waden reichten. Offenbar hatte er mit jenem Holz-Jungen nicht nur die Welt, sondern auch – iiiiiih – die gebrauchten Kleider getauscht. Na, hoffentlich hatte der keine Läuse... Nein, lieber an was anderes denken, den Blick auf die Stadt richten, und los geht’s.
Nachdem er etwa fünf Minuten marschiert war, bemerkte er, dass ihm da offenbar irgendein Gefährt entgegenkam, das zuvor noch hinter dem nächsten Hügel verborgen gewesen war. Es näherte sich langsam, konnte also wohl kein Auto...
Das war ja ein Ochsenkarren! Nach ein paar weiteren Minuten war der Wagen gemächlich herangezottelt, Peter trat an den Straßenrand und starrte. Von vier kräftigen, geradezu riesigen Ochsen gezogen, rollte da ein sicher fünf Meter langes Gefährt auf hölzernen Scheiben-Rädern heran. Auf dem Kutschbock saßen ein Mann, der die gemächlich stampfenden und sanft schnaubenden Tiere mit einer langen, dünnen Stange antrieb, und eine Frau, die etwas zu stricken schien. Beide waren groß und schlank und etwa um die 40 Jahre alt, mit wettergegerbten, langen Gesichtern, schon leicht ergrautem Blondhaar und in grobe Wollhosen und Leinenhemden gehüllt. Der Wagen war hoch mit Säcken und Körben beladen, wobei die Säcke in der vorderen Hälfte so aufgeschichtet waren, dass sich obendrauf bequem drei Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren lümmeln konnten, mit fast weißblonden, schulterlangen Haaren und ähnlich wie ihre Eltern gekleidet. Die Kinder sahen nun ihrerseits neugierig zu Peter herunter. Auch der Mann richtete jetzt seine Blicke auf ihn, runzelte schließlich die Stirn und rief ihm zu: »Was glotzt du so blöd? Ihr Stadt-Bengel seid eine echte Landplage...«
Von hinten rief das älteste Kind, der Stimme nach zu urteilen ein Mädchen: »Ja, mach den Mund zu, sonst fliegt dir noch ein Trillerlops hinein!«
Was immer das auch bedeuten mochte, die beiden kleineren kugelten sich jedenfalls vor Lachen, und Peter klappte automatisch seine fast schon schmerzenden Kiefer wieder zu, starrte aber doch weiter dem Wagen hinterher. Erst jetzt konnte er hinter die Ladung sehen. Dort, ganz am Ende des Karrens, saß noch ein Mädchen, im Gegensatz zu den anderen mit tiefschwarzen Haaren und einem etwas volleren Gesicht, mit einer einfachen, dunkelgrauen Leinenjacke und wadenlangen Hosen aus dem gleichen Stoff gekleidet. Das Mädchen war etwa in Peters Alter, schien dafür aber recht kräftig zu sein. Lässig lehnte sie an einer Kiste und ließ die nackten Füße vom Wagen baumeln. Beiläufig strich sie mit der rechten Hand eine widerspenstige Haarsträhne zurück, schob dabei gleichzeitig ihr gut schulterlanges, glattes Haar hinter das rechte Ohr – und Peter starrte schon wieder.
Das Ohr!
Das Ohr des Mädchens lief oben eindeutig spitz zu. Nicht gerade lang auslaufend und nadelfein, aber eben doch... spitz. Und als Peter nun sah, was sie über ihrem Schoß liegen hatte, wurden seine Augen noch größer. Da lagen ein großer Bogen und ein Köcher mit langen, gefiederten Pfeilen. Und einen Pfeil hatte sie in der linken Hand. Seine mit Widerhaken versehene Spitze schimmerte wohl nicht nur so wie Stahl... Peter konnte sich kaum einreden, dass es sich bei der Waffe bloß um einen Sportbogen oder gar ein Spielzeug handelte. Und er fragte sich, während ihm eine Gänsehaut das Rückgrat hochkroch, was das Mädchen mit ihrem Bogen gemacht hätte, wenn Peter von dieser seltsamen Wagenbesatzung als Bedrohung eingestuft worden wäre... Was glücklicherweise nicht der Fall war. Stattdessen grinste ihn das Mädchen nur frech an, griff dann mit der Rechten in einen Korb und warf dem Jungen mit einem wortlosen Augenzwinkern etwas Rotes, Rundes und Doppelfaustgroßes zu.
Automatisch fing Peter das Ding auf – und hielt den größten Apfel, den er je gesehen hatte, in den Händen. Reflexartig hob er zum Dank die Hand, riss sich dann kopfschüttelnd vom Anblick des sich langsam entfernenden Wagens los und marschierte weiter in Richtung Stadt.
Immerhin hatte er schon fünf Dinge aus seiner ersten Begegnung mit den Einheimischen des – wie war das? Elf-Stämme-Landes? – gelernt. Erstens: Er verstand ihre Sprache. Zweitens: Die Gegend hier war offenbar nicht ungefährlich und die Einwohner wachsam – denn anders war es ja wohl kaum zu erklären, dass ein junges Bauernmädchen ihrer Familie mit einem Bogen Geleitschutz gab. Drittens: Wollte er nicht anecken, bis er – hoffentlich sehr, sehr bald – wieder zu Hause war, sollte er überaus vorsichtig sein und besser nicht fremde Leute anstarren. Viertens: Hm, ja, die Mädchen hier konnten offenbar gefährlich sein, aber auch – Peter errötete innerlich und fragte sich, wie er ausgerechnet jetzt darauf kam – sehr hübsch und nett. Und fünftens: Die Äpfel hier schmeckten wirklich ganz fantastisch! Peter tropfte der Saft vom Kinn, als er immer wieder gierig große Stücke aus der Frucht biss – er hatte gar nicht gemerkt, wie hungrig und durstig er gewesen war.
Eine Weile später kamen ihm, im gemessenem Trab, zwei Reiter auf braunen Pferden entgegen, ähnlich wie der Bauer gekleidet, aber zusätzlich ausgestattet mit dicken Lederwesten und Lederkappen, unter denen ihr langes Blondhaar hervorquoll. Dass sie, in ledernen Scheiden, auch Kurzschwerter von den Hüften hängen hatten und aus Futteralen an den Flanken der Pferde je ein langer Bogen – im Gegensatz zu dem einfachen und glatten Holzbogen des Mädchens allerdings reich mit Schnitzereien verziert – herausragte, wunderte Peter kaum noch. Der Junge nahm seinen Mut zusammen und wagte, mit möglichst wenig Starren, ein höfliches »Guten Tag«, und zu seiner Erleichterung erntete er von beiden ein freundliches Kopfnicken, von einem sogar die Worte »Gute Straße, junger Wanderer« – das schien hier wohl eine Art Grußformel zu sein. Auf jeden Fall war es beruhigend, dass es hier offenbar auch freundliche, umgängliche Menschen gab.
Vom nächsten flachen Hügel aus sah er ganz in der Nähe eine Kreuzung, und von da an wurde es offenbar etwas belebter: Der Weg, auf dem er sich der Stadt näherte, war der schmalste und wohl am wenigsten genutzte. Nach den drei anderen Seiten zu waren die Straßen etwa fünf Meter breit. Und die Straße, die – dem Stand der Sonne entsprechend – nach Süden führte, sowie die Straße in Richtung Stadt waren sogar mit schweren Steinplatten gepflastert. Wirklich stark war der Verkehr nicht, aber ein paar Reiter, Pferde- und Ochsenkarren waren hier unterwegs und sogar eine sechsköpfige Gruppe in Baumwollkutten gehüllter Fußgänger, die in geschlossener Formation eilig voranstrebte.
Was Peter dagegen nicht sah, waren Autos oder irgendeine andere Art von motorisiertem Fortbewegungsmittel, nicht mal ein Fahrrad. Und er hätte sein letztes Hemd verwettet – oder vielleicht eher das letzte Hemd jenes anderen Jungen? –, dass er auch an allen anderen Orten dieser seltsamen Welt mit spitzohrigen Mädchen keine Motoren oder ähnliches finden würde. Mit einem Seufzer marschierte er weiter auf die Stadt zu und hoffte, bald anzukommen. Er war ja eigentlich ganz gut zu Fuß, doch langsam erschöpfte ihn der Marsch – zumal nach seiner kräftezehrenden Reise durch Wasserbaumstämme nach... wohin auch immer. Vor allem aber wollte er endlich ein paar Antworten bekommen, und wenn darunter auch die Antwort wäre, wie er denn um Himmels Willen bloß wieder nach Hause kommen würde, dann könnten ihm das ganze Elf-Stämme-Land, sämtliche seltsamen Prophezeiungen dieser komischen Welt und, ja, sogar alle hübschen Mädchen, die es hier geben mochte, gestohlen bleiben.
Die Stadt, das wurde immer deutlicher, war wohl eher ein sehr groß geratenes Dorf oder allenfalls eine Kleinstadt auf einem lang gestreckten Hügel. Umgeben allerdings von einer durchaus wehrhaft wirkenden, etwa vier Meter hohen Stadtmauer. Und nach allem, was Peter bisher gesehen hatte, dachte er erst gar nicht daran, dass es sich bei der Mauer lediglich um ein Relikt aus vergangenen Tagen handelte, das man nur aus Denkmalschutzgründen und für Touristen stehen ließ. Dazu hätte auch nicht gepasst, dass am offenen Stadttor zwei Wachen mit Brustpanzern, eisernen Kappen und gefährlich aussehenden Lanzen mit 30 Zentimeter langen, leicht dolchartig gekrümmten Spitzen postiert waren. Und auf einem kleinen Türmchen auf dem steinernen Torbogen stand ein weiterer Wachmann, der locker eine gespannte Armbrust in der rechten Armbeuge hielt. Aber die beiden am Tor, der eine wohl gut über 50, der andere allenfalls 25 Jahre alt, unterhielten sich gelassen miteinander und nickten einem Reiter, der vor Peter durch das Stadttor ritt, nur kurz zu. Also marschierte auch Peter einfach auf das Tor zu und blieb, ermutigt von der freundlichen Begegnung mit den beiden Reitern, bei den Wachen stehen, um sich vorsichtig zu räuspern und zu fragen: »Entschuldigen Sie, diese Stadt hier, ist das, äh, Rú-tan?«
Die Wachen wandten sich ihm zu und sprachen etwa zehn Sekunden kein Wort, während sie Peter verwundert anstarrten, sodass es ihm schon ganz heiß und kalt den Rücken runterlief. Doch schließlich wandte sich der Ältere grinsend an den Jüngeren und sagte: »Lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Prinz Schuhputzer sucht sicher bloß wieder ein Opfer für seinen Unsinn.« Dann tat er erschrocken und rief: »He! Vielleicht hat er uns ja nur abgelenkt, um unsere Stadt zu klauen!...« Kurz schaute er über die Schulter zurück »... nein, sie ist noch da.«
Der Jünger musste nun kichern und meinte, mit einem Blick auf Peter, zu seinem Gefährten: »Vielleicht können wir ja auch hoffen, dass ihm endlich mal jemand derart ordentlich auf den Kopf gehauen hat, dass er seine eigene Stadt nicht mehr erkennt – und verschwindet?« Und zu Peter gewandt: »Mach, dass du weiterkommst, oder ich könnte diesen Job mit dem Kopfnuss-Verteilen selbst übernehmen!« Dabei stieß er den Lanzenschaft einmal heftig auf den Boden, doch seine Stimme klang eher belustigt und freundlich. So war Peter zwar überzeugt, dass es wohl keine echte Drohung gewesen war, doch er wollte lieber nichts riskieren, zog den Kopf ein und ging eilig weiter. Und natürlich war er überaus verwirrt. Offenbar war er in der richtigen Stadt. Aber... wieso seine Stadt? Und vor allem: Wie konnte es sein, dass die beiden ihn zu kennen schienen????
Doch er wurde schnell abgelenkt durch das Treiben in dem Städtchen, das er gerade betreten hatte. Selbst das Suchen nach Antworten schien in diesem Augenblick nicht mehr so wichtig. Unglaublich! Irgendwie erinnerte es ihn an ein mittelalterliches Stadtbild – und so doch wieder nicht. Zum einen wirkte hier alles echt, nicht wie in einem alten, aber sanierten Stadtkern, in dem es eben doch moderne Schaufenster und elektrisches Licht gibt. Zum anderen sah man hier auch so etwas wie einen eigenen Baustil: Die zwei- bis dreigeschossigen Häuser waren aus groben, vermörtelten Steinquadern zusammengesetzt, wobei sich in der Horizontalen immer eine dünne mit einer dicken Mörtelschicht abwechselte. Und offenbar war dem Mörtel irgendein Farbstoff beigemengt worden. Jeder Hausherr schien eigene Farbtöne zu bevorzugen – und es war wirklich alles vertreten: vom klassisch grauen Mörtel bis hin zu ritzerot, grasgrün oder hellblau vermauerten Häusern.
Auffällig war auch, dass es ziemlich viele freistehende Häuser gab. Bei ihm zu Hause hätte man das im Mittelalter vermutlich als grobe Platz- und Energieverschwendung angesehen. Zudem wusste Peter, dass in den mittelalterlichen Städten Europas die Straßen auch als Kloaken herhalten mussten: Man war damals regelrecht durch Dreck gewatet, und der Gestank wäre wohl von einem modernen Menschen nicht zu ertragen gewesen. Doch hier war es, na ja, nicht gerade das, was seine Mutter als penibel reinlich bezeichnet hätte, aber im Großen und Ganzen sauber, und vor allem: Die Luft war frisch. Vielleicht daher die vielen Lücken zwischen den Bauten? Um den Wind ungestört zwischen den Häusern hindurch pfeifen zu lassen. Die Dächer waren Flachdächer, was einem aus der Ferne, bei flüchtigem Hinsehen, durchaus entgehen konnte, denn auf den meisten Dächern gab es noch zeltartige Konstruktionen aus buntem Stoff.
Die Straßen waren mit Steinplatten gepflastert und hatten eine kaum merklicher Neigung nach innen, denn in der Mitte jeder Straße verlief ein kleiner Graben, der nur in Kreuzungsbereichen und in der Höhe einmündender Straßen unter Steinplatten verlief. Bürgersteige gab es nicht.
In den Erdgeschossen vieler Häuser waren Ladenlokale untergebracht. Die von steinernen Rahmen eingefassten Türen und Fenster – manche unter einem geraden Sturz, manche unter Bögen – waren breit und einladend. Eine Ordnung nach Handwerkern schien es hier nicht zu geben, die verschiedensten Gewerke und sonstige Geschäfte waren quer durcheinander gewürfelt. Sonderbar geschwungene Schriftzeichen auf manchmal schlichten, manchmal reich bemalten Holztafeln, die ein gutes Stück über Kopfhöhe in die Straßen hineinragten, verkündeten offenbar, was es in dem jeweiligen Laden gab. Peter konnte die Schrift allerdings nicht lesen. Da stand zum Beispiel »Trillerlops und Hühner«, dort »Berols Töpferwaren« und auf dem nächsten Schild.... Heeeeeh! Peter blieb wie angewurzelt stehen und musste, entgegen aller guten Vorsätze, doch wieder starren. Wenigstens nicht auf Menschen, sondern auf diese Schilder. Wie war das möglich? Sein Verstand teilte ihm ganz zweifelsfrei mit: Du kennst diese Schriftzeichen nicht, sie haben nicht die kleinste Ähnlichkeit mit unserem Alphabet. Und trotzdem hatte er nicht die geringste Mühe, den Sinn hinter der Schrift zu erkennen. Wenn die ganze Geschichte bisher schon absolut verrückt war, so wurde es nun wirklich unheimlich. Vielleicht sollte er, statt ziellos und staunend durch die Straßen zu streifen, doch möglichst schnell versuchen, diesen Xavox zu finden? Genug Leute, die er fragen konnte, liefen jedenfalls herum.
Fast alle Erwachsenen waren recht hoch gewachsen. Die meisten von ihnen trugen Kleidung aus Wolle oder Leinen, manche teilweise aus Leder. Auch die Frauen und Mädchen trugen Hosen. Röcke schienen hier unbekannt.
Unter den meist dunkelhaarigen Bewohnern dieser Stadt waren immer wieder einzelne Menschen mit langen, hellblonden Haaren, die ganz besonders groß zu sein schienen. Im Andenken daran, wie ihn der Bauer, der zum gleichen Volksstamm zu gehören schien, von seinem Ochsenkarren aus angefaucht hatte, trat Peter lieber auf einen für hiesige Verhältnisse wohl eher kleineren, braunhaarigen Mann mit roten Pausbacken zu. Er war gerade damit beschäftigt, eine kleine Auslage vor seinem Laden mit solchen überaus leckeren Äpfeln zu bestückten. »Entschuldigung«, Peter konnte ein leichtes Schielen zu den Äpfeln nicht vermeiden, »können Sie mir vielleicht sagen, wie ich zum Tanzenden Einhorn komme?«
»Hmmm, warte mal, junger Freund...«, sagte der Mann, der nun freundlich zu ihm rüberblickte, »mein Weg hat mich erst vor ein paar Wochen nach Rú-tan geführt, aber ich meine, die Kneipe ist im Blutviertel zu finden.... ist aber kein, äh, sehr gutes Viertel. Wenn du einen preiswerten Gasthof suchst, so was gibt’s auch hier in der Nähe.«
»Danke für den Hinweis, äh, werter Herr, aber ich muss leider zum Tanzenden Einhorn, um jemanden zu treffen.«
»Nun, du musst es wissen. Also: Geh einfach noch zwei Straßen weiter, dann wendest du dich nach rechts und hältst die Richtung immer ein. Nach etwa zehn Minuten erreichst du einen größeren Platz mit etlichen Söldner-Schenken. Dann bist du schon im Blutviertel. Auf dem Platz fragst du am besten noch mal nach dem Einhorn, das muss ganz in der Nähe sein.«
»Vielen Dank für die Auskunft und viel Glück mit Eurem Geschäft«, sagte Peter, um die Freundlichkeit des Mannes zu erwidern.
Beim Stichwort »Geschäft« schien dem Mann etwas einzufallen, und er fragte hastig: »Willst du nicht noch ein paar Äpfel kaufen?«
»Ich würde wirklich gerne«, antwortete Peter mit einem langen Seufzer und einem sehnsüchtigen Blick auf die prallen Früchte, »aber ich fürchte, ich habe keinen einzigen Cent in der Tasche.«
Der Händler zog kurz die Augenbrauen hoch und entgegnete leicht verwirrt: »Was sind, äh, ›Cent‹? – Bist wohl auch nicht von hier, was? Na, wie auch immer, hier«, – damit warf er Peter einen Apfel zu – »und wenn du mal Geld in der Tasche hast, denk an mich und kauf was in meinem Laden.«
»Gerne«, sagte Peter aufrichtig, von der Freundlichkeit des Mannes überrascht, und fühlte sich schon etwas besser, weil Großzügigkeit im Elf-Stämme-Land offenbar nicht die Ausnahme war. Und während er in Richtung Blutviertel marschierte, aß er den Apfel samt Krutzen und Kernen. Und vor lauter Genuss merkte er nicht, dass die Häuser nach und nach einfacher, schließlich schäbiger wurden und inzwischen auch einiges an Dreck und Müll in den Straßen lag.
Als er den beschriebenen Platz erreichte, war es später Nachmittag geworden. Schon lange, bevor er aus der Straße herausgetreten war, hatte er ein lautes Gewirr rauer Stimmen gehört, immer wieder unterbrochen von noch lauterem Lachen, Fluchen und Streiten. Etwa in der Mitte des nur annähernd runden, knapp siebzig Meter durchmessenden Platzes sprudelte eine Quelle in ein flaches Steinbecken und lief durch einen in Granitplatten gefassten Graben in die andere Richtung ab. Ja, der Ort war recht belebt, denn vor mehreren Gasthäusern, nicht wenigen Spelunken und einer Handvoll Ställe standen und saßen etliche Kerle und ein paar Frauen an grob zusammengezimmerten Holztischen, mit Krügen in den Händen oder vor sich. Sie trugen verschiedene... ja, was? Das schienen so was wie Uniformen zu sein. Manche hatten Brustharnische oder Kettenhemden an, alle hatten sie Schwerter an den Hüften, auf den Tischen und Bänken lagen Helme, an den Wänden lehnten Schilde und Speere, Bögen und Armbrüste. Nun denn.
Peter trat auf den Platz hinaus. Und da er eigentlich überhaupt keinen dieser Bewaffneten ansprechen wollte, schien es ihm auch egal zu sein, wen er nun tatsächlich fragte. Ein paar Meter vor ihm, etwa zwischen Mitte und Rand des Platzes, stand eine Gruppe von vier Männern in schwarzen Lederuniformen – sah ganz schön wild aus –, die offensichtlich in ein Gespräch vertieft waren. Der Größte, geradezu ein Riese, dem ein langer, dünner Zopf vom Kopf hing, hatte Peter den mächtig breiten Rücken zugekehrt, mit der Linken hob er gerade einen Holzkrug an die Lippen, in dem man problemlos eine Katze hätte ersäufen können.
»Entschuldigung, können Sie mir vielleicht sagen, wie ich...«
Das »wie ich...« war nur noch lahm von Peters Lippen getröpfelt. Oh nein, hier stimmte irgendetwas ganz und gar nicht, das war klar.
Den drei etwas kleineren dieser Leder-Typen, die nun in Peters Richtung blickten, waren bei seinem Anblick sämtliche Gesichtszüge entgleist, und ihre Kinnladen hingen weit nach unten. Alarmiert durch die Reaktion seiner Begleiter fuhr der Große blitzschnell herum, während seine Rechte schon den Griff seines Kurzschwertes berührte, und...
er prustete Peter eine Ladung Bier ins Gesicht, während ihm sein rechtes Auge – das linke war hinter einer ledernen Augenklappe verborgen – schier aus der Höhle springen wollte.
Dann folgten dem Bierschwall noch etliche Speicheltropfen, als der Riese ein zornbebendes »Duuuu!!!!« brüllte, nun tatsächlich sein Schwert herausriss und Peter, ohne den Krug abzustellen, ganz offensichtlich einhändig halbieren wollte.
Der konnte sich vor Entsetzen keinen Millimeter rühren und wäre sicher eine Sekunde später in zwei verschiedenen Richtungen zu Boden gesunken. Wäre nicht ein langer, aber etwas weniger breiter Typ aus der Vierergruppe dem Riesen mit aller Macht und beiden Händen in den Schwertarm gefallen, um ihn zurückzuhalten. Hätte der Riese nicht – um den Schwertarm frei zu haben – links den Bierkrug gehalten und den Hieb zweihändig führen können, ohne Zweifel wäre Peter nun trotz des Eingreifens jenes langen Kerls eine gespaltene Persönlichkeit gewesen.
Der Lange rief: »Nein, Rolli...«Dieser Riese hieß Rolli? Unglaublich. »... doch nicht hier, wo es alle sehen.«
Der Große schnaubte, wischte die Hand des anderen beiseite, und entgegnete, noch immer vor Zorn bebend: »Zwei Monate haben wir diesen kleinen Prinzen-Bastard gejagt. Wir sollten ihn längst in die Erde geschickt haben. Und ich habe es satt, dass er uns immer wieder ein Schnippchen schlägt. Wenn er sich schon entblödet, zu uns zu kommen, dann mache ich ihm jetzt auch gründlich den Garaus.« Ein Dritter aus der Gruppe, der die gleichen rostrotbraunen Haare und die gleiche Hakennase wie der Vierte hatte – sie mussten wohl Brüder sein – mischte sich nun, ebenfalls sein Schwert lockernd, auch ein: »Hey, Tior, lass Rolli nur machen. Wir haben keine Lust mehr, hinter dem Hosenscheißer durchs Gebüsch zu kriechen. Und wenn’s noch länger dauert, bekommen wir am Ende das Blutgeld gekürzt. Außerdem: Glaubst du wirklich, es schert hier irgendjemanden, wenn wir diese kleine Ratte zu ihren Ahnen-Ärschen schicken? Und selbst wenn: Rolli ist Hauptmann der Lederkrieger, wer wollte ihm widersprechen oder gar vorwerfen, dass er nicht rechtens gehandelt habe?«
Peter stammelte: »Also, ich finde schon, Herr Rolli sollte auf seinen Freund, Herrn Tior, hören, und, äh, kennen wir uns...?«
Aber die anderen schienen gar nicht auf Peter zu achten, und, noch schlimmer, Tior machte nur kurz ein nachdenkliches Gesicht, zuckte schließlich mit den Schultern und meinte: »Nun, was soll’s? Ist vielleicht wirklich nicht so wichtig, wo dieser Wicht seine Gedärme verteilt.«
Auch Peters entsetztes »Also, ich würde meine Gedärme am liebsten nirgends verteilen, und das wär mir schon wichtig, irgendwie...« blieb ohne Beachtung.
Stattdessen ließ Rolli sein Schwert drei Mal locker ums Handgelenk kreisen, während er mit einem bösen Lächeln vor Peter hintrat und leise vor sich hinmurmelte: »Hmmm, Kopf ab, Bauch aufschlitzen oder doch lieber halbieren...?« Dann nahm er noch einen Zug aus seinem Bierhumpen, den er nach wie vor in der Linken hielt, und holte mit dem Schwert aus...
***
»Ach du herrje! Mensch, Peter, was ist denn mit dir passiert?«
»Wie? Was? – Äh – ich schätze... nein, da war jemand... Hab ich...? Ich glaube, ich habe Prügel bezogen, aber ich kann mich nicht erinnern... Und wer seid ihr?«
Kante und Ali sahen sich kurz mit großen Augen an, dann trat Kante näher zu Peter hin, besah ihn sich genau und meinte schließlich: »Oh Mann! Du hast vielleicht einen Oschi von Beule auf der Stirn! Und dein Nasenbein dürfte hin sein. Setz dich und lehn dich gegen den Baum, ich mache mein Handtuch feucht, dann kannst du's auf die Beule drücken... äh... und du erkennst uns wirklich nicht?«
Rétep hatte schnell geschaltet. Vielleicht konnte er ja wenigstens ein paar Vorteile aus seinem neuen Körper ziehen, musste hier nicht bei Null anfangen... Und wenn er nur im Haus von diesem Peter etwas für seine Reisekasse, nun ja, finden würde.





























