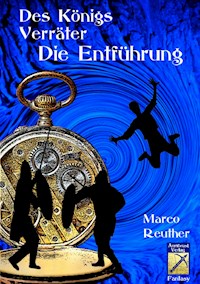Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Halana
- Sprache: Deutsch
Wie fängt man einen Zauberer? Ein nicht ganz alltägliches Problem, das die junge Kriegerin Halana lösen muss - wenn auch keineswegs freiwillig. Ihre Feinde sind der mächtige Herzog Cosa, die blutrünstige Bruderschaft der elf Gebote - und Verrat. Ihre Verbündeten sind ein schüchterner Zauberer auf der Suche nach dem Bruder des Schlafenden Gottes, ein einbeiniger Koch, eine Hebamme und ein falscher Hofnarr. Eine ideale Truppe also, um zwei Nationen und ein Kind zu retten. - Und um dorthin zu gelangen, wo niemand sein will: in den Turm des Schwarzen Herzogs. Fantasy, Abenteuer, Spannung - Aus dem NecroWeb-Magazin: "... ein Fantasy-Roman, der mit ungewöhnlichen Helden, überraschenden Wendungen und großen Abenteuern gespickt ist. Da der Autor gelungen interessante Fragen aufwirft und dunkle Geheimnisse andeutet, die erst im fortgeschrittenen Lesegenuss aufgeklärt werden, wird eine Spannung erzeugt, die bis zum Schluss bestehen bleibt. 'Lesegenuss' ist in Bezug auf Halana auch das Stichwort, denn nichts anderes bietet der erste Teil dieses Fantasy-Epos. ... Historische Roman-Bezüge finden dabei ebenso Eingang ins Werk wie emotional wirkende Schicksalsschläge, gekonnt ausgearbeitete Kampfsequenzen oder die hervorragenden Figurenkonstellationen. Auch nach der Lektüre von 'Halana und Der Turm Des Schwarzen Herzogs' hat man somit von den Erlebnissen der Kriegerin nicht genug."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Eltern Maria und Gerhard Reuther
– verdammt gut, dass Papa den Schnupfen hatte.
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Stahl und Fleisch – Das Kind aus der Todzone
Stahl und Kampf – Die Schlacht am Kleinen Horn
Stahl und Liebe – Das Verlangen und der Tod
Stahl und List – Tee gegen Schwerter
Stahl und Taktik – Der Auftrag
Stahl und Magie – Wie man einen Zauberer entführt oder bei dem Versuch scheitert
Stahl und Macht – Die Stadt der Zauberer I
Stahl und Steppe – Der Hunger des Gelb
Stahl und Staunen – Die Stadt der Zauberer II
Stahl und Menschenjagd – Flucht und Fluch der Kinder
Stahl und Schlafender Gott – Gelöste Rätsel, neue Fragen
Stahl und Angriff – Der Zug gegen den Turm
Stahl und Stahl – Vier gegen dreihundert
Stahl und Rache – Auf Leben und Tod
Stahl und Treue – Der Kampf um die Furt
Stahl und Trauer – Rrrricka gegen den Mrrr
Stahl und Suche – Das Kind
Stahl und Gefahr – Der Weg ins Ungewisse
Epilog: Stahl und Dunkelheit – Der Ritt in die Nacht
Zeittafel
Der Autor
Dank
Prolog
STAHL UND FLEISCH
Das Kind aus der Todzone
Die Wendeltreppe war steil. Als Halana und das Kind gerade die Hälfte des Weges geschafft hatten, hörten sie von unten das Bersten der Turmtüre. Als sie drei Viertel des Weges geschafft hatten, trafen sie auf zwei Wachen des Herzogs. Hinter ihnen trampelten jetzt schwere Schritte die Stufen hinauf.
»Großer Zerstörer!«, seufzte die Kriegerin, zog beide Schwerter, stellte sich mit dem Rücken dicht an die Wand und wies das Kind an: »Geh vor mir in die Hocke, kauere dich möglichst klein zusammen und schütz deinen Kopf mit den Armen.« Dann hielt sie ein Schwert treppauf gerichtet, das andere treppab und wartete auf den Angriff.
Das Pochen der Wunde in ihrem Bein erinnerte Halana daran, dass sie eigentlich nicht in der Verfassung war, gegen vier Soldaten des Schwarzen Herzogs gleichzeitig zu kämpfen. Aber die Wahlmöglichkeiten sind sehr eingeschränkt, wenn man in der Falle sitzt.
Dabei hatte sie geglaubt, der Schlinge, die Herzog Cosa nach ihr ausgeworfen hatte, schon entkommen zu sein. Doch nun schien sie sich doch noch um ihren Hals zu legen. Schlimmer noch: Oben im Turm, fast schutzlos, wartete das, was der Herzog so sehr begehrte, was er so sehr brauchte, um den nächsten Schachzug seines mörderischen Planes auszuführen. Ein Schachzug, in dem Halana der Bauer war, den man getrost opfern konnte.
Halana steckte wirklich tief in der Sch…
Ganz tief.
Und warum das alles?
Die Antwort war einfach: wegen einer Liebesnacht. Einer erbärmlichen, sinnlosen Liebesnacht, die sie in einem, in wirklich nur einem einzigen Punkt angreifbar und verletzlich gemacht hatte. Der eine Punkt hörte auf den Namen Ruff und hatte knapp zehn Monate nach jener Liebesnacht das Licht der Welt erblickt.
Sieben Jahre zuvor:
Petrinas Ohren glühten rot, ihr Mund stand offen. Obwohl sie die irdene Wasserschüssel für ihre Herrin halten musste, dachte sie einen Moment daran, angewidert das Zelt der Hebamme zu verlassen. Doch irgendwie war es auch faszinierend. Petrina, mit dunklen, kurzen Haaren, groß gewachsen und von kräftiger Statur, kam aus einer Bauernfamilie des Nordlandes. Die Bewohner waren rau wie das Land, und so war die junge Helferin mit ihren fünfzehn Jahren durchaus schon derbe Worte gewohnt. Doch dies hier… Diese schreckliche Frau beschimpfte ja sogar das Kind, das sie im Leib trug, mit übelsten Worten. Dabei mochte die junge Kriegerin, die nur mit einem kurzen, weiten Leinenhemd bekleidet vor Petrina stand, kaum älter sein als sie selbst.
Das schulterlange Haar, von dunklem Kastanienbraun und mit einem kaum wahrnehmbaren rötlichen Schimmer, klebte zerzaust an Stirn und Schläfen.
Das Gesicht, in dem man den sonnengebräunten Teint noch erahnte, war jetzt blass und verschwitzt. Krampfhaft hielt sich die Braunhaarige an einer Schlaufe der Gebärstange fest, die, an zwei Pfosten verankert, quer durchs Zelt verlief. Und sie fluchte und schimpfte nun schon fast eine Stunde ohne Unterlass in voller Lautstärke, wobei Petrina keine Wette eingegangen wäre, in dieser Zeit auch nur einen Fluch zwei Mal gehört zu haben.
Gerade hatte die junge Frau auch noch den Kindsvater verflucht, und das endete mit einer überaus plastischen Schilderung dessen, was eine reichliche Anzahl übler Krankheiten mit einem gewissen Körperteil des Mannes vollbringen möge, bevor es endlich mit Hilfe hier nicht näher zu schildernder Werkzeuge den Kontakt zu seinem Besitzer verlieren sollte.
Giula Wasserfrau, die Barbierin, Amputiererin und Hebamme dieses Feldzuges, lachte und meinte anerkennend: »Also wirklich Kindchen, das ist ja keinesfalls das erste Mal, dass ich für einen Kriegsmeister arbeite, und da bekommt man im Laufe der Zeit doch so einiges zu hören. Aber du überraschst selbst mich noch. Ich möchte jedenfalls nicht in der Haut des Mannes stecken, der dir deinen hübschen Bauch so schön gerundet hat, wenn du ihn wieder triffst.«
In diesem Moment wurde der Körper der jungen Frau von heftigen Wehen geschüttelt, und sie schrie: »Jaaa! Wenn ich den verdammten Bastard – der Große Zerstörer soll ihn holen – wenigstens wiedererkennen würde!«
Petrina machte noch größere Augen. Selbst Giula zog eine Augenbraue hoch, während sie die Stirn der jungen Kriegerin mit einem feuchten Lappen abtupfte und entgegnete: »Nun, das überrascht mich jetzt wirklich, Kindchen… Halana, nicht? Also, ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass du blind bist…«
»Wirklich komisch!«, brüllte Halana die Hebamme an, dann ebbten die Wehen ab, und sie zischte: »Ich war nicht blind, und sicher auch nicht vor Liebe… ich war bloß betrunken… das erste Mal in meinem Leben…«
»Wie alt bist du denn?«
»Achtzehn. Glaub ich jedenfalls.«
»Achtzehn?«, sagte die Hebamme, und diesmal schwang ein wenig Wärme in ihrer Stimme mit, »und schon bei einem Kriegszug dabei? Und du glaubst nur, dass du achtzehn bist? Vom Alter her… bist du ein Kind der Todzone?«
Von dort, wo Petrina stand, hörte man erschrockenes Luftholen, während die Tonschüssel mit einem dumpfen Scheppern auf dem Boden zersprang.
»Dummes Ding!«, herrschte Giula das Mädchen an, »möchte gar nicht wissen, was man euch Bauerntrampeln für Geschichten über die Todzone erzählt. Die Kinder von dort spucken jedenfalls kein Feuer und fressen auch kein Eisen, und sie bluten wie wir – sie haben halt bloß keine Eltern. So, jetzt hol eine neue Schale, und mach schnell die Sauerei da weg. Wir wollen doch nicht, dass Halanas Kleine in die Tonscherben plumpst.«
»Danke!«
»Danke?«, fragte Giula überrascht, »wieso bedankst du dich, Halana?«
»Wenn die Leute von meiner Herkunft erfahren, zucken die meisten zurück. Manche sagen zwar, es sei ihnen egal, aber ich glaube ihnen nicht. Dir glaube ich.«
»Danke gleichfalls«, sagte nun Giula, während sie hinter Halana trat, sanft die verspannten Nacken- und Schultermuskeln der jungen Frau lockerte und dabei die feste Muskulatur einer Kriegerin unter ihren Fingern spürte, »doch wenn ich in meiner Profession nicht wüsste, dass es nur darauf ankommt, wer man ist, und nicht, woher man kommt, dann wäre ich wahrlich dumm – und ich hoffe, das bin ich nicht. Aber du wolltest erzählen, warum du nicht weißt, wie der Vater deines Kindes aussieht?«
»Wollte ich das?«, entgegnete Halana, doch fast lächelte sie trotz aller Erschöpfung. Dann grunzte sie: »Aah! Das tut gut!«, während Giulas Daumen links und rechts ihrer Wirbelsäule entlangstrichen. Und Halana erzählte: »Letzten August, als der Südwolfsgau noch abtrünnig war, hatte es einen Kampf am Ostrand der Wolfsebene gegeben. Du hast vielleicht gar nicht davon gehört, denn zur selben Zeit gab es auch eine größere Schlacht gegen das Vogtland, da ist unser Scharmützel wohl untergegangen. Für den König war es vermutlich auch keine große Sache. Doch für uns, die wir daran beteiligt waren und Freunde verloren haben, war es das schon. Und für mich erst! Es war mein erstes echtes Gefecht nach meiner Ausbildung zur Kriegerin. Und wir haben gewonnen! Tunefa, mein Kriegsmeister, der verrückte Bastard, war den Wolfsgauern drei Tag lang ausgewichen und hatte sie in dem Glauben gelassen, dass wir auch diesen Tag kampflos verstreichen ließen. Doch als die Sonne schon fast den Boden traf, sind wir aufgesessen und mit einem einzigen großen Keil mitten in die Wolfsgauer reingeprescht. Sie wurden so überrumpelt, dass sie sich kaum richtig formieren konnten. Der Kampf dauerte nicht lange, und sie ergriffen die Flucht, und ich…«. Halana schwieg und starrte ins Leere.
»Und du?«, half Giula mit leiser Stimme nach.
Halana blickte nach unten, wo sie nur die Wölbung ihres Bauches sah, und flüsterte: »Und ich habe zwei Männer getötet. Es ging so schnell. Der erste hatte es noch geschafft aufzusitzen. Unsere Schilde rasselten aneinander. Doch noch bevor sich unsere Klingen auch nur ein einziges Mal gekreuzt hatten, hatte sich mein Schwert schon, zwischen unseren Schilden hindurch, in seinen Bauch gebohrt. Hätte er doch nur sein Kettenhemd noch angehabt… er sah so erstaunt aus, als er vom Pferd rutschte. Der zweite…«, Halana schluckte, »drei Mal trafen sich unsere Klingen, und ich glaube, er war ein guter Krieger. Doch die meisten seiner Kameraden hatten da bereits die Flucht ergriffen, und meine Schwertschwester Lusian griff ihn nun von der anderen Seite an. Als er sich ihr zuwandte, war sein Hals einen Moment ungedeckt…«
Halana schwieg erneut, dann atmete sie tief durch und sprach weiter: »Na ja, auf jeden Fall haben wir ganz ordentlich Beute gemacht, was natürlich dem Kriegsmeister gute Einnahmen bescherte und seine Laune hob. Er überließ uns etliche Krüge Wein. Im Rausch des Sieges und um zu vergessen habe ich wohl Tenufas Großzügigkeit reichlich ausgekostet – zu reichlich, offenbar. Es blieb nicht nur beim Rausch des Sieges. Die Feier wurde immer ausgelassener und muss wohl bis zum Morgen gedauert haben. Allerdings… ich hab nicht den blassesten Schimmer, was in der Zeit nach Mitternacht passierte. Da ist nur so eine ganz verschwommene Ahnung, dass ich mich irgendwann in irgendeinem Zelt albern kichernd in die Arme eines Kriegers schmiegte – na ja, gewehrt hab ich mich offenbar nicht.
Das Nächste, was ich wieder mitbekommen habe, war… nicht wirklich lustig. Ich bin mit einem grauenhaften Brummschädel aufgewacht. Aber nicht in einem Zelt, sondern nackt hinter ein paar Büschen in der Nähe des Lagers. Offenbar wollte ich mich, na ja, in Ruhe übergeben, ohne das Zelt zu versauen, bin dann aber einfach dort, wo ich war, wieder eingeschlafen. Immerhin hatte ich aus unerfindlichen Gründen mein Kleiderbündel mitgeschleppt – andererseits: Hätte ich es zurückgelassen, dann wüsste ich wenigstens, in welches Zelt ich gekrochen war. Und dann, als ich mich anzog«, sie seufzte tief, »dann bemerkte ich ein bisschen Blut… Aber ich habe bis heute nicht herausgefunden, wem ich das zu verdanken hatte. Und vielleicht weiß ja auch jener Krieger nicht mehr, was geschehen ist, denn der Wein war an diesem Abend wirklich reichlich geflossen.« Dann seufzte Halana erneut und murmelte: »Als Kriegerin mit Kind, da wird es nicht einfach, es zu etwas zu bringen.«
Giula nahm sie tröstend in den Arm und sagte: »Arme Kleine. An einem einzigen Tag den ersten Kampf, das erste Töten, den ersten Suff und den ersten Mann… und dann auch noch beim ersten Schuss ein Treffer und den ersten Balg in dir.« Doch sie sagte es mit einem sanften Lächeln, so dass Halana, wenn auch mit einem erneuten Seufzen, zurückgrinsen musste.
»Aber keine Angst«, fuhr Giula fort, »unser König ist weise und weiß, was er an den Kriegerinnen Engalands hat. Er schickt bei den Kriegszügen immer ein paar ältere Frauen mit, die die Kinder betreuen. Denn glaub mir, du bist wirklich nicht die einzige, der das Geschenk zuteil wird, neues Leben zu geben. Und du bist stark. Du wirst dir noch einen Namen als Kriegerin machen.«
»Meinst du?«
»Aber ganz sicher.«
»Du?«
»Ja?«
»Du hast vorhin von meiner ›Kleinen‹ gesprochen. Glaubst du, dass es ein Mädchen ist?«
»Natürlich. Du bist stärker als der Vater. So wie du geflucht hast, kann das nur ein Mädchen sein, da bin ich ganz sicher.«
Es war ein Junge.
Doch mit ihrer anderen Vorhersage sollte Giula recht behalten: Halana brachte es unter den Kriegern des Königs zu einigem Ansehen. Nicht sofort allerdings, ein paar Jahre sollten noch ins Land ziehen. Aber dafür hatte der Tag der Geburt ihres Sohnes, den sie doch mit solcher Angst, einsam und Kind wie Vater verfluchend, begonnen hatte, Halana auch etwas Gutes gebracht: eine Freundschaft. Die Hebamme, der die Kriegerin noch einen Tag zuvor völlig unbekannt gewesen war, hatte sich – sie wusste gar nicht so recht warum – zu dieser jungen, ungestümen Frau hingezogen gefühlt.
Schon fünf Minuten nach ihrer falschen Prognose hatten die letzten heftigen, aber glücklicherweise nur kurzen Wehen eingesetzt. Giula erkannte, dass die Zeit gekommen war. Schnell wusch sie sich nochmals die Hände, während sie ihre Helferin mit einem kurzen Kopfnicken zu der Gebärenden schickte.
Petrina trat, wie sie es schon am Beginn ihrer Dienstzeit vor drei Monaten gelernt hatte, hinter Halana und schob ihre Arme unter deren Achseln hindurch, um sie zu halten und zu stützen, während sich jeder Muskel im Körper der jungen Kriegerin anzuspannen schien und sie sich, erneut Flüche durch zusammengebissene Zähne pressend, an der Halteschlaufe fast vom Boden hochzog. Giula kniete sich derweil zwischen die gespreizten Beine der Kriegerin, brauchte aber nicht mehr zu tun, als das Kind in Empfang zu nehmen und mit dem kleinen Silbermesser, das sie zuvor aus einem Topf mit kochendem Wasser gezogen hatte, die Nabelschnur zu durchtrennen.
Der berühmte Klaps war nicht notwendig gewesen: Der kleine Junge hatte sofort und aus vollem Halse seine Ankunft verkündet, als er auch schon von Giula in ein sauberes Baumwolltuch gebettet wurde. Halana hatte sich unterdessen erschöpft auf das hinter ihr bereitstehende Feldbett sinken lassen.
Die Hebamme trat auf sie zu, blickte in ihre türkisgrünen Augen und wollte ihr das kleine krähende Bündel in die Arme legen, doch Halana machte eine abwehrende Geste und zischte: »Wirf es weg. Ich will es nicht haben!«
Die Hebamme lachte nur, legte der Kriegerin das Bündel auf den Bauch und meinte: »Zurückstopfen kann ich’s ja nun nicht mehr, also schau’s dir erstmal an.«
»Na ja,« entgegnete Halana mürrisch, »ich kann ja mal sehen, ob ich nicht die Fratze des Vaters wiedererkenne.«
Sie strich sich das verschwitzte, kaum merklich gelockte Haar aus der Stirn, zog dann das kleine Bündel vorsichtig weiter nach oben und sah ihrem Kind zum ersten Mal ins Gesicht.
Seltsam, irgendwie dachte sie plötzlich gar nicht mehr daran, dieses unter einem Flaum dunkler Haare hervorlugende winzige Gesichtchen mit den schwabbeligen kleinen Pausbacken nach irgendwelchen Merkmalen abzusuchen, die sie mit einem ihrer Kameraden in Verbindung bringen könnte. Die kleine Nase schien jedenfalls eher ihrer eigenen zu ähneln, die Lippen… konnte man wohl noch nicht sagen, ihre eigenen fand Halana jedenfalls etwas zu voll für jemanden, der das Kriegshandwerk zu seinem Beruf gemacht hatte.
Irgendwann murmelte sie: »Ich werde dich Marika nennen.«
»Äh, geht nicht«, wandte Giula etwas verlegen ein.
»Warum nicht?«
»Na ja, hat doch ’n Zipfel…«
»Oh! Na gut, dann heißt du eben Ruff.«
»Ruff?«, kam es missbilligend von Petrina, »das ist aber ein hässlicher Name!«
»Na und? Ist ja auch ein hässliches Kind. Seht doch: viel zuviel Haut für den kleinen Körper – der wirft ja richtig Falten«, doch dann gab sie Ruff ganz, ganz vorsichtig, einen zarten Kuss auf den Kopf.
»Keine Angst«, lachte Giula, »der kleine Scheißer wird schon noch in seine Haut reinwachsen. Ich frag mich allerdings, ob du genauso gut in deine neue Aufgabe hineinwachsen wirst, Kriegerin.«
»Welche Aufgabe?«
»Mutter sein!«
»Oh heiliger Zerstörer! Mutter? Ich?«
Das war der Moment, in dem Giula kopfschüttelnd seufzte und sagte: »Ich weiß zwar nicht, warum ich das jetzt tue… hör zu, Halana: Ich habe bald 48
Sommer auf dem Buckel und selbst zwei Kinder großgezogen. Solange du deinen Dienst noch nicht wieder aufnehmen kannst, wirst du bei mir bleiben, und ich bringe dir bei, wie du mit deinem kleinen Ruff umgehen musst, so dass er sogar bei dir eine Chance hat, die nächsten Tage zu überleben.«
»Das… würdest du für mich tun?«, fragte Halana ganz überrascht, die es nicht gewohnt war, dass ihr andere eine Wohltat gewährten. Doch es war der Beginn einer tiefen Freundschaft, und Halana lernte nicht nur den Umgang mit einem Baby, sondern sie saugte begierig jedes Quäntchen Wissen auf, das Giula ihr geben konnte. Und später, wenn Halana zu Kriegszügen aufbrach, dann blieb Ruff meist nicht in der Obhut der Kinderfrauen des Heerlagers, sondern bei Giula, die er »Ohm« nannte, und bei »Tante Petrina«, die in Giulas Diensten blieb.
Doch wir greifen den Ereignissen vor. Vielleicht, ich gestehe es, nur deshalb, um etwas Zeit zu schinden. Aber leider: Ich muss nun von ihm berichten. Auch wenn ich es uns gerne erspart hätte. Doch es muss sein. Denn er war es, der Blut und Zerstörung beflügelte, ihnen die Sporen gab und sie noch härter vorantrieb, als man es selbst in diesem Land gewohnt war.
Gönnen wir also Halana und ihrem Sohn noch einen kleinen Moment des Friedens und lassen Sie uns Ort und Zeit wechseln: Wir befinden uns jetzt, etwa fünf Jahre nach Ruffs Geburt, im Schwarzen Land des Herzogs Cosa, direkt in seiner Hauptstadt Vandar. Dort betreten wir die Gemächer des Herzogs in seiner Burg.
Ach so, bevor ich’s vergesse – schließlich möchte ich Sie ja nicht in die Irre führen: Das Schwarze Land, der größte Nachbar des Königreichs Engaland, heißt nicht etwa aus einer Metapher heraus Schwarzes Land, weil von dort »das Böse«
seine Finger ausstreckt und sein Unwesen treibt oder irgend so ein Unsinn. Nein, es ist viel einfacher: Das Land war früher – obwohl heutzutage ein Großteil der Flächen gerodet ist – über und über mit dunklem Tannenwald bedeckt gewesen, daher der Name. Länder an sich können ja auch gar nicht böse sein.
Menschen schon.
Der Mann, den wir gleich kennen lernen, gab sich jedenfalls alle Mühe, dem Namen »Schwarzes Land« tatsächlich eine finstere Bedeutung zu geben.
Herzog Cosa.
Herzog Cosa begehrte…
Nein, bitte vergessen Sie den letzten Satz. »Begehren« wird dem nicht gerecht, was in Cosas schwarzem Herzen brannte (und diesmal hat das
»Schwarz« nichts mit Bäumen zu tun).
Er sehnte sich…? Er verzehrte sich…? Es schrie…!
Es schrie Tag und Nacht in ihm, dieses unbändige Verlangen, diese dröhnende Wut. Das Verlangen, seine Hand auf das Land seines Nachbarn zu legen; diese Wut, dass sich König Róge VI. und seine Krieger nicht zermalmen ließen; dieses Begehren, seine Macht ins Unermessliche zu dehnen; diese brennende, sinnlose Frage, warum der König König war und er, obwohl Herrscher über ein mindestens ebenso großes Land, nur Herzog; dieser immer wieder wie ein Vulkan in ihm explodierende Drang, sich dem Großen Zerstörer durch immer neue Opfer zu beweisen, und… ja, und der rasende Zorn, dass Karandra, des Königs älteste Tochter, seinen Boten auslachte, als der in seinem Namen um ihre Hand angehalten hatte. Und bei allen Kräften des Großen Zerstörers: Wenn Ihnen Ihr Leben etwas bedeutet, dann nennen Sie den Herzog ruhig grausam, ja, nennen Sie ihn einen Schlächter, es wird ihn nicht stören, aber erwähnen Sie nie – hören Sie? –, erwähnen Sie niemals den Namen der Prinzessin in seiner Gegenwart.
Cosa war ungeduldig. Dabei hatte er mit seinen 41 Jahren noch Zeit, seine Ziele zu erreichen. Und der erste Schritt war ja bereits getan: Der Tod Kasims III., seines Vaters, hatte ihn, Cosa I., auf den Thron des Herzogtums gebracht.
Es war ein schrecklicher Unfall gewesen, der Tod des alten Herzogs. Unachtsam war er gewesen und nach dem Genuss von zuviel Wein beim Urinieren von den Zinnen des Nordwest-Turms gestürzt. Nur Cosa war in jener späten Abendstunde bei ihm gewesen. – Ja, ein Unfall war es. Denn Cosa hatte seinen Vater nicht umbringen wollen. Nein, wirklich nicht.
Aber so eine Gelegenheit…
Und böse war es doch eigentlich nicht gewesen, oder? Dessen war sich Cosa jedenfalls sicher, denn schließlich wusste ja niemand davon.
Wie? Diese Einstellung finden Sie seltsam?
Nun, viele Menschen wären überrascht, dass sie, falls sie einmal einen Blick in ihr tiefstes Inneres wagen sollten, genau diese Einstellung finden würden. Und bei Cosa fand man sie sogar ganz bestimmt. Simedi, der Philosoph, den er sich hielt, um auch seinen Geist zu schulen, hatte ihm einst folgendes Gedankenspiel zum Nachdenken gegeben: Man stelle sich vor, eines Nachts, im Schlage eines Augenblicks, würde sich, weil es dem Ewigen Zerstörer so gefiele, die Größe von jedem Ding und jedem Lebewesen auf der Welt verdoppeln. Ja, die Welt selbst und das gesamte Universum und alles darin wäre von einem Moment zum anderen doppelt so groß wie zuvor. Niemand würde es merken, denn die Größenverhältnisse aller Dinge und Tiere und Menschen hätten sich nicht geändert. Aber wenn es niemand bemerkt hat, hat es dann überhaupt stattgefunden?
Cosa hatte Simedi damals auspeitschen lassen, weil er mit solchem Unsinn seine Zeit verschwendete. Doch die Frage war ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und er beantwortete sie für sich schließlich mit »Nein!«, eigentlich hatte überhaupt nichts stattgefunden, wenn es niemand bemerkt hatte. Und war es nicht genau so mit einer bösen Tat? Wenn niemand davon wusste, dann war es doch so, als sei sie nie geschehen. Nun ja, vielleicht hatte Kasim III. den kurzen Stoß in seinem Rücken noch richtig gedeutet in den drei, vier Sekunden, die ihm blieben, bis sein Körper auf den schroffen Steinen am Fuß der Burg zerplatzt war. Aber Cosa glaubte es eigentlich nicht, weil er seinen Vater nie für besonders helle gehalten hatte – wie konnte man Herzog eines so großen Landes sein und seine Hand nicht nach Mehr ausstrecken wollen?
Herzog Cosa I. war einst ein schöner Jüngling gewesen, mit stolzem, ebenmäßigem Gesicht, starkem Kinn, gerader, aristokratischer Nase und kurz geschnittenen schwarzen Haaren. Auch als Mann wäre er sicher noch schön gewesen, doch die ständige Wut und die zornige Überzeugung, dass ihn die Hälfte der Welt hintergehen und ihn die andere Hälfte gleich umbringen würde, wenn er nicht ständig wachsam und unnachgiebig sei, hatte sein Gesicht zerfurcht und seine Mundwinkel nach unten gezogen. Ein stechender, kalter Blick wäre für seine blauen Augen sicher angemessen gewesen, doch so war es nicht. Vielmehr waren sie leer, seine Augen, verbargen die Gedanken dahinter. Nur bei seinen gefürchteten Wutausbrüchen schienen sie Flammen zu sprühen.
Herzog Cosa war auch ein großer Mann – rein körperlich gesehen: Fast 1,90 Meter erreichte er, zudem war er breitschultrig, kräftig und äußerst gewandt. Schon seit früher Kindheit trainierte er täglich mit dem Schwert und anderen Waffen, zu denen er auch seine Fäuste zählte. Als Cosa bereits mit 14 Jahren eine große Fertigkeit mit der Klinge erreicht hatte, die sogar die Kampfkunst seines älteren Bruders übertraf, tötete er innerhalb von einem Jahr zwei seiner Ausbilder und verletzte drei andere schwer, bevor ihn sein Vater endlich unter Androhung drakonischer Strafen dazu gebracht hatte, sich in den Kampfübungen besser zu beherrschen – Kasim hatte sich doch tatsächlich um diese Lakaien geschert, aber, wie gesagt, er war ja auch schwach gewesen.
Nach dem Frühstück hatte Cosa noch etwas Entspannung bei einem zitternden Bauernmädchen gesucht, das ihm ein Leibwächter zugeführt hatte. Ihr Gesicht hatte er schon in dem Augenblick wieder vergessen, als er sich von ihr abwandte. Dann verließ er, nachdem er sein Kettenhemd wieder angelegt hatte, seine Gemächer und schritt in Begleitung zweier Krieger seiner Leibgarde zum kleinen Beratungssaal. Unterwegs zwirbelte er seinen exakt gestutzten Kinnbart, der sich von Ohr zu Ohr zog. Er mochte seine neue Angewohnheit nicht, beim Nachdenken an seinem Bart zu spielen. Doch im Augenblick merkte er es gar nicht, denn in Gedanken war er schon in der Runde mit seinen Beratern.
Wieder einmal würde es darum gehen, wie es gelingen könnte, das Königreich niederzuwerfen, hinter dem dann leichtere Beute auf seine starke Hand wartete. Wieder einmal verfluchte er die ungünstige Lage seines Landes, denn es grenzte zum größten Teil an das Meer, an das Rote Gebirge und an die schier endlose Steppe. Drei kleinere Stämme hatte es einst in der Nachbarschaft gegeben, doch die hatte schon sein Urgroßvater unterworfen. Jetzt blieb, wollte man nicht über das Meer nach Altengaland oder zur Insel Kris segeln, zum Erobern nur das Königreich. Gut, man könnte auch einen nachschubtechnisch äußerst problematischen Zug durch die Steppe mit ihren barbarischen Bewohnern wagen, doch solche Raubzüge brachten, verglichen mit dem Aufwand, nicht viel ein. Nein, es musste das Königreich sein. Es sei denn natürlich, man rechnete auch… aber nein, das war ja noch nicht einmal denkbar, geschweige denn durchführbar.
Militärisch hatte er den König nicht in die Knie zwingen können, genauso wenig, wie es König Róge gelingen konnte, das Schwarze Land zu erobern.
Und der Versuch, Róges Tochter… Cosa knirschte mit den Zähnen und vertrieb den Gedanken augenblicklich. Er wollte bei der Beratung einen klaren Kopf haben. Vielleicht würde diesmal wirklich etwas dabei herauskommen.
Denn mit seinem Gold hatte Cosa sich Junas von Anselm eingekauft, den großen Taktiker und Intriganten. Es hieß, er sei jenseits des Königreichs in einer Stadt des Deunischen Städtebündnisses geboren worden, doch er verhandelte seine Dienste wie ein Söldner. Nur dass er nicht mit der Waffe, sondern mit seinem Verstand kämpfte.
Vor neun Wochen waren Junas und seine Leute in aller Heimlichkeit eingetroffen, dann hatten sie damit begonnen, Wissen zusammenzutragen. Und heute würde Junas endlich etwas bieten für sein wahrlich fürstliches Beraterhonorar: Er wollte erste Vorschläge unterbreiten, wie man das Königreich endlich von der Landkarte ausradieren könnte.
Der Herzog betrat das Beratungszimmer. Die anderen waren schon alle versammelt – natürlich waren sie das, denn wer hätte es gewagt, zu spät zu kommen?
Da war sein zwergenwüchsiger General Narsus, dann sein oberster Verwalter Klenko, neben Junas der einzige Nicht-Schwarzländer in der Runde. Klenko war einst ein Sklave auf der Insel Kris gewesen, doch sein Umgang mit der vertrackten Kunst der Zahlen und sein Händchen für das Vermehren von Münzen hatten die Aufmerksamkeit von Kasim III. erregt, der ihn in seine Dienste genommen und ihm schließlich die Freiheit geschenkt hatte. Klenkos Talent entdeckt und genutzt zu haben, war wohl die einzige wichtige Tat seines Vaters gewesen, dachte Cosa – wenn er auch die Sache mit dem Freilassen nie so recht verstanden hatte. Dann war da noch Telio, sein Berater und Schreiber schon aus der Zeit, als er nur Zweiter in der Thronfolge und noch kein Herzog war.
Eisenhand, der Befehlshaber seiner Leibgarde, war ebenfalls da, und – aber der zählte eigentlich nicht – der namenlose Hofnarr, ein gedrungener Mann mit fast schneeweißer Haut, schulterlangen weißblonden Haaren und leicht schräg stehenden Augen, Hose und Jacke aus bunten Flicken und Troddeln und mit einer flachen Lederkappe auf dem Kopf, an deren Rand ein paar Schellen angenäht waren. Das waren alle im Rat.
Nein, natürlich nicht.
Die Tür auf der anderen Seite des Raumes öffnete sich und SIE kam herein, in einem schlichten, bis auf den Boden reichenden weißen Leinenkleid und mit einer weißen Leinenhaube auf dem Kopf. Natürlich. Sie kam zu spät. Und sie wusste auch, dass sie es sich erlauben konnte.
»Mein lieber Junge!«, sagte die zierliche alte Frau zärtlich, »du bist schon da?« – die anderen zählten nicht – »vergib einer alten Närrin wie mir, die schon anfängt, die Zeit zu vergessen.« Tatsächlich war sie, und das wusste jeder hier im Raum, weit davon entfernt, senil zu sein. Auch ihre gemessenen Bewegungen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie vor Energie sprühte. Ohne eine Entgegnung abzuwarten fuhr sie gleich mit ihrer sanften Stimme fort: »Aber es scheint, ihr habt noch nicht begonnen? So lass mich vorab nur eines sagen: Wozu auch immer du dich entscheidest, mein lieber Cosa, wichtig ist vor allem – es muss blutig sein. Blutig, mit größtmöglicher Brutalität und einem Maximum an Toten, denn…«
»Großmutter! Ich kenne deinen Standpunkt gut. Wenn du uns jetzt…«
»Meinen Standpunkt?!« – Ein ob der Unterbrechung zorniger Blitz aus kleinen, dunklen Augen traf Cosa. »Junge, es ist kein Standpunkt, es ist Wissen, es ist Überzeugung, es ist Hingabe, aber sicher kein ordinärer Standpunkt.
Gib dem Großen Zerstörer, was ihm gebührt, mach ihn glücklich, und er wird auch dich glücklich machen.« Fast zärtlich fuhr sie fort: »Blut muss fließen.
Und verschwendet eure Zeit nicht mit Tropfen. Es müssen Ströme von Blut sein!«
Der Herzog seufzte so leise, dass es seine Großmutter nicht hörte. Liebrose von Burgis, die Mutter von Cosas Mutter, wandelte inzwischen gut 70 Jahre unter der Sonne des Großen Zerstörers. Allerdings hatte sie etliche Jahre ihres Lebens in Abgeschiedenheit verbracht – zumindest wusste niemand so genau, was sie in jenen Jahren getan hatte. Zwar war sie nach der Hochzeit von Kasim III. mit ihrer Tochter, Prinzessin Blau von Burgis, gemeinsam mit dieser in die Burg Vand eingezogen, doch hatte Kasim sie keine sechs Jahre später, als Cosa gerade vier Jahre alt geworden war, aus seiner Hauptstadt hinausgeworfen. Natürlich hatte man es damals nicht so genannt, doch tatsächlich war es nichts anderes gewesen: ein Rauswurf. Cosa wunderte sich noch heute, woher sein Vater die Kraft dazu genommen hatte.
Auch warum es dazu gekommen war, wurde niemals deutlich gesagt. Aber es ging das Gerücht, dass sich Liebrose an der Folterung Gefangener beteiligt habe, und Kasim sei dann der Geduldsfaden gerissen, als sie nicht nur an Verhören teilnahm, sondern ohne sein Wissen Gefangennahmen anordnete. Des Weiteren hieß es, selbst ihre eigene Tochter habe keineswegs protestiert, als Liebrose davongeschickt wurde. Zudem bekam sie die strikte Auflage, sich von der Familie fernzuhalten, so sie nicht selbst Bekanntschaft mit dem Kerker zu machen gedenke.
Dank ihres Goldes und ihrer Herkunft fand sie ohne Probleme Aufnahme in einem Haus des Ordens der Elf Gebote, der mit seinen spirituellen Diensten dafür sorgte, dass der Große Zerstörer den Menschen gewogen blieb. Doch nur wenige Tage nach dem Tod Kasims III., ihres Schwiegersohns, war sie wie selbstverständlich wieder mit einem kleinen Tross in der Burg erschienen und hatte sich ihren Platz genommen. Im Orden schien sie einiges gelernt zu haben – auch was den Umgang mit Menschen betraf. Vor allem aber war sie in jener Zeit von einer begeisterten Anhängerin zu einer geradezu glühenden und hingebungsvollen Dienerin des Großen Zerstörers geworden.
Der Einzige, der in der Ratsrunde Liebrose mit staunenden Augen und leicht spöttisch lächelnd ansah, war Junas von Anselm. Er kannte sie ja auch noch nicht wirklich, dachte Cosa und fragte ihn: »Nun, mein ›teurer‹ Berater – was sagt Ihr? Werden Eure Pläne den Wünschen meiner Großmutter entsprechen?«
Junas, etwa 45 Jahre alt und groß gewachsen, war elegant mit einem weißen Samthemd und einer grünen Brokatweste nach neuester Mode gekleidet, zu der er sogar im Saal ein passendes Barett trug. Er entgegnete gleichmütig mit seiner leisen Stimme: »Ja, verehrter Schwarzer Herzog, meine Dienste sind teuer, sehr sogar. Aber sie werden sich auszahlen. Auf die Gefahr hin, Eure werte Großmutter zu enttäuschen: Eure Eroberung könnte sogar mit einem kleinen Paukenschlag gelingen, der unter dem ersten Zuschlagen einen so heftigen Schwall an Blut hervorspritzen lässt, dass es kein weiteres Aufmucken gegen eure Macht geben wird und somit weiteres Blutvergießen gar nicht nötig ist.«
Liebrose von Burgis holte schon Luft, um zu protestieren, doch Junas, der es hatte kommen sehen, hob abwehrend die Hand und fuhr an die alte Frau gewandt fort: »Aber selbstverständlich, geschätzte Dame von Burgis, ist es dann Eurem Enkel überlassen, wie er nach dem Sieg mit seinen – hm – neuen Untertanen verfährt. Wenn er es für sinnvoll hält, sein Reich zu entvölkern und die Leute an den Großen Zerstörer zu verfüttern, bitte, das ist seine Sache.
Ich werde dann schon weitergezogen sein, mit meinem ohne Zweifel fürstlichen Lohn in der Tasche.«
»Ich weiß nicht, wie man dort, wo Ihr herkommt, zum Großen Zerstörer steht«, entgegnete die Angesprochene mit leisem, gefährlichem Grollen in der Stimme, »aber Ihr solltet hier nicht so despektierlich von seiner erhabenen Wesenheit sprechen, das kann… Folgen haben.«
»Großmutter, bitte! Der werte Junas ist unser Gast.«
»Bezahlter Gast«, war leise General Narsus leicht kieksende Stimme zu hören. Doch ein Blick des Herzogs brachte ihn zum Verstummen. Cosa, der schon langsam wieder diese Wut in sich aufsteigen spürte, weil die Runde nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hatte, fuhr ungehalten fort: »Genug jetzt mit dem Geschwätz. Junas, Ihr habt also einen Plan. So redet!«
Junas von Anselm deutete eine leichte Verbeugung an und begann: »Eure Einschätzung, die Ihr mir in unserem ersten Gespräch gegeben hattet, mein Herzog, war absolut richtig: Im offenen Krieg werdet Ihr das Königreich allein mit eurem Heer nicht niederwerfen können.«
»Ich hoffe, ich bezahle Euch nicht dafür, mir das zu sagen, was ich ohnehin schon weiß?«, warf der Herzog jetzt fast schon drohend ein, während eine blaue Ader auf seiner Stirn sichtbar wurde.
»Aber nein«, beeilte sich Junas von Anselm zu versichern und war nun nicht mehr ganz so gelassen, »ich weiß, dass es etliche Berater gibt, die so verfahren und Altbekanntes nur in wohlverbrämte Worte hüllen. Aber ich werde Euch mit Sicherheit einen ganz neuen Weg präsentieren. Um ehrlich zu sein: Ich hätte durchaus auch ein paar andere lukrative Angebote annehmen können, statt ins Schwarze Land zu reisen. Doch ein wesentlicher Bestandteil meiner Idee war mir schon länger im Kopf herumgespukt, und hier bietet sich endlich die Möglichkeit, diese überaus reizvolle Sache in die Tat umzusetzen.
Also: Direkt könnt Ihr das Königreich in einem Krieg nicht erfolgreich angehen – das haben die entsprechenden Versuche gezeigt. Die einzige mögliche Folgerung: Ihr müsst einen Umweg machen, um das Königreich in Eure Faust zu zwingen. Zuerst wird es nötig sein, einen, sagen wir mal, feindlichen Akt gegen ein anderes Nachbarland zu begehen.«
»Pah!«, Narsus konnte sich nicht länger zügeln, »glaubt Ihr wirklich, auch das hätten wir nicht schon mehrfach durchgespielt? Aber weder unsere Nachbarn jenseits des Meeres noch die Steppen- oder Berg-Stämme oder gar die Völker hinter diesen sind irgendeine Option für uns.«
»Nun«, sagte Junas mit einem selbstgefälligen Lächeln, »ich dachte auch eher an einen anderen Nachbarn.«
»Mann!«, quäkte Narsus verächtlich, »für das Gold, das man Euch in den Rachen wirft, solltet Ihr wenigstens mal unsere Landkarten studiert haben!
Wir haben keine anderen Nachbarn!«
»Doch! Doch!«, fiel der Hofnarr fingerschnippend und lachend ein, »unser werter Gast wird natürlich das Land der Zauberer meinen!«
Die Männer des Herzogs fielen in das Lachen ein, und selbst beim Herzog zeigte sich, was äußerst selten vorkam, der Ansatz eines Schmunzelns. Bis er bemerkte, dass ihn Junas nur schweigend und mit einem leisen Lächeln ansah.
»Moment mal!«, rief der Herzog verblüfft, »das ist nicht Euer Ernst, oder? – Ihr meint tatsächlich das Land der Zauberer!«
Bestürzte Blicke wandten sich Junas zu, und jeder holte Luft, um dem Berater etwas entgegenzuschleudern, als der Herzog persönlich Junas auch schon anbrüllte: »Verfluchter Bastard! Euer einziger Lohn wird die Axt des Henkers sein! Was fällt Euch ein, meine Zeit mit…«
»Stopp!« – wer sie nicht kannte, hätte nicht vermutet, dass Liebroses Stimme so laut sein konnte. »Stopp, mein lieber Enkel«, fuhr sie sanfter fort, »ich kann ja nicht behaupten, dass ich deinen Berater mag – ich habe das untrügliche Gefühl, dass er sich zu weit von der allumfassenden Fürsorge des Großen Zerstörers abgewandt hat –, aber dumm ist er nicht. Und dass das Königreich nicht mit normalen Mitteln zu bezwingen ist, musstest du ja schmerzhaft lernen. Also lass ihn ausreden. Für die Scharfrichter-Axt ist gegebenenfalls immer noch Zeit.«
Junas schluckte zwar, fuhr dann aber seinerseits verärgert fort: »Denkt ihr denn etwa wirklich, dass ich so verblödet bin und die Armee des Herzogs gegen das Land der Zauberer schicken will? Natürlich ist mir bekannt, dass es seit Generationen keinen Kontakt zu den Zauberern gab und dass jeder, der versucht hat, die Grenze zu ihrem Land zu überschreiten, den qualvollen Feuertod gestorben ist. Aber das ist es ja gerade: Stellt euch vor, diese oder eine ähnliche Waffe zu besitzen – oder gar die Zauberkraft selbst! Das Königreich Engaland hätte dem nichts, aber auch wirklich gar nichts entgegenzusetzen.«
Kurz flackerte fast so etwas wie ein sehnsüchtiger Blick in den Augen des Herzogs auf, doch dann schüttelte er den Kopf und entgegnete: »Ein wunderbarer Traum. Aber eben ein Traum. Denn wie sollen wir in das Land der Zauberer gelangen, ohne zu Asche zu zerfallen?«
»Oh, ›wir‹ werden es schon gar nicht tun, und man muss ja auch nicht immer mit einer Armee in ein Land einfallen, um zu erreichen, was man möchte. Das Zaubererland komplett erobern zu wollen, da habt Ihr natürlich recht, wäre ein völlig wahnsinniges und absolut aussichtsloses Unterfangen. Aber wenn man nur einen Apfel aus Nachbars Garten will, braucht man ja nicht gleich den ganzen Baum zu fällen.«
»Heißt?«
»Heißt: Es sollte vollkommen genügen, einen Krieger hineinzuschicken, der uns einen Zauberer fängt.«
»Was dem Krieger aber schwerfallen dürfte, da er die Entführung als Asche-Häufchen durchführen müsste«, warf der Hofnarr ein. Doch niemand lachte, und vom Herzog fing er sich, ohne dass der ihn überhaupt ansah, eine blitzschnelle und harte Rückhand-Schelle auf den Mund ein. Dann sagte Cosa zu Junas: »Inzwischen gehe ich davon aus, dass Ihr bei Euren Nachforschungen tatsächlich auf eine Möglichkeit gestoßen zu sein glaubt, mit der man einen Krieger unbeschadet in das geheime Land schicken kann?«
»Nicht jeden x-beliebigen Krieger. Aber, ja, ich denke, es wird funktionieren, auch wenn es vielleicht ein wenig dauern kann, eine geeignete Person aufzutreiben.«
Und dann breitet Junas seinen Plan vor den Anderen aus.
Als er geendet hatte, kamen zwar ein paar Einwände von Narsus, doch je länger der Herzog darüber nachdachte, umso besser gefiel ihm die Idee. Und auch falls sie scheitern sollte, wäre nicht viel verloren.
Der Schwarze Herzog gab schließlich Order, alles Notwendige in die Wege zu leiten, und er verließ mit einem seltenen Gefühl der Zufriedenheit den kleinen Ratssaal. Die Anderen folgten dem Herzog, abgesehen natürlich vom Hofnarren, der in einer Ecke kauerte und immer noch ein eigens zu diesem Zweck mitgeführtes Tuch auf seine blutenden Lippen presste.
Während des Hinausgehens wandte sich Liebrose an Junas von Anselm und meinte: »Nun, ich mag Euch noch immer nicht. Aber vielleicht hatte ich Euch zunächst unterschätzt… Seid so gut und folgt mir eine kurze Weile in meine Gemächer, ich würde gerne ein paar Fragen mit Euch erörtern.«
»Wie Ihr wünscht«, entgegnete der Berater mit leicht skeptischer Miene und folgte.
Schließlich hatten sie die Räume der alten Dame erreicht, wo sich Liebrose, gefolgt von Junas, gleich in ihre Schreibstube begab. Bei ihrem Eintreten hatte sich ein Mann erhoben, der offenbar in dem bequemen Fellsessel gewartet hatte. Viel mehr, außer dass er groß und stattlich war, konnte man nicht über ihn sagen, denn er trug einen schwarzen Umhang mit hochgezogener, weit ausladender Kapuze und zudem auf dem Gesicht eine ebenfalls schwarze Maske mit langer, spitzer, schnabelförmiger Nase. Vielleicht konnte man noch aus der Haut auf seinen Handrücken schließen, dass er den Zenit seines Lebens schon überschritten hatte. Auch seine sonore Stimme klang nicht wie die eines jungen Mannes, jedoch kräftig und befehlsgewohnt, als er jetzt ohne Umschweife die alte Frau fragte: »Wie ist es gelaufen?«
Die verneigte sich tief und antwortete: »Euer Plan beginnt, Erleuchteter. Er beginnt…«
»Gut zu hören, meine Tochter.«
Junas, in demütiger Haltung Abstand wahrend, räusperte sich leicht.
»Ach ja, natürlich«, sagte der Schwarze, »wie abgesprochen für deine Mühe…«
Damit zog er ein schweres Säckchen unter dem Mantel hervor und warf es beiläufig Junas zu. Als der es auffing, war ein helles, metallisches Klimpern zu hören.
Dann wandte sich der Maskierte nochmals an Liebrose und beschied ihr: »Da du eine treue Dienerin bist, hat es mir gefallen, deinem Wunsch zu entsprechen…«, er deutete auf eine kleine Kiste neben dem Tisch, »…das sollte deine Vorräte erst einmal aufstocken, die Sudmeister des Ordens kochen aber noch mehr davon.«
»Tausend Dank, Meister«, entgegnete Liebrose, klappte begierig den Kistendeckel auf und blickte erfreut auf eine große Anzahl mit Wachs versiegelter Tontöpfe. »Tausend Dank«, wiederholte sie und ergänzte: »Es ist nicht nur für mich. Es hilft mir auch, einen nützlichen Bauern in unserem Spiel an mich zu binden.«
»Nun, wenn es der Sache dienlich ist… doch Euch, meine Dienerin, scheint es auch gut zu tun. Euer Teint ist jedenfalls schön anzusehen.«
Die alte Frau errötete tatsächlich, während sich Anselm schnell abwandte, damit niemand die Mischung aus Übelkeit und Grinsen in seinem Gesicht sehen sollte. Der Erleuchtete lehnte sich unterdessen entspannt zurück und dachte, dass die Goldmünzen für diesen eitlen, gierigen Dummkopf und die Schmeicheleien für die schwachköpfige Greisin ein erstaunlich geringer Preis dafür seien, die Welt in Chaos und Untergang zu stürzen.
*
»Erzähl mir eine Geschichte. Erzähl vom Meer. Ich möchte etwas vom Meer hören.«
»Ach, Wieselchen, sei mir nicht böse, aber heute kann ich nicht so lange…«
»Wieso nicht?«, unterbrach die Stimme des Mädchens, die von oben aus dem schmalen Schacht kam, »und du nuschelst so…?«
Nun hörte er das Klirren der Eisenkette, dann wieder die diesmal ängstliche Stimme des Mädchens, das nun direkt vor der seitlichen Öffnung des Schachtes zu hocken schien, das Gesicht an den Eisenstab gepresst, der verhinderte, dass sie ihren Kopf in die Öffnung stecken konnte: »Er… er hat dich wieder geschlagen? Der böse Mann? Stimmt’s?«
Der Hofnarr seufzte leise durch die geschwollenen Lippen, dann versuchte er seiner Stimme einen möglichst unbekümmerten Klang zu geben und entgegnete: »Ich sag’s doch immer: schlau wie ein Wiesel. Dir entgeht nichts.
Aber sorg dich nicht, es war nicht so schlimm. Nur die Lippen sind etwas dick – das hat man halt davon, wenn man sie ab und an riskiert.«
»Das… das tut mir leid«, kam nun die zittrige Stimme aus der kleinen Zelle, »hat er dich wegen…, wegen mir…?«
»Nein, nein, Wieselchen, es gab eine Besprechung zwischen dem Herzog und ein paar Beratern, und ich hab an der falschen Stelle einen Witz gerissen.«
»Pass bloß auf dich auf! Wenn dir etwas passiert, was soll dann aus mir…«
Die restlichen Worte verstand der Hofnarr nicht, weil sie von leisem Weinen verschluckt wurden.
»Schhhh«, beruhigte er ebenso leise, »keine Angst, natürlich komme ich wieder. Jeden Tag. Bis du eines Tages wieselflink aus diesem Loch verschwunden bist.«
Das Mädchen hatte sich wieder zusammengerissen und sagte, beschämt, dass es zuerst an sich gedacht hatte: »Gut, dann geh jetzt, und ruh dich aus.
Morgen kannst du mir ja vielleicht wieder etwas erzählen.«
»Aber eine neue Lektion können wir ruhig noch durchgehen.«
»Nein«, kam es bestimmt zurück, »ich werde halt ein paar alte für mich wiederholen – ich hab ja inzwischen genug.«
»Wirklich?«
»Sicher.«
»Und du machst auch immer deine Übungen?«
»Klar. Denkst du vielleicht, ich würde stattdessen spazieren gehen? – ’tschuldigung, das hätte ich nicht sagen sollen.«
»Wieselchen, du darfst alles sagen«, seufzte der Hofnarr, dann warnte er:
»Achtung, ich schicke dir jetzt dein Essen rauf.«
Er zog an einem Seil neben dem Schacht. Von unten kam ein kleiner, nach vorne und hinten offener Kasten zum Vorschein, den er mit hohen Gefäßen bestückte. Die Gefäße passten oben genau zwischen Eisenstab und Wand hindurch. Kurz darauf kamen identische, aber leere Gefäße wieder hinunter. Dann überprüfte der Hofnarr noch vorsichtshalber – obwohl er es erst heute Morgen frisch gefüllt hatte – das Wasserfass, in das eine dünne, aus der Decke kommende Kupferröhre ragte. Er wusste, dass es über ihm, in der Turmzelle, eine Pumpe gab, und auch den »Luxus« eines winzigen Abort-Erkers in schwindelnder Höhe, so dass es dem Mädchen wenigstens erspart blieb, seine Notdurft mit dem Aufzug nach unten zu schicken. Es gab hier unten bei ihm sogar einen Kamin, dessen Abzug in drei kleinen Rohren durch eine Wand des Kerkers führte, damit es dort im Winter wenigstens nicht ganz kalt wurde.
Schließlich wollte der Herzog das Mädchen ja am Leben erhalten.
Vorerst.
Als er den Aufzug wieder versenkt hatte, fragte er schließlich durch den Schacht hinauf: »Soll ich morgen noch irgendetwas Bestimmtes mitbringen?«
»Na ja, ich… ich wachse…«
»Gut, ich werde sehen, dass ich die nächsten Wochen nach und nach ein paar Kleider nach oben schicke.«
»Und… und ein neues Buch?«, kam es fast ängstlich zurück.
Der Hofnarr seufzte innerlich. Bücher waren sehr, sehr teuer, und wenn ihn jemand erwischte, wie er eines aus der Bibliothek des Herzogs… aber dann dachte er daran, wie viel besser es dem Mädchen ging, seit er ihr das Lesen beigebracht hatte, und wie begeistert sie ihm von ihrem ersten Buch erzählt hatte, und so sagte er: »Natürlich. Ich werd sehen, was sich machen lässt.«
Fast schien es ihm, als hörte er einen dankbaren Seufzer von oben.
Dann kam ihr Abschieds-Ritual.
Der Hofnarr stellte vorsichtig einen brennenden Kerzenstummel möglichst weit am Rand auf das Dach des kleinen Aufzugs, steckte seinen Kopf seitlich in den Schacht und blickte nach oben. Dort sah er, von einer blassen, schmalen Kinderhand gehalten, einen Handspiegel erscheinen. Er lächelte nach oben in Richtung Spiegel – zum Winken war kein Platz (einmal hatte er es versucht und sich prompt den Ellbogen an der Kerze verbrannt). Dann änderte sich der Winkel des Spiegels etwas, und er konnte, kaum zu erkennen in dem trüben Licht, ein Viertel eines fast weißen Gesichts erahnen, mit einem kleinen Teil eines dichten rotbraunen Haarschopfs. Schließlich verschwand der Spiegel wieder, und die Hand tastete sich, an einem ebenso blassen Unterarm, so weit wie es nur ging den Schacht hinunter. Der Hofnarr nahm die Kerze heraus und reichte nun seinerseits mit dem rechten Arm, so weit er konnte, den Schacht hinauf, bis die Fingerspitzen von Mittel- und Zeigefinger, ganz, ganz sanft, zwei vor Anstrengung zitternde Fingerkuppen berührten.
Was hatte sich das Mädchen gefreut, als ihnen vor ein paar Wochen – fast zwei Jahre, nachdem er mit ihrer Versorgung betraut worden war – diese Berührung zum ersten Mal glückte. Und, ja, sie wuchs. Vielleicht konnten sie sich eines Tages tatsächlich die Hände reichen.
Falls sie lange genug lebte.
Und er auch. Wüsste der Herzog, dass er entgegen des ausdrücklichen Befehls begonnen hatte, mit dem Kind zu reden… die Zunge zu verlieren, wäre wohl das Freundlichste, was ihm dann passieren könnte. Und dass er ihr gar mehr Dinge als die notwendige Nahrung nach oben schickte… er wagte es nicht, darüber nachzudenken, was dann mit ihm geschehen würde. Glücklicherweise scheuten die meisten Menschen den mühsamen Aufstieg zum Turm-Kerker, und so hatten ihn schon lange keine Wachen mehr nach oben begleitet. Wozu auch? Niemand würde dem Kind eine Tür öffnen können, denn es gab keine. Die Treppe zum obersten Turmzimmer war abgerissen, das Loch in dem abgeflachten Tonnengewölbe zugemauert worden.
Schließlich zog der Hofnarr seine Hand wieder aus dem Schacht zurück, und dann kam natürlich noch ihre letzte Frage, die er jeden Abend hörte, bevor sie sich trennten: »Ach, sag mal, wie heißt du eigentlich?«
Und wie immer antwortete er: »Netter Versuch, Wieselchen, aber du weißt doch, ich habe keinen Namen.«
Dann verließ er die Kammer, die unter dem Turmkerker lag, schloss die Tür, stieg die lange Treppe hinunter und hörte nicht das leise Weinen, das nun aus dem Schacht drang. Doch in seinem Herzen wusste er davon.
1. STAHL UND KAMPF
Die Schlacht am Kleinen Horn
»Igitt! Was ist das denn für ein Fraß?«, angewidert schüttelte Lusian ihren Kopf, so dass die schwarzen, verdreckten Locken der Kriegerin nach allen Seiten flogen, während sie in den undefinierbaren Eintopf starrte, der in ihrer Holzschüssel hin und her schwappte.
»Was willst Du?«, entgegnete Halana, »ist doch eigentlich eine tolle Leistung unserer Köche, wenn man bedenkt, dass wir praktisch keine Vorräte mehr haben«, dann nahm sie selbst einen großen Schluck aus ihrer eigenen Schüssel, wobei sie ebenso angestrengt wie vergeblich versuchte, ihre Geschmacksnerven auszuschalten. Auch sie starrte geradezu vor Schmutz, was aber nach drei Wochen an der Front unter diesen Bedingungen wohl kaum anders zu erwarten war.
Die anfänglichen Sticheleien und Intrigen des Schwarzen Herzogs – wie etwa das Aufhetzen des Wolfsclans gegen den König – hatten sich längst zu einem waschechten Krieg ausgeweitet. Etwa einen Monat nach Ruffs Geburt hatte sich Halana wieder dem aktiven Dienst der königlichen Truppen angeschlossen, und jetzt, knapp zwei Jahre nachdem der kleine Hosenscheißer das Licht des Königreichs erblickt hatte und nicht mehr auf ihre Milch angewiesen war, hatte sie Ruff erstmals für längere Zeit in Giulas Obhut gelassen, um sich einem größeren Kriegszug anzuschließen. Aber die Sache war nicht ganz so gelaufen, wie sie es sich vorgestellt hatte.
Jedenfalls keineswegs so glatt und sauber wie damals im Wolfsgau. Einige der Krieger hatten es gleich als schlechtes Omen gesehen, als Fürst Rudgar, der den Kriegszug leitete, keine Woche nach dem Start des Trosses an der Ruhr erkrankt war, zurückbleiben musste und die Führung seinem noch unerfahrenen Sohn Ludgar übertragen hatte. An der Ebene des Kleinen Horns – einem Berg, der ziemlich abrupt aus dem Flachland aufstieg und erster Ausläufer eines kleinen Gebirges war – hatten sich die Heerlager schließlich gegenüber gelegen. An einem schönen, warmen Frühsommertag, der eigentlich eher dem Leben als dem Tod gehören sollte, war es zur Schlacht gekommen: Rund 1500 Krieger des Schwarzen Herzogs unter Oberbefehl von General Jam standen, in gut einem Kilometer Entfernung, etwa ebenso vielen Kämpfern des Königreichs gegenüber, dazu auf beiden Seiten mehr oder weniger 300 Mann Hilfstruppen. Es sah so aus, als würde der stärkere Schwertarm den Kampf entscheiden müssen.
Die Schlacht begann, als hätten sowohl General Jam als auch Fürst Ludgar ihre Lehrbücher über das Kriegswesen wohl studiert: Die größte Streitmacht der Fußtruppen stand jeweils im Zentrum, zu beiden Seiten von kleineren, aber weiter nach hinten reichenden Flanken-Blöcken abgesichert. Je 100 Krieger der Reiterei warteten in den Lücken zwischen Zentrum und Flanken darauf, hervorzubrechen und die Schlacht zu eröffnen. Hinter den Kriegern und vor den breit gefächerten Schanzen des gut 800 Meter zurückliegenden Lagers stand zudem eine kleine Reserve bereit. Die Bögen blieben bei diesen offenen Feldschlachten in der Regel im Lager zurück, denn seltsamerweise verspürten die Krieger beider Seiten eine gewisse Abneigung dagegen, in einen Pfeilhagel des Feindes zu laufen. Daher hatte es sich auch eingebürgert, dass die Reiterei den Schlagabtausch eröffnete. Stießen die Reiter einer Seite ins offene Feld vor und tauchten nicht gleich auf der anderen Seite die Reiter des Feindes auf, dann wurde der Angriff sogleich abgebrochen, denn dann hätte man ein Ziel für die – beliebter Trick – vielleicht ja doch lauernden Bogenschützen geboten. Es wurde erst so richtig zünftig, wenn beide Seiten ihre Reiter nach vorne warfen, wodurch Bogenschützen eher die eigenen Leute statt den Gegner treffen würden.
Die Ausrüstung der Fußtruppen ähnelte sich auf beiden Seiten: Die Kriegerinnen und Krieger trugen eiserne Brustharnische, an denen kurze Kettenröcke befestigt waren, feste Stiefel und gepolsterte, haubenähnliche Helme, von denen kurze lederunterfütterte Kettenbahnen herabhingen, die Ohren und Nacken schützen sollten. Die Helme der Schwarzländer hatten kleine Hörner an beiden Seiten, die der Engaländer ein drei Zentimeter breites, glänzendes Stahlband in der Mitte, das über die ganze Länge des Helms verlief. Unterarme, Oberarme und Schienbeine der Krieger waren mit zwei Zentimeter starken Ledermanschetten geschützt.
Die Schilde waren nur in den Größen genormt: Die Krieger des Herzogs trugen knapp einen Meter durchmessende Rundschilde, die des Königs langgezogene Sechseck-Schilde, 140 Zentimeter hoch und in der Mitte 70 Zentimeter breit. Verziert waren die Schilde dagegen ganz nach dem Geschmack der Besitzer. Viele hatten die Wappen ihres Clans darauf gemalt oder – wer es sich leisten konnte – in das Metall punzen lassen. Einige Schilde hatten auch aufwändige Gravuren, Glückssymbole oder sogar aus der Mitte herausragende Metalldorne. Halana war fast die einzige in dem Heereszug, die ihren Schild unverziert und nur glänzend blank poliert trug.
Auch die Bewaffnung der Krieger war unterschiedlich. Die meisten Kämpfer bevorzugten Schwerter, die etwas zu groß waren, um Kurzschwerter genannt zu werden, aber es gab auch Äxte, Lanzen, Morgensterne, Streitkolben und eine Art kurzen Dreizack. Unter ihrem Rüstzeug trugen die Frauen und Männer des königlichen Heeres dunkelgrüne Hosen und Hemden, die des Herzogs braune.
Die Hilfstruppen waren bunt zusammengewürfelte Haufen, die nur dadurch einer Seite zuzuordnen waren, dass sie entweder grüne oder braune Stirnbänder und Armmanschetten trugen. Dennoch waren die Krieger der Infanterie keineswegs abgeneigt, Leute der Hilfstruppen in ihrer Nähe zu haben und sie gegebenenfalls auch zu decken. Denn in Ermangelung teurerer Waffen hatten es etliche Leute aus dem Kontingent der Hilfskräfte zu einer beachtlichen Fähigkeit in der Kunst des Messerwerfens gebracht.
Die Reiter waren ähnlich wie die Fußkämpfer ausgerüstet, trugen allerdings zusätzlich Speere, die etwas länger und kräftiger als die herkömmlichen Speere des Fußvolks waren, da sie im Reiterkampf auch als Lanzen eingesetzt wurden. Zudem waren bei den Reitern die Schilde beider Parteien rund, sowie etwas kleiner und handlicher, und die Helme waren aufwändiger: in der Mitte etwas weiter in die Stirn gezogen, nach hinten um die Ohren herum bis in den Nacken ausladend, mit seitlichen Schutzscharnieren über die Schläfen. Von den Helmen der Reiter des Herzogs wehten lange Rosshaar-Büsche, von denen des Königs Federbüsche. Zudem trugen alle Reiter lange, ausladende Staubumhänge, die beim Galopp hinter ihnen her wehten.
»Ich finde die Dinger bescheuert, die sind doch nur hinderlich«, hatte Halana schon am ersten Tag ihrer Ausbildung zur Reiterin gemault.
»Ja«, hatte der alte, einäugige Ausbilder entgegnet, »aber das dient dazu, dem Gegner Angst einzujagen. Wenn der Umhang, groß und rot, beim Angriff hinter dir her weht, dann macht dich das größer.«
»Aber die Reiter des Feindes haben doch auch solche Umhänge?«
»Stimmt.«
»Was nutzen sie dann?«
Als Antwort hatte ihr der Ausbilder nur einen leichten Klaps auf den Hinterkopf gegeben und so was gemurmelt wie: »Kannst ja mal den König fragen.«
Kurz nach Sonnenaufgang hatten beide Heere, zwischen denen sanft das noch unberührte Gras wogte, ihre Positionen bezogen. Der junge Fürst Ludgar saß, mit goldverzierter Rüstung und geschützt von zehn ebenfalls berittenen Gardisten seines Vaters, zu Pferde in der vorderen Mitte des Zentrums, während die Flanken-Blöcke von erfahrenen Kriegsmeistern geführt wurden.
Ludgar spähte angestrengt zu General Jams Truppen hinüber. Immer wieder wischte er unwirsch eine seiner roten Haarlocken aus der Stirn, die unter dem Helm herausschaute und sich partout nicht zurückstopfen lassen wollte.
Plötzlich meinte Ludgar auf der anderen Seite eine Bewegung zu erkennen und gab sofort das Zeichen zur Angriffsformation. Der Hornist stieß ins Horn, die Reiter schwärmten vor das Zentrum und hatten sich, wie in vielen Übungen und Einsätzen gelernt, in wenigen Augenblicken paarweise in drei langgezogene, versetzt hintereinander liegende Reihen formiert.
Flankiert von seinen beiden Stellvertretern hatte Kriegsmeister Bagnan, der erfahrene Lanzenführer der Reiterei, seinen Führungsplatz in der Mitte der hinteren Reihe bezogen. Halana dagegen hatte ihre Position in der vordersten Reihe etwas rechts der Mitte und somit gut 100 Meter vor ihrem Anführer – die jungen, unerfahrenen Krieger waren bekanntlich am leichtesten zu entbehren und daher meist in der ersten Reihe zu finden. Halanas weiße Stute Smila schnaubte ungeduldig. Links neben ihr saß Lusian auf ihrem Rappen. Seit Halanas Schwertschwester vor einem Jahr den kleinen und den Ringfinger ihrer rechten Hand durch den Schwerthieb eines kurz darauf toten Schwarzländlers verloren hatte, bevorzugte sie im Kampf die linke Seite.
Inzwischen war es ihr auch mit viel Übung gelungen, eine perfekte Linkshänderin zu werden.
Das zweite Signal ertönte, Halana senkte ihre Lanze und wusste ohne hinzusehen, dass es ihr 199 weitere Krieger gleichtaten, bereit, die ungeschützte Seite des Schwertbruders mit dem Leben zu schützen.
Atemloses Schweigen lag über dem Schlachtfeld, nur noch vereinzeltes Schnauben der Pferde war zu hören.
Dann kam das dritte Signal.
200 Rösser schossen aus dem Stand wie ein einziges Pferd nach vorne, 800 Hufe donnerten über den Boden, Adrenalin pumpte durch 8000 Liter Pferde- und Menschenblut, als Ross und Reiter auf die Linie der Schwarzländer zurasten.
Doch… schnell hörte Halana über das Tosen hinweg Lusians Ruf neben sich: »Verdammt! Da tut sich nichts! Warum bläst der Trottel nicht ab?«
Endlich kam das Hornsignal zum Abbruch des Angriffs, aber bis die Pferde gezügelt waren, war die vorderste Reihe der Reiter schon nahe genug an der feindlichen Linie, um geübten Bogenschützen ein Ziel zu bieten. Das war den Reitern nicht entgangen, denn nicht wenige hielten während der ersten Meter des Rückzugs den Blick zurückgewandt und den Schild halb erhoben. Das brachte ihnen zwar keine Pfeile, dafür aber Gejohle, Pfiffe und spöttische Schreie der Infanteristen des Herzogs ein.
Schnaufend und schnaubend vor Anstrengung, den Adrenalinausstoss zu zügeln, ordneten sich die Reiter mit ihren Tieren wieder in der eigenen Linie ein. Doch kaum war dies geschehen, ließ Fürst Ludgar, der abermals eine Bewegung wahrgenommen hatte, erneut Signal geben, und das Spiel begann von vorne. Immerhin wurde diesmal der Angriff rechtzeitig genug abgebrochen, um die Reiter nicht mehr in unmittelbare Gefahr zu bringen.
Beim dritten Mal waren dann tatsächlich ein paar Berittene der Schwarzländer vor deren Front erschienen. Doch kaum waren die Reiter des Königs daraufhin erneut vorgeprescht, hatte sich der Gegner schnell wieder zurückgezogen. Schließlich, auf dem Rückzug vom fünften abgeblasenen Angriff – der Tag begann bereits warm zu werden –, maulte Halana lauthals zu Lusian hinüber: »Na, General Jam führt unser Bürschchen ja ganz schön vor. So langsam sollte der’s doch kapiert haben!«
»Das will ich nicht gehört haben!« – Halana hatte nicht bemerkt, dass Bagnan hinter ihr ritt. Schuldbewusstsein wollte sich aber bei ihr nicht einstellen, zumal sie sah, dass der Kriegsmeister, genauso verstaubt und verschwitzt wie sie alle, einen keineswegs glücklichen Eindruck machte. So zuckte sie nur die Schultern und meinte: »Na, wenn das so weitergeht, fallen wir vom Pferd, bevor die Schwarzen nur einen Handstreich machen müssen.«
Diesmal hatten sie sich noch nicht einmal in die Linien eingeordnet, als schon wieder wegen einiger Schwarzland-Reiter das Signal ertönte, Stellung zu beziehen. Jetzt war nicht nur von einem Reiter ein ungehaltenes Raunen zu hören, und es dauerte schon etwas länger, bis alle ihr Plätze eingenommen hatten. Halana wollte sich gerade lauthals bei Lusian beklagen. Aber in diesem Augenblick verdrängte eine unumstößliche Gewissheit alle anderen Gedanken. Sie fragte sich nicht lange, warum, doch statt loszuschimpfen zischte sie zu ihrer Schwertschwester: »Pass auf! Diesmal ist es echt!« Und schon wandte sie sich nach rechts und brüllte laut zum nächsten Reiterpaar hinüber: »Vorsicht! Konzentriert euch! Diesmal wird es ernst!«
»He! Was soll das? Wer hat dir erlaubt, hier den Anführer zu spielen? Das wird eine Strafe nach sich ziehen!«, hörten sie nun Bagnans verärgertes, aber auf die Entfernung kaum zu verstehendes Brüllen aus der hinteren Reihe.
Lusian blickte einen kurzen Moment verunsichert zu ihrer Freundin, wandte sich dann aber nach links und brüllte ebenfalls: »Achtung! Es wird ernst!«
Und noch bevor sie von Bagnans Zetern eingeholt wurden, waren die Warnrufe der beiden jungen Frauen nach beiden Seiten weitergegeben worden. Da kam auch schon das Angriffssignal.
Und diesmal formierten sich auch die Reiter von General Jam, gesellte sich zum Dröhnen der eigenen Hufe das harte Getrampel der Schwarzländer Pferde…
…das immer näher kam.
Hinter den Reitern General Jams setzten sich jetzt auch dessen Fußtruppen in Bewegung, marschierten im Eilschritt nach vorne, und Halana wusste, dass es ihre eigenen Leute genauso machen würden. Natürlich sah sie sich nicht um.
Noch 100 Meter.
Das Dröhnen ihres Blutes übertönte nahezu das rasende Stampfen der Pferde.
90 Meter.
Ihr Blick hatte sich auf ein Reiterpaar der Schwarzländer verengt, das ihr und Lusian fast auf ihrer eigenen Linie entgegenkam.
80 Meter.
Wie auf ein geheimes Kommando schwenkten die beiden Schwertschwestern komplett auf die zwei heranstürmenden Gegner ein.
70 Meter.
Die Pferde keuchten immer schwerer. Die Speere senkten sich hinter den Schilden hervor auf Stoßhöhe – auch die der Gegner.
60 Meter.
Die Hufe dröhnten. Wer mochten die beiden sein?
50 Meter.
Wer würde heute sein Blut über das gerade noch so unberührt wogende Gras verspritzen? Diese beiden oder…?
40 Meter.
Gleichzeitig gaben Halana und Lusian ihren Pferden nochmals die Sporen, forderten alles…
30 Meter.
…schrieen wild »Engalaaand«, hörten den Kriegsschrei aus 1000 weiteren Kehlen, dem sich von der anderen Seite ein heißeres, tausendfaches »Schwarzlaaand!« entgegenwarf.
20 Meter.
Körper streckten sich über Pferderücken, Schaum tropfte aus keuchenden Rossmäulern und wurde vom Wind fortgerissen, Muskeln spannten sich aufs Äußerste.
10 Meter.
Zielen, Finte…
0…
Ein ohrenbetäubendes Scheppern erfüllte das Schlachtfeld, und nicht wenige Kriegsschreie waren zu Schmerzensschreien geworden.
Halanas Widersacher hatte mit seinem Pferd im letzten Moment eine ungewöhnlich weite Ausweichbewegung nach links gemacht. Sollte das etwa eine neue Finte sein? Beinahe wäre er nicht mehr in Lanzenreichweite gewesen – beinahe. Doch Halana hatte sich fast waagerecht nach rechts und nahezu von Smilas Rücken geworfen, den Arm mit Schild und Speer in unmöglichem Winkel verdreht, die feindliche Lanze mit der Schildkante gerade noch erwischt, so dass sie haarscharf über ihrem Ohr ins Leere zischte, während ihr eigener Speer unter dem Schild des Mannes durchtauchte und ihm durch die rechte Achsel stieß.