
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Kennst Du den Unterschied zwischen Vampirelfen und Elfenvampiren? Nein? Tja, das könnte sich als Fehler erweisen. Als letzter Fehler deines Lebens, falls Du ihnen jemals begegnen solltest. Elfenvampire sind zwar manchmal etwas nervtötend, ansonsten jedoch harmlos. Wenn Du dagegen einem Vampirelf über den Weg läufst, dann beachte unbedingt eine ganz einfache Regel: Renn! Renn um dein Leben! Klara Plotzky hatte nicht darum gebeten. Dennoch ist das Mädchen mitten hinein geraten in den Kampf zwischen Elfenvampiren und Vampirelfen. Um den jungen Elfenvampir Lothingel zu retten, bleibt Klara nichts anderes übrig, als sich von ihm beißen zu lassen. Der Biss eines Elfenvampirs erweckt bei Elfen ihre Magie. Bei Menschen jedoch ... Klara muss erkennen, dass ihre neuen magischen Fähigkeiten mit höchst unerfreulichen Nebenwirkungen einhergehen. Und die kommen gerade sehr ungelegen: Unter großen Gefahren müssen sie und ihre Freunde die finsteren Kellergewölbe einer Schlossruine erforschen, sich mit sonderbaren Wesen einer fremden Welt herumschlagen und das Geheimnis des längst verstorbenen Freiherrn von Tunkelhagen ergründen, um ein Elfenreich zu retten. - Und das alles nur wegen einer Strafarbeit ... Fantasy für junge Leser von 9 bis 99: "Klara rannte um ihr Leben. Schon hörte sie die zwei Vampirelfen hinter sich. Es war wohl doch keine so gute Idee gewesen, die Beiden derart wütend zu machen. Das Mädchen mobilisierte seine letzten Kräfte, sprang über den umgekippten Tisch und die gestürzten Stühle, um in den nächsten Raum zu gelangen. Mit der Ferse trat Klara die Tür hinter sich zu und rannte zur Leiter, die nach oben, ins vierte Kellergewölbe führte. Da ihr die Hände auf den Rücken gefesselt waren, verlangte es höchste Konzentration, die schräg stehende Leiter hinauf zu steigen. Fast hatte sie es geschafft. Da hörte sie das krachende Splittern der Tür, als eine der Bestien einfach hindurch sprang. Und als dem Bersten des Holzes ein heißeres Knurren des Vampirelfs folgte, da zuckte Klara zusammen, rutschte mit dem bloßen Fuß von der letzten Stufe ab - und stürzte. Ein höllischer Schmerz durchzuckte ihren linken Knöchel, als sie auf dem Boden aufschlug. Es gelang ihr noch, sich aufzusetzen, doch als sie aufstehen wollte, sank sie laut aufstöhnend wieder zurück. Die Vampirelfen kamen näher. Langsam. Die konnten sich jetzt Zeit lassen. Ihre Beute würde nicht mehr entkommen ... " Im Internet: www.armbrustverlag.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elfenvampire: gut Vampirelfen: böse
Für meine Tochter Johanna
Ohne Dich hätte Klara nie das Licht der Welt erblickt.
Kapitelübersicht
Prolog
Die Strafarbeit
Lothingels Last
Das Buch
Lothingels List
Der verborgene Keller
Lothingels Landung
Der Biss
Der blaue Grünling und ein Zauber mit Zeh
Das Rätsel
Geister-Pflaster
Gregor
Lothingel reist ab
Nächtlicher Schulbesuch
Es wird ernst
Es wird sehr ernst
Das trojanische Schaukelpferd
Lothingels Lachen
Das Rätsel im Rätsel im Rätsel
Klaras Opfer
Der siebte Keller
Brockriss’ Schwur
Klaras Geheimnis
Fußnoten
Danksagung
Der Autor
Prolog
Klara rannte um ihr Leben.
Schon hörte sie die zwei Vampirelfen hinter sich. Es war wohl doch keine so gute Idee gewesen, die Beiden derart wütend zu machen. Wobei das Wort »wütend« vermutlich ein wenig untertrieben war. »Rasend vor Hass und Zorn« traf es besser.
Hass auf Klara.
Das Mädchen mobilisierte seine letzten Kräfte, sprang über den umgekippten Tisch und die gestürzten Stühle, um in den nächsten Raum zu gelangen. Mit der Ferse trat Klara die Tür hinter sich zu und rannte zur Leiter, die nach oben, ins vierte Kellergewölbe führte. Die Leiter stand zwar ziemlich schräg, doch da ihr die Hände auf den Rücken gefesselt waren, verlangte es höchste Konzentration, die Sprossen hinauf zu steigen. Fast hatte sie es geschafft. Da hörte sie das krachende Splittern der Tür, als eine der Bestien einfach hindurch sprang. Und als dem Bersten des Holzes ein heißeres Knurren des Vampirelfs folgte, da zuckte Klara zusammen, rutschte mit dem bloßen Fuß von der letzten Stufe ab – und stürzte.
Ein höllischer Schmerz durchzuckte ihren linken Knöchel, als sie auf dem Boden aufschlug. Es gelang ihr noch, sich aufzusetzen, doch als sie aufstehen wollte, sank sie laut aufstöhnend wieder zurück.
Die Vampirelfen kamen näher.
Keuchend schob sich das Mädchen mit dem gesunden Fuß weiter, die Augen starr auf ihre Verfolger gerichtet.
Dann stieß sie mit dem Rücken gegen die nackte Felswand.
Ihre Flucht war zu Ende.
Die Vampirelfen gingen nun langsam auf Klara zu. Sie konnten sich jetzt Zeit lassen. Ihre Beute würde nicht mehr entkommen.
Wie war Klara nur hier hinein geraten?
Genau genommen … wegen einer Strafarbeit.
1. Die Strafarbeit
»Plotzky? Du heißt wirklich Klara Plotzky? Man, was’n das für ein bescheuerter Name? – AAAAH! AU! AUA! AUTSCH! DEIN NAME IST NICHT HÄSSLICH! DEIN NAME IST NICHT HÄSSLICH!«
Klara ließ das Ohr des gut einen Kopf größeren Jungen wieder los, das sie gerade heftig verdreht hatte. Eilig sprang der Kerl zwei Schritte zurück, rieb sich die rote Ohrmuschel und starrte das Mädchen wütend an. Was erlaubte die sich? Da er wegen eines Schulfußball-Turniers nur zu Gast am Altbach-Gymnasium war, kannte er sie kaum. Diese kleine Irre konnte doch wohl höchstens in der sechsten oder siebten Klasse sein? Und mit knapp 1,50 Meter war sie nicht einmal besonders groß. Ein paar saftige Schimpfworte lagen dem Jungen schon auf der Zunge. Doch er schluckte sie wieder hinunter, als er sich das Mädchen genauer besah.
Doch sein Problem löste sich von ganz allein.
»Klara! Klara Plotzky!«, tönte es verärgert herüber.
Mit böser Vorahnung drehte sich Klara um und sah Frau Kleinschnieder auf sich zu rauschen, die heute Pausenaufsicht hatte.
»Das habe ich gesehen!«, keuchte die leicht übergewichtige Lehrerin.
Klara wollte aufbrausen: »Aber er hat doch …«
»Ja, ja«, unterbrach Frau Kleinschnieder genervt, »er hat angefangen, natürlich. Es sind immer die anderen, die mit dem Streit anfangen. Hat er dir vielleicht die Nase umgedreht, Klara Plotzky?«
Musste sie ihren Namen nun auch noch so betonen? »Nein, hat er nicht, aber er hat gesagt …«
Wieder ließ die Lehrerin Klara nicht zu Wort kommen: »So, er hat also etwas gesagt, aber nichts getan? Wie kannst du da diesem armen Jungen nur das Ohr so herum drehen? Noch dazu, wo er Gast an unserer Schule ist?«
Mit unschuldigem Augenaufschlag entgegnete Klara: »Ach? Das heißt also, Schüler meiner Schule darf ich ruhig vermöbeln? Prima, da mache ich mir doch gleich mal eine Liste.«
Einen kurzen Moment sah die Lehrerin sie verwirrt an. Dann explodierte sie.
*
Klaras Heldentat hatte ihr ein paar anerkennende Blicke anderer Schüler eingebracht. Das hatte sie aber nicht vor einer Strafe gerettet. So feixte Marietta gut gelaunt, während sie auf dem Heimweg neben Klara radelte: »Na, das hast du ja mal wieder ganz toll hingekriegt. Wie viele Stunden darfst du jetzt in der Bücherei schuften? Zwei? Ach nein, warte mal – zwei Stunden waren es ja vorige Woche, diesmal hast du’s schon auf drei Stunden gebracht.«
»Ha, ha, wirklich komisch, Marietta, ich lach’ mich ja so was von tot!«
Marietta war Klaras beste Freundin, die sie schon seit der Grundschule kannte. Zu Beginn des vierten Schuljahres war das schwarzhaarige Mädchen mit den hohen Wangenknochen und den ebenmäßigen Gesichtszügen in Klaras Klasse gekommen. Auch noch im tiefsten Winter erweckte Marietta den Eindruck, als sei sie gerade von einem zehnwöchigen Strandurlaub zurückgekehrt. Mit anderen Worten: Sie sah unverschämt gut aus, was Klara leicht verächtlich die Nase rümpfen ließ, als sie »die Neue« zum ersten Mal gesehen hatte. Und dann hatte Marietta auch noch die Frechheit besessen, Klara gleich in ihrer ersten gemeinsamen Sportstunde von ihrem unangefochtenen Völkerball-Thron zu stoßen. Mit schlangengleichen Bewegungen war das schlanke Mädchen allen Bällen ausgewichen, hatte schließlich sogar einen Ball gefangen, der selbst Tim, den stärksten Jungen der 4b, umgehauen hätte. Und dann hatte sie in derselben Bewegung Klara mit einem hammerharten Wurf abserviert, den sie noch eine Woche später als blauen Fleck auf ihrem Oberarm bewundern konnte.
Ganz klar: Nach dem Sportunterricht hatte Klara der Neuen Prügel angedroht. Doch das Mädchen mit den dunklen Augen hatte an ihrem rechten Zopf wie an einer Kurbel gedreht und dabei langsam ihre Zunge in Richtung Klara ausgefahren, dann hatte sie links gekurbelt, und die Zunge war wieder verschwunden, während sie Klara frech angrinste.
Klara konnte nicht anders, sie musste laut los kichern.
Am Nachmittag waren sie zusammen in die Eisdiele gegangen. Seit diesem Tag konnte sich Klara eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie es gewesen war, bevor sie Marietta kennen gelernt hatte. Und was für wunderbare Geschichten die sich ausdenken konnte! Ihre dunkle Haut, hatte sie erzählt, käme daher, dass ihr Großvater ein südamerikanischer Indianer vom Stamm der Yanomami[2] sei – was selbstverständlich ausgemachter Blödsinn war, aber sie dachte sich immer die tollsten Geschichten über ihren »Opa« aus.
Keine Frage, Klara würde für Marietta durchs Feuer gehen, wenn nicht sogar freiwillig in eine Stunde mit Frau Kleinschnieder (o.k., eine halbe). Aber manchmal kann einem sogar die beste Freundin auf den Geist gehen. Wie jetzt, zum Beispiel. Marietta konnte einfach nicht widerstehen, Klara bis an den Siedepunkt heran zu treiben, wenn die sich mal wieder in Schwierigkeiten gebracht hatte.
Aber es war ja leider wahr: Drei Stunden in der Schulbibliothek hatte Frau Heimchen ihr diesmal aufgebrummt, nachdem die Kleinschnieder sie bei ihrer Klassenlehrerin verpetzt hatte. Und dann sollte sie die Strafarbeit auch noch an einem Samstag, erledigen, wenn ihre Freundinnen vermutlich alle faul im Schwimmbad lagen Eigentlich konnte die Heimchen, die übrigens keineswegs zierlich wie ein Heimchen[3] sondern beeindruckende 1,85 Meter groß war, sie ja nicht dazu zwingen, samstags in die Schule zu kommen. Aber sie hatte sehr deutlich durchblicken lassen, dass Klara andernfalls mit einem Eintrag ins Klassenbuch rechnen müsste. Das wäre dann Eintrag Nummer drei. Und was das bedeuten würde, war klar: Ärger! Mächtigen, dicken, sirupzähen Ärger der Extraklasse! Also wieder mal die Schulbücherei. Die war Frau Heimchens Lieblingsprojekt. Und diesmal hatte die Lehrerin eine »ganz besondere« Aufgabe für Klara, wie sie ihr tatsächlich freudestrahlend verkündet hatte. Als würde sie ihr damit einen dicken Gefallen erweisen. Dabei ging es bloß wieder um Lesestoff, wenn auch um besonders alten: Auf der Suche nach einem Kartenständer war Hausmeister Bramel im Keller der Schule auf ein paar uralte Kisten mit Büchern gestoßen. »Was da wohl für Schätze drunter sein mögen?«, hatte Frau Heimchen sich selbst mit verträumtem Blick gefragt und dann erklärt, dass Klara die ollen Schinken (»olle Schinken« hatte das Heimchen natürlich nicht gesagt) in die Bibliothek hochbringen und vorsichtig abstauben solle.
»Wenn sie Ihnen so wichtig sind, warum schleppen Sie die verflixten Bücher nicht selbst aus dem Keller?«, hatte Klara, nein, natürlich nicht gesagt, sondern nur gedacht. Laut fragte sie dagegen: »Aber sooo alt können die Bücher doch nicht sein? Die Altbachschule ist ja kein gar so alter Kasten, oder?«
»Das stimmt nur zum Teil. Das Haus stammt zwar aus den siebziger Jahren, allerdings nur der oberirdische Bereich. Hier stand früher schon eine Schule. Als das gut zweihundert Jahre alte Haus abgerissen und eine neue Schule gebaut wurde, hat man den alten Keller einfach nochmal benutzt. Das Kellergeschoss ist zwar inzwischen zum größten Teil renoviert, doch einen großen alten Kellerraum gibt es noch, der unverändert geblieben ist und in dem noch kistenweise altes Gerümpel steht.«
Fast wäre Klara mit ihrer Strafarbeit versöhnt gewesen bei dem Gedanken, was für ein Abenteuer es werden würde, in dem alten Keller herumzustöbern. Doch die Heimchen schien ihre Gedanken zu lesen und erklärte: »Nun, Klara, für dich sind am Samstag natürlich die Bücher das Wichtigste. Drei Stunden dürften – wenn du dich ordentlich ran hältst – gerade so ausreichen, um alle Bücher herauf zu bringen und sauber zu machen. – Ich werde das selbstverständlich am Montag kontrollieren.«
So war Klaras Laune schlagartig wieder in den Keller gesunken (da! Schon wieder ein Keller!), und Mariettas wenn auch freundschaftlicher Spott hatte nicht eben zu einer Besserung beigetragen.
Schließlich hatten sich die Wege der Freundinnen getrennt. Marietta war weiter in Richtung Ortsmitte von Schlüsselbergweiler geradelt, Klara hatte mit ihrem schlanken, zitronengelben Mountainbike die Abzweigung zu ihrem Schloss genommen. Na ja, eigentlich zum Schloss ihrer Eltern. Und eigentlich auch nicht Schloss.
Etwa fünf Minuten brauchte sie von der Gabelung bis zum Ortsrand, und gut weitere zehn Minuten bis zum Schlossportal. Mehr Zeit als genug also, um ihre Wut zu pflegen über die Ungerechtigkeit von Frau Kleinschnieder und Frau Heimchen im Speziellen sowie die Schule und die Welt im Allgemeinen.
Schließlich hielt sie vor dem vier Meter breiten, zweiflügligen schmiedeeisernen Tor mit den Bronze-Spitzen. Die Torflügel waren zwischen zwei mächtigen Pfeilern aus Sandsteinblöcken aufgehängt. Schwarze Steinkrähen starrten von den Pfeilern auf Klara hinab, und wie immer empfand sie deren Blicke als ein wenig aufdringlich – und mehr als ein wenig bösartig.
Dann trat sie wieder vorsichtig in die Pedale. Sie fuhr von der mit Kies belegten Einfahrt herunter, umrundete das Schlosstor auf der rechten Seite und fuhr dahinter wieder auf den Weg zurück. Eine Mauer oder einen Zaun gab es zu beiden Seiten des einsamen Tores schon lange nicht mehr. Genauso wenig wie das Schloss selbst.
Das Schloss derer von Tunkelhagen war vor über hundert Jahren abgebrannt. Es hieß, der letzte Freiherr von Tunkelhagen habe bei irgendeinem zwielichtigen Experiment irrtümlich seine eigene Bude abgefackelt. Er selbst war dabei wohl auch ums Leben gekommen. Die praktisch veranlagte Landbevölkerung hatte dann das in sich zusammengefallene Schloss als Steinbruch genutzt. Und sie war sehr gründlich gewesen: Außer einigen überwucherten Steinbrocken, nacktem Boden und dem ein- oder anderen eingestürzten Keller war nichts mehr übrig vom Schloss.
Was dagegen noch stand, war das frühere Gesindehaus, in dem einst die Küchenangestellten und ein paar Gärtner gewohnt hatten. Das kleine, gemütliche einstöckige Steinhäuschen mit dem Strohdach und den durch Sprossen unterbrochenen Fenstern hatten Klaras Eltern von der Gemeindeverwaltung Schlüsselbergweilers gemietet. Und das recht günstig, weil sonst keiner hier raus in das denkmalgeschützte[4] Haus ziehen wollte.
Und noch etwas war vom Feuer verschont geblieben: Keine 50 Meter von Klaras Elternhaus entfernt befand sich der ehemalige Stall der Freiherren. In seiner Blütezeit hatte das Adelsgeschlecht wohl über etliche Pferde und ein paar Kutschen verfügt, denn der Stall war nicht gerade klein und hatte sogar ein Obergeschoss mit einer Remisen-Wohnung[5], die einst die Kutscher und die Pferdeknechte beherbergt hatte. Heute diente das Gebäude noch immer als Stall. Allerdings für Benzinkutschen.
Zu den vier- und zweirädrigen Bewohnern der Scheune gehörten Papas alter Panhard – eine französische Automarke, die schon lange nicht mehr gebaut wurde –, dazu sein Mofa, das er brauchte, wenn der Panhard nicht anspringen wollte. Dann waren da noch Mamas kleiner Geländewagen, die Fahrräder der Familie und ein fast schrottreifer Wohnwagen, den ihr Vater mal billig gekauft hatte, um ihn irgendwann wieder campingtauglich zu machen. Das musste ein paar Jahre vor Klaras Geburt gewesen sein, doch außer weiteren Rostflecken hatte es an dem Wohnwagen noch keine Veränderung gegeben.
Klaras Lieblingsfahrzeug im Stall war aber eindeutig das schwere Münch-Motorrad aus den 70ern, an dem ein torpedoförmiger, noch älterer Beiwagen angebracht war. Sie liebte es, im Beiwagen zu sitzen und mit Natz über die Landstraßen zu brausen. Nathan Reinhard, genannt Natz, der Besitzer des Motorrades, war Klaras Großvater, der sich in der Wohnung über dem Stall häuslich eingerichtet hatte. Das Motorrad war jedoch nicht da, als Klara ihr Mountainbike in den Stall schob. Auch der Wagen ihres Vaters fehlte. Und das Fahrrad ihrer Schwester? Klara sah sich suchend um, konnte das Rennrad aber nirgends entdecken. Lex war also auch noch nicht zurück – guuut!
Klara lief zum Haus hinüber, öffnete die knarzende alte Holztür und betrat den getäfelten Hausflur. Dann sah sie durch die offene Tür, die rechter Hand in die große Küche führte.
Jette Plotzky saß im Schneidersitz auf dem Küchentisch. Ihre langen roten Haare waren zum Pferdeschwanz zusammengebunden, ihr sommersprossiges Gesicht war konzentriert über einen großen Schreibblock gebeugt. Als sie Klaras Schritte hörte, blickte sie lächelnd auf und begrüßte ihre Tochter: »Ein Wort mit sechs Buchstaben, erster Buchstabe ein G, dritter ein L?«
Klara musste nicht lange überlegen: »Galgen!«
»Ah! Prima, Schatz. Die Frage dazu wäre dann, hmmm … Im finsteren Mittelalter konnten Verurteilte daran enden.«
»Wie wär’s stattdessen mit: Ein Platz, um Lehrer aufzubewahren?«
Jettes Stirn kräuselte sich, dann meinte sie: »Nein, das versteht keiner. – Es dauert noch ein halbes Stündchen, bis das Essen fertig ist.« Schließlich senkte sich ihre Nase wieder Richtung Schreibblock, über den nun eifrig der Bleistift wanderte.
Jette Plotzky war von Beruf Rätsel-Erfinderin. Sie arbeitete für eine Agentur, die Kreuzwort- und alle möglichen anderen Rätsel an Zeitungen und Illustrierte verkaufte. Sicher wären bald weitere Fragen von Jette gekommen, doch Klara wollte die Zeit nutzen, solange ihre ältere Schwester noch nicht zu Hause war. Sie eilte die Treppe hinauf, die von der Mitte des breiten Hausflurs nach oben führte, ging an ihrem eigenen Zimmer vorbei und stand vor der Tür zu Lex’ Zimmer, auf der ein großes Schild verkündete: »Zutritt für Eltern verboten, UND KLEINE SCHWESTERN SOLLTEN NICHT EINMAL DARAN DENKEN, HIER REIN ZU KOMMEN, WENN IHNEN IHR LEBEN LIEB IST!!!«
Klar, dass die Tür abgeschlossen war. Aber Klara hatte den Ersatzschlüssel schon in ihrer Hosentasche. Im Zimmer sah sich Klara nur kurz um. All den blassen, schmachtenden Schauspieler-Gesichtern, die ihr aus zahllosen Postern entgegen starrten, konnte sie nicht viel abgewinnen. Was sie brauchte, lag auf dem Nachttisch neben dem Bett (igitt, selbst auf die Bettwäsche waren diese bleich geschminkten Teenager aufgedruckt, in einem schwarzen Rahmen, aus dem rote Flecken herauszutropfen schienen – das sollte wohl Blut sein).
Auf dem Nachttisch lag die Vampir-Liebesschnulze, die ihre Schwester gerade am Lesen war. Na, wenn Lex ihre Bücher nicht versteckte, war sie ja wohl selbst schuld, dachte Klara, während sie das Lesezeichen herauszog, das Buch kurz zusammenpresste und es dann wahllos zwischen zwei andere Blutsauger-Romane in das Regal quetschte, das bis zum Anschlag mit Vampir-Büchern vollgestopft war.
Als Klara die Tür von Lex Zimmer wieder hinter sich abschloss, ging es ihr schon ein klein wenig besser. Was sie jetzt noch brauchte, war klar: Kurz machte sie in ihrem Zimmer Station, um ihre Boxhandschuhe zu holen, dann rannte sie wieder auf den großen, mit Steinplatten belegten Hof hinunter. Von einem starken Ast der alten Eiche, die neben dem Brunnen stand, baumelte ein prall gefüllter Sandsack herab. Den hatte Großvater Natz gleich nach seinem Einzug hier aufgehängt. In seiner Jugend hatte Natz zwei, drei Jahre lang auf Jahrmärkten geboxt (was man seiner Nase noch immer ansah), bevor er eine Boxschule und dann ein Sportstudio aufgemacht hatte. Opa hatte ihr auch einiges an der richtigen Beinarbeit fürs Boxen gezeigt, aber die war ihr im Augenblick egal. Sie wollte jetzt bloß auf diesen blöden, fiesen, ollen Sandsack eindreschen. Was sie denn auch ausgiebig tat.
Nach fünf Minuten standen ihr die ersten Schweißperlen auf der Stirn, und ihr Atem ging stoßweise. Ein sattes, dröhnendes Blubbern näherte sich vom Schlosstor her. Natz Reinhard, im Anzug und mit lederner Schutzkappe auf dem Kopf, fuhr gemächlich mit seiner Münch Mammut auf den Hof.
Natz hielt kurz neben seiner Enkeltochter, die dem Sandsack gerade – links, rechts – zwei wütende Haken verpasste, und rief ihr schmunzelnd zu: »Was ist es denn diesmal? Wieder die Schulbücherei aufräumen?«
Klaras Antwort war ein lautes Schnauben und eine heftige rechte Gerade auf den Sandsack. Natz lachte kopfschüttelnd und fuhr weiter zur Scheune.
*
Nur ein paar Minuten nach ihrem Großvater kam auch Klaras vierzehnjährige Schwester nach Hause. Ohne Klara auch nur eines Blickes zu würdigen, brachte Lex ihr Rad in den Stall und verschwand kurz darauf im Haus.
Eigentlich hatte Lex das rote Haar ihrer Mutter geerbt. Doch davon sah man seit ein paar Wochen nichts mehr. Die schulterlangen, glatten Haare waren tief schwarz gefärbt. Dazu hatte Lex eine dicke Schicht schwarzen Lidschatten aufgetragen, was einen seltsamen Kontrast zu den wachen grünen Augen bildete. Natürlich waren ihre Klamotten auch schwarz, angefangen bei der trotz Sommerhitze langärmligen Bluse über Jeans und Turnschuhe bis zu den langen, baumelnden Ohrringen. Nur ein silberfarbener Totenkopf-Anhänger und ein paar silberfarbene Ringe brachten etwas Abwechslung. Und zwei Tage lang hatte Lex kein Wort mit Jette und Nick gewechselt, als diese weder durch Betteln noch durch Drohungen zu erweichen gewesen waren, ihr eine Silberperle im linken Nasenflügel zu erlauben.
Sobald Lex an ihr vorbei geradelt war, hatte Klara ihre Boxhandschuhe abgelegt. Schließlich brauchte sie Bewegungsfreiheit, wenn … Da! Es ging schon los!
»KLAROTTE!!!!«, tönte ein zorniger Wutschrei aus dem Haus. Dann war lautes Trampeln zu hören, als jemand, mehrere Stufen auf einmal nehmend, die Treppe herunter gerannt kam. Schon stürmte Lex aus der Tür und auf ihre Schwester zu, während sie brüllte: »Du miese Ratte warst wieder in meinem Zimmer! Du hast mein Buch zugeschlagen! Warte nur, Klarotte, wenn ich dich erwische!«
Damit genau das nicht geschehen sollte, hatte Klara den Brunnen zwischen sich und ihre Schwester gebracht. Während die beiden Mädchen den Brunnen auf gegenüberliegenden Seiten umrundeten und sich belauerten, rief Klara zurück: »Ist doch egal, wenn das Buch zugeschlagen ist. Du musst ja nur irgendeins aus dem Regal ziehen und irgendwo aufschlagen, steht doch eh überall dasselbe drin.«
»Das sind sehr wohl unterschiedliche Geschichten!«
»Ach ja? Junger Vampir liebt Menschen-Mädchen, das liebt den Vampir, aber der darf sie natürlich nicht beißen. So schmachten sie sich das ganze Buch durch an, gehen auseinander, kommen wieder zusammen, während er sie zwischendrin selbstverständlich vor bösen Vampiren beschützen muss.«
»Pah, als ob so kleine Mädchen auch nur den Schimmer einer Ahnung hätten …«
Hatte die gerade »kleines Mädchen« gesagt? Gut, das tat sie immer, wenn sie Klara ärgern wollte, aber trotzdem: »Du nennst mich klein? Wer von uns beiden glaubt denn, dass es Vampire gibt? Ich oder du, Lex?«
»Nenn mich nicht Lex! Ich heiße Alexandra!«
»Früher hattest du doch auch nichts gegen Lex. Glaubst du, wenn dein Name irgendwie vornehmer klingt, ziehst du dir einen Vampir-Liebsten an Land? – Dann geh’ ich schon mal Knoblauch suchen.«
Mit einem Wutschrei beschleunigte Alexandra ihr Tempo. Klara löste sich vom Brunnen, spurtete mit einem Lachen los und verschwand, dicht gefolgt von Alexandra, hinter der Hausecke.
*
Nick Plotzky parkte den Panhard erst einmal im Hof, nahe der Haustür, damit er die Einkäufe nicht vom Stall bis ins Haus schleppen musste. Nick war ein hoch gewachsener und noch immer ziemlich schlaksiger Mann mit dunkelblonden Haaren, einem freundlichen Gesicht und einer runden Brille auf der Nase. Sein Geld verdiente er als Möbeldesigner. Oft standen ein paar von ihm entworfene Möbel zu Testzwecken bei den Plotzkys herum, was es manchmal an der ein- oder anderen Stelle in ihrem Haus etwas eng werden ließ. Auf gewisse Weise war jedoch Mamas Beruf für Klara wichtiger, denn dem verdankte sie ihre Existenz: Als Jette – damals noch Jette Reinhard – einmal mit dem Zug nach München unterwegs war, hatte sie sich in die Konstruktion eines Zahlenrätsels vertieft. So sehr, dass sie auf halber Strecke ganz unbewusst damit begonnenen hatte, ihren Sitznachbarn mit Fragen zu löchern. Irgendwann hatte sie dann mal aufgesehen, den jungen Mann richtig betrachtet und ihn recht nett gefunden. Eine Folge davon war, dass sich 16 Jahre später zwei Mädchen um ein Haus herum jagten.
Als Nick gerade zwei große Tüten aus dem Kofferraum wuchtete, kam seine jüngste Tochter um die Ecke geschossen und rief ihm im vorbeirennen keuchend ein fröhliches »Hallo Paps!« entgegen. Nick hatte noch keinen Schritt Richtung Tür getan, als auch schon seine ältere Tochter heran gerast kam.
»Hallo, Liebes«, sagte Nick, bekam ein kurzatmiges »Hi, Papi« zurück, und brachte die Einkäufe zur Tür.
Noch ein weiteres Mal rasten die Schwestern ums Haus. Als sie dann zum dritten Mal die Vorderfront erreichten, war Klaras Vorsprung schon deutlich geschrumpft. Doch da erschien eine Frauenhand aus dem Küchenfenster, die eine Druckluft-Tröte hielt, wie sie gerne auf Fußballplätzen benutzt wird. Ein ohrenbetäubendes, Nebelhorn-ähnliches Kreischen erklang, und die Schwestern bremsten im vollen Lauf, während ihre Mutter rief: »Wascht euch Kinder, gleich gibt’s was zu futtern!«
»Bin – pffff – bin auch schon am Verhungern!«, keuchte Klara, während sie ins Haus schlenderte, dicht gefolgt von Lex, die ebenso außer Atem hervor stieß: »Das nächste Mal krieg ich dich! – Was gibt es denn, Mama?«
Klara kicherte: »Vermutlich Bluuuuut-Suppe!«
»Aaach, hör schon auf Klarotte. – Da kommt ja Opa!« Die Tröte war auch im gut 50 Meter entfernten Stall nicht zu überhören.
Während sie zum Händewaschen ging, fragte sich Klara, ob ihre Schwester wohl tatsächlich an die Existenz von Vampiren glaubte. Man stelle sich das mal vor: Vampire in Schlüsselbergweiler! Was für ein Unsinn.
2. Lothingels Last
Lothingel knurrte der Magen.
Warum in aller Welt hatte er sich auch so weit von zu Hause weg gewagt? Beinahe wäre er Atumbrass’ Schergen in die Hände gefallen. Ihm schauderte noch jetzt, wenn er daran dachte: Die Harkans-Krähen hatten ihn erspäht, als er über freies Feld geritten war, und dann musste wohl auch noch ein Trupp von Atumbrass’ Jägern ganz in der Nähe auf der Lauer gelegen haben. Wobei, nur um das klarzustellen, diese »Jäger«, wie Atumbrass XIII. sie selbst nannte, keineswegs Jagd auf so etwas wie Hasen oder Rehe machten, oh nein!
Atumbrass’ Schnüffler machten Jagd auf eine ganz andere Beute: Sie bevorzugten Elfen – und natürlich auch solche Leute wie ihn, Lothingel.
Die Krähen hatten jedenfalls nicht weit fliegen müssen, um ihren Verrat zu begehen. Nur seinem Pferd Ziesewind hatte es Lothingel zu verdanken, dass er noch lebte. Kein Wunder, dass Ziesewind schneller als die anderen Pferde gewesen war, denn schließlich stammte der Hengst aus der Rasse der Meer-Pferde. So war Ziesewind, wie die meisten Meer-Pferde, schwarz wie die Nacht mit schneeweißen Flecken. Aber so schnell sein Pferd auch sein mochte, so war es doch verdammt knapp gewesen: Sieben der Jäger waren plötzlich hinter ihm wie aus dem Nichts aufgetaucht – wüste Gesellen, die augenblicklich hinter Lothingel her hetzten. Und dann waren schräg vor ihm noch zwei Jäger hinter einer Baumgruppe hervorgekommen, um ihm den Weg abzuschneiden. Vollends war Lothingel das Herz in die Hose gerutscht, als er erkannte, dass einer dieser Jäger Brockriss persönlich war. Brockriss, Günstling des Königs und auch dessen Cousin, war für seine absolute Erbarmungslosigkeit berüchtigt. Wenigstens war er, wohl wegen seiner Massigkeit, ein paar Meter hinter den anderen Jägern zurückgefallen.
Dann musste Lothingel sogar – was er gar nicht gerne tat – sein Schwert ziehen, und es war zu einem kurzen aber umso heftigeren Schlagabtausch mit dem vorderen der beiden Jäger gekommen. Doch schließlich war er durchgebrochen, Brockriss’ enttäuschtes Brüllen noch im Ohr. Was Lothingel dagegen nicht hörte war, dass Brockriss zehn der Harkans-Krähen zu sich rief.
Dass dieser Lothingel, mit dem er bereits einmal aneinander geraten war, schon wieder entkommen konnte, nahm Brockriss persönlich. Und so gab er den Spion-Krähen den Auftrag, nach Lothingel Ausschau zu halte. Womöglich würden sie ihn ja doch noch irgendwo entdecken.
Vielleicht war es ja ganz gut, dass Lothingel diesen Auftrag der Harkan-Krähen in diesem Augenblick nicht kannte. Denn um der Wahrheit die Ehre zu geben: Lothingel war nicht eben für seinen Mut bekannt. Was sich in diesem Fall aber auszahlte: Schon auf früheren Kundschafter-Ritten hatte er sich verschiedene Verstecke angelegt. Nachdem er seine Verfolger nun zwischen ein paar großen Hügeln mit etlichem Geröll, vielen Felsnasen und noch mehr Büschen abhängen konnte, hatte er es vorgezogen, sich unsichtbar zu machen: Vor einer kleinen Höhle hatte er etwa ein Jahr zuvor Geröll aufgehäuft und ein paar Büsche wachsen lassen, so dass nur noch ein kleiner, verborgener Durchschlupf geblieben war, durch den er Ziesewind gerade so hindurch bugsieren konnte. Und genau in dieser Höhle befand er sich gut zwei Tage später noch immer.
Dass die Zeit verging, daran erinnerte ihn sein grummelnder Magen nun immer öfter. Denn seine Vorräte waren zur Neige gegangen. Sicher, im letzten Dorf war es ihm noch gelungen, ein großes Brot zu stehlen, und von dem hatte er auch reichlich gegessen. Doch dummerweise war von seinem Vorrat an Elfenblut kein Tropfen mehr übrig. Und wenn er nicht bald frisches Elfenblut bekam, dann würde es für ihn eng werden – sehr eng sogar. Lothingel war nämlich ein Vampir. Genauer gesagt: ein Elfenvampir.
Ein Elfenvampir kann durchaus auch ganz gewöhnliche Nahrung zu sich nehmen, wie etwa eingedampften Rosen-Nektar, Honigwurst, gesottenen Sampananggarabalarugapalaupatabanang oder die beliebte Tulpen-Rittersporn-Pastete, – oder halt auch Brot. Aber ganz ohne Elfenblut geht es auf Dauer eben nicht.
Wäre die Blutlos-Grenze erst einmal überschritten, dann, das wusste Lothingel, würde er innerhalb von 30 Minuten verschrumpeln wie eine Backpflaume, schließlich zusammenbrechen und keine weitere halbe Stunde später in die Todesstarre fallen. Wann genau die Blutlos-Grenze erreicht war, das war von Elfenvampir zu Elfenvampir unterschiedlich. Manche hielten es nur zehn Tage ohne Blut aus, andere sollen es schon bis zu drei Wochen geschafft haben. Lothingel hatte seine eigene Blutgrenze noch nicht kennen gelernt – danke auch, das musste wirklich nicht sein.
Zwar konnten einen die Elfen wieder aus der Todesstarre zurückholen, aber das war eine überaus unangenehme Prozedur, auf die Lothingel gerne verzichten konnte. Ganz besonders jetzt, denn hier in dieser Höhle im Feindesland konnte die Todesstarre für ihn durchaus endgültig sein. Falls ihn nämlich hier überhaupt jemand finden sollte, dann würde es wohl kaum ein Elf sein, – jedenfalls kein wohlmeinender Elf. Am wahrscheinlichsten wäre es, dass er von umherstreifenden Tieren gefressen wurde, die auch gedörrten Elfenvampir nicht verschmähten. Und von solchen Viechern gab es durchaus genug – etwa den großen Babalug, den Scheren-Zorg oder gar – Igitt!!! – die zwölfbeinigen Zibsel. Wobei ein Ende in den Mägen vieler kleiner Zibsel vermutlich noch immer besser wäre, als König Atumbrass XIII., genannt Atumbrass der Spitznasige, in die Hände zu fallen und von ihm wieder belebt zu werden. Was der mit seinen Gefangenen anstellte … oh nein, da hörte man nichts Gutes.
Diese düsteren Gedanken gaben schließlich den Ausschlag, dass sich Lothingel vorsichtig aus seinem Versteck hervor wagte, obwohl er keineswegs sicher war, dass sich nicht doch noch ein paar von Atumbrass’ Leuten in der Gegend herumtrieben.
Auch der Gedanke an seine Ankunft in Elfenheim, der Hauptstadt Bullivells, machte ihn nicht gerade glücklich. Wieder war seine Mission erfolglos geblieben. Genauso, wie die Missionen dutzender anderer Elfen und Elfenvampire vor ihm. Wieder war er dem Schlüssel des Großen Elf keinen Schritt näher gekommen. Seit über 100 Jahren, seit jener letzte Tunkelhagen verschwunden und die Tür zu dessen Welt zugestoßen war, seit jener Zeit war es für die freien Elfen und die Elfenvampire immer schlimmer geworden. So verzweifelt war die Lage, dass man seit einigen Jahren sogar im Feindesland nach einem neuen Übergang in jene andere Welt suchte.
Bullivell, das Land, in das Lothingel jetzt mit leeren Händen zurückkehren würde, war inzwischen die letzte Bastion der Elfen und Elfenvampire, die noch dem Ansturm von Atumbrass’ Armeen trotzten. Doch wie lange würde man sich noch ohne den Schlüssel halten können?
3. Das Buch
Eigentlich war Hausmeister Bramel ja noch gar nicht so alt. Dennoch trug er meist einen ultra-altmodischen grauen Arbeitskittel über einer nicht minder aus der Mode gekommenen braunen Cordhose und einem rot kariertem Holzfällerhemd. Vielleicht sollte der locker hängende Kittel ja seinen kleinen Bierbauch verdecken. Als Bramel Arbeit im Schuldienst gefunden hatte, da hatte er auch das Rauchen aufgegeben. Obwohl das nun schon über fünf Jahre her war, kaute der hoch aufgeschossene und trotz des Bierbauchs schmale Mann fast ständig auf Süßhölzern herum[6], was er sich angewöhnt hatte, um der Nikotinsucht endlich Herr zu werden. Auch jetzt schob er eine Stange Süßholz in seinem breiten Mund zwischen leicht schiefen Zähnen hin und her, während er Klara am Samstagvormittag mit leichtem Lächeln vor der Schultür begrüßte: »Ah! Da bischt du ja. Die anderen schind schon da.«
Die anderen? Welche anderen? Klara hätte es doch sicher gewusst, wenn noch jemand aus ihrer Klassenstufe eine Strafe aufgebrummt bekommen hätte? Ihr Missmut, der sich auf dem Weg zur Schule langsam wieder aufgebaut hatte, war fast augenblicklich der Neugierde gewichen.
Sie sollte nicht lange auf die Folter gespannt werden. Als sie sich der kleinen Schulbücherei näherten, die am Ende des Ganges im Erdgeschoss lag, hörte sie schon zwei Jungs lachen und eine ihr bekannte Mädchenstimme vollendete gerade halb zornig, halb belustigt einen Satz: » …noch so’n Dummspruch Tobs, und du kannst aus der Schnabeltasse trinken!«
»Marietta!«, rief Klara überrascht, als sie die Bücherei betrat. Ihre Freundin lehnte lässig an dem Pult, auf dem der Karteikasten mit den Leihkärtchen stand. Das Jungs-Gelächter war von Tobias Hendriksen und Leo Altmann gekommen. Leo war in Klaras Klasse, Tobias in der Parallelklasse. Die beiden lümmelten sich jeder in einer Ecke des alten Lese-Sofas und schienen sich prächtig über etwas zu amüsieren, das vor Klaras Eintreffen stattgefunden hatte. Allerdings schien Leos Lächeln genau in dem Moment ein klein wenig zu verkrampfen, als Klara den Raum betrat.
Tobs war ein recht großer Kerl aus der 6a, mit fast schwarzen, glatten Haaren. Klara wusste eigentlich kaum etwas über ihn, außer, dass er im vorigen Jahr neu an die Schule gekommen war, weil seine Eltern umgezogen waren. Das hatte sie jedenfalls gehört.
Es hieß, in der Schule sei Tobs recht gut. Er könnte aber besser sein, wenn er nicht so stinkefaul wäre – sagten die Lehrer. Wobei Tobias selbst es wohl eher so sah, dass er seine Zeit für besseres als Lernen nutzen könnte. Das hing vielleicht damit zusammen, dass man ihn oft beobachten konnte, wie er irgendetwas auf dem Schulhof tauschte oder verkaufte – vom Fußball-Sticker übers Pausenbrot bis zu Computerspielen. Ansonsten erweckte er gerne den Eindruck einer gewissen amüsierten Langeweile, gepaart mit freundlichem Desinteresse. Was allerdings nicht so recht dazu passte, war das ständige Umherhuschen seiner braunen Augen.
Im Gegensatz zu Tobias war Leo nicht gerade als coole Nummer bekannt. Er war der einzige von den vier Kindern, der seinen zwölften Geburtstag noch vor sich hatte. Seine Noten gehörten zwar schon immer zu den besten in der Klasse, dennoch schien der dunkelblonde Junge mit den fragenden Augen jedes Mal erstaunt, wenn er eine Klassenarbeit mit guter Zensur zurück bekam. So mancher seiner Klassenkameraden hätte kaum etwas Nennenswertes über Leo zu berichten gewusst – nur seinen Haartick hatte schon jeder bemerkt: Jeden Morgen brachte ihn seine Mutter mit ihrem 5er-BMW an die Schule, stieg in ihrem eleganten blauen Kostüm aus, um ihm fürsorglich beim Anlegend des – erstklassigen – Rucksacks mit seinen Schulsachen zu helfen, dann gab sie ihm noch einen schnellen Schmatzer auf die Backe, bevor sie wieder abdampfte. Und jeden Morgen, nachdem der BMW hinter der nächsten Kurve verschwunden war, hatte Leo nichts Eiligeres zu tun, als sein sorgfältig gekämmtes glattes Haar mit ein paar hastigen Handbewegungen wieder zu zerwuscheln.
Natürlich freute sich Klara, dass sie nun Gesellschaft hatte. Sogar ihre beste Freundin war hier! Und nur anstandshalber schämte sie sich auch ein klein wenig, weil sie sich über das Nachsitzen der Freundin freute.
Als Klara die Bücherei betreten hatte, meinte sie gleich zu Marietta: »Wusste gar nicht, dass du auch nachsitzen musst?«
»Äh, ja«, sagte Marietta mit schnellem Blick zum Hausmeister, »das war wegen der Sache mit der Reißzwecke auf Knubbels Stuhl.«
Kopfschüttelnd nuschelte der Hausmeister: »Muss die Heimchen – äh, Frau Heimchen, mein’ ich, wohl vergessen ham’, mir Bescheid zu sagen.«
Dann sah er die beiden Jungs an und sagte: »Und was is’ mit euch? – Ach, egal, will’s gar nicht wissen, was ihr wieder ausgefressen habt. Na los, kommt, ich zeig euch wo die alten Schinken rumstehen.«
Schweigend folgten die vier Herrn Bramel den kurzen Weg zur Treppe und dann hinunter zum Keller. Der war sonst immer abgeschlossen, was wohl ein Zeichen dafür war, dass die Lehrer den Schülern gegenüber ein gewisses Misstrauen hegten – natürlich vollkommen zu unrecht. Jetzt stand die Türe aber offen. Als Bramel dann noch das Licht anknipste, flackerte es kurz, und dann enthüllten mehrere starke Neonröhren … absolut nichts Interessantes. Es war einfach nur ein langer, glatt verputzter und weiß gestrichener Gang mit ein paar Metalltüren zu beiden Seiten.
Der Hausmeister erklärte: »Die Kellerräume in dem Bereich hier sind abgeschlossen, also gebt euch erst gar keine Mühe, irgendwas auszufressen.« Dabei schien er ganz besonders Tobias anzublicken, der sich aber größte Mühe gab, so auszusehen, als würde er das nicht bemerken. Bramel fuhr fort: »Nur die Tür ganz am Ende vom Gang ist nicht verschlossen. Die führt in den alten Keller. An der rechten Wand steht eine große Werkbank, davor und darauf findet ihr die Kartons mit den alten Büchern. Und jetzt viel Spaß bei der Arbeit – aber stellt nix an, sonst gibt’s Ärger.«
Damit ließ er die Kinder stehen, stieg die Treppe wieder hinauf und machte sich auf den Weg zu … – na ja, was auch immer ein Hausmeister an einem Samstagvormittag tun mochte.
Kaum waren Bramels Schritte verklungen, sah Klara die anderen drei herausfordernd an und erklärte: »Knubbel mit Reißnagel im Hintern wär’ nicht zu überhören gewesen! Wenn auch nur einer von euch tatsächlich Nachsitzen hat, fress’ ich ’n Besen ohne Senf. Also, was wird hier gespielt?«
»Na ja«, sagte Marietta, »nachdem du so sauer wegen dem Nachsitzen warst, dachte ich mir, ich leiste dir halt Gesellschaft.«
– Mann, das ist echt Marietta, dachte Klara – »Und außerdem hat meine Skate-Verabredung kurzfristig abgesagt und mir ist nix Besseres eingefallen.« – Na gut, auch das war Marietta.
»Na danke auch, olle Knolle, dass ich für dich immerhin noch besser als Langeweile bin. – Und was ist mit unseren Jungs hier?«
»Keine Ursache, schnelle Karamelle. Und was die beiden Kerle hier wollen, weiß ich auch nicht«, entgegnete Marietta, während sie Tobias und Leo mit gerunzelter Stirn musterte, so als seien sie irgend etwa, das man sich nicht unbedingt während des Frühstücks in Blickweite wünscht.
Während Tobias noch kicherte: »Wer von euch war noch mal Knolle und wer Karamelle?«, erklärte Leo leicht unsicher: »Na Tobs kannte die Geschichte mit dem alten Keller – die hat der Brontschek neulich in der 6a erzählt. Und in unserer Klasse hat sich natürlich das mit deinem Nachsitzen rumgesprochen. Als ich dann gestern in der Pause mit Tobs über dich gesprochen habe …«
»Wie? Ihr redet über mich?«
Leo tat, als hätte er Klaras Einwurf nicht gehört. Was allerdings nicht sehr glaubhaft erscheint, wenn man dabei rot wie eine Tomate wird. Jedenfalls redete er weiter: »… da sind wir also auf die Idee gekommen, dass es vielleicht ganz spannend wäre, in dem alten Keller zu stöbern.«
Klara stieß Marietta in die Seite und flüsterte – natürlich laut genug, dass es die Jungs auf jeden Fall hören konnten: »Merkste was? Die beiden Kinder wollen Schatzsuche spielen.«
Während Marietta kicherte und es Leo tatsächlich gelang, noch roter zu werden, entgegnete Tobias schnippisch: »Na wenn ihr die Bücher lieber ohne uns hoch schleppt, bitteschön, da hab’ ich kein Problem mit. Aber kommt nachher nicht weinend angelaufen, wenn ihr einem Spinnchen begegnet.«
»Schon gut«, lenkte Marietta grinsend ein, »wir sind ja froh, dass ihr uns helft. Zu viert haben wir das Bücher-Hochschleppen schnell erledigt, und dann bleibt uns noch ordentlich Zeit, um uns da unten umzusehen. Na los, kommt, vielleicht wird’s ja wirklich ein kleines bisschen spannend.«
Zu diesem Zeitpunkt konnte Marietta natürlich noch nicht wissen, dass »ein kleines bisschen« rückblickend ganz eindeutig zur Untertreibung ihres Lebens werden würde.
*
»Boah! Schaut euch das an!«, rief Leo begeistert aus. Er war durch den Kellergang vorausgeeilt (damit man das Rot in seinem Gesicht nicht sehen sollte) und hatte die Tür zum alten Keller als erster aufgestoßen, um nach dem Lichtschalter zu tasten. Er hatte den Schalter auch schnell gefunden, doch der dicke Knubbel auf dem Gehäuse hatte sich seltsamerweise nicht kippen oder eindrücken lassen. Erst nach ein paar Sekunden war dem Jungen klar geworden, dass es sich nicht um einen modernen Kippschalter handelte, sondern dass es einer jener uralten Drehschalter aus den Anfängen der Elektrifizierung sein musste, wie er ihn noch bei seiner Urgroßmutter auf dem Speicher kennen gelernt hatte. Und als er das Ding endlich gedreht hatte und das Licht aufgeflammt war, da war es gewesen, als sei er in eine andere Welt getreten.
Es war fast ein kleiner Saal, in dem sie nun standen. Statt Neonröhren baumelten an verschiedenen Stellen trübe Glühbirnen unter verstaubten Blech-Lampenschirmen von der Decke. Die Wände bestanden, soweit zu erkennen, aus nackten, dunklen, nur grob behauenen Steinquadern. Die Decke setzte sich aus mehreren ineinander übergehenden Tonnengewölben zusammen und war aus Ziegelsteinen gemauerten. Die Gewölbebögen wurden von ebenfalls aus Ziegeln gemauerten Pfeilern getragen. Auch der Boden war mit verwitterten Ziegelsteinen belegt und im Laufe der Jahrzehnte recht holprig und buckelig geworden. Es roch ziemlich muffig hier unten – und nicht nur nach feuchten Ziegeln. Denn an allen Wänden entlang stand ein Sammelsurium aus den unterschiedlichsten Schränken und Regalen. Die Regale schienen mit einem derart großen und kunterbunt zusammengewürfelten Haufen alter Dinge überzuquellen, dass sie auf den ersten Blick gar nicht alle zu erfassen waren. Dazu standen im ganzen Raum verteilt Kisten, Tische, betagte Pulte und Stühle, und sogar ein altes, großes und sicher wertvolles Schaukelpferd hatte auf wundersame Weise seinen Weg hier herunter gefunden. Es war nachtschwarz und mit weißen Flecken lackiert, und es stand, wie auf einem kleinen Podest, auf einem auf die Seite gekippten Schrankkoffer.
»Wow!«, entfuhr es Marietta und Klara gleichzeitig, während sie ihre Blicke durch den Raum wandern ließen, doch bald ergänzte Klara: »Da! Da steht ja die Werkbank mit den Bücherkisten. Los, lasst uns das Zeug so schnell wie möglich hoch bringen, dann können wir hier unten in Ruhe auf Schatzsuche … ich meine: Dann können wir uns in Ruhe umsehen.«
»Seit wann gibst du hier eigentlich die Befehle?«, wollte Tobias wissen, der gerade noch versonnen über eine große, zusammengerollte Landkarte gestrichen hatte, die neben einem angerosteten Kartenständer an der Wand lehnte, und der darüber nachdachte, was er dafür wohl auf dem Flohmarkt bekommen würde. Klara wollte gerade zu einer wütenden Erwiderung ansetzen, als Leo seinem Freund in die Seite stieß und meinte: »Na komm schon, Tobs, dafür sind wir doch hier, oder?«
Schließlich hatte auch Tobias mit nur leichtem Widerwillen angegriffen. So hatten sie die Schätze von Frau Heimchen tatsächlich in nur wenig mehr als einer halben Stunde in die kleine Bücherei geschafft. Aber ganz schön schwer waren sie schon, diese Bücherkartons, und nicht nur ihre Hände waren bei der Arbeit schmutzig geworden, so dass Tobias maulte: »Verdammte Plackerei. Und wenn meine Mutter den Dreck an meinem T-Shirt sieht, dann gibt das Motze. Na hoffentlich rentiert sich das jetzt auch, in dem Keller.«
Diese letzte Bemerkung ließ Klara ahnen, warum dieser Tobs mitgekommen war, und sie nahm sich vor, ihn im Auge zu behalten. Dann liefen sie alle auch schon wieder in den Keller hinunter. Aber es war zu Klaras Überraschung nicht Tobias, sondern Leo, der für Aufsehen sorgte.
Kaum hatten sie den Keller erneut betreten, rief Leo übermütig: »Na endlich kann das Abenteuer beginnen! Lasst uns mit einem kleinen Ritt starten!« Mit einem »Horrido« auf den Lippen sprang er auf den Schrankkoffer und schwang sich auf das Schaukelpferd.
Nun war Leo ja ein netter Junge, aber wer nett ist, der muss nicht unbedingt geschickt sein. Und mal abgesehen davon, dass es nicht all zu cool wirkt, wenn sich ein Elfjähriger auf ein Schaukelpferd setzt, so ist es sicher ganz und gar nicht cool, wenn ihm dabei auch noch ein Unfall passiert. Das Schaukelpferd hatte ohnehin schon ziemlich am Rand des Schrankkoffers gestanden. Schon beim ersten Vorwärtswippen traf die linke Kufe des Holzpferdes den Verschlusshaken der Tür. Der Haken öffnete sich, die Tür klappte nach unten, und die linke Kufe des Pferdes hing plötzlich in der Luft – was natürlich nicht funktioniert. Während der Schrankkoffer etwas zur Seite rutschte und allerhand Plunder aus ihm heraus purzelte, kippte das Schaukelpferd samt schreiendem Reiter zur Seite.
Das Schaukelpferd hatte Glück und landete auf einem Haufen Kleider, die unter ihm aus dem Schrankkoffer gefallen waren. Der Reiter hatte weniger Glück. Leo war mit einem satten Klatschen neben dem Kleiderhaufen gelandet. Während die Mädchen besorgt neben ihm in die Hocke gingen, konnte sich Tobias gar nicht mehr einkriegen vor Lachen.
»Hast du dir was getan?«, wollte Marietta mitfühlend von Leo wissen, während Klara Tobias über ihre Schulter hinweg anzischte: »Und du willst sein Freund sein?«
Leo biss die Zähne zusammen – bloß nicht anfangen zu heulen, das würde alles nur noch peinlicher machen. Dann murmelte er: »Mein Arm … das gibt sicher einen ordentlich blauen Fleck. Aber es scheint nichts Ernstes zu sein.«
Mit einem Seufzer setzte er sich auf und verschnaufte einen Moment. Auch Tobias hatte sein Lachen inzwischen mit immerhin einem Hauch Schuldbewusstsein eingestellt. So war es plötzlich für ein paar Sekunden mucksmäuschenstill im Keller. Dann deuteten Marietta und Klara wie auf ein Kommando Richtung Schrankkoffer und sprachen gleichzeitig – allerdings verschiedenes. Während Marietta überrascht rief: »Es rauscht!«, meinte Klara: »Eine Mappe!«
Zwischen den Kleidern, die aus dem Koffer gefallen waren, ragte eine sehr große, edel wirkende Ledermappe heraus. Und als sie nun alle wieder still waren, hörten es die drei anderen auch: Unter dem Koffer schien ein kaum vernehmliches Plätschern hervor zu kommen.
»Was mag das sein?«, murmelte Klare und meinte die Mappe. Die anderen bezogen es aber auf das Rauschen, und Tobias begann schon eifrig, den großen Koffer beiseite zu schieben. Eine Sekunde später legte sich auch Marietta ins Zeug, während Leo noch seinen Arm rieb – und Klara die dicke Ledermappe aus dem Kleiderstapel fischte und an sich drückte.
Gemeinsam hatten Marietta und Tobias den Koffer schnell beiseite gerückt. Darunter kam eine etwa 80 mal 80 Zentimeter große eiserne Platte zum Vorschein, die innerhalb eines eisernen Rahmens in den Boden eingelassen war. Das Rauschen war nun deutlicher zu hören. Es kam unter der Platte hervor.
»Sowas, das hört sich ja an, als würde da unten ein Bach fließen«, meinte Leo verblüfft, während Tobias schon versuchte, die Platte anzuheben. Die war zwar ursprünglich exakt in ihren eisernen Rahmen eingepasst worden, aber im laufe vieler Jahre hatte der Rost die Kanten etwas angenagt. Natürlich bestand da ganz eindeutig die Gefahr, sich ein paar recht üble Schnitte zuzuziehen, doch Marietta und Tobias hatten schon vorsichtig ihre Finger durch solche Lücken geschoben, und gemeinsam gelang es ihnen unter Stöhnen und Keuchen, den Deckel anzuheben und schließlich zur Seite zu drücken. Dann starrten vier Gesichter über die vier Kanten des freigelegten Schachtes in die Tiefe.
Bei dem schlechten Licht im Keller war es mehr eine Ahnung als eine Gewissheit, doch da unten, in gut drei Meter Tiefe, schien tatsächlich Wasser durch einen Kanal zu fließen.
»Ob das ein Abwasserkanal ist?«, flüsterte Leo.
»Warum flüsterst Du?«, flüsterte Klara, die Mappe noch immer an sich gepresst, und ergänzte dann: »Nein, wenn das Abwasser wäre, dann würde es hier sicher anders riechen. Andererseits … ich kann es nicht genau sehen, aber ich meine fast, dass da unten ist ein gemauerter Kanal. Genauso gemauert, wie der Schacht hier. Kann es dann ein unterirdischer Fluss sein?«
Ein allgemeines Schulterzucken war die Antwort. Doch dann war es Klara selbst, die ausrief: »Aber klar! Warum hat eigentlich im Unterricht noch nie jemand diese Frage gestellt!«
»Äh. Welche Frage?«, wollte Marietta wissen.
»Na, warum unsere Schule so heißt, wie sie heißt.«
»Was soll das denn für ’ne blöde Frage sein?«, meinte Tobias, während er sich leicht an den Kopf tippte. Doch Leo rief plötzlich:
»Na klar! Altbachschule! Nur dass es hier nirgendwo einen Bach gibt!«
»Na ja, offenbar schon«, meinte Klara, nun mit der freien Hand nach unten deutend, »scheint, wir haben ihn gerade entdeckt. Aus irgendeinem Grund muss der Altbach irgendwann kanalisiert worden sein. Aber warum wurde da eine Schule drüber gebaut? Na, das wäre doch mal ein hübsches Projekt, nachzuforschen, was es mit dem Bach auf sich hat.«
»Noch besser«, rief Leo aufgeregt, »lasst uns doch mal hinunter steigen und sehen, ob es da irgendwie weitergeht!«
»Klar«, meinte Klara mit einem falschen Gähnen, »aber du gehst bitte vor. Möchte sehen, wie du das ohne Sprossen in der Schachtwand machst.«
»Oh!«, war alles, was Leo entgegnen konnte, während Marietta den Gedanken ihrer Freundin aufgriff: »Und wer weiß? Vielleicht geht das Wasser da unten ja bis zur Schachtdecke und ist tief. Und von der Strömung wirst du dann in den Schacht hinein gedrückt. Wie lange kannst du eigentlich die Luft anhalten?«
»Ja, ja, schon gut«, grummelte Leo, »war ’ne Schnapsidee.«
Schließlich kamen sie überein, die Platte mit vereinten Kräften lieber wieder an ihren Platz zu legen. Nicht, dass der gute Hausmeister Bramel hier noch ein unfreiwilliges Bad nahm.
Dann richteten sie das Schaukelpferd wieder auf und durchstöberten noch kurz die Kleider, die aus dem Schrankkoffer gefallen waren. Leo, der seinen Sturz offenbar gut verkraftet hatte, schlüpfte sogar in einen eigenartigen schwarzen Frack – eine Art Anzugjacke –, dessen Rückseite ein gutes Stück länger als die Vorderseite war. Obendrein war der Rücken der Jacke auch noch so an der Unterseite gespalten, dass das Ganze sehr stark an zwei Pinguin-Flügel erinnerte.
Marietta hatte sich unterdessen eine seltsame runde schwarze Stoffscheibe gegriffen – und erschrak fürchterlich, als der Mittelteil der Scheibe ohne Vorwarnung nach oben sprang: Plötzlich hielt sie einen Zylinder in der Hand.
»Oh!«, kommentierte Tobias, »so einen Hut hab’ ich schon Mal in einem Museum gesehen. Das ist ein Chapeau-Claque – ein Klapp-Zylinder. Unter dem Stoff ist ein dünner Metallrahmen mit Gelenken und Sprungfedern verborgen. Zusammengeklappt braucht das Ding nur wenig Platz, aufgeklappt hat man einen eleganten Zylinderhut.«
Marietta setzte sich das Teil kichernd auf den Kopf, das ihr augenblicklich fast bis über die Augen rutschte. Auch Leo war der Frack viel zu groß, so dass die Ärmel wie leer herab baumelten. »Baaah! – Der stinkt vielleicht nach Mottenkugeln«, meinte er, während er den Frack schnell wieder auszog und einen Blick auf die Innenseite warf. »Da unten ist ein Monogramm eingestickt«, meinte er dann, »F.v.T. steht da.«
»Innen im Zylinder auch«, rief Marietta, nachdem sie sich das Teil wieder vom Kopf gezogen hatte, »wer das wohl gewesen war?«
Ein allgemeines Schulterzucken antwortete ihr, dann meinte Leo: »Also offenbar war es jemand mit Geld – jedenfalls hatte er mal welches gehabt. Solche Kleidung konnte sich nicht jeder leisten. Aber der Frack sieht reichlich abgenutzt aus. So als sei er noch getragen worden, als der Besitzer von seinem Stand her eigentlich längst einen neuen gekauft haben müsste. Und seht ihr das weiße Hemd da auf dem Boden? Es ist am Ärmel sogar schon geflickt.«
»Alle Achtung«, dachte Klara, »der kann gut beobachten.«
Eigentlich war Leo für sie immer einfach ein netter Junge gewesen, aber, nun ja, niemand, den man unbedingt in die eigene Volleyballmannschaft wählen würde. Was hatte ihr Opa Natz noch mal gesagt? Jeder Mensch habe Fähigkeiten, man müsse sich bloß die Zeit nehmen, sie zu sehen. Hmm… aber im Volleyball war Leo wirklich nicht sonderlich gut.
Schließlich räumten sie die Sachen in den Schrankkoffer zurück, schlossen ihn und schoben ihn wieder über den Schacht.
Um helfen zu können, hatte Klara ihren Fund – zögernd – kurz abgelegt, doch nun nahm sie die Ledermappe eilig wieder auf und trug sie zur Werkbank.
Leo hatte sie beobachtet und wollte nun neugierig wissen: »Was presst du da eigentlich die ganze Zeit so an dich, wie Gollum seinen Schatzzzzzz?«
»Ich drücke das Ding gar nicht …«, doch, sie hielt diese Lederschatulle ziemlich fest umklammert, musste Klara erkennen und entgegnete daher etwas lahm: »Also, ich glaube, das ist eine Mappe für Schriftstücke. Vielleicht können wir der Heimchen noch was zu ihrem Bücher-Schatz dazu legen?«
Doch irgendwo in sich drin spürte das Mädchen, dass es etwas Besonderes gefunden hatte. Etwas, das für sie viel mehr bedeuten würde, als nur eine kleine Freude für ihre Lehrerin.
Sachte legte sie die große Ledermappe auf die Werkbank und betrachtete sie. Hellbraun mochte das gut verarbeitete, glatte Leder einst gewesen sein, doch das Vergehen der Jahre hatte sie nachdunkeln lassen. Dennoch war das gut zehn Zentimeter hohe Wappen, das exakt in die Mitte der Mappe gepunzt[7] war, deutlich zu erkennen: Der Umriss war der eines Schildes, wie ihn Ritter in einem Turnier getragen haben mochten. Das Schild war in vier gleiche Teile geteilt, von denen die Teile links oben und rechts unten mit Pünktchen gefüllt, die beiden anderen leer waren. In der Mitte des Schildes befand sich ein großer Rabe, dessen bösartiger Blick Klara irgendwie bekannt vorkam. Der Rabe war mit eng beieinander liegenden und sich überschneidenden senkrechten und waagerechten Linien ausgefüllt. Oben auf dem Schild war wiederum ein Ritterhelm mit Federbusch angebracht, während darunter ein einziger, reich verschnörkelter Buchstabe in das Leder geschlagen war, in dem Klara ein altertümliches »T« zu erkennen glaubte.
Geschlossen gehalten wurde die Mappe durch eine Lederschnalle mit Messingverschluss. Andächtig öffnete Klara die Messingschließe, wischte sich ihre Hände am Hosenboden ab, schlug vorsichtig die Mappe auf und zog ein großes, dünnes Buch hervor, für das die Mappe offenbar passgenau angefertigt worden war. Schließlich schlug Klara den Buchdeckel um, starrte auf die erste Seite -- und Ehrfurcht überkam sie.
»Das … das geht hier um mein Schloss!«, rief sie.
»Dein was?«, warf Tobias ein, »ich denke, deine Familie haust doch wohl eher in einer Ruine, oder? Und gehören tut sie dir auch nicht.«
Klara wollte Tobias schon über den Mund fahren, als ihr dämmerte, dass er ja irgendwie Recht hatte. Also fauchte sie ihm nur ein zorniges »Blödmann!« entgegen und wandte sich dann an alle: »Hört zu, die alte Schrift hier ist zwar nicht einfach zu entziffern, aber ich denke, ich hab’s geschafft. Hier steht: Meine Familie: Hütet diese Pläne gut! In der Absicht, meine Kinder und deren Nachfahren zu schützen, habe ich, Freiherr Abrontius von Tunkelhagen, im Jahre 1632 den Auftrag erteilt, den Grundriss einer jeden Etage unseres Schlosses aufzuzeichnen. Die vier Geschosse über der Erde und ebenso eine Seite mit Aufrissen der beiden Türme hat der wohllöbliche Aachener Maler und Architekt Karolus van Pfleumel gegen gutes Geld gefertigt. Die unteren Etagen hat freundlicherweise mein guter Freund …« – hier stockte Klara und fragte sich, ob sie den Namen richtig las, doch es schien zu stimmen, » … hat freundlicherweise mein guter Freund Doringel Grünauge für mich gezeichnet. Ich persönlich habe dann den sicheren Weg zur einsamen Tür im fünften Kellergewölbe mit roter Tinte markiert. Auch das Gewölbe darunter … – Moment mal!«, unterbrach sich Klara erneut und sah vom Buch auf in drei gebannte Gesichter, »wenn dieser Tunkelhagen hier schreibt, das Gewölbe darunter, dann heißt das ja wohl, er hat mit den Kellergewölben, die er hier erwähnt, nicht einfach nur verschiedenen Kellerräume auf gleicher Höhe gemeint, sondern tatsächlich untereinander liegende Keller – Wow! Das is’ ja n’ Ding!«
»Was soll daran Wow sein?«, wollte Tobias wissen.
»Ganz einfach«, antwortete mit leuchtenden Augen Marietta, die sich schon oft mit Klara in den spärlichen Ruinen herumgetrieben hatte, »alle gehen immer davon aus, dass das Schloss nur ein Kellergeschoss hatte. Von dem sieht man auch noch ein paar wenige Reste. Und die liegen inzwischen alle im Freien, denn den Fußboden des Erdgeschosses und somit die Decke des Kellers gibt es schon lange nicht mehr. Und alle glauben deshalb, dass nichts mehr von Schloss Tunkelhagen übrig ist …«
Leo unterbrach: »Himmel! Jetzt kapier’ ich’s: In Wirklichkeit ist sehr wohl noch etwas von dem Schloss übrig! Wenn auch unterirdisch! – Und niemand weiß es!«
»Nun, niemand außer uns«, – das war Tobias, der sich die Hände rieb – »wenn da also noch ein paar weitere, noch tiefer gelegene unterirdische Kellergeschosse vorhanden sind? Mein Gott, was es dort wohl alles zu, äh, entdecken gibt? Geheime Keller eines alten Schlosses! – Man, dagegen kann dieser Schulkeller hier echt einpacken!«
»Lies weiter!«, drängte Marietta nun ihre Freundin, und Klara fuhr fort: »Also: …auch das Gewölbe darunter ist von Herrn Grünauge vermessen und auf Pergament festgehalten worden… – Äh, was ist Pergament?«
Leo wusste es: »Du hältst es in der Hand. Die Pläne in dem Buch sind offenbar nicht auf Papier, sondern auf dem viel festeren und sehr langlebigen Pergament gezeichnet. Das hatte man schon benutzt, bevor Papier erfunden wurde.«
»Ja und was ist es nun?«
»Ganz feine Tierhäute, besonders gegerbt und ich glaube, mit Kreide behandelt.«
»Tierhäute? – Igitt.«
»Was heißt hier, Igitt? Es ist halt eine besondere Art von Leder. Bei einer Lederjacke oder so sagst du ja auch nicht Igitt. – Aber lies doch weiter.«
Klara fing noch mal an:
»Die unteren Etagen hat freundlicherweise mein guter Freund Doringel Grünauge für mich gezeichnet. Ich persönlich habe dann den sicheren Weg zur einsamen Tür im fünften Kellergewölbe mit roter Tinte markiert. Auch das Gewölbe darunter ist von Herrn Grünauge vermessen und auf Pergament festgehalten worden. Der Vollständigkeit halber ist sogar das siebte Kellergeschoss in diesem Buch zu finden. Da diese letzte Kelleretage jedoch bekanntlich mit einem Tabu belegt ist und unser guter Freund selbst das sechste Untergeschoss nur sehr widerwillig betreten hatte, war im Falle der siebten Keller natürlich keine exakte Zeichnung möglich, sondern nur eine bestenfalls sehr grobe Skizze, zusammengesetzt aus Erinnerungen, auf die Herr Grünauge bei Nachforschungen in seinem eigenen Volke gestoßen ist.
Gestern wurde der Plan vollendet, was länger gedauert hatte, als erwartet. Die oberen Stockwerke waren kein Problem, da noch einige Pläne aus dem Jahre 1604 vorhanden waren, als Schloss Tunkelhagen von meinem Vater erbaut worden war. Doch zu allem, was jenseits des Weinkellers im zweiten Kellergewölbe beginnt, hat es niemals Pläne gegeben, da diese Keller noch zu jener Burg unserer Vorfahren gehört hatten, die vor dem Schloss auf dem Schlüsselberg gestanden hatte.
Ich bin jedenfalls froh, dass ich dieses schon lange gehegte Projekt endlich in die Tat umsetzen konnte, zumal meine Kräfte so langsam dem Fortschreiten der Jahre Tribut zollen müssen – während Doringel, ich werde mich wohl nie daran gewöhnen, noch immer über die meisten Kräfte seiner jungen Jahre zu verfügen scheint.
Also, meine Kinder und Nachfahren, hütet den Plan, nutzt ihn weise und vergesst nie unsere Freunde, denen wir so vieles zu verdanken haben.
Schloss Tunkelhagen
zu Schlüsselbergweiler
am 18. Maius des Jahres 1634 der Neuen Zeit,
gez. Freiherr Abrontius lll. von Tunkelhagen,
Ritter vom Orden der Störche«
Nach kurzem andächtigen Schweigen meinte Klara leise: »Unglaublich! Das hat dieser Abrontius vor fast 400 Jahren geschrieben!«
»War das der Kerl, der später das Schloss abgefackelt hat?«, wollte Tobias wissen – die Geschichte von »dem verrückten Alchemisten«, wie es im Allgemeinen hieß, kannte auch heute noch jeder im Ort.
»Nein«, entgegnete Klara, »das war viel später gewesen. Der Freiherr, dem das Schloss abgebrannt ist, war Fulko IV. von Tunkelhagen. Er war der letzte seines Geschlechts. Jedenfalls hatte er – im Gegensatz zu unserem Plänemacher hier – keine Kinder, und von irgendwelchen anderen Verwandten ist nichts bekannt. Er muss in seinen späteren Jahren auch verarmt gewesen sein oder ist jedenfalls so herum gelaufen. Dagegen hatte die Familie im 17. Jahrhundert, als dieses Buch hier entstanden ist, noch mehrere Zweige und gehörte zu den reichsten im Land.«
»Was du alles weißt!«, staunte Leo.
»Na ja«, antwortete Klara geschmeichelt, »du darfst nicht vergessen, wo ich wohne. Mein Opa und mein Vater haben inzwischen so ziemlich alle Informationen über das Schloss und die Familie Tunkelhagen gesammelt, die irgendwie aufzutreiben waren. Und sie haben auch nie daran gespart – Seufz! – alle anderen in der Familie an ihrem Wissen teilhaben zu lassen. – Und wann erkunden wir die Keller?«
Auch wenn diese Frage an dieser Stelle unerwartet schien, so war doch keiner der drei anderen überrascht. Irgendwie war es wohl allen klar gewesen, dass diese Frage gestellt werden musste.
Sofort begannen Marietta und Tobias, durcheinander plappernd zu versichern, dass sie auf jeden Fall und ganz unbedingt alles daran setzen würden, schon an diesem Samstagnachmittag auf Expedition zu gehen.
Die beiden und ebenso Klara waren so aufgeregt, dass sie Leos Räuspern nicht hörten, bis er es, immer lauter werdend, drei Mal wiederholt hatte und schließlich meinte: »Ist euch da nicht zufällig die ein- oder andere Kleinigkeit entgangen?«
»Was?«, riefen alle drei, während sie sich Leo zuwandten.
»Ihr wisst schon, was das Wort Tabu bedeutet, oder?«
»Äh, ja«, antwortete Marietta, »ein Tabu ist etwas, das absolut nicht erlaubt ist, und wenn es gebrochen wird, bringt das in der Regel unangenehme Konsequenzen mit sich – oh!«
»Verdammt«, ergänzte Klara und griff sich an den Kopf, »das siebte Untergeschoss! Dessen Betreten ein derartiges Tabu ist, dass es offenbar schon in den Zeiten von diesem Abrontius und seinem Freund, äh, Doringel – was für ein seltsamer Name – schon seit vielen, vielen Jahren niemand mehr betreten hatte. Das heißt dann wohl, was immer da unten drin ist, dürfte sehr, sehr gefährlich sein, oder?«
»Vielleicht war’s da auch ganz einfach nur baufällig?«, warf Tobias hoffnungsvoll ein.
Leo erwiderte: »Das hat sich aber in dieser Schrift doch irgendwie anders – na ja, das hat sich gruseliger angehört, als nur angeknackste Pfeiler. Oder hatte nur ich diesen Eindruck?«
Keine Antwort war in diesem Fall eine Antwort.
Schließlich meinte Leo zaghaft: »Klara, schlag doch einfach mal die letzte Seite auf. Vielleicht steht da ja was.«
»Gute Idee.« Sie begann zu blättern. Offenbar war jedem Stockwerk eine Doppelseite gewidmet, mit immer einem leeren Blatt dazwischen.
»Oh! – Na jetzt wird’s wirklich unheimlich!« Klara war am Ende des Buches angelangt, und es war ganz deutlich zu erkennen: »Hier hat irgendjemand die Seiten mit den beiden tiefsten Geschossen herausgerissen.«
Wer mochte das getan haben? Und warum?
Schließlich war es Marietta, die das beklemmende Schweigen durchbrach: »Aber offenbar konnte dieser Herr Grünauge in den ersten sechs Kellergeschossen unbehelligt arbeiten, oder?«
»Mal abgesehen davon, dass er es im sechsten Untergeschoss nicht gerne tat, scheint das zu stimmen«, sagte Leo.
Klara meinte: »Also sollten wir uns dann wohl nur die fünf, äh, oberen Untergeschosse ansehen. Das sollte klar gehen?«
»So?«, warf Leo ein, »wieso hat dann dieser von und zu Tunkelhagen den


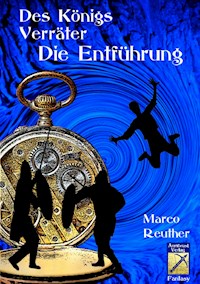













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












