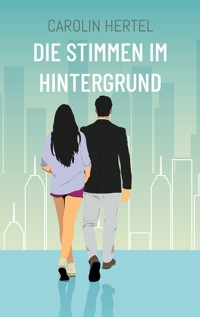Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: DESIRE
- Sprache: Deutsch
Das Vorleben von Taylor Schark aus seiner Sicht erzählt Teil 3 der packenden Buchreihe "Desire" Hätte mir je ein Mensch die Frage gestellt, wer ich bin, wäre meine Antwort wohl die von tausend anderen gewesen: Niemand besonderes. Doch wenn ihr von meiner Geschichte hört, wird euch schnell klar sein, wie viel Lüge in dieser Aussage steckt. Ich bin nämlich jemand ganz besonderes. Jemand, der es fertig gebracht hat, die einzige Seele zu zerstören, die ich je im Leben geschafft habe zu lieben. Ich bin Taylor Schark, der Abschaum höchstpersönlich. Und dies ist meine Geschichte...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autorenvita
Carolin Hertel wurde am 22.12.1988 in Bielefeld, Deutschland, geboren. Heute lebt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und den drei Kindern in Herford. Bereits von Kind auf war sie fasziniert vom geschriebenen Wort, und fasste ihre ersten kleinen Geschichten im Alter von sechs Jahren zusammen. Die Leidenschaft zum Schreiben von Büchern hat Carolin Hertel nie verloren, sodass sie während der Elternzeit ihr erstes Buch eigenständig verfasste. Ein weiteres Werk ist bereits mit großem Eifer in Arbeit. Da sie ihre Hochzeitsreise in Scharbeutz verbrachte, und bis heute gerne die Ferien mit der Familie dort verbringt, wählte sie diese Stadt als Ortshandlung von „…bis du mich wegschickst“ aus.
https://www.instagram.com/carolin_hertel/?hl=de
Für meine Mutter. …bis zum Mond und zurück.
Danksagung
Von ganzem Herzen möchte ich meinen größten Dank an meinem Ehemann, Waldemar richten. Über ein Jahrzehnt nun erträgst du meine Ideen, und die damit einhergehenden Gedanken, die mir im Alltag durch den Kopf schwirren. Ich danke dir für deine Geduld und die Augenblicke, in denen nur du durch einen kurzen Blick erkennst, was in mir vorgeht. Du bist mein bester Freund. Jedem wünsche ich einen Menschen in seinem Leben, mit einer Persönlichkeit wie deiner. Meine Liebe für dich lässt mich zum ersten Mal keine Worte finden. Ich danke meinen wunderbaren Söhnen Jesper, Lio und Bennett für ihr Lächeln und die grenzenlose Bereitschaft, mein Leben niemals langweilig werden zu lassen. Ich liebe euch drei bedingungslos. Ich danke meinem Vater für das Wissen, dass ich keine Zweifel haben muss, jemals allein zu sein. Zuletzt möchte ich einen ganz besonderen Dank an meine Mutter aussprechen. Dafür, dass sie mir das Leben geschenkt und mich mit einer Liebe großgezogen hat, die unerschöpflich ist. Danke, dass du mir eine so gute Freundin bist und mir stets das Gefühl von Geborgenheit vermittelst. Mama, du wirst immer ein Engel ohne Flügel sein.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Epilog
Prolog
Leidenschaftlich blickten wir einander in die Augen, während keiner von uns je geahnt hätte, dass ich ihre Seele längst zerstört hatte.
Erster Teil
…und auf einmal wurde es dunkel.
Ich fiel zu Boden. Direkt vor seine Füße. Ich schaute nicht zu ihm auf. Ich wusste auch so, dass der nächste Schlag kommen würde. Einen winzigen Augenblick fragte ich mich, ob es mir noch wehtat, wenn mein Vater mich schlug. Doch mittlerweile bekam ich eher das Gefühl, dass ich mich an die Schmerzen gewöhnt hatte. Aber dafür spürte ich bei jedem seiner Überfälle etwas anderes. Etwas, dass tief in meinem inneren saß. Ich wusste nicht, was es war oder wozu es fähig sein konnte. Aber mein Instinkt riet mir, mich von diesem Gefühl fernzuhalten. Es war ein Lodern in meiner Brust, ein penetrantes Empfinden, das mir jedes Mal aufs Neue Kraft gab wieder aufzustehen. Und dennoch, es ließ mich ersticken. Es wollte raus, dass spürte ich genau. Und je öfter mein Vater mich schlug, desto stärker wuchs dieses finstere Gefühl in mir.
»Na warte, du kleines Nichts!«, hörte ich Rico über mir sprechen und spannte sogleich die Bauchmuskeln an.
Ich schloss die Augen, als sein Tritt meine Magengegend erfasste. Sogleich keuchte ich einmal auf und zwang mich zurück auf die Knie.
Plötzlich hörte ich es von irgendwo Wimmern. Ich blickte auf und entdeckte meinen kleinen Bruder halb versteckt hinter dem Türrahmen stehen. Seine Augen waren gefüllt mit Tränen, als sie ängstlich in meine blickten. Ich biss die Zähne zusammen, um stark für Milo zu sein. Doch als ich hörte, wie unser Vater ihm mit aggressiver Stimme befahl endlich mit der Heulerei aufzuhören, stand ich hastig auf. Er hatte Milo bisher noch nie geschlagen. Diesen Prozess hob er sich stets für mich auf. Aber ich hätte nicht sagen können, ob es nicht vielleicht doch schon mal geschehen wäre, wenn ich unseren Vater nicht in solchen Momenten bewusst auf mich gelenkt hätte.
Ricos Augen lagen weiterhin auf den meines Bruders. Ich musste etwas unternehmen.
»Wie jetzt? War das schon alles?«, provozierte ich ihn.
Mein Plan ging auf. Sogleich hatte ich Ricos Aufmerksamkeit und ich sah im nächsten Moment, das seine Mimik sich verfinsterte. Ich wusste, jetzt würde er mich erst recht vermöbeln.
»Milo, verschwinde!«, rief ich meinem Bruder hektisch zu, bevor er zu sehen bekam, wie die Faust unseres Vaters mich traf.
Ich atmete tief ein und blickte Rico mit Abscheu in die Augen. Danach setzte er zum Schlag an und traf den Punkt unterhalb meines Auges. Mein Kopf schmetterte hart zur Seite. Ich war überrascht, dass er mir ins Gesicht schlug. Für gewöhnlich achtete Rico darauf, dass keine offensichtlichen Beweise für Häusliche Gewalt an mir zu sehen waren.
»Du meine Güte! Taylor!«, hörte ich plötzlich die Stimme meiner Mutter rufen.
Eilig stellte sie sich zwischen uns und kam dicht an mich heran. Nachdem sie mich zügig mit ihrem Blick untersuchte, schaute sie mir bedrückt in die Augen. Diesen Ausdruck kannte ich bis ins kleinste Detail und ich wusste genau, was sie mir jetzt zuflüstern würde.
»Nimm deinen Bruder und verschwindet für ein paar Stunden.«
Frustriert starrte ich in ihr Gesicht, welches mich stumm anflehte endlich zu gehen. Wie gerne hätte ich ihr gesagt, wie naiv sie doch war. Wie gerne geschrien, dass nicht ich es sein sollte, der die Wohnung verließ. Doch anstatt etwas von meinen Gedanken preiszugeben, flüchtete ich wortlos aus dem Wohnzimmer.
»Milo!«, rief ich.
Mein Bruder wartete schon im Flur auf mich, die Jacke bereits angezogen. Aufgebracht nahm ich meinen Hausschlüssel von der Kommode und verschwand gemeinsam mit ihm aus der Wohnung.
Nachdem Milo und ich einige Zeit ziellos durch die Gegend liefen, setzten wir uns irgendwann auf eine Parkbank. In solchen Augenblicken sprachen wir nie miteinander. Mein Bruder hatte relativ früh erkannt, dass ich nur wenig Lust auf eine Unterhaltung mit ihm hatte, wenn wir mal wieder abhauen mussten.
Wütend dachte ich nach, wohin wir jetzt gehen sollten. Es war Winter und draußen so kalt, dass die Haut an meinen Händen schon nach kurzer Zeit zu schmerzen begann. Meine Jacke hatte ich in der Aufregung vergessen mitzunehmen und stülpte mir deshalb die Kapuze meines Pullovers über den Kopf. Zähe Minuten verstrichen, in denen wir schweigend nebeneinandersaßen und darauf hofften, dass die Zeit zügig verging. Irgendwann aber kam der Zeitpunkt, in dem wir misstrauisch von den Passanten angestarrt wurden. Vor allem an mir blieben ihre Augen erschrocken hängen. Ich ahnte bereits weshalb.
Wortlos sprang ich von der Bank, formte aus Schnee eine kleine Kugel und kühlte damit die betroffene Stelle unter meinem Auge.
»Tut es weh?«, wollte Milo wissen.
Flüchtig schaute ich zu ihm. Was sollte ich sagen? Ich fand keine geeigneten Worte, also schüttelte ich mit dem Kopf.
Schweigend sah ich auf die Uhr. Es war noch früh, nicht einmal Nachmittag. Gereizt atmete ich ein.
»Wollen wir auf einen Spielplatz gehen?«, fragte Milo.
Zur Antwort schaute ich ihm verdrossen in die Augen. Er verstand meinen Blick umgehend, und senkte den Kopf. Doch schlagartig bekam ich ein schlechtes Gewissen. Für Milo waren diese Situationen genauso ätzend wie für mich, dass war mir klar. Und meine schlechte Laune machte diesen Augenblick nicht angenehmer für ihn. Trotzdem hatte ich im Moment keine Lust auf einen Spielplatz zu gehen. Zwischen Leuten zu sitzen, deren Blicke wahrscheinlich wie Kaugummi an meinem Veilchen klebten, darauf konnte ich gut verzichten. Ein blaues Auge war in unserer Gegend zwar nichts außergewöhnliches, reichte aber dennoch aus, um den Leuten die Gelegenheit zu bieten, sich ein schnelles Urteil zu bilden. Das habe ich selbst einmal bei meinem Kumpel erlebt. Tatsächlich traf damals nur ein harter Pass seine Nase und die Leute sprachen sofort davon, dass er sich mit irgendwem geprügelt hatte. Zugegeben, die Umgebung in der wir wohnten war bekannt für ihre täglichen Schlägereien. Aber musste man deshalb gleich jeden unter einen Kamm scheren?
Ich zog mein Portemonnaie aus der Hosentasche hervor und kontrollierte wie viel Geld ich noch hatte. Schweigend rechnete ich die Münzen zusammen und musste am Ende verbittert feststellen, dass es nicht einmal reichte, um uns etwas zu Essen zu kaufen.
Erneut überkam mich ein Schwall an Wut. Mein Vater war der Inbegriff eines Versagers. In meinem gesamten Leben konnte ich ihn mir nicht ein einziges Mal zum Vorbild nehmen. Weder hatte er je mit mir Fußball gespielt, noch mir etwas Sinnvolles beigebracht. Bei meinem Bruder sah das nicht anders aus. Deshalb hatte ich es mir auch schon früh zur Aufgabe gemacht, Milo alles Nötige beizubringen, was er fürs spätere Leben gebrauchen konnte. Und seien es auch nur Werte, die ich ihm irgendwie vermittelte. Er war erst neun Jahre alt. Er brauchte jemanden, der ihm den Weg zeigte und nicht, wie man als immer wiederkehrender Loser fungierte. Wäre meine Mutter nicht hier, wäre ich längst mit Milo abgehauen, weit weg von unserem Vater. Sie war das genaue Gegenteil von Rico. Mama sprach nicht mit mir über ihre Probleme. Natürlich nicht. Welche Mutter würde das schon mit ihren Kindern? Doch ich erkannte sehr wohl, was sie alles für mich und meinen Bruder tat. Tagein Tagaus schuftete sie sich ab, damit sie unsere Familie über Wasser halten konnte. Wenn sie nicht Tagsüber als Näherin in einer Änderungsschneiderei arbeitete, verbrachte sie die Abende damit, in verschiedenen Arztpraxen zu putzen, wofür sie nur einen geringen Lohn bekam. Anschließend kam sie dann völlig erschöpft nach Hause und bereitete das Mittagessen für den nächsten Tag zu. Wenn Milo oder mich etwas bedrückte, dann bemerkte sie es als Erste und unternahm sogleich alles, um uns wieder ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Sie gehörte zu der Sorte Mensch, ohne die man so manches Mal nicht weiterwüsste. Doch so perfekt meine Mutter in meinen Augen auch war, sie hatte ihre Schwächen. Die größte war wohl, dass sie es nicht schaffte, sich von meinem Vater zu trennen. Selbst dann nicht, wenn er mich mal wieder schlug. Zwar ging sie jedes Mal dazwischen, sobald Rico es auf mich abgesehen hatte und stellte sich mutig vor mich, aber ihn verlassen konnte sie daraufhin nie. Stattdessen versuchte Mama das Verhalten meines Vaters später in meinem Zimmer zu entschuldigen und rechtfertigte es damit, dass er sehr viel Stress auf der Arbeit hatte und noch einen Weg finden müsse, damit umzugehen.
Früher hatte ich sie oft im aufgewühlten Zustand gefragt, weshalb sie bei ihm blieb. Ihre Antwort daraufhin war immer dieselbe: »Taylor bitte, davon verstehst du nichts«. Darum blieb mir wohl nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass meine Mutter eines Tages den nötigen Mut fand und Rico endlich vor die Tür setzte. Ohne ihn wären wir alle besser dran.
Abermals schaute ich zu meinem Bruder. Mit gesenktem Kopf, baumelnden Füßen und bedrückter Miene saß er schweigend auf der Bank und ertrug die Zeit mit mir. Ich empfand Mitleid mit ihm. Wir haben schon oft irgendwo zusammen gesessen und versucht, die Zeit rumzukriegen, nachdem mein Vater mich verprügelt hatte. Aber im Winter war es am schlimmsten. Wenn man fror, verstrichen die Minuten deutlich langsamer. Mir wurde bewusst, dass wir nicht hierbleiben konnten. Bis auf unsere Eltern hatten Milo und ich keine Familie. Meine Mutter und Rico waren beides Einzelkinder, somit gab es weder eine Tante noch einen Onkel zu dem wir hätten gehen können. Mamas Eltern haben den Kontakt zu ihr abgebrochen, als sie mit mir schwanger wurde, sie war erst neunzehn. Und die Eltern meines Vaters habe ich noch nie im Leben gesehen. Rico hat noch kein einziges Mal von ihnen gesprochen und meine Mutter wich diesem Thema gerne auf geschickte Weise aus. Doch es gab jemanden von dem ich wusste, dass er mich nie im Stich lassen würde. Finn. Er war mein bester Freund seit Kindheitstagen und ich würde mir anmaßen behaupten zu können, dass ich unser Verhältnis mit der Verbundenheit eines Bruders gleichstellen konnte.
»Komm«, sagte ich zu Milo und sprang von der Bank.
Ungefähr dreißig Minuten später standen wir vor Finns Tür. Ich hatte ihm vorher eine Nachricht geschrieben und gefragt, ob er etwas dagegen hätte, wenn ich mit meinem Bruder zu ihm kam. Als er für einen kurzen Moment in mein Gesicht sah, durchzuckte seine Augen etwas, das Mitgefühl am nächsten kam.
»Das Werk deines Vaters?«, fragte er.
Schweigend nickte ich.
Rasch blickte er hinter sich und kontrollierte, ob jemand in der Nähe war.
»Geht schnell in mein Zimmer. Meine Mutter dreht durch, wenn sie das Veilchen sieht«, flüsterte er. »Ich komme gleich nach.«
Ich sah zu Milo und gab ihm mit einem knappen Nicken zu verstehen, dass er mir folgen sollte.
Anschließend beeilten wir uns ins Zimmer zu gehen, gut darauf bedacht keinen Lärm zu machen. Bei Finn war es immer ein wenig chaotisch. Er ließ seine Klamotten gerne irgendwo liegen und schien im Laufe der Jahre eine Leidenschaft fürs Ansammeln von Wasserflaschen entwickelt zu haben. Stumm blieben Milo und ich mitten im Raum stehen und warteten. Nebenbei beobachtete ich, dass er sich verlegen umsah. Das tat er immer, wenn wir hierher kamen. Und ich hatte grundsätzlich das Gefühl, dass Milo sich hier nie richtig wohlfühlen konnte. Er sprach in den Stunden, in denen wir hier waren, nie mehr als ein paar abgehakte Sätze und war meist zu schüchtern, um sich an irgendwas zu beteiligen.
Kurz darauf sprang die Tür auf. Rasch zog ich meine Kapuze ein Stück weiter nach vorn, falls es Simone, Finns Mutter, war. Doch es war mein Freund selber. In den Händen trug er eine Flasche Wasser und drei Gläser.
»Hier«, sagte er und schmiss mir ein Kühlpack zu. »Ich dachte, das könntest du vielleicht gebrauchen.«
Dankbar lächelte ich ihn an.
»Ich habe meiner Mutter gesagt, dass ihr heute mitesst. Ich hole uns nachher eine Portion aufs Zimmer. Ist aber nichts Besonderes. Nur Nudeln mit Soße.«
Aufrichtig sah ich ihn an. Dann wanderten seine Augen zu Milo, der weiterhin die Hände in seiner Jackentasche vergrub und sich nicht traute aufzusehen. Hoffnungslos zuckte ich mit den Schultern, nachdem Finn mich fragend ansah.
»Hey, habt ihr Lust auf einen coolen Film?«, fragte er ein paar Sekunden später.
Endlich blickte Milo auf.
Es war spät, als wir nach Hause kamen. Sobald wir die Wohnung betraten, hob meine Mutter Milo begierig auf die Arme. Sehnsuchtsvoll klammerte er sich an ihren Körper. Über der Schulter meines Bruders blickte Mama mir ins Gesicht. Als sie mein Veilchen fixierte, war sie den Tränen nahe.
»Ich bin so froh, dass ihr wieder da seid«, sprach sie so leise, als verriete sie ein Geheimnis.
»Warum flüsterst du?«, fragte Milo.
»Weil sie Papa nicht wecken will«, antwortete ich für sie und kassierte daraufhin einen schuldbewussten Blick meiner Mutter.
»Habt ihr Hunger?«, wollte Mama wissen.
»Wir haben schon gegessen«, versicherte ihr Milo.
»War es denn schön bei Finn?«
»Woher weißt du, dass wir dort waren?«
»Na hör mal. Denkst du etwa, ich erkundige mich nicht bei deinem Bruder, wo meine zwei Lieblingsmenschen sind?«
Im nächsten Moment kitzelte sie Milo durch, bis er in ihren Armen heftig zu strampeln begann.
»Es ist schon spät. Ich bringe dich jetzt ins Bett. Morgen ist Schule. Aber vorher haben wir noch eine Sache zu erledigen. Weißt du noch welche?«, fragte Mama mit freundlicher Stimme, während sie Milo zurück auf die Füße stellte. Mechanisch rollte ich mit den Augen.
Sie kniete sich wie immer zu meinem Bruder runter und sah ihm mit einem mütterlichen Lächeln ins Gesicht. Im Anschluss verschränkte sie Milos kleinen Finger mit ihrem und begann im Nachhinein gemeinsam mit ihm zu sprechen.
»Was die Schule nicht weiß, dass macht sie auch nicht heiß«, sangen beide im Chor.
»Sehr schön. Und jetzt ab ins Badezimmer, Zähne putzen«, schmunzelte sie verkrampft.
Nachdem Milo loslief, folgte Mama ihm ohne mich noch ein weiteres Mal anzusehen.
Müde stampfte ich in die Küche und setzte mich an den Esstisch. Ich nutzte die Zeit, um darüber nachzudenken, was ich morgen in der Schule für eine Erklärung zu meinem Veilchen abgeben konnte. Schließlich konnte ich nicht mit so einer bescheuerten Ausrede kommen, dass ich mir das Auge am Türknauf gestoßen habe. Nein, meine Ausrede musste wohlüberlegt sein. Sonst würde alles auffliegen.
Irgendwann hörte ich hinter mir ein gestelltes Husten. Ich drehte mich nicht um.
»Geht es dir gut?«, fragte meine Mutter. Ihre Stimme klang jetzt tief bedrückt. Einen langen Moment schwieg ich.
»Ja«, es war immer dieselbe Antwort.
»Kann ich etwas für dich tun?«
Mühsam schüttelte ich mit dem Kopf.
Kurz darauf kam sie näher an mich heran. Aus dem Augenwinkel konnte ich beobachten, dass sie mich sorgsam beobachtete.
»Tut es sehr weh?«, fragte Mama schmerzlich.
Ich schwieg weiter.
»Soll ich dir vielleicht etwas leckeres zu Essen machen?«
Wortlos sah ich sie an und schluckte gleichzeitig meine Wut herunter.
Minuten verstrichen, in denen wir beklommen nebeneinander saßen.
»Es tut mir so leid, was Papa getan hat«, flüsterte sie. Der Ton ihrer Stimme war gefüllt von Schmerz.
Kurz schielte ich zu ihr rüber, bevor ich den Kopf erneut senkte. Ich hasste diese Gespräche, die wir stets danach führten. Manchmal wollte ich meine Mutter anschreien, ihr sagen, dass ich das Recht auf Schweigen hatte, wenn ich mich schon regelmäßig schlagen lassen musste. Doch dann sah ich in ihre Augen und empfand etwas, dass wahrscheinlich Mitleid am nächsten kam. Deshalb antwortete ich mit einem leisen »Ich weiß«.
»Bitte versteh mich nicht falsch, Taylor«, begann sie zu sprechen. »Ich weiß, dass dein Vater falsch gehandelt hat. Aber warum hast du den Tisch nicht gleich abgeräumt, wie er es verlangt hat? Dann hätte er vielleicht nicht«, Mama hielt in ihrem Satz inne, als ich entsetzt in ihr Gesicht starrte. Sogleich neigte sie den Kopf und schwieg. Ich sah von ihr ab und betete insgeheim darum, dass das Gespräch ein schnelles Ende fand. Ich wusste, ich hätte auch aufstehen und gehen können. Doch ich ließ Milo grundsätzlich ein paar Minuten Zeit, damit er in Ruhe Einschlafen konnte, bevor ich irgendwann dazukam und mich mit Kopfhörern in mein Bett legte.
Ich hörte meine Mutter tief einatmen und spähte heimlich zu ihr rüber. Ihr Gesicht war gezeichnet von Müdigkeit und ich entdeckte eine tiefe Sorge in ihrem Blick.
Schweigsam sah ich zurück zu meinen Händen.
»Er hat momentan viel Stress auf der Arbeit, weißt du?«
»Hör auf!«, zischte ich durch die Zähne. Ich wollte diesen Mist jetzt nicht hören.
»Entschuldige«, stammelte sie verunsichert.
Unverhofft spürte ich dieses seltsame Brennen in meinem inneren. Es war unangenehm und erschwerte es, ruhig auf dem Stuhl sitzen zu bleiben.
Nach einer weiteren Stille, stand meine Mutter auf und suchte in dem Küchenschrank nach ihrer Zigarettenschachtel. Als sie mich daraufhin einen kurzen Moment ansah, bemerkte ich, dass sie wegen irgendwas nervös wurde.
»Hast du wirklich keinen Hunger?«, fragte sie nochmal.
Ich schüttelte den Kopf und schaute auf meine Armbanduhr. Es war noch zu früh, um ins Bett zu gehen. Ich würde wahrscheinlich stundenlang an die Decke starren und mit diesem penetranten Gefühl über den Vorfall von heute Vormittag nachdenken. Und dazu hatte ich sicher keine Lust.
Meine Mutter ging zum Kühlschrank und holte ein Kühlpack heraus, dass sie mir mit einem gequälten Lächeln hinhielt.
»Wir müssen dein Gesicht kühlen, damit die Schwellung schnell nachlässt. Morgen ist doch Schule«, sprach sie, während sie gleichzeitig versuchte, ihre Panik davor zu verbergen.
Ich sah in ihre Augen und fühlte unterdessen, dass ich zu zittern begann. Mein Herz begann schneller zu klopfen und meine Brust hob und senkte sich mit einem unangenehmen Druck. Zur selben Zeit füllten die Augen meiner Mutter sich mit Tränen.
»Gar nichts müssen wir!«, erklärte ich und stand verärgert von meinem Stuhl auf, um ins Bett zu gehen.
Lieber starrte ich an die Zimmerdecke als hier sitzen zu bleiben.
»Also ich will ja nichts sagen, aber«, »dann lass es«, warf ich eilig ein, bevor Finn seinen Satz zu Ende sprechen konnte.
Wir hatten noch zehn Minuten Zeit, bevor der Unterricht losging. Vorhin im Bus hat er sich noch zurückgehalten, aber es war klar, dass er mich auf mein blaues Auge ansprechen würde.
Verbittert sah ich zu unseren Mitschülern, von denen mich die meisten erschrocken betrachteten. Heute Morgen, als ich in den Spiegel sah, wurde mir bewusst, dass es keine Ausrede der Welt geben würde, die mein Veilchen glaubwürdig rechtfertigen konnte. Ich hatte zuerst an einen Skateboard Unfall gedacht. Oder an einen Basketball, den ich aus Versehen ins Gesicht geworfen bekommen habe. Doch man musste schon sehr viel Pech haben, um solch ein Ergebnis erzielen zu können. Zudem war unter den Lehrern bekannt, dass ich recht sportlich war. Glaubwürdigkeit war also etwas anderes.
»Tut mir leid, aber ich muss wenigstens Fragen was du den Lehrern deshalb erzählen willst«, sagte Finn und schaute mir neugierig ins Gesicht.
Da mir keine Antwort dazu einfiel, zuckte ich mit den Schultern. Eine Weile blieb mein Kumpel still, bis er einige Sekunden später mit lebhafter Stimme zu sprechen begann.
»Du könntest sagen, dass ich es gewesen bin.«
Unbeeindruckt drehte ich mein Gesicht zu ihm. Finn versuchte einen ernste Mimik zustande zu bringen, doch es dauerte nicht lange, bis er es aufgab.
»Ich weiß, ich weiß«, stöhnte er. »Du bist älter, größer und stärker als ich. Kein Mensch würde es glauben«, nuschelte er.
»Danke, trotzdem«, sagte ich und verzog den Mund zu einem halben Lächeln.
»Wenn du willst, dann könnte ich jetzt schnell so tun, als würde ich dir eine reinhauen. Vielleicht glaubt man es dann.«
Nun musste ich wirklich schmunzeln.
»Danke fürs Angebot, aber vielleicht ein anderes Mal.«
»Dann sollten wir uns auf den Weg machen. Die Stunde fängt gleich an«, murmelte er und schien genauso bedrückt von alldem zu sein wie ich.
Ich sah auf meine Uhr und stöhnte nervös auf. Ich erhob mich von der Bank und setzte mir den Rucksack auf. Gemeinsam gingen wir zum Unterricht. Weil Finn eine Stufe unter mir war, trennten unsere Wege sich auf halber Strecke. Für gewöhnlich setzte ich mich dann zu meinen Klassenkameraden. Doch heute hielt ich es für besser, ein wenig auf Abstand zu gehen und mir absichtlich etwas Zeit zu lassen. Ich stellte mich nicht wie sonst vor den Klassenraum. Stattdessen wartete ich vor dem Lehrerzimmer und suchte weiterhin nach einer Erklärung für mein Aussehen.
Als mein Lehrer Minuten später herauskam, erschien mir Finns Idee plötzlich nicht mehr so abwegig. Ich würde die Geschichte nur ein wenig abwandeln, oder besser gesagt, sie realistischer gestalten. Aber der Grundsatz könnte mit etwas Glück überzeugend sein.
»Herr Markens?«, sagte ich.
»Ach du Schreck! Was ist denn mit dir passiert?«
Ich atmete einmal tief durch, bevor ich zu lügen anfing.
»Gestern gab es eine kleinere Rauferei vor unserer Haustür. Und ich bin wohl zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Das wollte ich Ihnen unbedingt erklären, bevor Sie mit dem Unterricht beginnen.«
»Das ist ja schrecklich! Warst du persönlich in die Sache involviert?«, wollte er wissen und betrachtet mich besorgt.
Ich schüttelte mit dem Kopf. »Nein, aber ich musste an den beiden vorbei, um nach Hause zu gehen. Tja, und dann traf mich auch schon die Faust.«
Wissend nickte mein Lehrer.
»Etwas anderes habe ich von jemandem wie dir auch nicht erwartet, Taylor. Du bist ein freundlicher Junge. Es tut mir nur leid für dich, dass du mit so einer Sache konfrontiert wurdest. Bist du denn in Ordnung, oder willst du lieber nach Hause gehen und dich ausruhen? Vielleicht wäre sogar ein Besuch bei einem Arzt ratsam?«
»Nein. Es geht mir gut. Nur würde ich Sie bitten, es nicht an die große Glocke zu hängen.«
Verständnislos betrachtete mich Herr Markens.
»Es… es wäre mir peinlich«, erklärte ich eilig, damit er keinen Grund hatte skeptisch zu werden und etwas Besseres ist mir auf die Schnelle auch nicht eingefallen.
Plötzlich tätschelte er mir die Schulter.
»Ach, Jungs in diesem Alter sind wohl alle gleich. Ich weiß noch, als ich sechzehn war. Da habe ich immer so getan, als hätte ich an einer Prügelei teilgenommen, wenn ich einen Kratzer oder Ähnliches im Gesicht hatte. Ich wollte nicht, dass die Mädchen glauben könnten, ich sei so eine Art Verlierer«, lachte er verträumt.
Ich versuchte in sein Gelächter einzustimmen, doch es wirkte alles andere als natürlich.
»Mach dir keine Gedanken, ich sorge dafür, dass dich niemand in der Klasse belästigen wird«, versprach er.
»Danke.«
Gemeinsam gingen wir nebeneinander her, zum Klassenraum. Auf dem Weg verfolgten mich weiterhin neugierige Augenpaare und ich musste mir selbst eingestehen, dass es höchst unangenehm war.
»Falls es dich ein wenig aufmuntert, deine Matheklausur hast du mal wieder mit Bravur bestanden.«
Wenigstens etwas, dachte ich.
Im Unterricht stahl ich Herr Markens jegliche Aufmerksamkeit. Beinahe jeder meiner Mitschüler starrte mich an, als hätten sie noch nie etwas so abscheuliches gesehen. Natürlich blieb ich in den Pausen von Fragen nicht verschont und antwortete stets mit derselben Ausrede wie schon bei unserem Lehrer. Am Ende war ich extrem genervt und freute mich seit langem Mal wieder auf den Schulschluss. Sonst war es immer so, dass ich im Gegensatz zu meinen Mitschülern keine Eile hatte das Schulgelände zu verlassen. Zu Hause erwartete mich sowieso nichts, worauf ich mich freuen könnte.
»Und?«, fragte Finn, der bereits an der Bushaltestelle auf mich wartete.
»Hab gesagt, dass ich zur falschen Zeit am falschen Ort war«, antwortete ich und setzte mich neben ihn auf die Bank.
»Und das hat man dir geglaubt?«
»Ich denke schon.«
»Wenigstens musst du dir deshalb keine Sorgen mehr machen«, sagte er mit einer Erleichterung, als wäre das Veilchen sein eigenes Problem.
»Stimmt.«
Als ich meinen Apfel aus der Tasche kramte, wurde ich von Melissa angesprochen. Wir haben erst vor ein paar Wochen miteinander Schluss gemacht. Wenn man das überhaupt so nennen konnte. Ich glaube, wir waren ja nicht einmal richtig zusammen gewesen. In den drei Wochen, in denen wir uns regelmäßig trafen, ist bis auf ein einziger Kuss nichts passiert.
»Hallo Taylor«, begrüßte sie mich schüchtern.
»Hey«, antwortete ich knapp.
»Das mit deinem Auge tut mir leid. Ich hoffe, es geht dir trotzdem einigermaßen gut«, sprach sie.
»Ja, alles okay. Und wie geht’s dir?«
»Auch gut.«
Daraufhin trat eine peinliche Stille ein. Ich spähte leicht zur Seite und sah, dass Finn scheu auf den Boden starrte. In Gegenwart von Mädchen fühlte er sich immer etwas unwohl. Ich wusste, dass es die ein oder andere gab, die er mochte. Aber ihm fehlte einfach das nötige Selbstbewusstsein, um eine von ihnen anzusprechen.
»Also dann. Ich muss los. Mein Bus ist gleich da«, verabschiedete sie sich.
»Okay. Bis dann.« Höflich winkte ich ihr zu.
Als sie ein paar Meter gegangen war, bemerkte ich, dass Finn mich seltsam betrachtete.
»Was war denn das?«, fragte er.
»Was meinst du?«
»Willst du mir etwa erzählen, dass du diese verkrampfte Stimmung in der Luft nicht gespürt hast? Das war selbst mir peinlich.« Er verzog das Gesicht.
»Ich weiß einfach nicht, was ich zu ihr sagen soll.«
»Was ist denn da jetzt zwischen euch beiden?«, wollte Finn wissen.
»Da ist gar nichts. Ich habe einfach gemerkt, dass ich nichts für sie empfinde«, erklärte ich ihm.
»Das weiß ich. Aber du hast mir nie erzählt, wie sie es aufgenommen hat. Anscheinend will sie nicht aufgeben, sonst würde sie dich nicht ansprechen.«
»Das liegt daran, dass ich es ihr nicht erzählt habe«, antwortete ich und biss in den Apfel.
»Wieso nicht?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich denke, es könnte ihr wehtun«, erklärte ich ihm und blickte gleichzeitig in Melissas Richtung.
»Hm«, machte Finn und dachte einen Moment nach. »Aber wenn du willst das sie dich in Ruhe lässt, dann solltest du ehrlich sein.«
»Das weiß ich. Ich hoffe nur, dass sie nicht traurig sein wird. Melissa ist nett, für mehr reicht es aber nicht«, sagte ich.
»Na ja, du hast ja noch genug andere Mädels zur Auswahl«, stöhnte er eigenartig genervt.
»Was soll das denn bedeuten?«, fragte ich.
»Sieh dich doch mal um«, begann Finn und zeigte mit den Händen in die Umgebung. »Nenn mir mal ein Mädchen, dass nicht auf dich abfährt.«
Ich begann zu lachen. »So ein Schwachsinn!«
»Ach meinst du, ja?«, erwiderte er verärgert. »Weißt du eigentlich, wie nervig es manchmal sein kann dein Freund zu sein? Zumindest in Gegenwart von Mädchen. Wenn du neben einem stehst, ist der andere automatisch unsichtbar«, sprach er genervt.
»Hörst du dich eigentlich selbst reden?«, fragte ich und stand mit einem Kopfschütteln von der Bank auf, um zu unserem Bus zu gehen. Ich biss noch zweimal von meinem Apfel ab und warf ihn anschließend in den Mülleimer.
»Dein Leben zu Hause mag vielleicht scheiße sein, aber was dein Erscheinungsbild angeht, hat sich Gott persönlich wohl Jahrzehnte zeitgelassen.«
Ich wollte nichts mehr zu diesem Thema sagen, weil es in meinen Ohren einfach nur lächerlich klang und ignorierte ihn deshalb.
Im Bus quetschten sich die ersten Schüler hindurch, um einen Platz zu bekommen. Finn und ich hatten Glück und bekamen noch einen weit hinten.
Kurze Zeit später sah ich, dass einige Leute grob zur Seite geschubst wurden. Als ich genauer hinsah, erkannte ich, um wen es sich dabei handelte. Es war eine bekannte Clique aus unserer Gegend. Sie gingen auch auf unsere Schule, nur das sie einen Jahrgang über mir waren und ich nichts mit ihnen zu tun hatte. Aber die meisten unserer Schüler, einschließlich mir, wussten, dass es klüger war, ihnen aus dem Weg zu gehen. Insbesondere dem großen, blonden Kerl, sollte man nicht über den Weg laufen. Ich kannte seinen Namen nicht, doch war ich mir schon immer sicher gewesen, dass er die Schlüsselfigur der Clique war. Jedenfalls wirkte es so. Wenn etwas Illegales in unserer Gegend passierte, hatte er meistens damit zu tun. Das sprach sich nicht nur wie ein Lauffeuer herum, sondern stand er grundsätzlich auch dazu. Man könnte fast glauben, er würde es genießen, wenn die Leute wussten, wozu er fähig war.
»Steh auf«, sagte er zu einem Jungen, der zwei Plätze schräg von mir entfernt saß.
»Warum sollte ich?«, versuchte sich der Junge zu wehren, obwohl ihm anzusehen war, dass er sich unwohl fühlte.
»Was hast du gesagt?«, fragte der Blonde mit einer Dunkelheit in der Stimme, die genau verriet was passieren würde, wenn nicht das getan wurde wonach er verlangte.
»Schon gut, schon gut.« Eingeschüchtert nahm der Junge seinen Rucksack, machte eilig platz und sorgte für genug Abstand, indem er sich durch die Masse zwängte.
Zufrieden setzte sich der andere hin und nickte einem seiner Freunde zu.
»Idiot«, hörte ich Finn leise sprechen.
»Kannst du laut sagen«, stimmte ich zu.
Als ich eine Stunde später vor unserer Wohnungstür stand, atmete ich kräftig durch. Ich hatte mir auf dem Heimweg absichtlich Zeit gelassen, damit ich nicht zu früh auf meinen Vater treffen musste. Aber nun wusste ich nicht mehr, was ich noch tun konnte, um Zeit zu schinden. Ich steckte den Schlüssel ins Schlüsselloch und betrat unsere Wohnung mit einem flauen Gefühl. Im Flur hing ich meine Jacke an die Garderobe und stellte den Rucksack ab. Danach musste ich Rico begrüßen. So, wie er es seit Jahren von mir verlangte. Warum genau ich das tun sollte, hat er mir nie gesagt. Aber ich hatte so eine Ahnung. Schließlich brauchte er jemanden, wenn er wütend wurde.
Einen Moment blieb ich im Türrahmen stehen und verschaffte mir einen Überblick über die Lage. Mittlerweile war ich richtig gut darin anhand von Ricos Körpersprache abzuschätzen, ob er einen schlechten Tag hatte oder ich fürs Erste aufatmen konnte. Mein Vater saß zusammen mit einer Flasche Bier in der Hand auf dem Sessel und überkreuzte die Beine auf dem Wohnzimmertisch.
Als ich mir sicher sein konnte, dass er nicht ganz so wütend war ging ich zu ihm.
»Hallo«, sagte ich tonlos und schaute in sein Gesicht. Vor einigen Monaten hatte ich mal den Fehler begangen und während der Begrüßung auf den Boden gestarrt. Daraufhin hatte Rico mir mit seinen ganz persönlichen Maßnahmen beigebracht, dass ich mich in Zukunft respektvoller zu verhalten hatte.
Eine Weile starrte er noch auf den Fernseher, bis seine Augen langsam zu meinen schweiften. Gleichgültig musterte er mich. Das Veilchen schien meinen Vater nicht weiter zu interessieren.
»Du musst kochen. Deine Mutter verspätet sich heute«, sagte er.
»Sicher«, entgegnete ich und drehte mich zum Gehen um. Doch kurz danach rief er mich streng zurück. Angespannt wartete ich darauf, dass er zu sprechen begann.
»Hast du nicht etwas zu sagen?«, fragte er und blickte mich nebenbei aufmerksam an.
Rasch überlegte ich, was Rico meinen könnte. Weil ich nach einem langen Moment immer noch nichts erwiderte, half er mir auf die Sprünge.
»Findest du nicht, dass du dich für dein gestriges Verhalten bei mir entschuldigen solltest?«
Lautlos füllte ich meine Lungen mit Luft und versuchte mit aller Kraft das Brennen, welches schlagartig aufgetaucht war, vor meinem Vater zu verbergen. Wenn ihm auffallen würde, dass ich mich darüber ärgerte, gäbe ich ihm nur wieder einen Grund mich zu vermöbeln.
»Natürlich. Es tut mir leid«, kam es emotionslos über meine Lippen. Anschließend entfernte ich mich wieder mit lautlosen Schritten. Aber zu meinem Verdruss, rief er mich ein weiteres Mal zurück. Ich schloss die Augen und hatte das starke Gefühl, heute besonders vorsichtig sein zu müssen.
Abermals stellte ich mich vor ihn.
»Was tut dir leid?«, fragte Rico dann, während er mich intensiv musterte. Wenn meine Mutter nicht zu Hause war, provozierte Rico mich schon immer gerne.
Hastig verdrängte ich meinen Zorn.
»Ich hätte erst den Tisch abräumen sollen, wie du es gesagt hast. Es tut mir leid, dass ich zuerst Milos Hausaufgaben kontrolliert habe.«
Als er mich weiterhin anstarrte, war mir bewusst, dass mein Vater noch auf etwas wartete.
»Es kommt nicht mehr vor«, fügte ich hinzu.
Stumm nickte er und blickte im Anschluss wieder zum Fernseher. Das war mein Stichwort – ich konnte gehen.
Aber nachdem ich die ersten Schritte in Richtung Zimmer gemacht hatte, hörte ich ein dumpfes Geräusch.
»Da ist was runtergefallen«, rief mein Vater.
Wieder drehte ich mich um und sah auf den Boden. Mit angespanntem Unterkiefer marschierte ich zurück und hob die Fernbedienung, die er eben noch in der Hand gehalten hatte, auf. Schweigend gab ich sie ihm zurück. Daraufhin durfte ich auf mein Zimmer gehen.
Ich war erleichtert, dass Milo heute noch bei seiner Tischtennis AG war. Mitten im Raum blieb ich stehen und versuchte, mich zu beruhigen. Das Brennen in meinem Inneren wurde zu einem stechenden Schmerz in meiner Brust. Meine Hände begannen zu kribbeln und ich bekam zudem das Gefühl, als würde sich eine Schlinge um meine Kehle legen und mir jeden Atemzug nehmen wollen. Ich hörte mich selbst schwer atmen und es dauerte keine zwei Sekunden, bis meine Faust mit einem lautlosen Schrei heftig auf mein Kissen einschlug.
Am Samstagnachmittag klopfte es an unserer Zimmertür. Gleichzeitig schauten Milo und ich von unseren Schulbüchern auf, als die Tür aufging. Mit einem Schmunzeln steckte Mama ihren Kopf zwischen den Türspalt und blickte zunächst für ein paar Sekunden in unsere Gesichter.
»Klappt eure Schulbücher zu, wir müssen Einkaufen«, teilte sie uns übertrieben fröhlich mit.
Sie war schon angezogen und wartete ungeduldig darauf, dass wir es ihr gleich taten.
»Na los, worauf wartet ihr?«, lächelte sie.
»Okay. Ich muss nur meine Schuhe finden«, sagte Milo und klappte sein Buch in der nächsten Sekunde zu.
Während mein Bruder nach seinen Sachen suchte, blickte meine Mutter fragend zu mir.
»Komm schon, Taylor. Die Läden machen am Samstag eher zu.«
»Ich glaube, ich bleibe lieber hier. Ich muss noch für die Klausur am Mittwoch lernen.«
Besorgt spähte Mama zur Seite. Es war nur für eine winzige Sekunde und doch reichte es aus, um zu wissen, dass sie nicht wollte, dass ich mit meinem Vater allein zu Hause blieb. Als sie ihre Maskerade fortführte, verschränkte sie ihre Arme vor der Brust und betrachtete mich mit einem verzagten Lächeln.
»Ich brauche dich aber, Liebling. Wer außer dir sollte mir sonst beim Tragen helfen? Schließlich bist du der einzige von euch beiden, der stark genug ist.« Ich hasste es, wenn sie mit mir sprach, als sei ich noch ein Kleinkind.
Da ich davon ausgehen konnte, dass Rico mal wieder getrunken hatte und mich dann sowieso verdreschen würde, klappte ich genervt das Buch zu und nahm meine Jacke vom Stuhl. Nebenbei tätschelte meine Mutter mir nervös die Schulter.
Im Einkaufsladen ließ Mama sich mehr Zeit als sonst. Sie durchstöberte jedes einzelne Regal und schindete noch mehr Zeit, indem sie sich heute plötzlich stark für Produkte interessierte, die wir sonst nie kaufen würden. Mein Vater muss wohl schon sehr viel getrunken haben. Am liebsten hätte ich ihr gesagt, dass sie sich das Theater sparen konnte. Doch mir war bewusst, dass ich meine Mutter damit verletzen würde und gleichzeitig Gefahr lief, dass Milo alles mitbekam. Auch wenn mein Bruder schon öfters mitansehen musste, wie Rico mich verprügelt hatte, versuchten Mama und ich ihn stets davon fernzuhalten, wenn es nur irgendwie möglich war. Nur deshalb schob ich brav den Einkaufswagen hinter ihr her und lächelte Mama zu, wenn sie etwas sagte.
Als wir bei der Getränkeabteilung ankamen, zog ein lautes Stimmengewirr unsere Aufmerksamkeit auf sich. Es war die Clique, die in unserer Gegend immer wieder für Ärger sorgte. Völlig unbedenklich öffneten zwei von ihnen eine Bierdose und tranken einen großen Schluck daraus. Nebenbei lachte der Rest über etwas, dass ich nicht verstehen konnte.
»Taylor, wenn ich jemals mitbekommen sollte, dass du dich mit diesen Jungs rumtreibst, dann Gnade dir Gott! Hast du mich verstanden?«, sagte meine Mutter streng.
»Das wird nicht passieren.«
»Das will ich dir auch schwer geraten haben. Diese halbstarken Burschen machen nur Ärger. Ich würde wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich dich mit denen zusammen sehen würde.«
»Jetzt beruhige dich. Ich habe kein Interesse ein Mitglied dieser hirnrissigen Idioten zu werden«, verteidigte ich mich. Leider neigte meine Mutter oftmals dazu, sich in Dinge hineinzusteigern, die niemals passieren würden.
»Außerdem kenne ich diese Jungs schon seit Jahren und hatte bisher kein einziges Mal mit ihnen zu tun«, versuchte ich ihr die Sorge zu nehmen.
»Ich weiß, ich weiß«, stöhnte sie und schaute dann zu Milo. »Dasselbe gilt auch für dich, junger Mann.«
»Mama, ich bin erst neun!«, erwiderte er bockig.
Als einer Frau neben mir plötzlich mehrere Flaschen Wasser auf den Boden fielen, wurden wir hellhörig. Ohne darüber nachzudenken, eilte ich auf sie zu und half ihr, die Getränke wieder ordentlich zurück ins Regal zu stellen.
»Danke, das ist aber nett von dir«, sagte sie und lächelte mich freundlich an.
»Keine Ursache«, antwortete ich und kehrte ihr kurz darauf den Rücken zu.
Nachdem meine Mutter, Milo und ich weitergingen, klopfte Mama mir sanft auf die Schulter.
»Bleib einfach so ein lieber Junge, wie du es jetzt bist und verbringe deine Zeit mit Finn. Er ist ein guter Umgang«, meinte sie.
»Finn ist seit Ewigkeiten mein bester Freund. Und jetzt hör auf mit mir zu reden, als wäre ich Milo«, schimpfte ich.
»Schon gut, entschuldige. Lass uns weitergehen. Ich wollte mir noch ansehen, welche Sorten von Honig sie hier anbieten«, sagte sie und ging voraus.
Augenrollend trottete ich hinterher. Mama hasste Honig.
»Warum haben sie dich diesmal gefeuert, Rico?«, schrie meine Mutter lautstark aus dem Wohnzimmer.
Die Tür zu Milos und meinem Zimmer stand einen Spalt offen. Mein Bruder bekam nicht allzu viel von dem Geschrei mit. Denn sobald unsere Eltern zu streiten begannen, setzte er sich seine Kopfhörer auf und hörte Musik.
Ich selber war dabei meine Hausaufgaben zu erledigen, trotz, dass es Freitag war. Ich mochte es nicht, wenn ich meine Schulpflichten aufschob. Es gab nichts, dass ätzender war, als an einem Sonntagabend noch etwas für die Schule tun zu müssen.
Als ich heute pünktlich nach Hause kam, hatte ich mich gewundert, warum mein Vater schon auf dem Sofa saß. Aber nach kurzem Nachdenken war die Sache schnell klar. Er wurde gefeuert. Das war ein fortlaufender Prozess, der sich über die Jahre hinweg stark manifestiert hatte. Und als meine Mutter vorhin nach einem langen Arbeitstag nach Hause kam und bemerkte, dass mein Bruder und ich mucksmäuschenstill in unserem Zimmer hockten, ahnte sie wohl, dass etwas nicht in Ordnung war.
»Was weiß ich? Sollen die sich doch einen anderen Dummen suchen«, antwortete mein Vater gleichgültig.
»Das war keine Antwort auf meine Frage, Rico! Ich will wissen, weshalb sie dich rausgeworfen haben. Es kann doch nicht sein, dass du es nicht länger als zwei Monate schaffst eine Stelle zu behalten!«
Stille.
Ich konnte Mama nicht sehen, aber an dem erschöpften Ton ihrer Stimme, war deutlich herauszuhören, wie müde sie war. Genervt nahm ich den Stift zur Hand und senkte den Blick wieder auf mein Mathebuch. Doch schon wenige Sekunden später, wurde ich aufmerksam.
»Das Geld für Taylors Klassenfahrt ist nächsten Monat fällig. Wie sollen wir die bitte bezahlen, wenn kein Geld reinkommt?«, fragte meine Mutter verzweifelt.
»Der Junge kostet auch nur Geld! Sein sechzehnter Geburtstag letzten Monat war schon teuer genug. Außerdem finde ich, dass er zu Hause bleiben kann. Soll er lieber was lernen, als sich einen Lauen in Italien zu machen.«
Ich versuchte nicht an die Vorstellung zu denken, vielleicht nicht auf meiner Abschlussfahrt dabei zu sein. Der Gedanken bereitete mir Bauchschmerzen.
»Es ist seine Abschlussfahrt! Er hat es verdient mitzufahren. Aber wir werden uns das nicht leisten können, wenn du dir nicht schnell eine neue Arbeit suchst. Ich flehe dich an, Rico. Bitte geh gleich morgen los und frag in ein paar Firmen nach, ob Bedarf an Arbeitskräften besteht. Mir zuliebe«, bat meine Mutter ihn drängend. Dabei fiel mir auf, dass sie angefangen hatte leiser zu sprechen.
»Nein, nein, nein! Kommt nicht in Frage. Ich muss mich erstmal von diesem Bockmist erholen und zur Ruhe kommen. Und jetzt nerv mich nicht weiter und hol mir ein Bier«, antwortete mein Vater in einem Ton, der deutlich machte, das ihr Streit beendet war.
Wütend klappte ich mein Buch zu und stampfte zu meinem Bett rüber. Wie sehr ich es hasste, dass wir ständig aufs Geld achten mussten. Ich holte meinen Mp3-Player unter meinem Kissen hervor, setzte mir die Kopfhörer auf und suchte in meiner Playlist nach Songs, die zu meiner Stimmung passten. Als ich meine Auswahl getroffen hatte, stellte ich die Musik auf die höchste Lautstärke. Wenigstens lag Milo mit dem Gesicht zur Wand und bekam nicht mit, wie wütend ich war. So blieb mir seine blöde Fragerei erspart. Ich legte die Hände hinter den Kopf und schloss die Augen. Währenddessen spürte ich, dass dieses merkwürdige Gefühl in mir aufstieg. Heute kam es mir schlimmer vor. Es traf mich mit mehr Wucht und sorgte dafür, dass mein Kopf dröhnte. Mit meiner ganzen Kraft versuchte ich es zu ignorieren, doch es wollte mir auch nach etlichen Minuten nicht gelingen. Stattdessen wagte ich es herauszufinden, was es zu bedeuten hatte. Aber je mehr ich mich dem hingab, desto heftiger wurde dieses Empfinden. Ich merkte, dass es sich verdunkelte, sobald ich an meinen Vater dachte, und dass es mich am Ende fast auffraß. Hartherzig unterdrückte ich es, doch zum Schluss konnte ich kaum noch ruhig atmen. Deshalb stand ich auf und marschierte in unserem kleinen Zimmer immer wieder auf und ab, was mir verständnislose Blicke meines Bruders einbrachte.
Nach ungefähr einer Stunde bekam ich Durst. Bevor ich das Zimmer verließ, vergewisserte ich mich, dass meine Eltern nicht mehr stritten. Bis auf das Geräusch des Fernsehers war nichts zu hören. Gut darauf bedacht meinem Vater nicht zu begegnen, machte ich mich auf den Weg in die Küche. Meine Mutter saß am Tisch und telefonierte. Weil sie mit dem Rücken zu mir saß, sah sie auch nicht, dass ich hinter ihr stand. Ich griff nach einer Flasche Mineralwasser und stoppte in meiner Bewegung, als ich hörte was sie sagte.
»Mehr bekomme ich nicht dafür?« Verzweifelt schüttelte sie mit dem Kopf und atmete tief ein.
»Das ist eine 585er Goldkette. Sie ist mindestens das Doppelte wert«, sprach sie entrüstet weiter.
Leise versuchte ich über ihre Schulter zu blicken und entdeckte die Goldkette ihrer Großmutter auf dem Tisch liegen. Sie hatte doch wohl nicht vor ihr einziges Erbstück zu verkaufen? Ich wusste, wie viel ihr diese Kette bedeutete. In meiner Kindheit kam sie öfters damit an mein Bett und zeigte sie mir voller Stolz. Am Ende versprach meine Mutter mir dann stets, sie mir eines Tages zu vermachen, damit ich sie an meine Kinder weitergeben konnte.
»Haben Sie Kinder?«, hörte ich meine Mutter wieder sprechen.
Es folgte eine kurze Pause.
»Dann bitte ich Sie, von Mutter zu Mutter. Machen Sie mir einen fairen Preis, sonst muss ich meinem Sohn sagen, dass er nicht auf seiner Abschlussfahrt dabei sein kann.«
Eisern widerstand ich dem Drang ihr nicht den Hörer vom Ohr zu nehmen. Abermals schüttelte meine Mutter mit dem Kopf und legte schließlich auf. Anschließend vergrub sie ihr Gesicht in den Händen und flüsterte verzweifelt vor sich hin.
»Was mache ich nur?«
Ich beschloss zu verschwinden und ging so leise wie möglich aus der Küche. Zeitgleich hörte ich meinen Vater laut über etwas lachen, das im Fernsehen gezeigt wurde.
Am späten Abend, als ich hörte wie die Schlafzimmertür meiner Eltern zugezogen wurde, schlich ich mich aus meinem Zimmer. Ich hatte Hunger bekommen, aber bis jetzt hatte ich mich aus reiner Vorsicht vor meinem Vater verstecken müssen. Milo schlief bereits, deshalb verzichtete ich darauf, das Licht einzuschalten. In der Küche suchte ich im Kühlschrank nach etwas Essbaren. Er war schon immer sehr überschaubar gewesen, doch ich hatte Glück und fand einen Joghurt. Als ich mir einen Löffel aus der Schublade nahm, hörte ich meine Mutter hinter mir sprechen.
»Hallo, mein Schatz.«
Ich drehte mich zu ihr um und betrachtete sie einen Moment. Sie verstaute gerade ihre Schachtel Zigaretten im Küchenschrank. Anders als mein Vater, rauchte meine Mutter grundsätzlich auf dem Balkon. Sie hat mehrmals versucht Rico zu überreden es ihr gleichzutun, aber bis heute weigerte er sich.
Schweigend begann ich meinen Joghurt zu löffeln und schaute weiterhin in ihr Gesicht. Sie gab sich Mühe ihre wahre Stimmung vor mir zu verbergen. Geweint hatte sie auch, dass verrieten ihre geschwollenen Augenlider. Außerdem war sie blass um die Nase.
»Soll ich dir vielleicht ein Brot machen?«, fragte Mama freundlich.
»Nein, danke.«
»Komm, setzen wir uns einen Augenblick hin«, lächelte sie matt.
Nach einem kurzen Zögern, tat ich ihr den Gefallen.
»Dich bedrückt doch etwas«, sprach sie nach wenigen Sekunden, in denen sie mich aufmerksam musterte.
»Es ist nichts«, stammelte ich.
»Du magst vielleicht nicht zu den großen Rednern gehören, aber ich erkenne doch sehr schnell, wenn du lügst. Also raus damit«, sagte sie und ihre Grübchen kamen zum Vorschein.
Eine Weile starrte ich in Mamas Gesicht. Manchmal wünschte ich mir, meine Züge würden ihren gleichen. Doch es sollte nicht sein und ich erbte die Genetik meines Vaters. Jeder der uns zusammen sah, es kam nicht sehr häufig vor, versicherte, dass ich Rico wie aus dem Gesicht geschnitten war. Eine Tatsache, die mich maßlos störte. Jeden Tag sah ich in den Spiegel und musste bitterlich feststellen, dass die Leute Recht hatten.
»Ich habe vorhin dein Telefonat mitbekommen«, gestand ich kleinlaut.
Überrascht betrachtete sie mich.
»Oh«, sagte sie nur.
»Ich will nicht, dass du die Kette deiner Oma verkaufst, nur damit ich auf irgendeiner Klassenfahrt dabei sein kann.«
»Es ist nicht irgendeine Fahrt, sondern deine Abschlussfahrt«, verbesserte sie mich.
Einen Moment schwiegen wir und meine Mutter schien plötzlich tief in Gedanken zu sein.
»Taylor«, stöhnte sie meinen Namen leise. »Du bist mein Kind. Ich liebe dich und Milo über alles und deshalb werde ich auch immer alles tun, damit es euch beiden gutgeht. Ich weiß, dass ihr nicht alles habt und glaub mir, ich wünschte jeden Tag, es wäre anders. Aber ich verspreche dir, dass du auf dieser wichtigen Fahrt dabei sein wirst. Mach dir also bitte keine Sorgen.«
»Das kann ich aber nicht, wenn du dafür dein Erbstück verkaufen musst. Es ist nur eine Fahrt, aber ich weiß, dass dir diese Kette sehr viel bedeutet.«
Plötzlich schnaufte meine Mutter auf.
»Die Kette ist mir völlig egal. Es ist nur ein Stück Metall und es bedarf sicher keinen Gegenstand, um mich an meine Großmutter zu erinnern. Aber eine Abschlussfahrt, die hast du nur ein einziges Mal im Leben. Es werden ein paar Tage voller Erinnerungen sein, von denen manche vielleicht sogar dein Leben prägen werden. Du wirst mitfahren und sobald du wiederkommst wirst du mir erzählen, wie es in Italien gewesen ist.«, sagte sie und legte ihre Hand auf meine.
Schweigend starrte ich auf den Tisch. Doch als sie nach einer Weile wieder zu sprechen begann, setzte mein Herz einen Schlag aus.
»Niemand auf dieser Welt hat es mehr verdient als du.«
Ich schluckte schwer und fand keine Worte, die ich erwidern konnte.
»Ich möchte, dass du mir etwas versprichst«, sagte sie dann.
Gespannt wartete ich, dass sie sprach.
»Ich möchte, dass du mir versprichst alles zu tun, um irgendwann ein glückliches Leben zu leben. Du musst dein Abitur machen, dir anschließend einen guten Job suchen und es aus diesem Drecksloch hier raus schaffen. Du bist so ein kluger, hübscher Junge und dir liegt die ganze Welt zu Füßen. Alles was du nur tun musst, ist, mutig auf sie zuzugehen.«
Ich betrachtete meine Mutter voller Mitgefühl und Respekt. Sie war schrecklich unglücklich und trotzdem blickte sie mir mit Liebe in die Augen. Ich sah, dass sie ernsthaft darauf wartete, eine Antwort von mir zu bekommen.
»Ich verspreche es.«
Im Anschluss beugte sie sich vor und gab mir einen leichten Kuss auf die Wange. Ich mochte diese Art von Nähe nicht, ertrug es ihr zuliebe aber mit einem unguten Gefühl. Ich hätte ihr gerne gesagt, dass sich alles ändern könnte, wenn sie nur meinen Vater rauschmeißen würde. Er brachte ihr sowieso nichts, egal in welcher Hinsicht. Aber ich wusste, dass wenn ich mit diesem Thema anfangen würde, dieser Moment schlagartig zunichte wäre.
»Du solltest jetzt ins Bett gehen. Es ist schon spät«, sprach sie lächelnd.
»Und du?«
»Ich bereite noch schnell das Essen für morgen zu. Ich werde wahrscheinlich später nach Hause kommen.«
Ich verbot mir einen Seufzer und stellte mich jetzt schon darauf ein, morgen mal wieder den ganzen Tag im Zimmer zu hocken, damit ich Rico nicht auf die Nerven ging.
»Ich kann dir noch beim Kochen helfen«, sagte ich.
»So weit kommt es noch. Du hast deine eigenen Verpflichtungen. Morgen ist Schule, also los, ins Bett.«
Damit ich mich endlich bewegte, erhob meine Mutter sich als erste und wartete darauf, dass ich ins Zimmer ging.
Als ich sie verließ, nahm ich jene Gedanken mit mir, obwohl alles in mir danach strebte, sie rauszubrüllen.
Zwei Wochen später saß ich an meinem Schreibtisch und machte Hausaufgaben. Ich musste mich beeilen, weil Finn und ich in der Schule abgemacht hatten, heute Nachmittag eine Runde Basketball zu spielen. Und meiner Mutter musste ich vorhin noch versprechen, dass ich zum Essen blieb. Milo saß hinter mir auf dem Boden und spielte mit seinem Lego. Er machte seit Minuten einen riesigen Krach und störte meine Konzentration erheblich.
»Milo, komm schon! Spiel etwas leiser, okay?«
»Ich brauche aber das eine bestimmte Teil, sonst kann ich mein Auto nicht weiterbauen«, grummelte er.
Ich unterdrückte ein Fluchen und verzichtete auf eine Diskussion mit ihm. Zum einen, weil Milo es eh nicht verstehen würde und zum anderen, weil unser Vater es nicht erlaubte, wenn er irgendwo anders als in seinem Zimmer spielte. Schließlich brauchte Rico Ruhe, wenn die Glotze lief oder er ein Nickerchen halten wollte. Ich wusste aus eigener Erfahrung, wie ätzend es war, wenn man ins Zimmer verbannt wurde und gleichzeitig still zu sein hatte. Deshalb versuchte ich Milo wenigstens in unseren vier Wänden ein wenig Freiheit zu lassen, auch wenn ich meine eigenen Bedürfnisse dadurch meist einschränken musste. Um Milo bei seinen Hausaufgaben nicht zu stören, setzte ich mir meistens die Kopfhörer auf und hörte Musik. Wenn er ins Bett ging, verließ ich freiwillig das Zimmer und setzte mich zwangsweise in die Küche, damit er in Ruhe einschlafen konnte. Ich hätte mir gerne mal einen Film angesehen, aber Rico beanspruchte stets das Wohnzimmer für sich. Aus diesem Grund machte es mich manchmal auch fuchsteufelswild, wenn mein Bruder keine Rücksicht auf mich nahm. Trotzdem schluckte ich meinen Frust hinunter und versuchte, weiter zu lernen.
Rico war in den letzten Tagen ziemlich schlecht gelaunt und seit meine Mutter einen zusätzlichen Job angenommen hatte, damit meine Abschlussfahrt finanziert werden konnte, war die Stimmung bei uns zu Hause deutlich angespannt. Ich versuchte meinem Vater so gut es ging aus dem Weg zu gehen, aber das war leichter gesagt als getan. Zudem trank er jetzt häufiger. Jeden Tag gab ich mein Bestes, um ihn zufrieden zu stellen, doch allein in dieser Woche hat er mich schon zweimal geschlagen. Ich glaube, meine Mutter sprach mich nicht darauf an, weil sie Angst vor der Wahrheit hatte. Denn ich war mir sicher, sie vermutete bereits, dass mal wieder etwas vorgefallen war.
Nachdem ich meine Englischhausaufgaben beendet hatte, lernte ich noch ein wenig für Physik. Das Versprechen, das ich meiner Mutter zuletzt gegeben habe, spornte mich dazu an. Auch ich wollte diesem Drecksloch entfliehen. Und wenn es eines Tages soweit war, würde ich Mama und Milo mitnehmen, und Rico hier versauern lassen. Genau das war mein Plan und ich würde alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen. Nicht umsonst lernte ich die letzten Tage bis tief in die Nacht hinein, wie einer dieser Streber.
»Jungs, das Essen ist fertig!«, hörten wir meine Mutter laut aus dem Flur rufen.
Gemeinsam gingen mein Bruder und ich in die Küche und setzten uns an den winzigen Esstisch, der kaum Platz für uns alle bot. Zuerst bekam mein Vater seine Portion, darauf bestand er eisern. Es war mir zuwider, dass er sich ständig bedienen ließ. Dabei war es Rico gleichgültig, das meine Mutter heute schon in der Schneiderei gearbeitet hatte und gleich zu ihrem nächsten Job musste. Alles hätte ich dafür gegeben, ihm mal so richtig die Meinung zu sagen. Aber weil Mama es hasste, wenn wir stritten, hielt ich meinen Groll in Zaum.
Als meine Mutter sich zu uns setzen wollte, schwankte sie plötzlich zur Seite. Rechtzeitig griff ich nach ihrem Arm und sah sie besorgt an.
»Huch«, stöhnte sie. »Was war das denn? Entschuldigt bitte.« Ihre Stimme klang schwach.
»Geht’s dir gut?«, wollte ich wissen.
»Sicher, Liebling. Mir war nur einen kurzen Moment schwindelig.«
»Du siehst sehr blass und müde aus. Besser, du legst dich ein wenig hin«, riet ich ihr.
»Nein, nein. Das geht nicht. Ich muss gleich wieder los. Ein Glas Wasser wird sicher helfen«, antwortete sie matt. »Mach dir keine Sorgen«, fügte sie wenig später hinzu, weil ich sie skeptisch musterte.
»Vielleicht wirst du krank«, vermutete ich.
»Da hast du es!«, mischte Rico sich ein. »Jetzt bekommt deine Mutter auch noch ´ne Grippe, weil sie so viel arbeiten muss. Und das nur, damit du auf dieser bescheuerten Fahrt mitfahren kannst.«
Fassungslos drehte ich mein Gesicht in seine Richtung.
»Wie bitte?«, fragte ich entsetzt.
»Rico, hör auf. Bitte«, flehte Mama und schloss erschöpft die Augen.
»Da!«, sagte er und zeigte mit dem Finger auf Mama »Sieh sie dir nur an. Deine Mutter sieht total beschissen aus. Wie so ´ne alte Schachtel. Kein Mensch würde glauben, dass sie erst fünfunddreißig ist«, maulte er und aß hinterher mürrisch sein Essen weiter.
Wütend biss ich die Zähne aufeinander.
»Wegen mir? Du bist doch derjenige, der sich von vorne bis hinten bedienen lässt und seinen Arsch nicht von der Couch bekommt!«
Bevor ich noch etwas sagen konnte, krallte Rico auch schon seine Finger in meine Haare und zog meinen Kopf brutal nach hinten.
»Na warte! So redest du sicher nicht mit mir!«
»Rico, nicht! Lass ihn los!«, hörte ich Mama schreien und sah, dass sie im nächsten Moment versuchte, Ricos Griff von mir zu lösen. Doch mein Vater packte ihr Handgelenk und schubste Mama grob zur Seite.
Es fühlte sich an, als würden meine Nerven bei dem Anblick durchbrennen. Zornig riss ich mich von Rico los und nahm zuerst Abstand. Dann sah ich ihn an und wollte nur noch eins… draufhauen! Blind vor Wut schmiss ich den Stuhl um und ging furchtlos auf meinen Vater zu.
»Was hast du vor? Mir eine reinhauen?«, fragte er und lachte dabei abfällig.
»Wenn du wüsstest«, antwortete ich und wollte ihn mir gerade greifen. Aber Rico war schneller, packte mich am Kragen meines Pullovers und drückte unsanft gegen die Wand. Direkt im Anschluss knallte er mir eine.
»Du kleiner Idiot. Dir werde ich es zeigen!«, schrie er. Im Hintergrund waren verzweifelte Rufe meiner Mutter zu hören. Dann folgte ein weiterer Schlag in mein Gesicht. Gerade als ich mich wehren wollte, stellte meine Mutter sich vor mich. In ihrem Blick lag blankes Entsetzen. Ängstlich betrachtete sie mich.
»Lauf weg! Schnell!«, sprach sie zu mir.
Ich wollte nicht. Etwas in mir wusste, dass ich gegen meinen Vater gewinnen würde. Zeitgleich rüttelte Rico wild an der Kleidung meiner Mutter, um an mich heranzukommen.
»Verschwinde, Taylor!«, sagte Mama nun lauter.
Nur weil ich die Angst in ihren Augen sah, rückte ich widerwillig ab.
»Milo!«, rief ich.
Mit einem lauten Türknall verließen mein Bruder und ich Sekunden später die Wohnung. Blind vor Wut durchquerten wir die Straßen. Meine Gedanken galten ganz meinem Vater. Aufgeregt versuchte ich mich unter Kontrolle zu bekommen. Mein Puls raste viel zu schnell und mittlerweile begann das Atmen anstrengend zu werden.
»Hier«, hörte ich Milo kaum hörbar sprechen.
Zum ersten Mal blickte ich zu ihm und sah, dass er mir meine Jacke hinhielt. »Damit du nicht wieder frieren musst«, flüsterte er niedergeschlagen. Augenblicklich bekam ich Mitleid mit meinem Bruder. Als ich ihn betrachtete, wie er so zierlich vor mir stand und die Jacke nach mir ausstreckte, beruhigte ich mich von allein. Seine Gesichtszüge waren zerrüttet. Plötzlich fiel mir auf, dass er selber nur im Pullover vor mir stand. Langsam hockte ich mich zu ihm runter und schaute Milo einen Moment in die Augen. Ich sah, dass ihm nach weinen zumute war. Doch er versuchte seine Gefühle angestrengt vor mir zu verbergen.
»Ich finde, dir steht sie besser«, sagte ich und lächelte ihn matt an.
»Aber«, wollte er mir das Wort abzuschneiden. »Kein aber! Ich meine es ernst. Mir ist sowieso nicht kalt und wir wissen doch beide, wie gerne du meine Klamotten trägst«, neckte ich ihn.
Milo biss sich auf die Lippe und senkte den Blick. Anschließend nahm ich meine Jacke, und half ihm hinein. Daraufhin beäugten wir uns einige Sekunden schweigend.
»Lass uns gehen. Wir spielen heute Basketball.«
Nachdem wir ein paar Schritte gegangen sind, rieb ich einmal über seinen Schopf.
»Danke, dass du an mich gedacht hast. War ziemlich cool von dir«, gestand ich.
»Wir sind doch ein Team.«
»Das sind wir«, versprach ich ihm.
Als wir beim Sportplatzplatz ankamen, sahen wir das Finn schon fleißig ein paar Körbe warf.
»Hey, Milo«, begrüßte mein Kumpel ihn wenig überrascht. Kurz darauf ließ Finn einen besorgten Blick über mich schweifen.
»Alles klar?«, fragte er. Finn wusste mittlerweile, dass es zu Hause Stress gab, wenn ich meinen kleinen Bruder mitbrachte.
»Ja«, antwortete ich tonlos.
Schon vor Jahren hat er mir versichert, dass ich mich nicht schlecht zu fühlen brauchte, wenn ich Milo des Öfteren zu unseren Treffen mitbrachte. Den Grund dafür kannte er ja. Trotzdem fühlte ich mich schon früher immer mies dabei und es gab Zeiten, da machte ich mir ernsthafte Gedanken um unsere Freundschaft. Aber bis heute nahm Finn es immer cool auf. Nur wünschte ich manchmal, er würde mich an diesen Tagen nicht ständig so besorgt anstarren. Das nervte extrem.
»Lass uns anfangen«, sagte ich und schlug ihm den Ball mit einem halben Grinsen aus der Hand.
»Willst du mitspielen, Milo?«, rief ich meinem Bruder zu.
»Lieber nicht. Ich schaue einfach nur zu«, schrie er zurück. Daraufhin setzte Milo sich auf eine Bank.
Er tat mir leid. Aber ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass er es bei mir wesentlich besser hatte, als zu Hause.
Finn und ich kamen gut ins Spiel rein und es dauerte nicht lange, bis ein paar Jungs aus unserer Gegend fragten, ob sie mitspielen durften. Während Milo mich bei jedem meiner Körbe ununterbrochen anfeuerte, war ich froh, dass der Nachmittag wenigstens noch einigermaßen angenehm verlief.