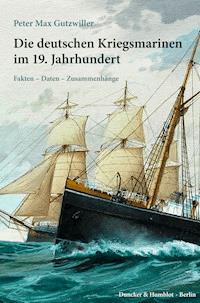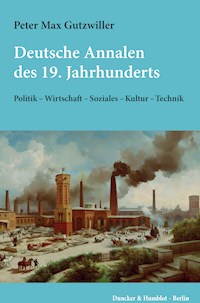
54,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Werk bezweckt in tabellarischer Form die Feststellung der für das 19. Jahrhundert wesentlichen Fakten und Werke als Grundlage für das Verständnis, die Deutung und Beurteilung der Entwicklung primär in Deutschland, aber auch im mitbestimmenden Ausland. Ohne Anspruch auf eine ohnehin nicht erreichbare Vollständigkeit werden jene Vorgänge und Ereignisse dargestellt, die sich nach Ansicht des Autors in allen Lebensbereichen für die jeweilige Zeit und die Folgezeit als charakterisierend und prägend erweisen. Gleichzeitig soll aber, unabhängig von der eventuellen Fortwirkung, auch die beeindruckende Vielfalt des gedanklichen und tätigen Wirkens im 19. Jahrhundert vor allem in Deutschland aufgezeigt werden. Die Darstellung folgt grundsätzlich in jedem Jahr der folgenden Systematik (A) Internationale Beziehungen: Weltausstellungen; Konferenzen, Vereinbarungen; Krisen; Kriege (B) Entdeckungen, Expeditionen, Paläontologie, Archäologie: Forschungsreisen und Objekte (C) Innerstaatliche Vorgänge: Staatsorganisation; Politik; Militär; Rechtswesen; Religion, Kirche; Soziale Entwicklung; Schule; Presse; Städtebau; Gesellschaft; Sport (D) Ökonomie: Institutionen; Unternehmen; Geld, Edelmetall; Metrik; Gewicht; Zeit (E) Kultur: Institutionen, Universität, Museum, Theater, Bibliothek, Künstlervereinigungen; Werke der Darstellenden Künste, Musik, Belletristik (F) Naturwissenschaften, Technik: Institutionen; Grundlagen; Chemie, Physik; Biologie, Landwirtschaft; Dampf, Kohle, Eisen, Stahl; Gebäude-, Geräte- und Maschinenbau; Optik, Astronomie; Photographie, Film; Licht, Gas, Elektrizität; Meteorologie; Fernübermittlung; Militärtechnik (G) Zivilverkehr: Schifffahrt; Schienenverkehr; Straßenverkehr; Luftfahrt (H) Gesundheit, Medizin, Hygiene, Ernährung: Institutionen; Grundlagen; Bakteriologie, Virologie; Anästhesie, Operationstechnik und -geräte; Psychologie, Psychiatrie; Hygiene; Ernährung (I) Geburts- und Todesjahre bedeutender Persönlichkeiten. Auf der Basis dieser Darstellung wird in einem Epilog der Versuch einer zusammenfassenden Charakterisierung des deutschen 19. Jahrhunderts unternommen. Der Text wird ergänzt durch ein umfangreiches Sachverzeichnis, Personenverzeichnis und Ortsverzeichnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
PETER MAX GUTZWILLER
Deutsche Annalen des 19. Jahrhunderts
Deutsche Annalen des 19. Jahrhunderts
Politik – Wirtschaft – Soziales – Kultur – Technik
Von Peter Max Gutzwiller
Duncker & Humblot · Berlin
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlag: Borsig,s Maschinenbau-Anstalt zu Berlin Gemälde, 1847, von Eduard Biermann (© akg-images)
Alle Rechte vorbehalten © 2017 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde Druck: CPI buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany ISBN 978-3-428-15266-7 (Print) ISBN 978-3-428-55266-5 (E-Book) ISBN 978-3-428-85266-6 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ♾
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Julius Dassel sel. Rolf Krämer Leo Schmutz Dieter Scholer
zugedacht mit dem tiefempfundenen Dank des Verf. für lebenslange Freundschaft
Vorwort
Geschichtsschreibung besteht aus einer Feststellung von Fakten und aus deren Deutung und Beurteilung. Die vorliegende Arbeit strebt nur das erstere an, will mithin bloss durch die „Absonderung des wirklich Geschehenen … das Gerippe der Begebenheiten“1gewinnen, und so als Grundlage für die Beurteilung und Deutung der Vorgänge und Zusammenhänge dienen.
Unbestritten ist, dass die Deutung der Fakten auch bei strenger Disziplin nicht anders als subjektiv sein kann. Aber auch die Feststellung der Fakten ist, bei allem Bemühen, nicht objektiv, schon allein, weil es aus praktischen Gründen unmöglich ist, alle Fakten einer Epoche darzustellen, weshalb eine Auswahl unumgänglich wird, die notwendigerweise subjektiv geprägt ist. Das vorliegende Werk strebt denn auch in keiner Weise eine ohnehin unerreichbare Vollständigkeit an. Der Verf. hat sich vielmehr bemüht, jene Vorgänge im 19. Jahrhundert herauszugreifen, die sich aus der Rückschau, im Gesamtzusammenhang, nach seiner Beurteilung für die jeweiligen Jahre und die Folgezeit (gelegentlich auch für das Verstehen der vorausgegangenen Zeit), als charakterisierend und massgeblich erwiesen. Ausser Acht gelassen wird dabei, ob damalige Ereignisse, Entwicklungen und Werke auch für die Gegenwart noch als bedeutsam gelten. Die Annalen wollen – u. a. durch die Nennung von Vorgängen, die nicht a priori als bedeutsam erscheinen – darüber hinaus auch die beeindruckende Vielfalt des gedanklichen und tätigen Wirkens im 19. Jahrhundert darstellen. Eine weitere Auswahl wurde insofern getroffen, als dem Verf., wie im Werktitel ausgedrückt, daran gelegen war, besonders die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts sicht- und fassbar zu machen, die aber nur in ihrem Zusammenwirken mit den damals mitbestimmenden ausländischen Umfeldern verstanden werden kann, die deshalb in die Betrachtung einbezogen wurden.
Von den verschiedenen Methoden zur Darstellung geschichtlicher Fakten hat sich der Verf. für die Annalistik entschieden, weil sie dank gedrängter Form in tabellarischer Anordnung eine umfassendere Darstellung auch von scheinbar Nebensächlichem ermöglicht, die Verknüpfung von Ereignissen unterschiedlichster Natur aller Lebensbereiche erlaubt, und weil sie besonders geeignet ist, die Gleichzeitigkeit bzw. Abfolge massgeblichen Gesche[8]hens (z. B. als Hintergrund einer Biographie2) übersichtlich darzustellen. Diese letztere Aussage ist richtig im Rahmen der reinen Faktenlage; sie gilt aber nur bedingt bei der Beurteilung von deren Wirkung. Denn oft wurden „Ereignisse“ zunächst gar nicht als solche zur Kenntnis genommen, z. B. weil sie nicht oder nur einem kleinen Kreis bekannt waren3, oder zwar allgemein zugänglich waren, aber (nicht selten bei naturwissenschaftlichen und technischen Errungenschaften) zunächst nicht als Ereignisse gewertet wurden4. Umgekehrt gerieten auch bedeutende Ereignisse später in Vergessenheit: Bachs Matthäuspassion wurde 1829 nach rund 100 Jahren durch Felix Mendelssohn-Bartholdy erstmals wieder aufgeführt, stand also zwar seit 1727 in der Welt, konnte aber während der Phase der Vergessenheit keine Wirkung entfalten. Und schliesslich erklärt sich die Differenz zwischen dem Eintritt eines Ereignisses und dessen Kenntnisnahme (und damit seiner Wirkungsmöglichkeit) aus dem damaligen Fehlen genügender Technik zur raschen Fernübermittlung5. Aus diesen mehrfachen Gründen ist der Schluss auf die Kausalität des Früheren für das Spätere oftmals fragwürdig, sofern sie sich nicht aus den gesamten Umständen ergibt6. Diese Ausgangslage hat sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts mit der rapiden Zunahme und leichteren Zugänglichkeit von Druckschriften und mit der Schaffung der Voraussetzungen der elektro- und funktechnischen Telekommunikation deutlich und bleibend verändert7. Denn damit rückte der Eintritt eines Ereignisses und dessen Kenntnisnahme (und eventuelle Wirksamkeit) räumlich und [9] zeitlich markant näher – heute wird Ist-Zeit-Reporting verlangt – womit hinsichtlich der Kausalität relevanter Vorgänge eine neue Dimension erreicht wurde.
In der historischen Literatur wird oftmals die Frage nach dem Sinn von Epochendefinitionen gestellt. Entsprechend dem Fokus des Betrachters wird bezüglich des 19. Jahrhunderts etwa von einem „langen“ bzw. einem „kurzen“ Jahrhundert gesprochen und werden dessen Anfang und Ende entsprechend terminiert. Dieser mehr thematischen als kalendarischen Umschreibung wird hier nicht widersprochen, weil sie den Vorzug hat, dynamische Prozesse (z. B. Aufklärung, Imperialismus, Moderne) nicht künstlich zu unterbrechen. Im Rahmen der hier vorgelegten Annalen wird jedoch, dem Wortsinn entsprechend und wegen der ihnen eigenen Zielsetzung, an der traditionellen Epochenbildung festgehalten. Deshalb beginnt das 19. Jahrhundert in diesen Annalen am 1.1. 1800; es endet am 31.12.1900.
Der Verf. hat bei der Arbeit an den hier vorgelegten Annalen vielfache Hilfe erfahren. Besonderer Dank gilt meinem Sohn RA Christian Gutzwiller für die Erstellung des Ortsverzeichnisses und meiner Lebensgefährtin Lisa Schiesser für ihr anhaltendes Verständnis für meine häufigen geistigen Abwesenheiten und ihre umfassend liebenswürdige Unterstützung.
Für Fehler und Versäumnisse bin ich allein verantwortlich.
Sich mit dem europäischen 19. Jahrhundert zu befassen ist deshalb so wichtig, weil Bürgertum und Arbeiterschaft damals unter grossem Einsatz für sich und die nachfolgenden Generationen oft unter hohen Opfern der Obrigkeit wichtige Freiheiten abgerungen haben, die wir Heutige nun in einem schleichenden Prozess wieder zu verlieren im Begriffe sind8, ohne uns dagegen entschieden genug zur Wehr zu setzen. Es wäre höchste Zeit für eine Revolution der Rückbesinnung auf Demokratie, Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung – in den Köpfen, nicht auf der Strasse!
Küsnacht / Zürich, 9. März 2017
Der Verf.
1 W. v. Humboldt, Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers, gelesen am 11.4.1821 in der Akademie der Wissenschaften in Berlin, gedruckt in den Taschenausgaben der philosophischen Bibliothek Nr. 3 (S. 3), Leipzig o. J.
2 In casu VAdm Paul Gottfried Hoffmann, 1846-1917, in Arbeit.
3 Es vergingen rund 50 Jahre bis zur Drucklegung (1863) von Goyas Desastres de la guerra (1810-1814).
4 Beispiele sind die 1866 von Mendel publizierten aber erst 1900 gewürdigten Ergebnisse seiner Pflanzen-Kreuzungs-Experimente. – Friedrich Fröbels Hauptwerk „Die Menschenerziehung“ (1826) war über den Tod des Verfassers (1852) hinaus seiner Zeit so weit voraus, dass seine Bedeutung damals lange nicht erkannt wurde. – Weil Publikationen in italienischen Fachschriften damals zu wenig Beachtung fanden, wird allgemein Branly (1890) und nicht Calzecchi-Onesti (1884) als Erfinder des Kohärers / Fritters betrachtet.
5 Von der Geburt seines 2. Sohnes Werner (1879) erfuhr KL P. G. Hoffmann (auf Bismarck) in Sydney erst, als das Kind bereits 6 Monate alt war.
6 Auch die Deutung von „Gleichzeitigkeit“ ist heikel: sie kann sich zufällig ergeben oder als Ausfluss des sog. „Zeitgeistes“; es würde zu weit führen, diesen causae und ihrer Relation im Rahmen dieser Arbeit nachzuspüren.
7 Fixpunkte sind die Jahre 1833, als Gauss und Weber die erste elektromagnetische telegraphische Nachrichtenübermittlung gelang, 1837 mit Morses Erfindung des Schreibtelegraphen-Apparates, 1847 mit der Guttapercha-Isolierung von Kabeln durch W. Siemens, 1850 mit der Verlegung des 1. Unterwasserkabels von Dover nach Calais und zum Schluss des Jahrhunderts die Erfindung der drahtlosen Telegraphie (Arco, Branly, F. Braun, Hertz, Marconi, Maxwell, Popow, Slaby) und der Telephonie (Bell, Meucci, Reis).
8 „Freiheitsindex 2012“ erhoben durch das John-Stuart-Mill-Institut für Freiheitsforschung der Universität Heidelberg, zusammen mit dem Allensbach Institut für Demoskopie und dem Institut für Publizistik der Universität Mainz (vgl. z. B. NZZ Nr. 275 vom 26.11.2013 S. 6).
Inhaltsverzeichnis
Arbeitstechnische Hinweise
Systematik der Annalen
Annalen
Epilog: Versuch einer Charakterisierung des deutschen 19. Jahrhunderts
Personenverzeichnis
Ortsverzeichnis
Sachverzeichnis
Arbeitstechnische Hinweise
1. Länderbezeichnungen
Der Einfachheit halber werden folgende Länder-Bezeichnungen verwendet: „Deutschland“ für das Deutsche Reich (bis 1871 für die betroffenen deutschen Länder); „England“ für die Staaten des Vereinigten Königreichs; „Österreich“ für die Länder der Doppelmonarchie; „USA“ für die jeweilen der nordamerikanischen Union angehörenden Staaten. Bei Staaten, die im Verlauf der Zeit ihren Namen wechselten (z. B. Abessinien / Äthiopien, Siam / Thailand, Persien / Iran, Osmanisches Reich / Türkei), wird i.d.R der moderne Name verwendet. Vorgänge ohne regionale Angabe beziehen sich auf Preussen / Deutschland.
2. Völkerrechtliche Begriffe
Einzelne Begriffe (z. B. Annexion, Autonomie, Kolonie, Protektorat, Selbstverwaltung, Staat) werden möglicherweise nicht stets in einem staatsund völkerrechtlich akkuraten Sinne verwendet.
3. Namen, Lebensdaten
Vornamen und Lebensdaten enthält das diesem Anhang beigegebene Personenregister. Regelmässig unter einem Pseudonym arbeitende Künstler werden unter diesem Pseudonym genannt, im Personenregister auch unter Angabe des bürgerlichen Namens. Auf die Angabe von Adelsprädikaten und -titeln wird i. d. R. verzichtet.
4. Werkdaten, Werktitel
Wenn nicht anders angegeben, werden Werke der Bildenden Künste im Jahr der Fertigstellung, Werke der Musik und der Bühne im Jahr der Uraufführung, Werke der Belletristik und übrigen Literatur im Jahr der ersten (Buch-)Publikation eingereiht; bei sich über mehrere Jahre erstreckenden Publikationen erfolgt die Einreihung i. d. R. im Jahre des Abschlusses mit Hinweis auf den Anfang. Werktitel in englischer, französischer und italienischer Sprache werden im Original genannt, Werktitel in anderen Fremdsprachen in der in Deutschland üblichen Übertragung.
[14] 5. Tageschronologie
Innerhalb eines Jahres wurde nicht einer oft nur unter unzumutbarem Aufwand feststellbaren Tageschronologie, sondern dem Sachzusammenhang Priorität eingeräumt.
6. Bibliographie
Zur Erarbeitung dieser Annalen hat der Verf. jede Art von öffentlich zugänglichen Quellen aus allen Sachgebieten benutzt, einschliesslich Zeitschriften, Zeitungen und Internet; dem Werk eine Bibliographie beizugeben wäre geradezu unsinnig. Im Falle (überraschend häufiger) widersprechender Angaben in der Sekundärliteratur verlässt sich der Verf. bei Werken der Literatur auf Kindlers Neues Literatur Lexikon (1988ff.), bei Werken der Musik auf die Kulturführer von Harenberg, bei Errungenschaften der Naturwissenschaften und Technik auf die Bde. 3 und 4 der Propyläen Technikgeschichte, Berlin, Neuausgabe 1997.
7. Gründer
Die in diesem Werk als Gründer einer Gesellschaft oder Institution ausgewiesenen Personen sind oft nicht die einzigen Gründer gewesen, sondern jene, die mit der Gründung am ehesten in Verbindung gebracht werden.
8. Abkürzungen
Zusätzlich zu den üblichen werden die folgenden Abkürzungen verwendet
Systematik der Annalen
Die Darstellung, nach Jahren gegliedert, erfolgt grundsätzlich im Sinne der nachfolgenden Systematik. Zur übersichtlicheren Darstellung komplexer Zusammenhänge oder zur Vereinfachung wird gelegentlich von dieser Systematik abgewichen. Die systematische Einordnung nennenswerter Vorgänge bereitet oft Mühe, weil ein Sachverhalt u. U. in mehrere systematische Gefässe passt. Solche Zuteilungskonflikte wurden i. d. R. nach dem Wirksamkeitsprinzip gelöst. Um Uferlosigkeit zu vermeiden, wurde konsequent auf Mehrfach-Nennungen verzichtet, jedoch wurden, wo es dem besseren Verständnis dient, Jahresquerverweise angebracht. Sachliteratur wird im betreffenden Teil genannt, oder am Ende des jeweiligen Teils (E).
(A) Internationale Beziehungen
Weltausstellungen, Konferenzen, Konventionen.
Zwischenstaatliche Vorgänge: Deutschland, Europa, Asien (W>O), Pazifik, Afrika (N>S), Amerika (N>S).
(B) Entdeckungen, Expeditionen, Paläontologie, Archäologie
Forschungsreisen; Objekte. Sachliteratur.
(C) Innerstaatliche Vorgänge
Staatsorganisation, Politik, Militärorganisation; Rechtswesen; Religion, Kirche; Soziales (Sklaverei, Sozialismus; Stellung der Frau, Stellung des Kindes); Schule, Universität (soweit nicht im jeweiligen Teil (E) behandelt); Presse; Städtebau (soweit nicht im jeweiligen Teil (E) behandelt); Gesellschaft, Vermischtes; Sport.
(D) Ökonomie
Institutionen, Unternehmen; Geld, Edelmetall, Edelsteine; Metrik, Gewicht, Zeit. Sachliteratur
(E) Kultur
Institutionen (Universität, Museum, Theater, Bibliothek, Musik, Künstlervereinigungen); Personen.
Werke (Darstellende Kunst, Musik, Belletristik). Sachliteratur.
[16] (F) Naturwissenschaften, Technik
Institutionen (Hochschulen, Vereinigungen); Grundlagen; Chemie, Physik; Biologie, Landwirtschaft; Dampf, Kohle, Eisen, Stahl; Gebäude-, Geräteund Maschinenbau; Optik, Astronomie; Photographie, Film; Licht, Gas, Elektrizität; Meteorologie; Fernübermittlung; Militärtechnik. Sachliteratur.
(G) Zivilverkehr
Schifffahrt; Schienenverkehr; Strassenverkehr; Luftfahrt. Sachliteratur
(H) Gesundheit, Medizin, Hygiene, Ernährung
Institutionen; Grundlagen; Bakteriologie, Virologie; Anästhesie; Operationstechnik und -geräte; Psychologie, Psychiatrie; Hygiene; Ernährung. Sachliteratur
(I) Geburts- und Todesjahre bedeutender Persönlichkeiten
Annalen
1800
(A)
Österreich durch Frankreich aus Graubünden vertrieben.
Österreichische Niederlagen gegen Frankreich bei Marengo, Montebello und Hohenlinden.
Bündnis Dänemarks mit Preussen, Russland und Schweden.
Vertrag von San Ildefonso: Französisch-Spanisches Bündnis gegen Portugal.
Malta durch England besetzt.