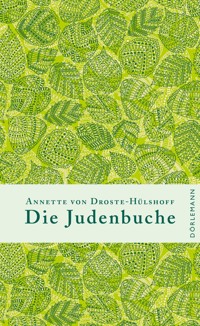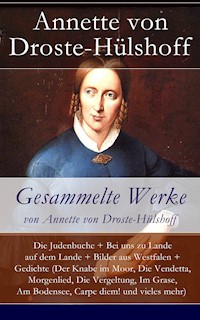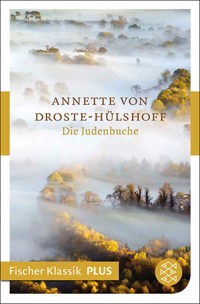4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deutscher Novellenschatz
- Sprache: Deutsch
Der "Deutsche Novellenschatz" ist eine Sammlung der wichtigsten deutschen Novellen, die Paul Heyse und Hermann Kurz in den 1870er Jahren erwählt und verlegt haben, und die in vielerlei Auflagen in insgesamt 24 Bänden erschien. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurden in dieser Edition die sehr alten Texte insofern überarbeitet, dass ein Großteil der Worte und Begriffe der heute gültigen Rechtschreibung entspricht. Dies ist Band 24 von 24. Enthalten sind die Novellen: Droste-Hülshoff, Annette von: Die Judenbuche. Lorm, Hieronymus [d. i. Heinrich Landesmann]: Ein adeliges Fräulein. Sacher-Masoch, Leopold von: Don Juan von Kolomea. Ziegler, Franz Wilhelm: Saat und Ernte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Deutscher Novellenschatz
BAND 24
Deutscher Novellenschatz, Band 24
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849661328
Das Korpus „Deutscher Novellenschatz“ ist lizenziert unter der Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenz und Teil des Deutschen Textarchivs. Eine etwaige Gemeinfreiheit der reinen Texte bleibt davon unberührt. Näheres zum Korpus und ein weiterführender Link zu den Lizenzbestimmungen findet sich unter https://www.deutschestextarchiv.de/novellenschatz/. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurden die sehr alten Texte insofern überarbeitet, dass ein Großteil der Worte und Begriffe der heute gültigen Rechtschreibung entspricht.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Ein adeliges Fräulein.1
Die Judenbuche.26
Saat und Ernte.64
Don Juan von Kolomea.98
Ein adeliges Fräulein.
Hieronymus Lorm (Heinrich Landesmann).
Vorwort.
Heinrich Landesmann, am 9. August 1821 zu Nikolsburg in Mähren geboren, erhielt, da er schon als Kind sehr kränklich war, bis zu seinem zwölften Jahre Unterricht im Hause seines Vaters, eines angesehenen Wiener Kaufmannes, und musste dann den Besuch der polytechnischen Schule schon nach einem Jahre wieder aufgeben, da er von einer Lähmung befallen wurde. In seinem fünfzehnten Jahre verlor er das Gehör und zum Teil auch das Sehvermögen, was ihn nicht abhielt, mit verdoppelter Energie, nun ganz auf seine eigenen Studien angewiesen, an seiner geistigen Ausbildung fortzuarbeiten. Er verließ Österreich, da er sich mit der Zensur und dem Metternichschen System nicht zu vertragen vermochte, und siedelte 1845 nach Berlin über, wo er seine journalistischen Arbeiten fortsetzte und seine poetischen Erstlinge herausgab. (Wiens Poetische Schwingen und Federn. Leipzig, 1846. — Das literarische Dachstübchen, 1847. — Gräfenberger Aquarelle. 1848, Berlin). Im April 1848 kehrte er nach Wien zurück und widmete seine Tätigkeit vornehmlich dem Feuilleton der Wiener Zeitung. Daneben erschienen von novellistischen Arbeiten: Am Kamin. Erzählungen. 2 Bände. (Berlin, 1852.) — Erzählungen der Heimgekehrten. (Prag, 1858.) — Intimes Leben. (Prag 1859.) — Novellen. 2 Bände. (Wien, 1864.) — Gabriel Selmar, ein Roman (Wien, 1863, 3. Auflage, schon im Jahre 1855 geschrieben und zuerst unter dem Titel: "Ein Zögling des Jahres 1848" veröffentlicht). Außerdem Dramatisches, Lyrisches, Epigrammatisches, in Journalen und bei verschiedenen Verlegern.
Es ist hier nicht unsere Aufgabe, Hieronymus Lorms dichterische Bestrebungen im Ganzen zu charakterisieren, die Summe Dessen zu ziehen, was er im Kampfe mit einem ausgesucht harten Schicksal aus sich gemacht hat. Wir haben es hier nur mit dem Novellisten zu tun und werden es leicht erklärlich finden, dass sich in diesem unter so ungewöhnlichen Verhältnissen ein Überschuss der geistigen Intention über die sinnliche Kraft, ein Übergewicht des Denkers über den Dichter ausbilden musste, da dem schwer Heimgesuchten das Leben mehr durch Reflexion und innere Anschauung nahe trat, als durch den frischen, unmittelbaren Blick in die bewegte Welt. Seine Novellen sind fast immer in psychologischer Hinsicht bedeutender als in künstlerischer; weit geringere Talente, wenn sie nur die Naivität ihrer Phantasie walten lassen, bringen es oft zu größerer Anschaulichkeit und Unmittelbarkeit der Illusion, als ein geistreicher Denker, dem alle Symbolik des einzelnen Falles, alle sittlichen und geistigen Beziehungen jedes Ereignisses beständig gegenwärtig sind. Mehrfach aber ist es Lorm geglückt, Probleme zu finden, wo seine feuilletonistisch schweifende, grüblerische, oft allzu spitzfindige Darstellungsweise dem Thema gemäßer ist, oder, wie in der von uns mitgeteilten Erzählung, einen echt novellistischen Griff zu tun, einen Kollisionsfall zu finden, der die Menschennatur von einer ungewöhnlichen und doch bedeutsamen Seite offenbart und den Leser zu nachdenklichem Mitgefühl anregt.
***
I.
Seit Jahren liebte ich es, zur Weihnachtszeit die große Stadt trotz ihrer verlockenden Bescherungen zu verlassen, um die landschaftliche Natur in ihrem tiefen Winterfrieden zu besuchen. Wird den Kindern der holde Wahn vorgespiegelt, Christkindlein würde ihnen in der geheimnisvollen Nacht seine Gaben zwischen die Fenster legen, — wer um diese Zeit sich zu seinem Vergnügen auf das Land begibt, der späht ernsthaft nach den Gaben, welche tatsächlich von oben kommen. Ich, auf dem Lande geboren, habe stets ein Heimweh nach ihm behalten, welches mich am öftesten im Winter, inmitten der glänzendsten Gesellschaft überfällt. Es ist mir dann keineswegs darum zu tun, mein Geburtsdorf wiederzusehen, sondern nur darum, überhaupt auf das Land zu kommen. Die Weihnachtszeit gibt dazu freie Tage; ich forsche dann gerne nach den Stimmungen und Hoffnungen des Landmannes, in welchen die besten Freuden des nächsten Jahres eingeschlossen liegen, ich lasse mir sagen, ob der Schnee der weißen Weihnachten von der Art ist, um das Versprechen grüner Ostern auch wirklich zu halten. Endlich sind die Gebräuche, mit welchen die Weihnacht in manchen Bauernstuben gefeiert wird, auch nicht zu unterschätzen; um die von kunstloser Hand angefertigten, ganz von traulichem Moos umgebenen "Krippen" sammeln sich Kinder, welche dann mit dem Öchslein oder Eselein an der Brust glücklicher zu Bette gehen, als die meisten Stadtkinder, nachdem sie den Krinolinen-Umfang ihrer neuen Puppen geprüft haben.
Dieses Jahr ist das erste, in welchem ich mich zu alt fühle, um es noch einmal mit Schnee und Frost aufzunehmen. Es ist freilich auch das erste meiner Pensionierung, und wie das Amt den Verstand, so ziehe die Pensionierung das Alter nach sich. Wer nicht pensioniert wurde, weil er zu alt ist, der wird sicherlich alt werden, weil er pensioniert wurde. Nie durch Weib und Kind beglückt, nun auch zum ersten Mal eines Vergnügens meiner kräftigeren Jahre beraubt, bleibt mir in meiner Einsamkeit nichts übrig, als mir still und allein den Weihnachtsbaum des Alters anzuzünden.
Das ist natürlich der Baum der Einbildungskraft, über und über behängt mit Erinnerungen, worunter manches Spielzeug, nach welchem man aber einst ungemein ernsthaft die Hände ausgestreckt hat. Indem ich mich jedoch des Ausdrucks "Weihnachtsbaum des Alters" bediene, ist er auch schon angezündet. Denn er stammt aus dem Munde einer Person, die zu meinen liebsten, und deren Begegnung mit mir zu meinen merkwürdigsten Erinnerungen gehört.
Zu einem meiner Weihnachts-Ausflüge vor vielen Jahren wählte ich nämlich eine Gegend im südlichen Teil des Landes, nicht weil sie mir anmutiger als eine andere erschienen wäre, — die Jahreszeit gleicht solche Unterschiede aus — sondern um vielleicht meinem fürstlichen Gebieter einen großen Dienst leisten zu können. Es befand sich dort in der Nähe eines Gebirgsdorfes ein Herrenhaus, welches einer Freifrau von Börte gehörte und von ihr ununterbrochen bewohnt wurde, und in diesem Schloss ein Bild, welches mein Fürst, weil es aus französischer Schule war, aus der er am liebsten sammelte, gar zu gerne besessen hätte, wie er einst in meiner Gegenwart äußerte, wenn nur an die wunderliche Frau heranzukommen gewesen wäre, geschweige denn, dass man ihr ein Angebot hätte machen können auf einen Gegenstand, von dem man wusste, dass sie ihn zu ihren unveräußerlichen Besitztümern zählte.
Fest, aber tief verschwiegen fasste ich den Vorsatz, einen Versuch zu machen. Dadurch bekam die Art von unwissenschaftlicher Naturforschung, zu der ich jährlich den Weihnachtsurlaub benützte, einen abenteuerlichen Beigeschmack, der jedoch mein Reisebehagen weder durch Furcht noch durch Hoffnung störte. Zu letzterer war kein Grund vorhanden, und da Niemand um mein Vorhaben, bezüglich der Freifrau von Börte, wusste, so setzte ich mich auch keiner Beschämung aus, wenn es misslang. Der Plan diente also nur dazu, meinen winterlichen Spaziergang noch durch den Reiz der Phantasie zu würzen.
Es ging ein tüchtiger Sturmwind, als ich in der dritten Woche des Dezembers dem Gemeindewirtshaus des Gebirges zusteuerte. Es war in diesem Winter noch wenig Schnee gefallen, sonst hätte ich auch schwerlich so bequem bis zu dem hochgelegenen Orte Vordringen können. Allein an diesem Tage versuchte der Wind vergebens, wie es schien, dichte, graue Schneewolken auseinanderzujagen. Er hinderte sie nur im Verein mit der Kälte, ihre Flocken fallen zu lassen.
II.
Wer kein Neuling ist in den Dörfern, weiß auch in einer ihm noch neuen Gegend bald, was er zu tun hat, damit sein Erscheinen in städtischem Gewand und zu einer Zeit des allseitigen Heimbleibens nicht in allzu belästigendem Grade die glotzende Neugier der im Winter fast müßigen Bauern und das blöde Anlächeln ihrer Weiber errege. Meistens genügt es, mit dem Wirte Freund zu werden. Ich hatte ihm bald einen komplizierten Viehhandel deutlich gemacht, der mich angeblich hierherführte, und sobald der Wirt kein Zeichen gibt, dass ihn der winterliche Besuch irgendwie befremde, wird derselbe auch von den Gästen als etwas Selbstverständliches betrachtet. Wehe dem Reisenden, dem es nicht gelingt, einen längeren Aufenthalt in einer Gegend zu erklären, die in das moderne Verkehrsnetz noch nicht eingeschlossen wurde! Er wird auf eindringliche Weise erfahren, wie abscheulich die sogenannte gute alte Zeit war, die seitab von den Eisenbahnen heute noch besteht.
Will man nun gar die Leute mitteilsam machen, dann gilt es, sich völlig aufgeknöpft zu zeigen; sie müssen glauben, alle Triebfedern unserer Existenz zu kennen, seit wir in die Welt blickten. Geübt in der praktischen Ausführung dieser Regel war ich, eh' der Abend völlig hereingebrochen war, bereits ein guter alter Bekannter in der Wirtsstube. Der Sturm draußen brauste noch zuweilen stark auf, schlief aber bald wieder ein, als wäre er selbst im Erfrieren. Der Gäste kamen und gingen nicht viele, und wenn auch manche von ihnen lange blieben, so dauerte doch ihre Bedienung keineswegs ebenso lange, sondern erlaubte der Wirtin immer wieder zu ihrem Spinnrocken zurückzukehren. Neben diesem saß ich behaglich schmauchend und brachte die Wirtin zum Reden. Ich musste die Schleuße natürlich bei ihren eigenen Angelegenheiten öffnen, wenn sie noch bei dem was mich interessierte, in Fluss sein sollte.
Eintönig, aber gerade deshalb zur Ruhe des Momentes passend, flossen ihre Reden an meinem Ohr vorüber; ich war bereits vom sechsten Wochenbette mit ihr aufgestanden und war bereit, mich zum siebenten niederzulegen. Während aber meine Aufmerksamkeit gar keinen Zweifel zu lassen schien, wie sehr ich die mütterlichen Leiden und Freuden nachempfand, sah ich doch zugleich mit Teilnahme, wie der Wirt hinter dem Schenktisch den landwirtschaftlichen Anzeiger aus der Kreisstadt zur triefenden Küchenlampe hielt und tief in der Stille forschte, wo die Vieh- und Körner-Preise verzeichnet waren, wie er dann auf den Stuhl sich warf, einnickte, aber plötzlich auffuhr, hastig nach demselben Blatte griff, als hätten sich die Preise inzwischen geändert, und wieder einnickte; wie bei jeder solchen Bewegung der große Haushund sich erhob, von Bank zu Bank schnuppernd die Runde machte und mit Ausnahme eines Winkels, den er anstarrte und wo er vielleicht den Kater zu sehen erwartete, Alles in Ordnung fand und sich wieder zum Ofen legte. Alles dies spielte sich trotz seiner Gewöhnlichkeit wie in einem Nebel der Behaglichkeit vor mir ab, bis plötzlich Wirt und Hund, Stube und Gäste vor mir zu versinken schienen, und Aug' und Ohr sich ganz und ausschließlich auf die schwatzende Wirtin richteten. Denn sie hatte eben unversehens den Namen der Freifrau von Börte genannt, worauf ich bisher gelauert, was ich aber gerade durch eine Anfrage hervorzurufen mich wohl gehütet hatte.
Wer hat sich an Ihr Bett gesetzt, Frau Wirtin und geweint und geschluchzt? fragte ich, als ob ich den Namen nicht verstanden hätte.
Der Bräutigam der Frau von Börte, wiederholte sie, wir nennen sie nicht anders als die Freifrau, seit sie von ihrem Vater das "einödige" Schloss geerbt hat. Ehemals hat man sie natürlich die Baronin geheißen. Es ist aber bekannt geworden, dass sie diesen Titel nicht mag, seit sie einen Hausierer mit Modesachen, der immer ins Schloss gekommen und immer abgewiesen worden ist, einmal vor sich ließ, bloß weil er sagte, er wolle zur Freifrau von Börte, statt zur Baronin. Sie kaufte ihm Vieles ab, was sie nachher den Bäuerinnen geschenkt hat, und der Hausierer ist dann bei uns zu keinem Ende gekommen mit dem Erzählen, in welche Gunst es ihn gebracht, dass er ihr den Titel "Freifrau" gegeben hat. Vielleicht weil es ein ausländisches Wort ist und "Baronin" ihr schon zu gemein war. Seitdem sagt man nun überall: die "Freifrau" in der ganzen Gegend.
Es ist aber doch eine sonderbare Grille der Frau von Börte, bemerkte ich, dass sie so vielen Wert auf die Anrede legt.
Ja, sagte die Wirtin mit einer bezeichnenden Handbewegung nach der Stirne, das arme, alte Weibele! Es ist nicht ganz richtig mit ihr.
Was Sie sagen! rief ich fast erschreckt. Denn mit einer Verrückten lässt sich kein Geschäft machen, und schon der Versuch, sie zum Verkauf des Bildes zu bewegen, wäre sträflich gewesen.
Gewiss ist es freilich nicht, sagte die Wirtin und versicherte auch, dass sie die Behauptung zu einem anderen Fremden gar nicht ausgesprochen hätte; ich aber wäre wie sie Wohl sehe, ein rechtschaffener Mann und würde es nicht weitertragen. Ich erkannte, dass ich wohl getan, früher keine direkte Anfrage zu stellen, man würde mir misstrauisch jede weitere Aufklärung versagt haben. Denn aus Liebe zu der seltsamen Frau, oder um einem Auftrag von ihr zu gehorchen, war man beflissen, ihr Fremde ferne zu halten und deshalb Erkundigungen nach ihr nicht zu beantworten. Nach dem großen Fortschritt aber, den ich in dem Vertrauen meiner Wirtin gemacht hatte, durfte ich nun schon die Aufforderung wagen, mir die Schicksale und Lebensumstände der Frau von Börte zu berichten.
III.
Aus den überflüssig langen Erzählungen der Wirtin ergab sich nun der folgende lückenhafte Tatbestand:
Der Baron von Börte, der Vater der "Freifrau", war ein tiefverschuldeter Edelmann aus uraltem Hause. Das Schloss im Gebirge, in dessen Nähe ich mich jetzt befand, war ursprünglich nur ein Jagdhaus und zu dauerndem Wohnsitz nicht eingerichtet gewesen. Nachdem aber der Baron, ermattet vom Kampf mit dem Leben, seine übrigen Besitztümer den Gläubigern preisgegeben hatte, opferte er auch seine Stellung bei Hof und in der Regierung, aus dem vollen Untergange nur eine unbedeutende Summe und das Jagdhaus rettend, in das er sich mit seiner Tochter zurückzog. Er war Witwer; die Tochter zählte damals siebzehn Jahre. Wald und Felder gehörten zum Schloss. Der Baron war aber seiner edelmännischen Gewohnheit so müde geworden, dass er die Jagd verpachtete. Die Äcker ließ er bewirtschaften, von dem mitgebrachten Gelde das Haus wohnlich machen, — und so lebten Vater und Tochter in zwar nicht durch Mangel, aber auch nicht durch Freuden gestörter Einsamkeit. Sie mochte zu dem Wesen beider Menschen wenig gepasst haben. Denn war die Tochter in der Blüte ihrer Schönheit und schon deshalb zum Genuss berechtigt, so war auch der Vater noch ein kräftiger Mann, und jede Bewegung von ihm hatte etwas vom ungeduldigen Löwen im Käfig jeder Schritt, mit dem er den Boden trat, schien zu sagen, dass die Zurückgezogenheit von der Welt eine erzwungene war, und Entrüstung darüber auszudrücken.
Zwei Jahre dauerte diese Einsamkeit, dann wurde sie von einem Manne unterbrochen, den man anfangs in der Gegend für einen Landschaftsmaler gehalten hatte. Er war aber dies nicht eigentlich, sondern ein Kaufmann von großem Vermögen. Nachdem er sich auf unbekannte Weise Zutritt in das sonst unzugängliche Schloss verschafft hatte, verließ er dasselbe eines Tages als Bräutigam.
Nun kam er natürlich öfter und in kürzeren Zwischenräumen in die Gegend. Zuweilen kamen auch unmittelbar vor oder nach ihm beladene Saumtiere, welche Kisten schleppten, Geschenke von ihm, Bilder und andere kostbare Ausschmückungen der Gemächer. Die ganze Gegend wurde durch ihn auf einen erhöhten Ton des Wohlbehagens gestimmt. Das Glück machte ihn freigebig, drängte ihn, Andere glücklich zu machen. Und sein Glück war groß, das will sagen, seine Liebe zu der schönen Braut. Und auch sie machte aus ihrer Neigung kein Hehl. Wenn die Liebenden durch das Tal schritten, die verschlungenen Arme lösend und sich wie Kinder an den Händen fassend, dann lächelten Diejenigen, die sie sahen, unwillkürlich, als hätte sie ein eigenes Glück berührt. Auch der Baron hatte sein hartes, missmutiges Wesen aufgegeben und zeigte überall seine herzliche Beistimmung, seine väterliche Freude.
Und wieder einmal, es war im Spätherbst, kam der glückliche junge Bräutigam zum Besuch seiner Verlobten in das Dorf. Wie gewöhnlich hielt er zu Pferde, nur mit einem Mantelsack ausgestattet, vor dem Wirtshaus. Es war aber diesmal schon tiefe Nacht, weil der Postmeister auf der ungefähr drei Meilen entfernten Station, der ihm stets das Reitpferd stellte, diesmal ein solches nicht so rasch zur Verfügung gehabt hatte, nachdem er einige Stunden früher einem fremden Kavalier, der mit seinem Diener in dieselbe Gegend gewollt, zwei Pferde hatte überlassen müssen.
In so später Stunde konnte oder wollte der junge Mann sich nicht mehr unmittelbar auf das Schloss verfügen und musste daher tatsächlich das Zimmer beziehen, das er sich übrigens bei jedem Besuche im Wirtshaus einräumen ließ, wenn er es auch niemals wirklich bewohnte. Er war aber so aufgeregt in liebender Ungeduld, dass er gar nicht an das Niederlegen dachte, sondern, nachdem er einige Augenblicke auf einem Sofa geruht, in Haus und Hof umherschlich, wie um irgendeine Beschäftigung zu finden, die seine Unruhe hätte beschwichtigen können.
So gelangte er auch in das eheliche Schlafgemach des Hauses. Die Wirtin, die noch von ihrem letzten Wochenbett nicht aufgestanden war, lag bei dämmerndem Nachtlicht wach im Bette, und als sie seinen Tritt hörte, rief sie ihn freundschaftlich an. Er setzte sich auf den Stuhl an ihrem Bette, und froh, seinen gepressten Empfindungen Luft machen, oder auch nur der Geliebten mit lauten Worten gedenken zu können, sprach er von seiner Liebe, seiner Freude, seiner Sehnsucht nach dem nächsten Morgen, nicht eingedenk, wie gering das Verständnis seiner Zuhörerin für den poetischen Ausbruch seiner Leidenschaft, wenn sie auch diese selbst mit dem Instinct des Volksherzen wohl zu würdigen verstand, noch weniger Darauf achtend, dass der daneben von den Mühen des Tages ausruhende Eheherr solche Melodien mit einem nicht ganz dazu passenden orgelnden Nasen-Choral begleitete. Erst als sich in diesen Bass ein weiblicher Alt als zweite Stimme mischte, mochte der schwärmerisch Liebende zum Bewusstsein gekommen sein, dass er an seinem einsamen Zimmer einen ebenso guten Anteilnehmer finden könne.
Sobald die ersten Bewegungen im Hause das Nahen des Morgenrots anzeigten, begab sich der junge Mann auf den Weg nach dem Schloss. Man konnte jetzt im Wirtshause sicher sein, ihn Tage lang, nämlich bis zu seiner Abreise, nicht wiederzusehen. Allein der Vormittag war noch nicht ganz verflossen, als man ihn bereits wieder auf das Wirtshaus zuschreiten sah, langsam, wankend, gesenkten Hauptes, nur zuweilen aufblickend, als müsste er ergründen, wo er sich befinde. Bei seinem Eintritt in das Haus sah man Todesblässe auf seiner Stirne und seinen Wangen. Mechanisch schritt er wieder nach dem Zimmer der Wirtin, warf sich auf denselben Stuhl, auf dem er sich einige Stunden früher so glücklich gefühlt hatte, und vielleicht war es die blitzartige Erkenntnis dieses Kontrastes was seine Erstarrung löste: er brach in krampfhaftes Schluchzen aus und weinte Tränenströme. Erst die immer drängenderen Fragen der Wirtin und das Ansammeln der Hausleute um ihn mochten ihn ahnen lassen, dass er Menschen ein Schauspiel gebe, denen er sich nicht enthüllen wollte, oder die ihn nicht fassen konnten. Wie flüchtend eilte er auf sein Zimmer, in welchem er sich bis zum Abend verschloss.
Am Abend verfügte er sich wieder auf das Schloss, kehrte gleich niedergeschlagen zurück und ließ zwei neue Kerzen auf sein Zimmer bringen. Es hatte den Anschein, dass er die ganze Nacht schrieb, wenn er nicht laut mit sich selbst sprach. Nachdem er des anderen Tages abermals vom Schloss zurückgekehrt war, ohne dass sich in seinem Aussehen oder seiner Stimmung etwas geändert hatte, befahl er sein Pferd zu satteln. Er beschenkte die Leute mit Geld, mit Sachen, nicht wie sonst im überschwänglichen Drang, so viel als möglich von seinem Glücke mitzuteilen, sondern sichtlich nur, um so viel es anging von den Dingen dieser Welt loszuwerden. Dann eilte er ohne Abschiedswort davon, und man sah ihn erst etwa ein Jahr später wieder, als der Freiherr von Börte gestorben und begraben war. Da schien der junge Mann einen verzweifelten Versuch zu machen, sich seiner ehemaligen Braut wieder zu nähern. Als dies aber vergebliche Mühe blieb, schied er, um nicht mehr wiederzukehren.
Begreiflicherweise hatte der rätselhafte Vorgang in der ganzen Gegend großes Aufsehen erregt und die lebhafteste Neugier nach der Erklärung desselben angefacht. Was man jedoch aus den in halber Geistesabwesenheit ausgestoßenen Äußerungen des jungen Mannes und aus den Berichten der im Schloss Bediensteten zusammenstellte, war wenig. Dennoch schien es zur Erklärung vollkommen auszureichen.
Die Tochter des Freiherrn von Börte hatte ganz einfach ihren Bräutigam nicht mehr sehen wollen, als er sich am Morgen nach der im Wirtshaus durchwachten Nacht im Schloss eingefunden hatte. Vergebens waren die Fragen, Bitten, Beschwörungen und Tränen, nicht bloß ihres Geliebten, auch ihres Vaters, der von dem unbegreiflichen Verhalten nicht minder erschreckt, ebenfalls keinen Grund dafür anzugeben wusste. Das Fräulein gab fest und bestimmt den Entschluss zu erkennen, das Verhältnis als gelöst zu betrachten und den Bräutigam niemals mehr sehen zu wollen, und ein anderes Wort als die stete Wiederholung dieses gänzlich unerklärlichen Ausspruchs war dem Mädchen nicht abzugewinnen.
Gerade aber der Mangel einer fassbaren Ursache solchen Verhaltens, nachdem die beiderseitige große Liebe der Verlobten und ihre bisherige selige Eintracht keinem Zweifel unterworfen werden konnte, schnitt alle Vermutungen und Gerüchte ab und rief die Annahme hervor, die Alles zu erklären schien: dass bei dem jungen, schönen Mädchen eine plötzliche Geistesstörung eingetreten wäre.
Nichts jedoch in dem ferneren Verhalten der Freiherrntochter schien für die schreckliche Annahme eine Bestätigung zu bieten, wenn man diese nicht in der außerordentlichen Liebe zur Einsamkeit finden wollte. Seit dem Tode ihres Vaters und dem letzten vergeblichen Annäherungsversuch des jungen Mannes verließ Frau von Börte, wie man sich längst gewöhnt hatte das Fräulein zu nennen, vielleicht zur Abkürzung des Wortes "Freifrau", im Sommer niemals ihre Behausung, sondern beschränkte ihre Spaziergänge auf den Schlossgarten, dessen Pflege sie mit der sorgsamsten Aufmerksamkeit überwachte. Im Winter erging sie sich auch zuweilen im nahen Walde, soweit der Schnee es zuließ, und stieg häufig in das Dorf nieder, wo sie die Kranken und die Armen besuchte und sich dem Geringsten gleich stellte, so dass nur die Liebe und Verehrung, die ihr entgegengebracht wurden, sie als eine Höhere erscheinen ließen. Dabei war sie matronenhaft gekleidet und musste wohl auch mit dem Glück der Jugend, von welchem sie sich so plötzlich abgetrennt hatte, diese selbst verloren haben, da die Wirtin sie im Gespräch mit mir ein "alt Weibele" genannt hatte.
Das war Alles, was ich mir an Tatsachen aus der langen Erzählung der Wirtin zusammenstellen konnte.
IV.
Was mich am nächsten Morgen weckte, war ein greller weißer Schimmer vor den Augen. Durch das vorhanglose Fenster der Bauernstube schimmerte unter blauem Himmel und goldenem Sonnenlicht der Schnee, der über Nacht reichlich gefallen war, die ganze Landschaft wie zur Feier des heiligen Christfestes mit einem reinlichen, weißen Tischtuch bedeckend. Seelenvergnügt sprang ich in die Höhe, eilig kleidete ich mich an, um nur der Wonne im Freien sogleich teilhaftig zu werden. Solche Ungeduld an einem 24 Dezember mag einem eingeborenen Städter seltsam vorkommen, der seinen Naturgenuss in Landpartien während der heißen Jahreszeit erschöpft. Allein ich bin eben Einer "vom Lande".
Bald stieg ich wie mit beschwingtem Schritte aufwärts, wo nur die Bergpfade gangbar waren, ohne in der nivellierenden Schneefläche ein besonderes Ziel ins Auge fassen zu können, oder mich sonderlich um eines zu kümmern. Es war windstill und sonnig; das jungfräuliche Knirschen des Schnees unter dem Fuß, der ihn zum ersten Mal berührte, spornte die Kraft des Gehens an, und der Kälte den erhöhten Blutumlauf durch die eigene Bewegung entgegenzusetzen, war eine unvergleichliche Erquickung.
Ich weiß nicht, wie lange ich kletterte und wie lange ich noch geklettert wäre, wenn nicht plötzlich eine Art physischen Heimwehs mich überfallen hätte. Dies Heimweh war nichts weiter als Hunger, aber ein wahrer Kuhreigen des Magens, ein Hunger, wie ich ihn, seit ich von meiner Heimat und von meiner Jugend geschieden war, nicht mehr verspürt hatte. Nun wusste ich zwar, dass ich den Rückweg zu suchen, aber nicht, wie ich ihn zu finden hatte. Das Einfachste war freilich, mich umzudrehen und abwärtszusteigen. Allein schon nach wenigen Augenblicken erkannte ich von der Gegend, in welcher alle Unterschiede verschneit waren, wenigstens so viel, dass ich mich nicht auf demselben Wege befand, auf welchem ich in die Höhe gekommen war.
Gleichviel! dachte ich, wenn ich auch statt meines Wirtshauses nur irgendeinen Rauch finde, der anzeigt, dass gekocht wird. Und munter niederschreitend gelangte ich auf einen Boden, der mir nach und nach merkbare Unterschiede von den bisher betretenen Wald- und Bergpfaden zeigte. Er war sichtlich besonders geglättet und geebnet worden, und die dürren, schneebelasteten Zweige und Stämme der Anpflanzungen an seinen Seiten wiesen auf eine veränderte und offenbar durch Kunst herbeigeführte Vegetation hin. Der Gedanke lag nahe, dass ich mich in das Besitztum der Frau von Börte verirrt hatte.
Jetzt erst dachte ich wieder an die geheime Mission, die ich mir beim Antritt meiner Winterreise selbst auferlegt hatte. Doch verwarf ich in der Erinnerung, dass Frau von Börte nicht als völlig zurechnungsfähig zu betrachten sein dürfte, jeden Gedanken an die Erwerbung des Bildes. Dennoch durchzuckte mich ein Gefühl eigentümlicher Erwartung, als ich plötzlich aus noch ziemlicher Ferne eine Gestalt mir entgegenkommen sah, welche ganz der mir von der Wirtin geschilderten Erscheinung der Frau von Börte glich. Ich beschleunigte meine Schritte und stand bald einem Mütterchen gegenüber, aus dessen matronenhafter Kopfbedeckung sich eine Physiognomie hervordrängte. In einem Tone rauer Verdrießlichkeit sagte die Alte zu mir: Hier geht man nicht, hier ist privat —.
Ich bin unversehens auf diesen Weg gekommen, erwiderte ich, meine Absicht ist, das Dorf wiederzufinden; entschuldigen Sie, Frau Baronin —
Ein helles Lachen hinter mir unterbrach mich. Ich wendete mich um, und eine zweite, ähnlich gekleidete Frauengestalt stand vor mir. Aus der gleichen altmütterlichen Kopfbedeckung drängten sich jedoch blonde Löckchen hervor und blickte mir ein zartes, von der Kühle etwas gerötetes Gesicht mit großen, leuchtenden, tiefblauen Augen entgegen.
Lass gehen, Crenz, sagte die neu hinzugekommene Dame, und zu mir sich wendend: Ich will Ihnen einen Führer in das Dorf geben, wenn Sie nicht von Ihrem Irrweg ermüdet erst ein wenig ruhen wollen.
Während nun die Alte, der ich zuerst begegnet war, sich entfernte, sagte die andere Dame, indem sie sich langsam in Bewegung setzte und mich dadurch veranlasste, an ihre linke Seite zu treten und neben ihr zu schreiten:
Im Sommer bin ich eben so ungastlich wie meine Magd und hätte den verirrten Wanderer seinem guten Stern überlassen.
Noch immer lächelte sie, und lieblich klang ihre Stimme. Obgleich ich damals bereits an der Schwelle des Greisenalters stand, konnte ich mich doch einer wehmutsvollsüßen Bewegung des Herzens dieser Erscheinung gegenüber nicht erwehren, in der ich offenbar das Fräulein von Börte zu begrüßen hatte. Das machte mich einige Augenblicke stumm und verlegen. Mit unwillkürlicher Galanterie versetzte ich endlich:
Wie Viele, die im Sommer in dieser Gegend Villeggiatur halten, würden auch im Winter sich einfinden, wenn sie wüssten, dass die Gastfreundschaft der Freifrau von Börte an diese Jahreszeit geknüpft ist!
Die würden sich verrechnen, die zu diesem Zwecke kämen, entgegnete sie lachend; nur dass ich zum ersten Mal einen Städter in dieser Gegend traf, an einem Wintertage, ist Ursache, dass ich nicht vor ihm flüchtete. Ich selbst war im nahen Walde, beobachtete, von Ihnen ungesehen, wie kräftig und fröhlich Sie dahinschritten, offenbar erquickt von dem seltenen Naturgenuss, und folgte Ihnen, als Sie die Richtung nach meinem Hause einschlugen. Ich hatte sogar halb schon den Mut gefasst zu dem Entschlusse, Sie aus freien Stücken anzusprechen, bevor noch Ihre Begegnung mit Crescenzia dazu Veranlassung gab.
Und wenn der Wald jetzt statt in Schnee in das Grün seiner Blätter gekleidet wäre, so würden Sie dies nicht getan haben? fragte ich, im Inneren beflissen, mir über die Umdämmerung des Geistes, wenn sie in der Tat vorhanden sein sollte, so bald als möglich klar zu werden. War vielleicht dieser Unterschied im Verhalten zu den Menschen nach Maßgabe der Jahreszeiten eine von den Äußerungen des gestörten Seelenlebens?
Ihre Antwort widerlegte jedoch diese Annahme. Gewiss würde ich dies nicht getan haben, sagte sie, und der Grund ist ganz einfach. Ich lebe in freiwilliger und doch nach meinem Schicksal notwendiger Trennung von der Welt, die mir nichts mehr geben kann, von der ich nichts mehr will. So ist denn die Natur, insofern sie mir im nahen Wald und Feld, in diesem Berg und Tal zugänglich bleibt, meine Welt, ja meine Heimat, mein Haus, der heiligste Raum meines Lebens. In diesen führt man nicht fremde Gäste, die bloß als einen Gegenstand frivoler Neugierde betasten, was uns ein Teil des eigenen Herzens ist. Die Natur ist mein einziges, mein letztes Besitztum. Auch dieses mit dem Bedürftigen zu teilen, fordert die Menschenliebe, aber doch wohl nur in der Voraussetzung, dass er ein wirkliches Bedürfnis darnach, eine wahre Freude daran habe, dass er es nicht als ein Spielzeug behandle und endlich gleichgültig wegwerfe. Nun sehen Sie, mein lieber Herr, die Leute, die nur im Sommer auf das Land ziehen und nur, weil sie es in der Stadt, die um diese Zeit ihre Theater und Konzertsäle schließt, schon durchaus gar nicht mehr aushalten können, sie sind die fremden Gäste, denen die Natur ein Gegenstand frivoler Neugierde, ein Spielzeug ist, das sie wegwerfen, sobald der Winter naht. Ich tadle sie nicht, sie sind eben die Glücklichen, denen ihre Freuden, die der Welt wie der Familie, nicht Zeit und Gelegenheit geben, zu erfahren, dass die Natur nur Denjenigen ihre Genüsse ganz erschließt, die keine anderen mehr haben, dass sie gleich dem Jehova des Alten Testamentes ein eifersüchtiger Gott ist, der keine anderen Götter neben sich duldet. Ich tadle sie nicht, allein wie könnte ich Gemeinschaft mit ihnen haben? Und doch würde ich einen Genossen meiner Naturliebe sehr willkommen nennen. Es ist wohl eine Unbesonnenheit von mir, dass ich ihn in dem Mann vermutete, der diese Landschaft im Winter aufsucht, wer weiß, in welcher geschäftlichen Absicht, die mit meiner Torheit gar nichts gemein hat.
Wenn der Leser nicht vergessen hat, dass ich ihm die Motive erzählte, die mich stets zur Weihnachtszeit aus der großen Stadt forttrieben, so wird er ermessen, wie sehr diese Worte der seltsamen Frau mich treffen mussten. Ich brauchte nur der Wahrheit Stimme zu leihen, um sie zu überzeugen, dass hier ein wunderbarer Zufall zwei Menschen zusammengeführt hatte, die sich in einer gleichen und nicht häufig vorkommenden Auffassung des Gefühls für die Natur begegneten.
Wir waren während dieses Gespräches zum Schloss gelangt, hatten das Portal überschritten und befanden uns am Fuße der breiten und schönen Treppe, als ich erst bemerkte, dass ich schicklicherweise wohl nicht weiter mit vordringen konnte. Ich blieb stehen; die Freifrau, die bereits einige Stufen erstiegen hatte, wandte sich um, und mit einem Ernste, dessen etwas gebieterischer Ton ohne Zweifel aus dem Wunsche hervorging, einer ihr angenehmen Vorstellung bis auf den Grund zu schauen, um sich von der vollen Wahrheit zu überzeugen, fragte sie:
Rein also aus Liebe zur Natur haben Sie diese Winterreise unternommen und gerade in diese von der Residenz soweit entlegene Gegend?
Wie sie jetzt vor mir stand, die zierliche Gestalt, der die Treppenstufen zu einem würdig erhöhenden Piedestal dienten, im Antlitz einen fast beklommenen Ernst, eine Antwort erwartend, die, an sich unwichtig, nur ihrer Abgeschiedenheit und Vereinsamung bedeutungsvoll vorkommen konnte, da wäre es mir eine unmögliche Entweihung alles dessen gewesen, was in meinem alten Herzen noch an Poesie übrig war, wenn ich eine Unwahrheit gesagt hätte. Ich entgegnete daher:
Ich bin Kustos der Kunstschätze des Fürsten. Oft hörte ich meinen lieben Gebieter begeistert von einem Gemälde sprechen, dass sich in der Sammlung dieses Schlosses befinden soll. Zwar nicht einer Hoffnung, aber doch einer leichten Möglichkeit, des Bildes ansichtig zu werden, wollte ich Raum lassen, als ich meinen gewohnten Weihnachtsausflug diesmal hierher lenkte.
Ein Schatten flog über ihre Züge, und mit einer gewissen Herbheit des Tones sagte sie: Welchen Namen führt das Bild, das Sie meinen?
Ich erwiderte: Es ist Ary Scheffers heilige Monica mit ihrem Sohne, dem heiligen Augustin.
Sie wurde bleich und starrte mich einige Augenblicke erschrocken und neugierig zugleich an. Als ich in meinem unschuldigen Bewusstsein diesen Blick mit ruhiger Treuherzigkeit aushielt, senkte sie die Augen, und eine leise Röte stieg in ihr Antlitz. Abermals erhob sie dann ihre Augen auf mich, und mit dem Tone und der Miene einer inneren Beschwichtigung, wie nach dem Aufgeben eines grundlosen Misstrauens, sagte sie: Sie sollen das Bild sehen; das Tageslicht reicht gerade noch dazu aus, in einer Stunde bricht die Dämmerung an.
Nachdem ich ihrem Wink gehorchend mit ihr die Treppe emporgestiegen, gelangten wir in einen Korridor, wo es bereits dunkelte. An einer Türe blieb sie stehen und bedeutete mich einzutreten. Ich öffnete und breitete die Portiere auseinander, die hinter mir zufiel, ohne dass die Freifrau mir folgte. Allein stand ich in einem luxuriös aber in einheitlichem Stil ausgeschmückten Wohngemach, in das die Sonne noch mit ihren hellsten Strahlen fiel. Marmor, Sammet, geschnitztes Holz waren reichlich verwendet, doch schien all dies niemals wirklich benützt zu werden, sondern nur vorhanden zu sein, um dem Raum einen wohnlichen Schimmer zu geben, damit er nicht bloß der kahle Rahmen zu dem Bilde sei, das an der Wand hing.
Das Bild war nun freilich von seltenem Werte und hätte jede Art von Umgebung vergessen lassen. Nur von innerem Leben bewegt, sind die beiden Figuren, die heilige Monica und ihr Sohn, nebeneinander hingestellt; die eine der ekstatische Ausdruck des zu seligem Schauen gewordenen Glaubens, die andere eine Verkörperung der schmerzlichen Sehnsucht nach dem Glück des Glaubens. Das Antlitz der Heiligen ist emporgewendet, ihr Leben scheint dem Erlöschen nahe, aber in den ganz vergeistigten Zügen spiegelt sich dennoch volles Leben, wenn auch ein anderes, höheres. Dem Sohn aber ist das Licht, in dessen Glanz sie schwelgt, nur erst ein schwacher Dämmerschein, zu unsicher, zu schwankend, um die Zweifel aufzuklären, die rastlos forschenden Gedanken in einem Brennpunkt zu vereinigen. Das sagt die schwermütige Neigung seines Hauptes, der wie in einen Abgrund niederstarrende Blick.
Im Anblick des Bildes vergaß ich Hunger und Ermüdung, und so aufmerksam und so lange hatte ich es betrachtet, dass ich es sogar unter den endlich leise darüber fallenden Schatten der Dämmerung noch immer in seiner vollen Wirkung vor mir zu sehen glaubte.
Plötzlich klang die holde Stimme des Fräuleins von Börte hinter mir. Mir unhörbar war sie eingetreten, musste mein Entzücken still beobachtet haben, und als ob meine Gedanken laut zu ihr gesprochen hätten und sie nun das Gespräch nur fortsetzte, sagte sie: Und glaubt man nicht noch die Spuren eines Schmerzes im Antlitz der Heiligen zu sehen, während man in ihrem Anblick doch zugleich klar und voll empfindet, dass sie alles Irdische überwunden hat? Und fühlt man nicht ebenso, dass der Trotz des Sohnes nicht andauern kann, dass ein Charakter, wie er in diesen großartigen, von leidenschaftlicher Kraft überhauchten Zügen ausgeprägt ist, unmöglich lange ein Spielball des Zweifels bleiben, sondern bald zu einer bestimmten Lebensrichtung kommen wird?
Sie sprach unverkennbar aus dem Tiefsten ihrer Seele, und so allgemein der Inhalt war, ihre Worte klangen doch wie aus dem persönlichen Resonanzboden ihres Gemütes heraus. Ich aber, unbekannt mit der eigentlichen Natur dieses Wesens vor mir, dessen großer äußerer und moralischer Reiz mir sogar durch den Verdacht einer intellektuellen Störung getrübt war, noch unbekannter mit den Schicksalen, die auf dieses Wesen bestimmend eingewirkt haben mochten, konnte auf solche Verinnerlichung im Erfassen eines Kunstwerks nicht eingehen. Unbefangen erwiderte ich daher:
Als ein alter Galeriedirektor bin ich gewohnt, zunächst nach dem zu schauen, was in der Kunst das Praktische ist: nach der Technik. Da muss ich nun gestehen, dass nichts von dem modernen Nazarenertum verschiedener sein kann, als die Ausführung dieses Bildes. Und dennoch kann ich es mir nicht erklären, warum die Gleichgültigkeit gegen koloristische Wirkung, was mancher anderen Schöpfung dieses Künstlers trotz der edlen Reinheit der Formen zum Nachteil gereicht, hier zur Vollkommenheit beiträgt.
Eine seltsame Bewegung, gleich dem triumphierenden Lächeln eines Engels, spielte um die Lippen des Mädchens. Sie hatte die Augen emporgeschlagen und schien das plötzlich in ihr erregte Gefühl still für sich auszukosten. Dann wendete sie sich zu mir, noch immer mit einem Lächeln auf den Lippen, das sich aber in das eines gutmütigen Spottes verwandelt hatte: