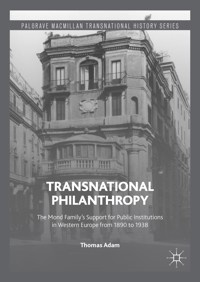Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Wie wirkte sich der Ausbruch des Vulkans Tambora, der 1815 im fernen Indonesien stattfand, auf die deutsche Geschichte aus? Warum hat sich die deutsche Tradition des Weihnachtsbaums im 19. Jahrhundert weltweit verbreitet? Wie gelangte das Fußballspiel in den 1870er Jahren aus Großbritannien an hiesige Gymnasien und wurde im 20. Jahrhundert zum Nationalsport der Deutschen? Kaum eine Entwicklung, die die moderne Gesellschaft in Deutschland formte, kann ausschließlich aus der deutschen Geschichte heraus erklärt werden. Thomas Adam schildert sie von 1815 bis zur Gegenwart erstmals aus einer konsequent globalgeschichtlichen Perspektive. Im Gegensatz zu anderen Überblicksdarstellungen, die sich auf den engen Raum des deutschen Nationalstaats und auf einen politikhistorischen Ansatz beschränken, bietet er eine lebendige Kultur- und Sozialgeschichte der Menschen, die in Deutschland gelebt und es geprägt haben, aber auch jener, die es verlassen haben. Historische Ereignisse und Entwicklungen, die man oft als »typisch deutsch« ansieht, erscheinen in diesem transnationalen Kontext in einem völlig neuen Licht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 704
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Adam
Deutschland in der Welt
Gesellschaft, Kultur und Politik seit 1815
Campus Verlag Frankfurt / New York
Über das Buch
Wie wirkte sich der Ausbruch des Vulkans Tambora, der 1815 im fernen Indonesien stattfand, auf die deutsche Geschichte aus? Warum hat sich die deutsche Tradition des Weihnachtsbaums im 19. Jahrhundert weltweit verbreitet? Wie gelangte das Fußballspiel in den 1870er Jahren aus Großbritannien an hiesige Gymnasien und wurde im 20. Jahrhundert zum Nationalsport der Deutschen? Kaum eine Entwicklung, die die moderne Gesellschaft in Deutschland formte, kann ausschließlich aus der deutschen Geschichte heraus erklärt werden. Thomas Adam schildert sie von 1815 bis zur Gegenwart erstmals aus einer konsequent globalgeschichtlichen Perspektive. Im Gegensatz zu anderen Überblicksdarstellungen, die sich auf den engen Raum des deutschen Nationalstaats und auf einen politikhistorischen Ansatz beschränken, bietet er eine lebendige Kultur- und Sozialgeschichte der Menschen, die in Deutschland gelebt und es geprägt haben, aber auch jener, die es verlassen haben. Historische Ereignisse und Entwicklungen, die man oft als »typisch deutsch« ansieht, erscheinen in diesem transnationalen Kontext in einem völlig neuen Licht.
Vita
Thomas Adam ist Associate Professor am Department für Political Science der University of Arkansas und dort stellvertretender Direktor des International and Global Studies Programms am Fulbright College of Arts and Sciences.
Inhalt
Einleitung
Industrialisierung und Urbanisierung
Die Ankunft der Eisenbahn
Der Deutsche Zollverein
Großstädte und ihre Einwohner
Die Gründung des Deutschen Bundes
Der Einfluss der Französischen Revolution
Die Neuordnung auf dem Wiener Kongress
Restauration und Vormärz
Die Erfindung der deutschen Identität
Ein deutscher Feiertag: Weihnachten
Die Revolutionen von 1830 und 1848/49
Die erfolgreiche Revolution von 1830
Die gescheiterte Revolution von 1848/49
Veränderungen im politischen Leben
Washington überquert den Delaware
Die Spaltung des Deutschen Bundes und die Reichsgründung
Österreich und Preußen als Rivalen
Der preußische Verfassungskonflikt
Der Krieg gegen Dänemark (1863/64)
Der Krieg zwischen Preußen und Österreich (1866)
Der Norddeutsche Bund
Das »dritte Deutschland« neben Preußen und Österreich
Der Krieg gegen Frankreich (1870/71)
Die Gründung des Deutschen Reiches
Auf dem Weg zum Nationalstaat?
Staat und Gesellschaft im Kaiserreich
Die katholische Minderheit und der Kulturkampf
Die jüdische Minderheit und der aufkommende Antisemitismus
Die Herausbildung der Arbeiterbewegung
Das sozialistische Milieu
Das konservative Milieu
Import aus England: das Fußballspiel
Die boomende Zivilgesellschaft
Öffentliche Museen und Museumsvereine
Realschulen, Gymnasien und Universitäten
Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
Die Deutsche Orient-Gesellschaft
Die Meyersche Stiftung für Erbauung billiger Wohnungen
Die transnationale Vorbildwirkung der deutschen Zivilgesellschaft
Schutzzölle und innenpolitische Stabilität
Außenpolitische Bündnisse und Flottenpolitik
Die deutschsprachige Diaspora in der Welt
Auswanderung aus Deutschland
Koloniale Visionen in Nordamerika
Söldner aus Hessen
Siedlungszentren und kulturelle Begegnung
Deutsche Sehnsucht nach Amerika
Wer ist deutscher Staatsbürger?
Der Erste Weltkrieg
August 1914
Die Finanzierung des Krieges
Zwei-Fronten-Krieg in Ost und West
Der Frieden von Brest-Litowsk
Das Kriegsende
Novemberrevolution und Ende der Monarchie
Der Friedensvertrag von Versailles
Prägende Kriegserfahrungen
Die Weimarer Republik
Deutschlands erste Demokratie
Attentate und Putschversuche
Die Rückkehr zur Friedenswirtschaft
Reparationszahlungen und Hyperinflation
Durchbruch zur Moderne
Der Weg in die NS-Diktatur
Die Kampagne gegen den Young-Plan
Eine neue Volkspartei?
Die Präsidialkabinette der späten Weimarer Republik
Der Aufstieg der NSDAP
Hofiert durch die Konservativen
Die »Machtergreifung« und die Konsolidierung der Diktatur
Staat und Gesellschaft während der NS-Diktatur
Mythos Autobahn
»Kraft durch Freude« für die »Volksgemeinschaft«
Überwachung und Denunziation
Die Konzentrationslager
Deutsche im Exil
Der Holocaust
Die Geburt des »Arischen« und der »arischen Rasse«
Juden zwischen Assimilation und Antisemitismus
Einflüsse der Eugenik
Das NS-Euthanasieprogramm
Von der Ausgrenzung zum Völkermord
Der Zweite Weltkrieg
Münchener Abkommen und Deutsch-Sowjetischer Nichtangriffsvertrag
Der Vernichtungscharakter des Krieges
Widerstand gegen die Diktatur
Bedingungslose Kapitulation und Teilung in Besatzungszonen
Die Gründung und die Anfangsjahre der beiden deutschen Staaten
Spannungen im Kalten Krieg
Neue politische Strukturen
Rebellionen
Das Auseinanderdriften der Gesellschaft in Ost und West
Frauen als Arbeiterinnen und Mütter
Aufbruch an den Universitäten
Gastarbeiter und politische Flüchtlinge
Protestbewegungen und Öffentlichkeit
Der Umgang mit Dissidenten
Die friedliche Revolution in der DDR
Die Auflösung des Ostblocks
Die Krise der DDR
Die Montagsdemonstrationen
Revolution oder Zusammenbruch?
Die ersten freien Wahlen
Der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik
Die Transformation der Volkswirtschaft der DDR
Die Auswanderung aus den ostdeutschen Ländern
Die Entfernung belasteten Personals im öffentlichen Dienst
Die Herausbildung einer ostdeutschen Identität
Die Entstehung einer ostdeutschen Partei
Die Wahl des deutschen Regierungssitzes
Die Berliner Republik
Die Hartz-Reformen
Stuttgart 21 und Fukushima
Die Flüchtlingskrise
Die Corona-Pandemie
Ausblick
Literatur
Einleitung
Industrialisierung und Urbanisierung
Die Gründung des Deutschen Bundes
Die Revolutionen von 1830 und von 1848/49
Die Spaltung des Deutschen Bundes und die Reichsgründung
Staat und Gesellschaft im Kaiserreich
Die deutschsprachige Diaspora in der Welt
Der Erste Weltkrieg
Die Weimarer Republik
Der Weg in die NS-Diktatur
Staat und Gesellschaft während der NS-Diktatur
Der Holocaust
Der Zweite Weltkrieg
Die Gründung und die Anfangsjahre der beiden deutschen Staaten
Das Auseinanderdriften der Gesellschaft in Ost und West
Die friedliche Revolution in der DDR
Der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik
Die Berliner Republik
Einleitung
In den vergangenen zwei Jahrhunderten schufen sich jede deutsche Gesellschaft und jede Generation ihre eigene deutsche Geschichte, die ihren Bedürfnissen der Identitäts- und Sinnstiftung entsprach. Dadurch entstand eine Abfolge von deutschen Geschichten, die ihrem jeweiligen Publikum eine Interpretation anboten, in der vor allem die Besonderheiten der deutschen Gesellschaft hervorgehoben wurden. So galt am Ende des 19. Jahrhunderts in der kaiserlichen deutschen Gesellschaft etwa die Abwesenheit einer Revolution im Stil der Französischen Revolution nicht nur als eine besondere Charakteristik der deutschen Gesellschaft, sondern auch als eine Grundlage für deren Überlegenheit über andere westliche Gesellschaften wie etwa die französische und die englische Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft erschien als das Resultat eines evolutionären Prozesses, in dem der Fortschritt durch wohltätige Herrscher wie etwa den preußischen König Friedrich II. erreicht wurde. Diese Andersartigkeit der deutschen Geschichte wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in der westdeutschen Gesellschaft dazu verwendet, den Niedergang der deutschen Geschichte im Nationalsozialismus zu erklären. Galt das Fehlen einer erfolgreichen bürgerlichen Revolution im 19. Jahrhundert einst als Vorteil, wurde das Ausbleiben dieser Revolution in der Bundesrepublik in den 1970er Jahren als strukturelle Ursache für die Entwicklung hin zum Nationalsozialismus erkannt.
Weder die erste noch die zweite Inkarnation des deutschen Sonderwegs beruhte aber auf systematischen Untersuchungen, die sozial-strukturelle Entwicklungen in der deutschen Gesellschaft mit sozial-strukturellen Entwicklungen in anderen westlichen Gesellschaften verglich und die gegenseitige Beeinflussung und Durchdringung sozialer und kultureller Strukturen der modernen Gesellschaften und Kulturen in westlichen Ländern untersuchte. Strukturen und Phänomene der modernen Gesellschaft und Kultur von der Infrastruktur der Großstädte bis hin zu sozialen Verhaltensweisen entwickelten sich aber nicht innerhalb abgeschlossener politischer Räume wie etwa des Nationalstaates, sondern durch umfassende Austauschprozesse zwischen Städten und Regionen sowie deren Bewohner. In diesen Austauschprozessen überwogen zudem die Aktivitäten individueller Bürger, die sich ohne staatliches Mandat als Kulturvermittler einsetzten, und von nicht-staatlichen Organisationen, die Ideen und Modelle sozialer und kultureller Organisation aufspürten, annahmen und umsetzten. Einer Geschichtsschreibung, die auf politisch legitimierte Akteure und staatliche Organisationen konzentriert ist, konnte es nicht gelingen, diese Aktivitäten, die die deutsche Gesellschaft nachhaltig prägten, zu erfassen. Daher blieben Darstellungen wie etwa Sebastian Conrads und Jürgen Osterhammels Das Kaiserreich transnational, die einem politikgeschichtlichen Ansatz verhaftet waren, und selbst Darstellungen wie Die Internationale der Rassisten von Stefan Kühl weit hinter ihrem Anspruch zurück, eine transnationale Perspektive auf Perioden und Aspekte der deutschen Geschichte zu liefern.
Die transnationale Wende in der Geschichtsschreibung hat Historiker dazu ermuntert, die Produktion von Geschichtserzählungen – nationalen und regionalen – aus einer Perspektive anzugehen, in der die Rolle des Staates in den Hintergrund rückt, der Rahmen der Nation überwunden wird und in der nicht-staatliche Akteure in den Mittelpunkt der Darstellung rücken. Sie führt insgesamt dazu, dass grundlegende Aspekte der Erzählung der deutschen Geschichte neu gedacht werden müssen. Zuerst geht es darum, den Raum der deutschen Geschichte neu zu bestimmen. Traditionelle deutsche Geschichten des 19. Jahrhunderts haben zum Beispiel ihren Untersuchungs- und Darstellungsbereich zumeist auf den geographischen Raum beschränkt, der im Jahr 1871 das Deutsche Reich bildete. Damit wurde eine politische Ordnung – das Deutsche Kaiserreich – zum Erfahrungsraum der deutschen Nation. Nationalstaaten waren im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aber in der Regel keine monolithischen Einheiten, in denen sich jeweils nur eine Nation aufhielt. Weder Deutschland noch Polen (nach 1919) war die Heimat aller Personen, die zu der jeweiligen nationalen Gruppe zählten. Und weder Deutschland noch Polen waren ausschließlich von Deutschen und Polen bewohnt. Alle europäischen Sprachgruppen, die sich auch als nationale Gruppen verstanden, formten im 19. und 20 Jahrhundert aufgrund ihres migratorischen Verhaltens globale Diasporen, die zum Beispiel Deutsche in Leipzig mit Deutschen in Philadelphia oder Rio Grande do Sul oder Polen in Warschau mit Polen im Ruhrgebiet oder in Chicago verbanden. Die deutschsprachige Diaspora umfasste deutschsprachige Siedler in dem geographischen Raum von der Wolga bis zum Pazifik und von der Ostsee bis zur Südspitze Südamerikas. Moderne Formen der Kommunikation wie etwa Briefe, deren Beförderung um die Welt durch globale Abkommen ermöglicht wurde, gaben dieser Diaspora im 19. Jahrhundert ein Netzwerk, durch das Informationen in alle Richtungen flossen. Sie beeinflussten die Formierung von Bildern über fremde und exotische Regionen und beförderten die Migration aus Zentraleuropa und Osteuropa nach Nord- und Südamerika.
Traditionelle, auf die Nationalgeschichte fokussierte Geschichten geben dieser deutschsprachigen Diaspora keinen Raum. Deutsche Geschichten ignorieren diese Migranten und Exilanten grundsätzlich, da sie nicht mehr in dem Raum der deutschen Nation leben. Und wiederum Nationalgeschichten der Empfängerländer wie etwa der USA, Kanada oder Brasilien ignorieren die deutschen Migranten und Exilanten sowie ihre Beiträge zur Ausgestaltung der amerikanischen, kanadischen oder brasilianischen Nationalidentität, weil sie durch die Historiker der betreffenden Länder nur als marginale Einwanderergruppen wahrgenommen wurden, deren Beitrag zur politischen Geschichte des jeweiligen Landes als zu vernachlässigen galt. Im Kontext der deutschen Migranten, die sich in den USA niederließen, etablierte sich zumindest eine deutsch-amerikanische Schule der Geschichtsschreibung, die, zwischen den Stühlen sitzend, freilich nur wenig von Historikern der deutschen Geschichte und Historikern der amerikanischen Geschichte wahrgenommen wird.
Die hier vorliegende deutsche Geschichte sucht diesem Dilemma in zweierlei Weise beizukommen: Zum einen legt sie den Raum der deutschen Geschichte nicht auf den deutschen Nationalstaat fest; zum anderen richtet sie den Fokus nicht nur auf staatliche Aktionen und Akteure, sondern weitet ihn auch auf nicht-staatliche Aktionen und Akteure aus. So wird nicht nur der Beitrag der deutschsprachigen Migranten des 19. Jahrhunderts zur Ausgestaltung der amerikanischen Gesellschaft, sondern auch derjenige der deutschen Exilanten herausgearbeitet, die sich in den 1930er Jahren nach der Flucht vor dem Nationalsozialismus vor allem in den USA niederließen und hier an der Entwicklung der modernen Filmindustrie und Architektur entscheidend beteiligt waren. Damit wird dieses Buch vor allem eine Geschichte der deutschsprachigen Bevölkerung innerhalb und außerhalb des deutschen Nationalstaates sein und nicht nur eine Geschichte des deutschen Staates bieten.
Deutsche und nicht-deutsche Migranten und Reisende, die sich zwischen verschiedenen modernen Nationalstaaten hin und her bewegten, nutzten ihre Reisen, um das von ihnen in anderen Städten und Regionen Entdeckte zu beobachten, zu studieren und daraufhin zu überprüfen, ob es auch in andere urbane und regionale Kontexte überführt werden könnte. In diesem Prozess kam es zu zahlreichen interkulturellen Transfers von Objekten und Ideen, die Entwicklungen und Einrichtungen in deutschen Städten mit Prozessen und Institutionen in Städten in anderen Ländern verbanden. So erlebte etwa der amerikanische Student und Reisende George Ticknor in Göttingen und Dresden am Anfang des 19. Jahrhunderts die ihm unbekannte Einrichtung von familiären Weihnachtsfeiern mit einem Weihnachtsbaum und dem Austausch von Geschenken. Für Ticknor war dies eine völlig neue Erfahrung und er überlegte, inwieweit dieses Weihnachtsfest, das er als ein die deutsche Nation charakterisierendes Fest bezeichnete, eventuell auch in die amerikanische Gesellschaft integriert werden könnte. Er wollte damit auch dort die Konstruktion einer nationalen Identität vorantreiben. In den 1860er Jahren war es der Braunschweiger Gymnasiallehrer Konrad Koch, der in dem an englischen Privatschulen gespielten Fußball eine Freizeitaktivität entdeckte, die auch an deutschen Gymnasien eingesetzt werden könnte, um Schülern eine ansprechende physische Betätigung zu ermöglichen, die sie zu aktiven Partnern im Lernprozess machen würde. Koch konnte allerdings kaum ahnen, dass dieser Sport, der anfangs als undeutsch, gefährlich und unpatriotisch verschrien war, einmal zu einem die deutsche Nation definierenden Sport werden würde. Die Beispiele des Weihnachtsfests und des Fußballspiels verweisen auf die Multidirektionalität dieser Austauschprozesse, die im Fall des Transfers des Weihnachtsfests die bürgerliche Stadtgesellschaft Dresdens mit der bürgerlichen Stadtgesellschaft Bostons verband und im Fall des Fußballspiels die Institutionen des Gymnasiums Martino-Katharineum in Braunschweig mit den Public Schools in Rugby und Eaton in England verknüpfte. Dadurch entstand ein transnationales Netzwerk, das Personen in verschiedene Richtungen reisen ließ, um Informationen, Praktiken und Erfahrungen zu erwerben, auszutauschen und zu modifizieren und um kulturelle Praktiken und Institutionen in lokale Räume einzufügen. In diesen konkreten Austauschprozessen, die die Gesellschaften Deutschlands, Großbritanniens und der USA nachhaltig prägten, spielte der Staat – weder der deutsche noch der englische oder amerikanische Staat – so gut wie keine Rolle.
Kaum eine Entwicklung, die die moderne Gesellschaft in Deutschland formte, kann ausschließlich aus der deutschen Geschichte heraus erklärt werden. So wurde etwa die Industrialisierung des Verkehrswesens im Wesentlichen durch den Einfluss von Veränderungen im Wettergeschehen ausgelöst, das durch den Ausbruch des Vulkans Tambora im fernen Südostasien verursacht wurde. Es waren diese Veränderungen, die eine Umstellung des Waren- und Personentransports von Pferden auf mechanisierte Antriebsmaschinen nötig werden ließen. Der Ausbau städtischer Infrastrukturen von der Abwasserbeseitigung bis hin zur Konstruktion von U-Bahnen ist eine Geschichte transnationaler Austauschprozesse, in der ingenieurtechnische Leistungen in Berlin ohne ihre Vorbilder in Städten wie New York nicht möglich waren. Und auch die Theorie und Praxis der Eugenik verband deutsche Mediziner und Eugeniker mit Ärzten und Eugenikern vor allem in den USA, die Jahrzehnte vor ihren deutschen Kollegen mit der Sterilisierung von »schwachsinnigen« Menschen begonnen hatten und die Ausweitung dieser Praxis auf immer mehr Personen favorisierten. Das deutsche Gesetz über die Sterilisierung von »erbkranken Menschen« basierte weithin auf amerikanischen Gesetzen, die zur Sterilisierung von Tausenden von Opfern geführt hatten.
Es geht in diesem Buch aber auch darum, durch das Einnehmen einer vergleichenden und transnationalen Perspektive eine Neubewertung von Ereignissen der politischen Geschichte, etwa des Versailler Vertrags, der Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg und der Erfahrungen der Ostdeutschen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus zu erreichen. Diese Ereignisse wurden zu oft in Isolation von ihrem historischen Kontext und aus einer Binnenperspektive betrachtet. Der Versailler Vertrag mag für Deutschland hart gewesen sein, aber er war – wie ein Vergleich mit anderen ähnlichen Verträgen zeigt – keineswegs ungewöhnlich. Weder Deutschland noch seine Nachbarn zögerten, wenn sich die Gelegenheit ergab, sich gegenseitig harte Friedensverträge aufzuzwingen. Und auch die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten wird fast immer als eine vor allem Deutsche betreffende Erfahrung beschrieben. Dabei waren es eben nicht nur Deutsche, die aufgrund der Grenzverschiebungen in der Mitte der 1940er Jahre ihre Heimat verloren, sondern auch Ukrainer, Polen und viele andere. Die Erfahrung der Ostdeutschen nach 1990 war für viele entwurzelnd und das Leben umkrempelnd. Ostdeutsche erlebten innerhalb weniger Jahre eine rapide Transformation von einer Industriegesellschaft zu einer postindustriellen Gesellschaft. Diese Umwandlung an sich war keineswegs einmalig. Auch andere Industrieregionen in West- und Osteuropa durchlebten ähnliche Veränderungen. Der wesentliche Unterschied zwischen den ostdeutschen Industrieregionen und den anderen Industriegebieten bestand in der hohen Geschwindigkeit dieser Transformation, die zu enormen sozialen und kulturellen Verwerfungen führte. Und auch die Abwanderung, die so charakteristisch für Ostdeutschland zu sein scheint, ist keineswegs eine regionale Besonderheit, sondern reflektiert eine Rückkehr zu transkontinentalen Migrationsbewegungen, die durch den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg unterbrochen worden waren.
Industrialisierung und Urbanisierung
Im April des Jahres 1815 brach, von zeitgenössischen europäischen Gelehrten weitgehend unbemerkt, der Vulkan Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa aus. Die gewaltigen aus dem Vulkan herausgeschleuderten Massen von glühender Lava und schwarzer Asche begruben rasch die Flora und Fauna der Insel unter sich. Innerhalb kurzer Zeit bedeckte eine mehr als ein Meter dicke Ascheschicht die gesamte Oberfläche in einem Umkreis von 30 Kilometern. Und selbst in einer Entfernung von 160 Kilometern wurde die Oberfläche unter einer 25 Zentimeter dicken Ascheschicht begraben. Nur 26 der auf 12.000 Menschen geschätzten Inselbevölkerung überlebten diese Naturkatastrophe.
Die Folgen dieses gewaltigen Vulkanausbruches blieben jedoch nicht auf die unmittelbare Umgebung des Vulkans oder auf Südostasien beschränkt, sondern verursachten eine globale klimatische Katastrophe. Aus dem Vulkan gelangten Asche und Gase in die Stratosphäre, die dort eine Aschewolke bildeten, die in etwa so groß war wie der Kontinent Australien. Diese gewaltige Aschewolke bewegte sich nur sehr langsam und ließ kein Sonnenlicht zur Erde dringen. Südostasien wurde so für mehr als drei Tage in eine tiefschwarze Nacht gehüllt. Sinkende Temperaturen, fehlendes Sonnenlicht und der langanhaltende Ascheregen vernichteten Ernten und verursachten eine Hungersnot, der mehr als 70.000 Menschen allein in Südostasien zum Opfer fielen.
Die Aschewolke umrundete die Erde innerhalb von zwei Wochen und legte einen dunklen Schleier über unseren Planeten. Dieser für das Auge des Beobachters unsichtbare Schleier reflektierte das Sonnenlicht, verursachte eine mehr als ein Jahrzehnt währende globale Abkühlung und veränderte die Wetterlage in der nördlichen Hemisphäre. Gegen Ende des Jahres 1815 mehrten sich auch in Europa die Zeichen, dass etwas mit dem Wetter nicht stimmte. Im Dezember erlebten die Bewohner der am Fuße der Apenninen gelegenen Stadt Teramo in Italien die heftigsten Schneefälle, die bis dahin in dieser Region verzeichnet worden waren. Aber es war weniger die Schneemenge, die die Bewohner Teramos beunruhigte, als die Farbe des Schnees. Der Schnee war tiefrot und gelb gefärbt. Und dies war kein Einzelfall. Im Frühjahr 1816 erlebte Ungarn einen extrem kalten Winter mit Schneemassen, die ganze Dörfer unter sich begruben. Und wiederum war es nicht so sehr die Schneemenge, sondern seine braune Farbe, die Bestürzung unter den Bauern hervorrief. Die rote, gelbe und braune Einfärbung des Schnees, der im Winter 1815/16 über Europa fiel, wurde wohl durch die Staubpartikel verursacht, die beim Ausbruch des Tamboras in die Stratosphäre geschleudert und dort global verteilt wurden. Diese Staubpartikel verfärbten nicht nur den Schnee des Winters 1815/16, sondern verursachten über Jahre hinweg auch wunderschöne farbenprächtige Sonnenuntergänge, die durch Maler der Romantik wie Caspar David Friedrich und Karl Friedrich Schinkel festgehalten wurden. So erfasste Friedrichs Gemälde Frau vor untergehender Sonne aus dem Jahr 1818 eine tieforangene Färbung der untergehenden Sonne, die wohl durch die in der Stratosphäre noch vorhandenen Aschepartikel verursacht wurde.
Die langanhaltende Kälte, die Schneemassen und die ungewöhnliche Farbenpracht des Schnees galten Menschen in ganz Europa als Unheilsboten. Der auf diesen Winter folgende Frühling und Sommer brachte ungekannte Wetterkapriolen und Hungersnöte. Das Jahr 1816 war das zweitkälteste Jahr in der nördlichen Hemisphäre seit 1400, und es dauerte mehrere Jahre, bevor sich das Klima wieder langsam erwärmte und die Sommer durch Sonnenschein und nicht durch Schnee dominiert wurden. Der März 1816 war durch Stürme und Überflutungen gekennzeichnet, und im Mai, Juni und Juli wurden Felder und Dörfer wieder unter Schneestürmen begraben. Die Menschen froren in jenem Jahr ohne Sommer, Bauern bangten um die Erträge ihrer Ackerfelder.
Bereits im Sommer 1816 brach in Süd- und Westdeutschland eine Hungersnot aus. Die Preise für Getreide und Nahrungsmittel stiegen rasch überall in Europa an. Menschen in Dörfern und Städten suchten nach Essbarem auf Wiesen und Feldern. Wilde Beeren, Pilze und Brennnesseln waren die Nahrung für viele. Mehl zum Brotbacken wurde durch geriebene Baumrinde ersetzt. Und es waren nicht nur Menschen, die hungerten, sondern auch die (Wild- und Haus-)Tiere. Pferdebesitzer mussten zusehen, wie ihre Tiere verendeten, da sie nicht genug Heu zum Füttern der Pferde finden konnten oder zur Nahrungsquelle für Menschen wurden. Dies hatte Auswirkungen nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern auch auf den Transport von Gütern, da Pferde immer noch die Hauptantriebskraft für den Gütertransport waren. Nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch der Gütertransport kam im Herbst 1816 weitgehend zum Erliegen.
Diese Naturkatastrophe, die in dem Ausbruch des fernen und den meisten zeitgenössischen europäischen Gelehrten völlig unbekannten Vulkans Tambora ihre Ursache hatte, zwang Erfinder wie den Mannheimer Karl von Drais dazu, über pferdelose Alternativen der Fortbewegung und des Warentransportes nachzudenken. Drais experimentierte schon seit 1813 mit einer durch menschlichen Antrieb betriebenen Fahrmaschine, die aus einem Wagen mit vier Rädern und einem fußgetriebenen Antrieb bestand. Allerdings stellte sich bei einer öffentlichen Untersuchung durch Beamte des Großherzogtums Baden heraus, dass diese Fahrmaschine langsamer war als ein laufender Mensch. Im Jahr 1816 stellte Drais dann seine weiterentwickelte Fahrmaschine vor, die durch zwei Personen angetrieben wurde. Aber auch diese Maschine erwies sich nicht als zukunftstüchtig. Im Juni 1817 präsentierte Drais schließlich seine berühmte Laufmaschine mit zwei Rädern, die durch die Laufbewegungen einer Person, deren Füße den Boden berührten, fortbewegt wurde. Während einer öffentlichen Vorführung am 12. Juni 1817 erreichte Drais mit seiner Laufmaschine eine Geschwindigkeit von immerhin acht Kilometern pro Stunde. Mit dieser Entwicklung begann die Geschichte des Fahrrads und einer Fortbewegungstechnik, die nicht mehr auf Pferdekraft angewiesen war.
Die Ankunft der Eisenbahn
Auch wenn sich die landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion sowie der Bestand an Pferden, die sowohl zur landwirtschaftlichen Arbeit als auch zum Gütertransport verfügbar waren, in den Jahren nach 1816 wieder erholten, blieb die Entwicklung einer Alternative zum Gütertransport durch Pferdekraft eine vorrangige Aufgabe unter Erfindern und Kaufleuten. Vorbilder für einen Gütertransport mittels dampfgetriebener Maschinen gab es schon in England, wo George Stephenson bereits im Jahr 1814 eine Lokomotive für den Transport von Steinkohle entwickelt hatte. Die ersten englischen Eisenbahnen dienten in den 1820er Jahren vor allem zum Transport von Kohle. Im Jahr 1830 wurde dann die erste Eisenbahnlinie zur Personenbeförderung zwischen Liverpool und Manchester eröffnet.
Diese Revolution im Transportwesen faszinierte deutsche Kaufleute, Ingenieure und Politiker, die nach England reisten, um sich selbst ein Bild von den Eisenbahnen zu machen. Unter diesen Reisenden war auch der Ingenieur Paul Camille von Denis, der 1832 Belgien, England und die USA besuchte, um die Fortschritte im Eisenbahnbau zu studieren. Aufgrund seiner in den bereisten Ländern gesammelten Erfahrungen wurde Denis im Jahr 1835 mit der Aufsicht über den Bau der ersten deutschen Eisenbahnverbindung zwischen Nürnberg und Fürth (Ludwigsbahn) betraut. Finanziert wurde diese Strecke durch Kaufleute und Unternehmer, die von den Plänen des deutsch-amerikanischen Nationalökonomen Friedrich List für ein nationales Schienennetz und den Beschreibungen der englischen Eisenbahnen durch den Ingenieur Joseph von Baader inspiriert wurden und sich von dieser Innovation im Transportwesen wirtschaftliche Vorteile versprachen.
Nach ihrer Eröffnung im Jahr 1835 verkehrten auf der Ludwigsbahn zweimal täglich dampfgetriebene und stündlich pferdegetriebene Züge. Die Ursachen für den häufigeren Einsatz von Pferden waren die hohen Kosten der zum Antrieb der Lokomotive benötigten Kohle, die aus Sachsen nach Bayern mittels Pferdewagen importiert werden musste, sowie häufig auftretende Lieferschwierigkeiten. Eisenbahngesellschaften wie die Ludwigsbahngesellschaft befanden sich aber nicht nur in Abhängigkeit von Kohleproduzenten in anderen deutschen Staaten, sondern waren auch von englischen Lokomotivherstellern abhängig. Die ersten zwei Lokomotiven der Ludwigsbahn mussten aus England importiert werden, da es in Deutschland noch keine entsprechenden Hersteller gab. Die erste in einem deutschen Unternehmen – der Firma Henschel & Sohn in dem zum Großherzogtum Hessen-Kassel gehörenden Kassel – hergestellte Lokomotive kam erst im Jahr 1852 – 17 Jahre nach deren Eröffnung – auf der Ludwigsbahn zum Einsatz.
In einer Zeit, in der Kaufleute und Politiker in den verschiedenen deutschen Staaten sich für die Konstruktion von Bahnverbindungen innerhalb einzelner Bundesstaaten einsetzten, entwickelte List seine Vision für ein nationales Eisenbahnnetz, das alle deutschen Großstädte verbinden würde. List, der sowohl in den USA als auch in Deutschland gelebt und die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Staaten verfolgt hatte, setzte sich öffentlich für den Eisenbahnbau ein und suchte Kaufleute und Unternehmer von der Notwendigkeit der Konstruktion von Zugverbindungen zu überzeugen. Nachdem es ihm nicht gelang, Hamburger Kaufleute für den Bau einer Eisenbahnlinie zu gewinnen, zog er 1833 weiter nach Leipzig, das sich aufgrund seiner geographischen Lage in der Mitte Deutschlands und seiner herausgehobenen Rolle im Handel auch als ein zentraler Knotenpunkt für ein künftiges deutsches Zugstreckensystem anbot. Im Oktober 1833 veröffentlichte List in Leipzig seine Schrift Ueber ein sächsisches Eisenbahnsystem als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahnsystems und insbesondere über die Anlegung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden, in der er als ersten Schritt zu einem deutschen Eisenbahnsystem den Bau einer Verbindung von Leipzig nach Dresden vorschlug, die durch die Kaufleute und Unternehmer der Messestadt finanziert werden sollte. List hob nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile dieser Zugverbindung hervor, sondern appellierte auch an den Lokalstolz der Leipziger Bürger, indem er sie daran erinnerte, dass Leipzig mit diesem Schritt zum Herzen eines deutschen Eisenbahnsystems werden könnte.
Lists Vorschläge trafen in Leipzig, das um seine führende Position im Handel bangte, auf offene Ohren. Die Leipziger Bürgerschaft fürchtete vor allem den Bau einer Eisenbahnlinie im nahen, aber seit 1815 preußischen Halle (Saale), die die Position Leipzigs nachdrücklich schwächen könnte. Diese Ängste und Hoffnungen motivierten viele Leipziger Kaufleute und Unternehmer, die sich unter Führung des Unternehmers Gustav Harkort die Pläne Lists zu eigen machten. Die Begeisterung für das Unternehmen war enorm. So wurden die 15.000 Aktien der Eisenbahngesellschaft im Wert von jeweils 100 Talern innerhalb weniger Tagen an Investoren verkauft.
Die Initiative zum Bau von Eisenbahnlinien im 19. Jahrhundert ging in der Regel von den Kaufleuten und Unternehmern in einzelnen Großstädten aus, die zur Finanzierung der Eisenbahnprojekte Aktiengesellschaften gründeten. Die von diesen Eisenbahnaktiengesellschaften ausgegebenen Aktien erwiesen sich als eine profitable Geldanlage, da sie ihren Aktienbesitzern in den 1850er und 1860er Jahren eine zweistellige Dividende einbrachte, die zwischen 15 und 25 Prozent lag. So zahlte zum Beispiel die Leipzig-Dresdner Eisenbahngesellschaft ihren Aktionären im Jahr 1857 eine Dividende von 21 Prozent. Diese privaten Eisenbahnaktiengesellschaften wurden beginnend in den 1880er Jahren von den deutschen Bundesstaaten aufgekauft und in staatliche Eisenbahngesellschaften zusammengeführt.
Die Unternehmensform der Aktiengesellschaft, die es schon seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert gab, erhielt erst im Kontext des Eisenbahnbaus eine rechtliche Grundlage und avancierte damit zu einem wichtigen Instrument der Industrialisierung. So erließ die preußische Regierung im Jahr 1843 das erste Gesetz, das die Bildung von Aktiengesellschaften autorisierte. Dieses Gesetz definierte die Aktiengesellschaft über ihr wirtschaftliches Ziel – etwa den Bau einer Eisenbahnlinie – und nicht über ihre organisatorische Struktur als eine Vereinigung von Investoren und Aktieninhabern. Aktiengesellschaften wurden daher als eine Vereinigung von Aktien und nicht als ein Zusammenschluss von Aktieninhabern konzipiert. Daher gelangten Aktiengesellschaften auch als erste Unternehmensform in den Genuss der beschränkten Haftpflicht. Aktieninhaber hafteten im Fall des Konkurses ihrer Aktiengesellschaft daher nur mit dem Wert ihrer Aktien, nicht aber mit ihrem persönlichen Vermögen. Dieses Prinzip der beschränkten Haftung war dazu gedacht, die Finanzkraft der Investoren zu schützen, die nach dem Konkurs einer Aktiengesellschaft ihre verbliebenen Finanzmittel in eine neue Aktiengesellschaft investieren und somit die wirtschaftliche Entwicklung des Landes weiter vorantreiben könnten.
Der Bau der Leipzig-Dresdner Bahnverbindung begann im Herbst 1835. Vier Jahre später wurde die 116 Kilometer lange Strecke für den Verkehr freigegeben. Wie bereits im Fall der bayerischen Bahnverbindung zwischen Nürnberg und Fürth hing auch die sächsische Zugverbindung von englischer Technologie und Expertise ab. So mussten die Schienen und die ersten Lokomotiven aus England importiert werden, und die Konstruktion der Bahnstrecke wurde von dem englischen Ingenieur James Walker überwacht. Die Eröffnung der Zugverbindung verkürzte die Reise- und Transportzeiten zwischen Leipzig und Dresden, die mit Pferdetransporten zwischen zwölf Stunden und drei Tagen betragen konnten, auf lediglich dreieinhalb bis viereinhalb Stunden. Reise- und Transportkosten sanken deutlich, so dass mehr und mehr Personen davon Gebrauch machten. Das vor Baubeginn der Eisenbahnlinie zwischen Leipzig und Dresden geschätzte Passagiervolumen, das von 44.000 Personen pro Jahr ausging, erwies sich schnell als zu niedrig angesetzt. Im ersten Jahr ihres Betriebs beförderte die Leipzig-Dresdner Eisenbahn etwa 145.000 Reisende. Es waren aber nicht nur Menschen und Güter, die mit diesen Zügen verkehrten, sondern auch Briefe und Nachrichten. Der Einzug der Eisenbahn führte nicht nur zu einer Revolution im Gütertransport und vereinfachte die geographische Mobilität der Menschen, sondern verbesserte auch den Austausch und die Verbreitung von öffentlichen und privaten Informationen.
Die Leipzig-Dresdner Eisenbahn inspirierte, wie List es vorhergesehen hatte, den Bau weiterer regionaler Eisenbahnlinien, die durch ihre Verbindung letztlich ein nationales Eisenbahnnetz formten. Im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts entstanden insgesamt vier regionale Eisenbahnsysteme: ein nord- und mitteldeutsches System mit Hamburg, Hannover, Berlin und Leipzig als Zentren; ein rheinisches System mit Köln als Zentrum; ein südwestliches System mit seinem Mittelpunkt in Frankfurt am Main; und schließlich ein bayerisches System mit seinen Zentren in Nürnberg und München. Alle deutschen Großstädte waren bereits im Jahr 1865 durch Eisenbahnlinien miteinander verbunden. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erhielten dann auch viele Klein- und Mittelstädte einen Eisenbahnanschluss. Die Streckenlänge wuchs von 2.131 Kilometer im Jahr 1845 auf 18.560 Kilometer im Jahr 1870 und auf 59.031 Kilometer im Jahr 1910.
Mit dem Ausbau der Eisenbahn verloren Pferde als Antriebsmittel für den Personen- und Gütertransport allerdings nur allmählich an Bedeutung. Im Jahr 1846 und damit acht Jahre nach der Eröffnung der ersten preußischen Zugverbindung zwischen Berlin und Potsdam dienten Pferde noch als Hauptantriebsmittel für den Personen- und Gütertransport in Preußen. Insgesamt 38.349 Pferde transportierten 130 Millionen Tonnen in diesem Jahr. Daran änderte sich zunächst in den 1850er und 1860er Jahren nur sehr wenig. Erst nach 1900 entwickelte sich die Eisenbahn auch aufgrund immer leistungsstärkerer Lokomotiven zum wichtigsten Transportmittel für den Personen- und Gütertransport. Konnte eine Lokomotive im Jahr 1845 gerade einmal 40 Waggons mit einer Gesamtlast von 80 Tonnen ziehen, waren die Lokomotiven im Jahr 1910 so leistungsstark geworden, dass sie bis zu 100 Waggons mit einer Gesamtlast von 1.500 Tonnen ziehen konnten. Im Jahr 1910 beförderten Züge insgesamt etwa 500 Mal so viele Güter wie im Jahr 1845. Um dieses Gütervolumen mit Pferden zu transportieren, hätte man etwa 17 Millionen Pferde benötigt. Pferde spielten dennoch auch nach 1900 noch eine wichtige Rolle im Personen- und Güternahtransport. Sie transportierten im Jahr 1910 allein in Preußen immerhin noch 56,276 Millionen Tonnen.
Der Eisenbahnbau schuf eine gewaltige und stetig steigende Nachfrage nach Steinkohle und Eisen. Während Steinkohle in heimischen Bergwerken abgebaut werden konnte, mussten die aus Eisen gefertigten Schienen, Lokomotiven und Waggons in den ersten Jahrzehnten aus England importiert werden. Von den 245 Lokomotiven, die im Jahr 1840 auf allen deutschen Bahnschienen verkehrten, stammten 166 aus englischer Produktion. Weitere zwölf Lokomotiven waren in Belgien und 29 in den USA, aber nur 38 in Deutschland gefertigt worden. Erst in den 1850er Jahren begannen sich mit Unternehmen wie Maffei in München und Borsig in Berlin einheimische Lokomotivhersteller zu etablieren, die die englische Konkurrenz allmählich verdrängten und selbst zu Exporteuren im Eisenbahnbau aufstiegen.
Der Eisenbahnbau führte nicht nur zur Etablierung einer umfangreichen Eisen- und Stahlindustrie und der Ausweitung des Bergbaus, sondern förderte auch die Entwicklung moderner Bautechnologien wie der des Stahlbetonbaus. Auch wenn List das Leipziger Flachland als idealen und einfachen Baugrund für den Bau einer Eisenbahnlinie anpries, so führte die Bahnlinie nach Dresden doch auch über Straßen und Flüsse und hatte erhebliche Höhenunterschiede zu überwinden und Berge zu durchqueren. So war für diese Strecke auch der Bau eines 513 Meter langen Tunnels in der Nähe der Stadt Oberau nordwestlich von Dresden – des ersten Eisenbahntunnels auf dem europäischen Kontinent überhaupt – nötig.
Je mehr Eisenbahnstrecken gebaut wurden, desto mehr ergab sich die Notwendigkeit, Brücken über Straßen und Flüsse zu schlagen. Die ersten Brückenkonstruktionen waren einfach gemauerte Bauwerke, die nicht nur sehr klobig wirkten, sondern auch nur begrenzt belastbar waren. Mit der Entwicklung der Eisenbetonbauweise konnten schlanke Brückenkonstruktionen errichtet werden, die in der Lage waren, auch erheblich schwerere Lasten zu tragen.
Die Geschichte des Eisenbetons begann mit dem französischen Gärtner Joseph Monier, der in den 1860er Jahren Pflanzkübel aus Beton mit eingelassenen Drahtkörben herstellte, die wesentlich haltbarer waren als herkömmliche Pflanzkübel. In den 1890er Jahren übertrug der französische Ingenieur François Hennebique diese Innovation auf größere industrielle Bauwerke und baute ein europaweites Netzwerk von Lizenznehmern auf, die seine patentierte Eisenbetonbauweise in ihrem jeweiligen Land nach in Paris angefertigten Plänen ausführten. In Deutschland waren dies zunächst der Straßburger Unternehmer Eduard Züblin und der Leipziger Architekt Max Pommer.
Die aus Eisenbeton errichteten Gebäude und Brücken waren so schlank und filigran, dass sich die Zeitgenossen anfangs kaum vorstellen konnten, dass diese Bauwerke auch die an sie gestellten Erwartungen erfüllen würden. Derartige Vorbehalte wurden jedoch rasch ausgeräumt. Das Reichstagsgebäude in Berlin (1894) sowie der Leipziger Hauptbahnhof (1915) waren prominente Bauten, die nur mit Eisenbeton, der den Bau von weiten, freitragenden Decken und Kuppeln erst ermöglichte, konstruiert werden konnten. Diese beiden Bauten entwickelten sich nicht nur zu Wahrzeichen, sondern auch zu einer Dauerreklame für die neue Bautechnologie, die bald nicht mehr nur beim Bau von Brücken und Bahnhöfen, sondern auch bei der Errichtung von Fabrikgebäuden, Geschäftshäusern und sogar von Wohnhäusern Anwendung fand.
Der Eisenbahnbau brachte aber nicht nur technologische Veränderungen mit sich, sondern führte auch zu einer Standardisierung der Zeit. Eisenbahnverbindungen erforderten die Einführung von Fahrplänen, die den Zugverkehr regelten. Fahrpläne wiederum zwangen Kommunen dazu, ihre bis zur Ankunft der Eisenbahn lokal bestimmte Zeit zugunsten einer regional und später national vereinheitlichen Zeit aufzugeben. Bis zur Ankunft der Eisenbahn gab es in den deutschen Staaten keine einheitliche Zeit. Jede Kommune hatte ihre eigene Zeiteinteilung. Dieses Zeitchaos stellte eine Hürde für das Anlegen von Fahrplänen für den Zugverkehr dar und musste deshalb überwunden werden. Anfänglich nahmen die einzelnen Bahngesellschaften die Zeit in ihrer Zentrale als Basis für den Fahrplan. So benutzte die preußische Bahngesellschaft die Berliner Zeit als Grundlage, die bayerische Bahngesellschaft die Münchener Zeit und die württembergische Bahngesellschaft die Stuttgarter Zeit. Dieses Zeitchaos endete erst im Jahr 1893 mit der Einführung der Görlitzer Zeit, die nach dem durch Görlitz verlaufenden 15. Längengrad benannt wurde.
Die Einführung der Eisenbahn beeinflusste sogar den Wortschatz der deutschen Sprache nachhaltig. Viele im Alltag häufig gebrauchte Redewendungen haben ihren Ursprung in der technischen Fachsprache der Eisenbahn. So wird zum Beispiel das Herausdrängen eines Menschen aus seiner beruflichen Position mit der Redewendung umschrieben, dass er auf das Abstellgleis geschoben würde. Und wenn eine Person sich einer politischen oder gesellschaftlichen Bewegung anschließt, lange nachdem diese ins Leben gerufen wurde, dann sagt man gerne, dass der Betroffene auf den fahrenden Zug aufgesprungen oder gar nur ein Trittbrettfahrer sei. Und wenn Personen darauf drängen, etwas zu tun, sagen sie auch gern, dass es höchste Eisenbahn sei.
Der Deutsche Zollverein
Eisenbahnen beschleunigten und verbilligten nicht nur den Personen- und Gütertransport zwischen Städten wie Leipzig und Dresden innerhalb eines deutschen Staates (hier Sachsen), sondern auch zwischen Städten wie etwa Leipzig und Magdeburg, die sich in zwei unterschiedlichen deutschen Staaten (hier Sachsen und Preußen) befanden. Die Zugstrecke zwischen Leipzig und Magdeburg wurde im Jahr 1840 als erste grenzüberschreitende Bahnverbindung eröffnet. Mit diesem grenzüberschreitenden Bahnverkehr ergaben sich eine Reihe logistischer Probleme für die in den Austausch von Waren involvierten Kaufleute und Unternehmer, da die Bahn nun Gebiete miteinander verband, die unterschiedliche Währungen, Zeiten und Maßeinheiten verwendeten, und nicht nur eine politische Grenze, sondern auch eine Steuergrenze überquerte. Alle Güter, die eine der vielen Staatsgrenzen innerhalb des Deutschen Bundes überquerten, wurden besteuert. Da die Einnahmen aus dieser Besteuerung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs eine wichtige Einnahmequelle für die landesherrlichen Kassen waren, gab es unter den Landesherren nur wenig Interesse, diese Besteuerung aufzugeben. Lediglich die preußischen Könige zeigten sich einer Abschaffung dieser Steuern gegenüber aufgeschlossen, weil Preußen aufgrund seiner geographischen Position innerhalb des Deutschen Bundes zu den Verlierern bei der Besteuerung von Gütern gehörte. Preußen bestand aus zwei nicht miteinander verbundenen Hälften mit Brandenburg, Ost- und Westpreußen im Osten und dem Rheinland und Westfalen im Westen des Deutschen Bundes. Zwischen diesen beiden Hälften lagen kleinere Staaten wie das Königreich Hannover, das Herzogtum Braunschweig und das Großherzogtum Hessen-Kassel. Und dann war da auch noch das südliche preußische Territorium der vom Königreich Württemberg und dem Großherzogtum Baden umschlossenen Grafschaft Hohenzollern. Der Transport von Gütern aus dem Westen Preußens in dessen Osten schloss daher immer die Überquerung von Grenzen ein, an denen Steuern gezahlt werden mussten.
Der preußische Politiker Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein und der badische Politiker Karl Friedrich Nebenius erkannten bereits in den 1810er Jahren, dass die Besteuerung von Gütern im grenzüberschreitenden Verkehr die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Länder behinderte. Es dauerte aber noch mehr als ein Jahrzehnt, bis sich einzelne deutsche Staaten zu Zollvereinen zusammenschlossen und die Besteuerung von Gütern im grenzüberschreitenden Verkehr beendeten. Im Jahr 1828 bildeten sich mit dem Preußisch-Hessischen Zollverein, dem Mitteldeutschen Handelsverein und dem Süddeutschen Zollverein zunächst drei miteinander konkurrierende Zollvereine. Der Mitteldeutsche Handelsverein wurde vor allem durch die Furcht der mitteldeutschen Staaten vor einer preußischen Vormachtstellung zusammengehalten. So versprachen sich die Mitglieder dieses Verbundes, dem Staaten wie das Königreich Sachsen, das Königreich Hannover und das Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach angehörten, dass sie nicht dem Preußisch-Hessischen Zollverein beitreten würden. Es gelang ihnen aber nicht, die Steuergrenzen innerhalb ihres Handelsvereins zu überwinden. Daher überlebten weder der Mitteldeutsche Handelsverein noch der Süddeutsche Zollverein. Bis 1834 traten die Mehrzahl der deutschen Staaten dem Preußisch-Hessischen Zollverein bei, der durch den Deutschen Zollverein abgelöst wurde.
Dem Deutschen Zollverein gelang eine allmähliche Harmonisierung der Wirtschafts- und Finanzsysteme seiner Mitgliedsstaaten und die Schaffung eines gemeinsamen Marktes. Im Dresdner Münzvertrag von 1838 einigten sich seine Mitgliedsstaaten auf eine Vereinheitlichung ihrer Währungen, indem sie sich dazu verpflichteten, entweder den Taler oder den Gulden als Landeswährung zu führen. Der Vertrag legte auch eine Umtauschrate fest, die den Wert von einem Taler auf 1,75 Gulden festschrieb. Als wesentlich schwieriger erwies sich die Vereinheitlichung der Maß- und Gewichtssysteme, da diese noch nicht einmal auf der Landesebene standardisiert worden waren. Das Königreich Preußen hatte zwar bereits im Jahr 1816 ein landesweit einheitliches Maß- und Gewichtssystem eingeführt. Andere Staaten wie das Königreich Hannover folgten aber erst 1837 und das Königreich Sachsen gar erst im Jahr 1858. Das metrische System wurde in Deutschland als Standard erst im Jahr 1872 eingeführt.
Die Schaffung des Deutschen Zollvereins, der die Zollgrenzen zwischen seinen Mitgliedsstaaten allmählich abschaffte und dadurch einen deutschen Binnenmarkt schuf, förderte die wirtschaftliche Entwicklung und Integration der deutschen Staaten nachhaltig und bescherte dem Eisenbahnbau einen enormen Entwicklungsschub. Die Eisen- und Stahlindustrie sowie die Textilindustrie wuchsen gewaltig und vergrößerten das Handelsvolumen, das den Bau von Eisenbahnlinien zwischen den Mitgliedsstaaten des Deutschen Zollvereins beförderte. Vor allem in den 1840er Jahren flossen gewaltige Finanzmittel privater Investoren in den Eisenbahnbau, der zwischen 20 und 30 Prozent des gesamten Investitionsvolumens absorbierte. Der Eisenbahnbau überholte damit die Landwirtschaft als Wirtschaftssektor, der die meisten Investitionen anzog. Die Zahl der im Eisenbahnbau Beschäftigten versechsfachte sich innerhalb von nur fünf Jahren von 1841 bis 1846 und wuchs von 30.000 auf 178.000 Arbeiter.
Großstädte und ihre Einwohner
Eisenbahnlinien verbanden nicht nur Städte miteinander, sondern machten diese Städte auch zu Umschlagplätzen für Menschen und Güter. Oftmals folgten die neuen Eisenbahnlinien etablierten und traditionsreichen Handelslinien. In manchen Fällen schufen sie aber auch neue Handelsverbindungen. Eisenbahnen erhöhten nicht nur die Geschwindigkeit des Personen- und Warentransportes, sondern gaben Menschen eine größere Freiheit in der Wahl ihres Wohnortes. Nur eine Minderheit der Deutschen verblieb zeitlebens an dem Ort ihrer Geburt. Die Mehrzahl der Deutschen wanderte von ländlichen in urbane Gegenden. So wuchs der Anteil der in Städten lebenden Deutschen von 26,5 Prozent im Jahr 1816 auf 60 Prozent im Jahr 1910. Und Millionen Deutscher suchten ihr Glück in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten: Am Ende des 19. Jahrhunderts reichten die Siedlungen deutschsprachiger Auswanderer von der Wolga in Russland bis an die pazifische Küste Nord- und Südamerikas und von der Südspitze Afrikas bis nach Nordeuropa. Diese Wanderungsbewegungen hatten in vielen Fällen bereits vor dem 19. Jahrhundert begonnen, aber die Auswanderung aus Deutschland gewann aufgrund der verbesserten Transporttechnologie vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Intensität.
Leipzig befand sich unter den Städten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluss der Industrialisierung ein gewaltiges Bevölkerungswachstum erlebten. Obwohl sich die Einwohnerzahl dieser Stadt in nur 51 Jahren von 1834 bis 1885 von etwa 45.000 Einwohner auf mehr als 170.000 Einwohner erhöhte, expandierte der für die wachsende Zahl der Neu-Leipziger vorhandene Raum nicht. Mehr und mehr Menschen zwängten sich in den lediglich 17,7 Quadratkilometer großen Stadtraum, so dass die Bevölkerungsdichte von 2.542 Menschen pro Quadratkilometer im Jahr 1834 auf 9.624 im Jahr 1885 stieg. Doch es war nicht nur die Stadt, die buchstäblich aus den Nähten platzte, sondern auch die 43 Dörfer und Kleinstädte, die sich in einem Umkreis von sechs Kilometern befanden. Hier war das Bevölkerungswachstum noch viel dramatischer. So erhöhte sich die Bevölkerung dieser Vororte von insgesamt 18.000 Einwohner im Jahr 1834 binnen fünf Jahrzehnten auf 152.000 Einwohner (1885).
Am Anfang des 19. Jahrhunderts versorgten die Bauern dieser Siedlungen die Stadt noch mit landwirtschaftlichen Produkten. Die unmittelbare Landschaft der Stadt war durch Felder und Wälder geprägt. In den 1820er und 1830s Jahren begannen Dörfer wie die westlich von Leipzig gelegenen Orte Plagwitz und Lindenau Fabriken und Arbeitersiedlungen anzuziehen. Nachdem in diesen beiden Orten Textilfabriken und Eisengießereien entstanden waren, wuchs deren Bevölkerung rapide. Plagwitz hatte im Jahr 1834 lediglich 200 Einwohner, im Jahr 1884 waren es 10.000. Und in Lindenau wuchs die Einwohnerzahl im gleichen Zeitraum von etwa 1.000 auf mehr als 15.000. Dieses gewaltige Bevölkerungswachstum und die Verschiebung von einer landwirtschaftlichen zu einer industriellen Produktion veränderten den Charakter von Orten wie Plagwitz und Lindenau und ließen sie zu Konkurrenten Leipzigs werden. Da beide Orte geographisch durch die Weiße Elster sowie durch Sümpfe und Wälder von Leipzig getrennt waren, bestand hier die Möglichkeit einer von Leipzig unabhängigen, eigenständigen städtischen Entwicklung. Das Potential von Plagwitz und Lindenau für die Entwicklung Leipzigs erkennend, setzte sich der Leipziger Rechtsanwalt Karl Heine jedoch für die Anbindung dieser neuen industriellen Zentren an die alte Handelsstadt ein. Er initiierte und leitete verschiedene Infrastrukturprojekte wie die Trockenlegung der Sumpflandschaft, die Kanalisierung der Weißen Elster und des Straßenbaues, die Leipzig mit Plagwitz und Lindenau verbanden sowie neuen Raum für die Bebauung zwischen der Stadt und ihren Vororten eröffnete.
Die Verwandlung von Bauerndörfern wie Plagwitz in Industriekleinstädte brachte eine ganze Reihe von Herausforderungen für diese Kommunen mit sich. Die stetig wachsende Einwohnerzahl zwang diese Kommunen dazu, ihr Leistungsangebot zu erweitern. Volksschulen für die Kinder der Fabrikarbeiter wurden ebenso benötigt wie Straßen und Verkehrsmittel, um Personen und Güter zu transportieren. Vielen schnell wachsenden Gemeinden wie Plagwitz wuchsen die Probleme bald über den Kopf: Deshalb suchten diese nahe der Stadt Leipzig gelegenen Kommunen zuerst nach Möglichkeiten der Kooperation mit dem größeren Nachbarn und bald auch nach ihrer Integration in den Leipziger Stadtverband. Im Jahr 1889 begann dann die Serie der Eingemeindungen von Vororten wie Plagwitz und Lindenau, was nicht nur die Einwohnerzahl der Stadt weiter steigen ließ, sondern nun auch die Stadtfläche. Von 1889 bis 1892 wurden 17 Vororte mit insgesamt 143.000 Einwohnern nach Leipzig eingemeindet. Im Jahr 1895 zählte Leipzig fast 400.000 Einwohner.
Die wachsende Einwohnerzahl verlangte die Einführung von innerstädtischen Verkehrsmitteln, wie zum Beispiel Straßenbahnen, mit denen vor allem die Fabrikarbeiter zwischen ihrem Wohnort und ihrem Arbeitsort pendeln konnten. Die erste noch von Pferden gezogene Leipziger Straßenbahn wurde bereits im Jahr 1872 eröffnet und verband Leipzig mit dem östlich der Stadt gelegenen Reudnitz und dem südlich der Stadt gelegenen Connewitz. Erst zwanzig Jahre später wurden die pferdegezogenen Bahnen durch elektrisch angetriebene Straßenbahnen ersetzt. Wie schon im Eisenbahnbau so wurden auch die Straßenbahnen zuerst durch private Aktiengesellschaften gebaut und betrieben. In Leipzig konkurrierten am Ende des 19. Jahrhunderts drei Gesellschaften um die mehr als eine Million Passagiere, die jeden Monat die Straßenbahn benutzten. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges fuhren mehr als 230.000 Leipziger – was mehr als einem Drittel aller Leipziger entsprach – jeden Tag mit der Straßenbahn.
Die Straßenbahnfahrt war damit zur täglichen Routine für eine große Zahl der Leipziger geworden, die in einer sich mehr und mehr vergrößernden Stadt lebten. Die fortschreitende Eingemeindung von Vororten hatte das Stadtgebiet von 17,7 Quadratkilometern im Jahr 1885 auf 142 Quadratkilometer im Jahr 1936 anwachsen lassen. Straßenbahnen entwickelten sich zu einer fast alternativlosen motorisierten Form der Fortbewegung in diesem Stadtraum, da die meisten Leipziger sich keine individuellen Kraftfahrzeuge leisten konnten. So waren im Jahr 1906 lediglich 117 Autos und 73 Motorräder registriert. Bis zum Jahr 1939 stieg die Zahl der registrierten Automobile auf 18.672 und die der Motorräder auf 10.899 an. Damit verfügten im Jahr 1906 lediglich 0,04 Prozent aller Leipziger über ein privates Fahrzeug, im Jahr 1939 waren es bereits 4,2 Prozent. Autos und Motorräder blieben damit ein Zeichen wirtschaftlichen Erfolgs.
Während in Leipzig Straßenbahnen zum dominierenden innerstädtischen Transportmittel aufstiegen, entwickelte sich in der Metropole Berlin eine Mixtur aus Straßenbahnen, S-Bahnen und U-Bahnen. Im Jahr 1902 wurde in Berlin die erste U-Bahn-Linie in Deutschland eröffnet. Diese U-Bahn-Linie, die allerdings mehr oberirdisch als unterirdisch verlief, wurde von Werner von Siemens, der von ähnlichen Bahnprojekten in New York inspiriert worden war, als Hochbahn konstruiert und verband Berlin und Charlottenburg. Der Erfolg dieser ersten U-Bahn-Linie veranlasste die Stadt Berlin, weitere U-Bahn-Strecken zu konzipieren, die dann auch wirklich unter der Erde gebaut wurden. Diese Verkehrsmittel waren auf der einen Seite wichtig, um großstädtische Vororte näher an die urbanen und industriellen Zentren zu rücken und um den Arbeitsweg von Fabrikarbeitern zu verkürzen. Auf der anderen Seite trugen sie durch die Entwicklung elektrischer Antriebsmotoren auch zu einer zweiten industriellen Revolution bei.
Die rasch wachsende Nutzung von Elektrizität für den Antrieb von Nahverkehrsmitteln, der Beleuchtung der Straßen – die ersten elektrischen Straßenlaternen wurden in Berlin im Jahr 1879 aufgestellt – und später auch der Wohnungen führte zur Gründung von Unternehmen wie Siemens und der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) in Berlin. Diese Unternehmen haben durch ihre wirtschaftlichen und stadtgestaltenden Aktivitäten, wie etwa im Fall der Siemensstadt, die nach 1900 um das Siemenswerk herum in Spandau entstand, das Berliner Stadtbild geprägt. Elektrizität setzte sich nach 1900 allmählich auch als Antriebskraft in den Fabriken durch. Im Jahr 1900 nutzten lediglich 128 der insgesamt 1.325 Leipziger Fabriken Elektrizität als Energiequelle, 14 Jahre später waren es 1.840 von 4.983 Fabriken. Damit stieg der Anteil der Leipziger Fabriken, die Elektrizität nutzten, von 10 Prozent im Jahr 1900 auf 37 Prozent im Jahr 1914.
Die deutsche Gesellschaft am Vorabend des Ersten Weltkrieges war im Wesentlichen eine urbane und industrielle Gesellschaft geworden. Im Jahr der Gründung des Deutschen Reiches (1871) hatte noch die Mehrzahl der Deutschen (47,3 Prozent) in der Landwirtschaft gearbeitet, nur 32,8 Prozent der Deutschen waren in Bergwerken und Fabriken beschäftigt. Diese Vorherrschaft der Landwirtschaft war bereits im Jahr 1900 gebrochen, und im Jahr 1907 arbeiteten nun 43 Prozent aller Deutschen in der Industrie, während lediglich 38 Prozent in der Landwirtschaft beschäftigt waren. Mehr und mehr Menschen – im Jahr 1910 lebten 60 Prozent aller Deutschen in Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern – lebten in Städten, die zudem immer größer wurden. Im Jahr 1910 wurden in Deutschland insgesamt 48 Städte mit mehr als 100.000 Einwohner gezählt. Darunter befanden sich kleine Großstädte wie Augsburg und Erfurt, die nur wenig mehr als 100.000 Einwohner aufwiesen, und metropolenähnliche Großstädte wie Köln und Leipzig, die mehr als ein halbe Million Einwohner zählten. Die bei weitem größten Städte waren Berlin mit über zwei Millionen Einwohnern und Hamburg mit nahezu einer Million Einwohner. Die 48 Großstädte waren im Jahr 1910 die Heimat für 22 Prozent aller Deutschen. Diese modernen Großstädte entwickelten sich im Wesentlichen aus drei Stadttypen. Da waren zum einen Residenzstädte wie Dresden und München, deren Gesellschaft und Kultur über Jahrhunderte durch den Hof der regierenden Monarchen geprägt worden war. Dem standen Bürger- und Handelsstädte wie Leipzig und Hamburg gegenüber, die durch eine selbstbewusste Bürgerschaft geprägt worden waren. Und dann waren da auch neue Städte wie Barmen und Elberfeld, die sich aus Dörfern und Kleinstädten heraus entwickelt hatten. Das Bevölkerungswachstum in den aus diesen drei Typen entstehenden Großstädten wurde von deren Anbindung an das Eisenbahnnetz, das mehr und mehr Menschen aus den ländlichen Provinzen in die werdenden Großstädte brachte, und von den Eingemeindungen von Dörfern und Kleinstädten in der unmittelbaren Umgebung der industriellen und urbanen Zentren gespeist.
Die Gründung des Deutschen Bundes
Die zweieinhalb Jahrzehnte vom Ausbruch der Französischen Revolution im Jahr 1789 bis zur Gründung des Deutschen Bundes im Jahr 1815 waren eine Zeitenwende in der europäischen Geschichte. Am Anfang dieser Epochenwende stand die Französische Revolution, die das gesamte monarchische System in Frage stellte und auf dem europäischen Kontinent erstmals demokratische Alternativen entwickelte und praktisch umsetzte. Johann Wolfgang von Goethe erfasste die globalen Konsequenzen dieser politischen Entwicklungen, als er beim Anblick der französischen Gegner in der Schlacht von Valmy im Jahr 1792 sagte, dass von hier und heute eine neue Zeit ausginge. Es war aber nicht, wie manche hofften, ein neues Zeitalter der Demokratie, sondern vielmehr eine Ära des Nationalismus.
Ein Opfer dieser neuen Zeit war das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das für fast ein Jahrtausend als die zentrale Macht Europas bestanden hatte. Es erstreckte sich am Ende des 18. Jahrhunderts immer noch von der Nord- und Ostsee bis zum Mittelmeer und bot mehr als 300 Kleinstaaten, die seit der protestantischen Reformation des 16. Jahrhunderts weitgehende Autonomie gewonnen hatten, einen politischen Zusammenschluss. Mit der Spaltung des Reiches in protestantische und katholische Staaten nahmen die Konflikte zwischen seinen Mitgliedsstaaten zu und Kriege führten dazu, dass einige Staaten wie etwa das Kurfürstentum Brandenburg und das Königreich Österreich erheblich an Einfluss und Territorium gewannen, während andere Staaten wie etwa das Kurfürstentum Sachsen an Einfluss und Territorium verloren. Im Fall Sachsens trugen aber auch Erbteilungen des Landes unter den Nachkommen der Herrscher zu seiner stetigen Verkleinerung und Zersplitterung bei. So wurde Sachsen im Jahr 1485 zwischen den beiden Brüdern Ernst und Albrecht in das ernestinische Kurfürstentum Sachsen, das aufgrund fortschreitender Erbteilungen in den folgenden Jahrhunderten in immer kleiner werdende thüringische Einzelstaaten zerfiel, und das albertinische Herzogtum geteilt, das infolge von Kriegen wie den Napoleonischen Kriegen nunmehr als Königreich Sachsen erhebliche territoriale Verluste hinnehmen musste. Das Kurfürstentum Brandenburg gehörte hingegen zu den Gewinnern. So gelang es den Brandenburger Kurfürsten, ihr Territorium durch Kriege und gezielte Heiratspolitik beständig zu erweitern. Den in Brandenburg regierenden Hohenzollern gelang es zum Beispiel, die Kontrolle über das Herzogtum Preußen, das zum Königreich Polen gehörte, sowie die im Westen des Reiches liegenden Grafschaften Kleve und Berg und das im Südosten des Reiches liegende Herzogtum Schlesien zu gewinnen.
Die Bewohner der Mitgliedsstaaten des Heiligen Römischen Reiches gehörten unterschiedlichen Religionen an, sprachen verschiedene Sprachen und Dialekte und folgten ihren eigenen Traditionen und Ritualen. Das Reich wurde vor allem durch Tradition und eine Verfassung zusammengehalten, die seinen Mitgliedsstaaten umfangreiche Autonomierechte gewährte. Es gab wenig, was die Bewohner des Königreiches Preußen mit den Bewohnern des Herzogtums Kärnten verband. Und es war nicht nur das Heilige Römische Reich, sondern auch dessen größere Mitgliedsstaaten wie etwa Preußen, die eine landesweite Identifikation vermissten. Das Königreich Preußen war durch große Gebietsgewinne infolge dreier Kriege gegen Österreich sowie der Aufteilung des polnischen Staates unter seinen drei Nachbarn enorm angewachsen und zu einem Land geworden, das nicht mehr nur Protestanten, sondern nun auch Katholiken, nicht mehr nur Brandenburger und Preußen, sondern auch Polen und Schlesiern ein Zuhause war. Die preußischen Könige waren jedoch nicht in der Lage, ihren Untertanen eine sinnstiftende landesweite Identität anzubieten. Die Bewohner Pommerns und Schlesiens fühlten sich zuerst als Pommern und Schlesier und nicht etwa als Preußen. Als König Friedrich Wilhelm III. im März 1813 seine Untertanen zum Widerstand gegen die französische Besetzung seines Landes aufrief, konnte er sich nicht an seine preußischen Untertanen richten, sondern an seine Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern und Litauer. Dieser Aufruf verweist auf die anhaltende Zersplitterung der Bevölkerung des Königreiches Preußen, die sich mit ihren Provinzen, nicht aber mit dem preußischen Gesamtstaat identifizierte. Das Königreich Preußen war ebenso wie das Heilige Römische Reich eine Konföderation von Verwaltungseinheiten, die jeweils über umfangreiche kulturelle, sprachliche und religiöse Traditionen verfügten und diese auch zu bewahren suchten. Zu dieser Zersplitterung trug auch die fehlende Zentralisierung des preußischen Staates bei, der erst im Jahr 1746 mit dem Friedrichskollegium sein erstes Landesgericht erhielt, das für das gesamte Königreich als höchste Instanz zuständig war. Mit der Einrichtung dieses Gerichts wurde die bis dahin in der Obhut der Provinzen liegende Rechtsprechung erstmals hierarchisiert und zentralisiert. Das erste für alle Untertanen Preußens landesweit gültige Recht wurde erst mit dem Preußischen Landrecht im Jahr 1794 kodifiziert. Mit dem Preußischen Landrecht erhielten alle im Königreich lebenden Menschen die rechtliche Gleichstellung, was aber noch nicht eine Landesidentität schuf, die alle preußischen Untertanen miteinander verband.
Der Einfluss der Französischen Revolution
Die Neuigkeiten über den Ausbruch und den Verlauf der Revolution in Paris verbreitete sich unter den Bewohnern des Heiligen Römischen Reiches sehr zügig. Sie trafen vor allem in Staaten wie Preußen auf eine Bevölkerung, die wesentlich zufriedener mit ihren Herrschern war als die Franzosen mit ihren Königen. Der Preußen als König zwischen 1740 und 1786 regierende Friedrich II. galt als aufgeklärter Monarch, der umfangreiche Reformen angeschoben hatte, die zur Modernisierung Preußens beitrugen, und seinen Untertanen zumindest das Gefühl gab, deren Probleme ernst zu nehmen. Friedrich II. regierte mit eiserner Hand, aber er verstand sich im Gegensatz zu den französischen Königen nicht als über dem Staat stehend, sondern als des Staates erster Diener. Seine Justizreform etwa verbesserte die rechtliche Situation der preußischen Untertanen erheblich und überwand nicht nur die provinzielle Zersplitterung in der Rechtsprechung und Rechtspraxis, sondern versprach Untertanen unabhängig von ihrer sozialen Stellung auch Gleichheit vor dem Recht. Die Bürger Potsdams waren daher weit entfernt von einem Sturm auf das Schloss Sanssouci.
Die Radikalisierung der Ereignisse in Paris, insbesondere nach dem fehlgeschlagenen Versuch des Königs Louis XVI und seiner Frau Marie Antoinette, nach Österreich zu fliehen, trug wesentlich dazu bei, dass die Sympathien, die vor allem Intellektuelle und Dichter wie Johann Wolfgang von Goethe für die Revolution gehegt hatten, schnell zerstoben. Maximilien Robespierres Terrorherrschaft, der Tausende von zu Staatsfeinden Erklärten zum Opfer fielen, fand unter deutschen Demokraten nur wenig Unterstützung. Zu dieser Distanzierung trugen auch die Kriege zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich bei, die dazu führten, dass umfangreiche Territorien des Reiches unter französische Kontrolle gelangten. Die Ideen der Französischen Revolution kamen damit durch Krieg und Besetzung ins Reichsgebiet. Dies betraf zuerst die linksrheinischen Territorien, die bereits im Jahr 1794 unter französische Kontrolle kamen und für mehr als 15 Jahre unter französischer Verwaltung blieben. In dieser Zeit erlebten die Bewohner der linksrheinischen Gebiete etwa durch die Einführung des rechtlich fortschrittlichen Code Napoleon und einer Reform des Schulsystems tiefgreifende Veränderungen, die auch die Zeit der französischen Besatzung zumindest teilweise überlebten.
Mit der französischen Besatzung der linksrheinischen Gebiete wurde der Rhein für einige Jahre zur westlichen Grenze des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, dem durch diese territorialen Veränderungen ein Jahrzehnt umfassender politischer, gebietsmäßiger und konstitutioneller Veränderungen bevorstand. In einem ersten Schritt beschloss der Reichstag des Jahres 1803, die religiösen Mitgliedsstaaten aufzulösen und die bis zu diesem Zeitpunkt von kirchlichen Würdenträgern beherrschten Territorien an weltliche Herrscher zu übertragen. Mit dieser Entscheidung wurden drei Erzbistümer, 19 Bistümer und 44 Abteien aufgelöst und deren Territorien an die jeweils umliegenden Staaten von Preußen, Baden, Württemberg und Bayern angegliedert. Diese Abschaffung der kirchlichen Staaten setzte einen Prozess in Gang, in dessen Folge die Zahl der Mitgliedsstaaten des Reiches durch Zusammenlegung erheblich verkleinert wurde. Land und Menschen wurden in diesem Prozess willkürlich und oftmals unter Missachtung gewachsener regionaler Identitäten und Kulturen neuen Herrschern zugeordnet. Diese territoriale Reorganisation beschleunigte sich mit der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806. Aus den mehr als 300 Mitgliedsstaaten des Reiches entstanden weniger als 40, die zuerst in den von Napoleon 1806 geschaffenen Rheinbund und dann im Jahr 1815 in den Deutschen Bund gedrängt wurden. Diese Reorganisation von Ländern und Menschen war auch eine Reorganisation monarchischer Macht, da in diesem Prozess mehr als 200 Herrscher, deren Macht als von Gott gegeben galt, entmachtet wurden. Da diese Herrscher ihre Macht nicht durch Gott, sondern durch einen Menschen – Napoleon – verloren hatten, stellte dieser Prozess auch die Legitimität des Prinzips des monarchischen Regierungssystems in Frage.
Der Rheinbund bestand, da sowohl Preußen als auch Österreich ausgeschlossen waren, aus lediglich 30 Mitgliedsstaaten. Napoleon sah in dem Bund weniger einen Zusammenschluss deutscher Staaten als vielmehr eine Pufferzone zwischen Frankreich im Westen und Preußen und Österreich im Osten. Dennoch kann der Rheinbund durchaus als Beginn der neueren deutschen Geschichte gelten. Im Rheinbund, dessen westliche Grenze der Rhein und dessen östliche Grenze die Elbe bildeten, fanden sich als die größten Mitgliedsstaaten das Königreich Bayern, das Königreich Sachsen, das Königreich Westfalen und das Königreich Württemberg. Das Königreich Westfalen, das aus der Fusion kleinerer Territorien wie das Herzogtum Braunschweig und das Herzogtum Hessen sowie verschiedener preußischer Territorien hervorgegangen war und von Napoleons Bruder Jérôme Bonaparte beherrscht wurde, war der erste deutsche Staat, der sich eine Verfassung gab und damit zu einer konstitutionellen Monarchie wurde. Es war auch der erste deutsche Staat, der Juden Bürgerrechte gab und die Leibeigenschaft der Bauern abschaffte. Damit wurde er zu einem Laboratorium der politischen und gesellschaftlichen Modernisierung.
Das Ende des Heiligen Römischen Reiches, die Fusionierung von Territorien, die damit einhergehende Ablösung von mehr als 200 Landesherren und der Transfer von Land und Menschen hatte tiefgreifende Konsequenzen für die Identität, Kultur und Tradition derjenigen, die diese Zeiten durchlebten. Die Legitimität und Macht der Monarchen schienen geschwächt zu sein, da viele ihre Position entweder einbüßten oder aber ihre Macht durch Verfassungen beschränkt sahen. Die Verschiebung von Land und Menschen von einem Monarchen zu einem anderen, ohne dass den Betroffenen ein Mitspracherecht eingeräumt wurde, zerriss gewachsene Kulturen, Wirtschaftsräume und Identitäten. Viele Menschen fanden sich in neuen Staaten wie etwa dem kurzlebigen Königreich Westfalen oder dem langlebigen Herzogtum Nassau wieder, denen jede zentrale Struktur fehlte und daher Strukturen, Institutionen und Projekte benötigten, die den neuen Staatsangehörigen Möglichkeiten der Integration anboten.
Das im Jahr 1806 geschaffene Herzogtum Nassau war recht erfolgreich bei der Entwicklung von Integrationsstrategien. Dieses Herzogtum war aus der Fusion der Grafschaft Nassau-Usingen mit der Grafschaft Nassau-Weilburg und dem Fürstentum Nassau-Oranien entstanden und wurde anfangs gemeinsam von den Fürsten Friedrich August und Friedrich Wilhelm regiert. Beide Herrscher verstanden die Notwendigkeit, ihren Untertanen in dem neugeschaffenen Staat eine Landesidentität anzubieten. Die Schaffung eines einheitlichen und gut finanzierten Bildungssystems erschien beiden Herrschern als Voraussetzung für die Erziehung und Bildung der nassauischen Bevölkerung. Zu diesem Zweck schufen sie im Jahr 1817 zur Finanzierung des Bildungssystems den Nassauischen Zentralstudienfonds, dem die Stiftungen, Finanzmittel und Einrichtungen aller bestehenden Bildungseinrichtungen in den verschiedenen Landesteilen übertragen wurde.
Die unerwartete, aber vollständige Niederlage des preußischen Heeres in der Schlacht von Jena und Auerstedt im Jahr 1806 erschütterte die preußische Monarchie zutiefst. Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. hatten während ihrer jeweiligen Regentschaft viel Geld in den Auf- und Ausbau einer schlagkräftigen Armee investiert, der es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gelungen war, das Territorium des Königreiches Preußen wesentlich zu vergrößern. Diese militärischen Erfolge begründeten den Ruf der preußischen Armee und des Königreiches Preußen, das den anderen europäischen Staaten überlegen erschien. Diese preußische Überlegenheit endete im Jahr 1806 und zwang preußische Staatsbeamte wie Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum Stein und Karl August von Hardenberg sowie Offiziere wie Gerhard von Scharnhorst und August Neidhardt von Gneisenau zum Nachdenken über mögliche Ursachen dieser Niederlage. Mit der Flucht des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. nach Memel, das sich im äußersten Nordosten des Landes nahe der russischen Grenze befand, war das Land, das nun von französischen Truppen besetzt war, praktisch führungslos geworden. In diesem Machtvakuum fiel es Staatsbeamten wie Stein und Hardenberg zu, eine Ära umfassender politischer und sozialer Reformen einzuleiten.
Die Stein-Hardenberg’schen Reformen veränderten die preußische Gesellschaft von Grund auf und trugen wesentlich zur Modernisierung Preußens bei. So wurde im Jahr 1807 die Leibeigenschaft beendet. Im Jahr 1808 erhielten Kommunen das Recht der Selbstverwaltung. Im Jahr 1810 wurde mit der Universität Berlin die erste moderne Universität begründet und mit dem Abitur eine verbindliche Abschlussprüfung an den Gymnasien eingeführt. Im Jahr 1812 folgte die Emanzipierung der Juden. Diese Reformen waren nicht dazu gedacht, Preußen zu demokratisieren, sondern das monarchische System zu modernisieren und damit die alte Überlegenheit wiederherzustellen.
Auch die Erneuerung der preußischen Armee ging von Offizieren und nicht vom König aus. Nachdem Napoleon sich geschlagen aus Russland zurückzog, entschied sich Graf Yorck von Wartenburg entgegen königlicher Weisungen, eine anti-französische Allianz mit dem russischen Feldmarschall Hans Karl von Diebitsch eizugehen. Die folgenden Befreiungskriege wurden vor allem durch Scharnhorst und Hardenberg angeführt, die König Friedrich Wilhelm III. im März 1813 erfolgreich dazu drängten, die preußische Bevölkerung zum Widerstand gegen die französischen Besatzer aufzurufen. Dem Ruf des Königs folgend, meldeten sich mehr als 280.000 Männer für ein Freiwilligenheer, das zusammen mit russischen und österreichischen Truppen Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 besiegte.