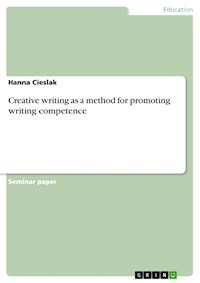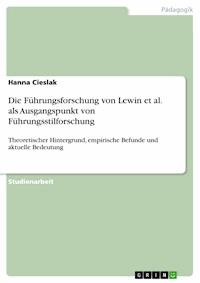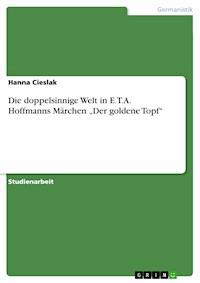Diagnose und Förderung deutschsprachlicher Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund E-Book
Hanna Cieslak
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Masterarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Pädagogik - Interkulturelle Pädagogik, Note: 1,0, Ruhr-Universität Bochum, Sprache: Deutsch, Abstract: Deutschland hat sich seit 1955 allmählich und in Wellen, aber in übersehbarer Faktizität zu einem Einwanderungsland entwickelt hat. Die Schule ist der beste Spiegel dieses Trends. Die multi-ethnisch zusammengesetzte Klasse ist in vielen Schulen die Regel. Ein substantieller Teil der schulpflichtigen Schüler stammt aus Familien, in denen zumindest ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde. Treffsicher sagte der Schweizer Schriftsteller MAX FRISCH hierzu: „Wir riefen Arbeitskräfte, es kamen Menschen.“ Menschen mit ihrer eigenen Sprache, Kultur und Familie, die es zu integrieren gilt. Doch anhand vieler Studien wurde dokumentiert, dass das deutsche Schulsystem nicht allen Kindern die gleichen Chancen bietet und das Recht auf Bildung nicht überall ausrei-chend umgesetzt wird. Dies trifft Migranten in besonders hohem Maße. Für eine erfolgreiche Integration der Menschen mit Migrations-hintergrund wird der Bildung jedoch eine Schlüsselfunktion zugeschrieben, um an der Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben zu können. Dabei haben sprachliche Fähigkeiten eine weitreichende Bedeutung für den Bildungserfolg eines jeden Menschen. Demzufolge bietet diese Tatsache Anlass genug, sich in dieser Arbeit mit der Thematik „Diagnose und Förderung deutschsprachlicher Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ zu beschäftigen. In diesem Zusammenhang beginnt die Arbeit mit einer eingehenden Deskription wichtiger Fakten zur Situation der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen, um in deren Verlauf auf der Grundlage von empirischen Bildungsstudien, wie z.B PISA 2000/2003 und IGlU sowie Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES einen umfassenden Überblick über die Bildungsbeteiligung und den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Elementar-, Primar- und Sekundarbereich sowie in der beruflichen Bildung zu geben. In einem weiteren Schritt folgt die Herausarbeitung und Skizzierung verschiedener Erklä-rungsansätze, die anhand von markanten Feststellungen und empirischen Studien versuchen, den mangelnden schulischen Erfolg von Kindern mit Migrationshintergrund zu erklären.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
2 Die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungswesen
2.1 Kinder mit Migrationshintergrund – Begriffliche Klärung
2.2 Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
2.2.1 Der Elementarbereich
2.2.1 Der Primarbereich
2.2.2 Die Sekundarstufe
2.2.1 Die berufliche Bildung
2.3 Sprachkompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund – Begriffliche Klärung
3 Erklärungsansätze für die Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund
3.1 Individuumsbasierte Erklärungsansätze
3.1.1 Die kulturell-defizitäre Erklärung
3.1.2 Die humankapitaltheoretische Erklärung
3.2 Schulstrukturelle Erklärungsansätze
3.2.1 Die Erklärung durch Strukturdefizite des deutschen Schulsystems
3.2.2 Die Erklärung durch institutionelle Diskriminierung
4 Sprachstandsfeststellungsverfahren bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
4.1 Sprachstandsfeststellungsverfahren als Teil der pädagogischen Diagnostik
4.2 Typen von Sprachstandsfeststellungsverfahren
4.2.1 Standardisierte Testverfahren
4.2.2 Informelle Testverfahren
4.3 Beispiele für Sprachstandsfeststellungsverfahren
4.3.1 HAVAS-5
4.3.2 Sismik
4.3.3 Delfin 4
5 Intervention und Fördermaßnahmen zur Verringerung der Bildungsdiskrepanz
5.1 Schulexterne Förderung im Elementar- und Primarbereich am Beispiel des „Rucksack“-Projekts der RAA
5.1.1 Durchführung am Beispiel des Standortes der RAA Herne
5.1.2 Schlussfolgerungen
5.2 Schulexterne Förderung im Sekundarbereich am Beispiel des Projekts „Förderunterricht von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ der Stiftung Mercator GmbH
5.2.1 Durchführung am Beispiel des Standortes Essen
5.2.2 Schlussfolgerungen
5.3 Schulinterne Förderung am Beispiel der »Grundschule an der Michaelstraße« in Herne
5.3.1 Schulprofil
5.3.2 Fördermaßnahmen
5.3.1 Schlussfolgerungen
6 Fazit
7 Anhang
8 Quellen- und Literaturverzeichnis
9 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
1 Einführung
„Fast ein Fünftel der deutschen Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Bei den jungen Menschen, die in die Schule kommen, haben sogar mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund. […] Wir wollen natürlich, dass die Menschen mit Migrationshintergrund von Anfang an der Schule folgen können. Deshalb ist es mehr als richtig, dafür Sorge zu tragen, dass jeder junge Mensch, der in die Schule kommt, auch wirklich den Lehrer versteht, also so viele Deutschkenntnisse hat, die notwendig sind, um in der Schule mitzukommen. Ganz wichtig sind hierbei für junge Menschen mit Migrationshintergrund deswegen der Ausbau von Kindertageseinrichtungen, die Sprachförderung in Tageseinrichtungen und die Forschung zur Sprachstandsfeststellung. […] Denn wir können auf kein einziges Talent, auf keinen Menschen in unserer Gesellschaft verzichten.“[1]
Mit diesen Worten stellte die Bundeskanzlerin Angela Merkel beim internationalen Symposium „Integration durch Bildung“ im Oktober 2007 heraus, wie wichtig es ist, die beachtlich große Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland ausreichend zu fördern, indem die Sprachdiagnostik und Sprachförderung bereits in Kindertageseinrichtungen flächendeckend ausgebaut wird.
Ebenso trägt sie mit ihren Forderungen der Tatsache Rechnung, dass sich Deutschland seit 1955 allmählich und in Wellen, aber in übersehbarer Faktizität zu einem Einwanderungsland entwickelt hat. Die Schule ist der beste Spiegel dieses Trends. Die multi-ethnisch zusammengesetzte Klasse ist in vielen Schulen die Regel. Ein substantieller Teil der schulpflichtigen Schüler und Schülerinnen (kurz: SuS) stammt aus Familien, in denen zumindest ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde.[2]Treffsicher sagte der Schweizer Schriftsteller Max Frisch hierzu: „Wir riefen Arbeitskräfte, es kamen Menschen.“ Menschen mit ihrer eigenen Sprache, Kultur und Familie, die es zu integrieren gilt.
Doch anhand vieler Studien wurde dokumentiert, dass das deutsche Schulsystem nicht allen Kindern die gleichen Chancen bietet und das Recht auf Bildung nicht überall ausreichend umgesetzt wird.Dies trifft Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in besonders hohem Maße.[3]Für eine erfolgreiche Integration der Menschen mit Migrationshintergrund wird der Bildung jedoch eine Schlüsselfunktion zugeschrieben, um an der Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben zu können. Dabei haben sprachliche Fähigkeiten eineweitreichende Bedeutung für den Bildungserfolg eines jeden Menschen.
Demzufolge bietet diese Tatsache Anlass genug, sich in dieser Arbeit mit der Thematik „Diagnose und Förderung deutschsprachlicher Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ zu beschäftigen.
In diesem Zusammenhang beginnt die Arbeit mit einer eingehenden Deskription wichtiger Fakten zur Situation der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen, um in deren Verlauf auf der Grundlage von empirischen Bildungsstudien, wie z.B. Programme for International Student Assessment 2000 und 2003 (kurz: PISA 2000 und 2003) und Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (kurz: IGLU) sowie Daten des Statistischen Bundesamtes und Bildungsberichten einen umfassenden Überblick über die Bildungsbeteiligung und den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Elementar-, Primar- und Sekundarbereich sowie in der beruflichen Bildung zu geben.
In einem weiteren Schritt folgt die Herausarbeitung und Skizzierung verschiedener Erklärungsansätze, die anhand von markanten Feststellungen und empirischen Studien, wie z.B. von Diefenbach sowie Gomolla/Radtke versuchen, den mangelnden schulischen Erfolg von Kindern mit Migrationshintergrund zu erklären.
Auf der Grundlage der Befunde zur Situation von Kindern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen und der Darlegung einiger Erklärungsversuche, die diese Bildungsbenachteiligung zu erklären versuchen, wird anschließend versucht, Sprachfördermaßnahmen herauszuarbeiten, die die Bildungsdiskrepanz in Deutschland deutlich verringern sollen. Sprachfördermaßnahmen greifen in diesem Zusammenhang nur dann, wenn sie individuell zielgenau aus der jeweiligen Diagnostik abgeleitet und sinnvollerweise vom Sprachstand des einzelnen Kindes ausgehen. Aus diesem Grund werden in einem weiteren Schritt ausgewählte aktuelle Sprachstandsfeststellungsverfahren, wie das Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstandes bei 5-Jährigen (kurz: HAVAS-5), das Beobachtungsinstrument Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen (kurz: Sismik) und Diagnose, Elternarbeit und Förderung der Sprachkompetenz in NRW bei 4-Jährigen (kurz: Delfin 4) dargestellt und hinsichtlich ihrer Praktikabilität analysiert.
Abschließend werden flächendeckende Sprachfördermaßnahmen vorgestellt, die in externe und interne Maßnahmen unterteilt werden und den Kindern mit Migrationshintergrund helfen sollen, ihre sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern. Hinsichtlich der schulexternen Förderung liegt das Augenmerk im Vorschul- und Primarbereich auf dem Rucksack-Projekt der Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlichen (kurz: RAA) in NRW, die im Hinblick auf die Unterstützung schulischer Belange und die Verknüpfung von Schule und Jugendhilfe modellhaft Migrationsförderung betreibt. Bezogen auf den Sekundarbereich liegt der Fokus auf dem Projekt Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund der Stiftung Mercator.
Ebenso wird danach gefragt, wo die Schule als Institution Veränderungen anzutreiben hat, damit alle Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen in der Schule optimal gefördert werden können. Diesbezüglich wird an dem Fallbeispiel der Grundschule an der Michaelstraße in Herne abschließend aufgezeigt, wie schulinterne Sprachförderung durchgeführt werden kann.
2 Die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungswesen
Ethnische und soziale Unterschiede in der Bildungsbeteiligung und im Bildungserfolg werden an verschiedenen Stellen in der Bildungslaufbahn sichtbar. Deshalb versucht dieses Kapitel, auf der Grundlage von empirischen Forschungsbefunden, wie z.B. PISA 2000, PISA 2003 und IGLU sowie Daten des Statistischen Bundesamtes und Bildungs-berichten, einen umfassenden Überblick über die Bildungsbeteiligung und den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Elementar-, Primar- und Sekundarbereich sowie in der beruflichen Bildung zu geben. Bevor die inhaltliche Darstellung jedoch geleistet werden kann, wird zunächst eine begriffliche Klärung vorangestellt, die aufzeigt, welche Kinder als Kinder mit Migrationshintergrund bezeichnet werden können. Abschließend werden die Sprachkompetenzen der Kinder mit Migrationshintergrund thematisiert. In diesem Zusammenhang werden Begriffe wie „Deutsch als Erst- und Zweitsprache“ theoretisch erläutert, weil diese im weiteren Verlauf der Arbeit wiederholt aufgegriffen werden.
2.1 Kinder mit Migrationshintergrund – Begriffliche Klärung
Bevor die Bildungsbeteiligung und der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund geschildert werden kann, ist es zunächst unerlässlich, die Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund zu definieren. Im öffentlichen Diskurs scheint es ein mehr oder weniger geteiltes Vorverständnis darüber zu geben, wer als Kind mit Migrationshintergrund bezeichnet wird, wie z.B. die Nachkommen der so genannten Gastarbeiter, die im Rahmen bilateraler Verträge zwischen Deutschland und den Ländern wie z.B. Italien (1955), Spanien (1960), Griechenland (1960), Türkei (1961) usw. zur Arbeit in Deutschland angeworben wurden.[4] Doch wenn man die Kinder von Aussiedlern[5] berücksichtigt, der Überhang der „Kinder mit Migrationshintergrund“ sicherlich über die Kategorie der „Nachkommen der nach Deutschland zugewanderten Gastarbeiter“ hinaus.
Ausgangspunkt einer möglichen Definition ist in jedem Fall der Begriff „Migration“. Dieser kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Wanderung“. Weil es bislang noch keine einheitliche Definition von „Migration“ in den Sozialwissenschaften gibt, ist nach Diefenbach der kleinste gemeinsame Nenner in Bezug auf „Migration“ der, dass es sich um solche Bewegungen von Personen und Personengruppen im Raum handelt, die einen dauerhaften Wohnortwechsel bedingen.[6] Notwendiger Bestandteil einer Definition von „Kindern mit Migrationshintergrund“ ist, dass eine Zuwanderung nach Deutschland aus einem anderen Gebiet stattgefunden hat. Hierbei kann jedoch unterschieden werden zwischen einem „Kind mit Migrationshintergrund 1. Ordnung“, d.h. ein im Ausland geborenes Kind von Eltern, die ebenso nicht in Deutschland geboren wurden, und einem „Kind mit Migrationshintergrund 2. Ordnung“, d.h. ein in Deutschland geborenes Kind von Eltern, von denen mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde. In der vorliegenden Arbeit wird der Ausdruck „Kinder mit Migrationshintergrund“ somit als Sammelbegriff für „Kinder mit Migrationshintergrund 1. und 2. Ordnung“ im oben beschriebenen Sinne verwendet. Die Kategorie „Kinder mit Migrationshintergrund“ darf dabei jedoch nicht ausschließlich mit dem Ausländerstatus in Verbindung gebracht werden. Obwohl „Kinder mit Migrationshintergrund 1. und 2. Ordnung“ über Jahrzehnte hinweg aufgrund von restriktiven Einbürgerungsgesetzen in aller Regel tatsächlich Ausländer gewesen und geblieben sind, hat sich diese Tatsache in der heutigen Zeit durch Einbürgerungen sowie durch Zuwanderungen von Aussiedlern, die nach Artikel 116 des Grundgesetzes und § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen dürfen, geändert.[7] Die meisten Kinder mit Migrationshintergrund haben heute einen deutschen Pass. Das ist ein Grund dafür, warum über diese Kinder bezüglich ihrer Bildungsbeteiligung im Folgenden nur eingeschränkt Aussagen gemacht werden können. Denn die amtlichen Bildungsstatistiken unterscheiden bis heute nur zwischen Deutschen und Ausländern, enthalten aber keine Kategorie für Personen mit Migrationshintergrund.[8] Dabei lässt sich heute nicht nur sagen, dass die Zahl der SuS aus Migrantenfamilien diejenigen der ausländischen SuS übersteigen muss; sie lässt sich inzwischen auch auf Grundlage der Daten aus den Leistungsstudien PISA 2000 und IGLU, die als eine der ersten Studien den Migrationsstatus von Kindern erfassten, quantifizieren. Demnach berichten Bos et al. über Grundschüler der vierten Jahrgangsstufe, dass gut 20% der Schüler einen Migrationshintergrund besitzen.[9] Andere derzeitige Quellen, mithilfe derer etwas über den Migrationsstatus von SuS gesagt werden kann, sind laut Gogolin Umfragen, die von Forschungsinstituten durchgeführt und in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, z.B. der Mikrozensus.[10] Auch nach Angabe des Statistischen Bundesamtesbasieren alle bislang veröffentlichten Ergebnisse bezüglich des Migrationsstatus auf demMikrozensus, einem Bevölkerungssurvey, bei dem rund 1% der zufällig ausgewählten Bevölkerung nach einer Vielzahl von unterschiedlichen Merkmalen befragt wird, u.a. auch zum Schulbesuch und zum höchsten erreichten Schulabschluss. Seit 2005 erhebt derMikrozensusauch detaillierte Angaben zur Zuwanderung, Einbürgerung und Staatsangehörigkeit, aus denen das Merkmal „Migrationshintergrund“ synthetisch bestimmt wird.[11]Mit demMikrozensus2005 liegen damit erstmals für die gesamte Bevölkerung Deutschlands repräsentative Daten zu dem Merkmal „Migrationshintergrund“ vor. Demnach liegt der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung bei 18,6%, das entspricht 15,3 Mio. Menschen,[12] wobei davon 6 Mio. der Altersgruppe der unter 25-Jährigen angehören und damit insbesondere für das Bildungssystem von Bedeutung sind. Der Anteil dieser jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die das deutsche Bildungswesen durchlaufen, liegt demMikrozensuszufolge bei 27%.[13]
Diese Tatsache illustriert nicht nur dieVersäumnisse der Bildungsstatistiken, sondern vor allem die quantitative Relevanz der Schüler mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem.
2.2 Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Der Schulerfolg ist in Deutschland eng mit der sozialen und ethnischen Herkunft verbunden. Kinder und Jugendliche aus Migrationsfamilien haben es schwer, gute Lernergebnisse zu erzielen und die Schule erfolgreich abzuschließen. Dem Bildungssystem kommt hier eine Schlüsselqualifikation für das Gelingen des gesellschaftlichen Integrationsprozesses zu.[14] Bildung ist ein wichtiger Faktor, um sich erfolgreich in die Aufnahmegesellschaft zu integrieren, da sie den Zugang zu beruflichen Positionen und zu den kulturellen Systemen ermöglicht.
Deshalb gehört es zu den wichtigsten bildungspolitischen Zielen demokratischer Gesellschaften, allen Heranwachsenden gleich gute Bildungschancen zu ermöglichen, sie individuell optimal zu fördern und gleichzeitig soziale, ethnische und kulturelle Disparitäten der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs auszugleichen.[15] Doch schafft es das Bildungssystem wirklich, die kulturellen Disparitäten der Bildungsbeteiligung aufzuheben? Dieses Kapitel versucht diese Frage zu beantworten, indem es die Bildungsbeteiligung und den damit verbundenen Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund fokussiert.Aufgrund des hierarchisch strukturierten Schulsystems in Deutschland, welches sich durchunterschiedlich aufeinander aufbauende Bildungseinrichtungen auszeichnet, die zuunterschiedlichen Abschlüssen führen, erfolgt im Folgenden eine Darstellung der Bildungsbeteiligung, die sich an der Chronologie der Schullaufbahn im deutschen Schulsystem orientiert.
2.2.1 Der Elementarbereich
Der Besuch vorschulischer Einrichtungen durch Kinder mit Migrationshintergrund ist vor allem deshalb in den Blick des Interesses gerückt, weil verschiedene internationale Studien zeigen konnten, dass Bildungs- und Sozialisationsleistungen, die von Kindergärten er-bracht werden, langfristige individuelle und gesellschaftliche Wirkungen haben.[16] Der Elementarbereich stellt die erste Stufe des institutionalisierten Erziehungs- und Bildungssystems der Bundesrepublik Deutschland dar und umfasst alle Einrichtungen, die die Familie in der Erziehung der Kinder zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr unterstützen und ergänzen.[17] Der Besuch eines Kindergartens ist sowohl für die soziale als auch für die kulturelle Integration von Kindern aus Zuwandererfamilien von entscheidender Bedeutung. Im Kindergarten findet ein wesentlicher Teil der sprachlichen Integration statt, da hier durch den Kontakt zu den Erziehern und anderen Kindern die Möglichkeit besteht, die deutsche Sprache zu erlernen und bereits vor der Einschulung Sprachdefizite abzubauen.[18] Auch Lanfranchi und Gogolin sehen einen Zusammenhang zwischen dem frühen Besuch einer Vorschuleinrichtung und dem späteren Schulerfolg.[19] Neben den positiven Auswirkungen auf den Schulerfolg durch eine allgemeine Steigerung der kognitiven Fähigkeiten sei auch eine Stärkung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten festzustellen. Lanfranchi zufolge liegt ein erster Indikator für die geringere Bildungsbeteiligung ausländischer Kinder darin, dass sie in geringerem Maße als deutsche Kinder am Angebot der vorschulischen Einrichtungen partizipieren.[20]Auch Gomolla/Radtke stelltenanhand ihrer Studie über Bielefelder Schulen im Jahr 2000 fest, dass insbesondere fehlendeKindergartenzeiten bei Kindern mit Migrationshintergrund unweigerlich zu zusätzlichem Förderbedarf vor dem Schuleintritt führen.[21]
Leider sind genaue Daten zur Teilhabe an diesen Einrichtungen aufgrund der Struktur dieses Bereiches schwer einzusehen. Die Einrichtungen befinden sich überwiegend in freier Trägerschaft, werden nicht vom Staat, sondern von kirchlichen und kommunalen Verbänden getragen. Dochobwohl über die institutionelle Betreuung von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund verhältnismäßig wenig bekannt ist, zeigten die Erhebungen des Mikrozensus im Bildungsbericht von 2006 (vgl. Abbildung 1), dass ausländische Kinder das Angebot, eine Kindertageseinrichtung zu besuchen zwar nach wie vor etwas seltener in Anspruch nehmen als deutsche Kinder, dass sich jedoch die Beteiligungsquote der ausländischen Kinder zwischen 1991 und 2004 der Beteiligungsquote der deutschen Kinder zunehmend angenähert hat. Seit 2000 besuchen über 80% der ausländischen Kinder ab einem Alter von vier Jahren bis zum Schuleintritt eine Kindertageseinrichtung.[22]
Abbildung1:Kinder in Kindergärten 2001. (Aus:Bildung in Deutschland, S. 150)
Die Kindergartenbesuchsquote sagt jedoch nichts darüber aus, ob der Kindergartenbesuch durchgängig oder zeitweilig stattfindet. Wichtig ist aber, dass seit Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz im Jahr 1996 eine zunehmende Angleichung der Kindergartenbesuchsquoten der ausländischen Kinder erreicht wurde.[23]
Aber auch wenn Kinder mit Migrationshintergrund elementarpädagogische Institutionen besuchen, so ist dies Mecheril zufolge nur teilweise mit der Aussicht auf eine verbesserte Situation bei der Einschulung verknüpft. Denn trotz einiger jüngerer Anstrengungen im vorschulpädagogischen Bereich, der Situation von Kindern mit Migrationshintergrund gerecht zu werden, führt insbesondere die sprachliche Situation der Kinder zu teilweise deutlichen Schwierigkeiten bei der Einschulung.[24]